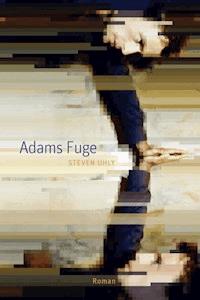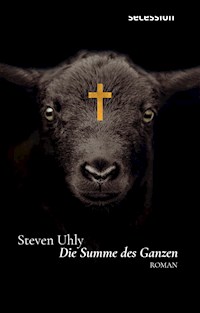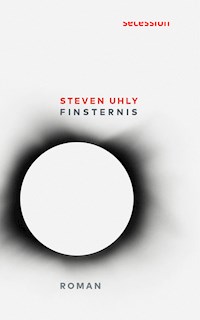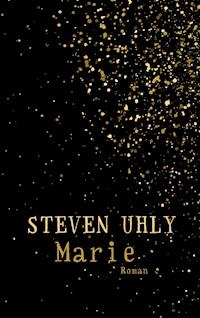14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland 2012. "Warum war ich überhaupt so, wie ich war?", fragt sich Hans D. Jahrelang hatte er keine Fragen mehr. Im Gegenteil, er war kurz davor, fraglos aufzugeben. Und dann? Dann bringt er den Müll hinunter, geht zu den Tonnen, findet im Müll ein Kind. Es beginnt ein berührender Prozess über die Entscheidung, was geschehen muss. Das Kind behalten, es verbergen? Und die Mutter? Eine Mordanklage zulassen, wider besseres Wissen? Was ist gerecht? Wie handeln? Am Ende der Geschichte sind die Dinge neu geordnet. Ein Kind wird überlebt haben und mit Hans D. werden wir wissen, dass Liebe der Schlüssel ist für Erkenntnis, Veränderung, ein gutes Leben. "Glückskind" ist ein Gegenwartsroman, der mit literarischer Wärme und Besonnenheit die ungeheuren Tiefen der Menschenseele auslotet, Zeile für Zeile - ein Glücksfall!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
GLÜCKSKIND
Steven Uhly
ROMAN
FÜR MEINE TÖCHTER
Wieder so ein Scheißtag. Hans D. macht den Wecker aus. Wenn er ihn nicht stellt, bleibt er einfach liegen. Manchmal den ganzen Tag. Wenn er ihn stellt, wie heute, hasst er seinen Wecker. Und er hasst sich selbst, weil er nicht hochkommt, weil er seine Wohnung noch immer nicht aufgeräumt hat, obwohl sie allmählich aussieht wie eine Müllhalde. Nicht einmal die Essensreste von gestern hat er beseitigt. Sie liegen auf dem Wohnzimmertisch herum, Tiefkühl-Hamburger mit Tiefkühl-Pommes-Frites und Ketchup, überall sitzen Fliegen darauf. Die Mülltüten stapeln sich an der Wand neben der Wohnungstür, er trägt sie nicht hinunter. Hans stöhnt. Er will sich das alles nicht klarmachen, er will nicht wahrhaben, wie es ihm geht, nämlich schlecht, so schlecht, dass er es kaum erträgt, einen klaren Gedanken zu fassen, den einzigen, der in Frage käme: Reiß dich zusammen, Hans! Ändere dein Leben! Nein, jetzt bitte keine klaren Gedanken.
Hans wälzt sich auf die andere Seite. An der Stelle, wo nachts sein Kopf liegt, ist das Kissen bräunlich verfärbt. Wann hat er den Bezug das letzte Mal gewechselt? Er schiebt auch diese Frage zur Seite, wie schon gestern und vorgestern. Sein Blick fällt auf den Boden. Überall Staub, eine dicke Schicht, man sieht, wo Hans den Boden berührt und wo nicht. Es gibt Pfade, wo weniger Staub liegt, weil er immer dieselben Wege geht. Vom Bett zum Klo, vom Klo zum Bett, vom Bett zum Kühlschrank. Die Küche ist eng, es gibt einen halbrunden Tisch aus Holz, der an der Wand befestigt ist, man kann ihn herunterklappen, wenn man Platz braucht, davor steht ein alter Klappstuhl aus Metall, früher einmal war er weiß, jetzt ist er zerkratzt und schäbig. Vom Kühlschrank ins Wohnzimmer, das zu groß ist für einen einsamen Mann. Vom Bett zum Bad mit seiner viel zu kurzen Badewanne. Eine Scheißwohnung, und dafür zahle ich fünfhundert Euro, denkt Hans und kratzt sich den Bart, den er trägt, weil er eines Tages aufgehört hat, sich zu rasieren. Die Haare wuchern ihm über die Lippen, wenn er isst, verfangen sich Essensreste darin. Manchmal bemerkt er es tagelang nicht, denn er hat aufgehört, sich im Spiegel zu betrachten. Mühsam setzt er sich im Bett auf, die alten Knochen wollen liegen bleiben. Nein, denkt er: Der dumme alte Kopf will liegen bleiben, er denkt sich die Knochen schwerer, als sie sind. Aber diesen Gedanken hat Hans schon so oft gehabt, dass er sich fragt, warum er nicht auf ihn verzichtet. Bringt ja doch nichts, denkt er. Mühsam setzt er sich auf. Seine Füße schlüpfen in die ausgelatschten Filzpantoffeln, er wirft einen Blick aus dem Fenster. Ein trüber Tag. Der Wievielte ist heute eigentlich? Hans weiß es nicht. Er steht auf. Der Rücken ist steif, es dauert eine Weile, bis er sich ganz aufrichten kann. Irgendwann in den nächsten Tagen muss er den Weiterbewilligungsantrag ausfüllen und abschicken und hoffen, dass Frau Mohn ihn nicht ins Amt zitiert. Das macht sie gern, seit er ihr einmal die Meinung über ihre Unfreundlichkeit gesagt hat. Dieses dumme Luder, denkt Hans. Die ist bestimmt in der Schule immer gehänselt worden und rächt sich jetzt dafür. Wenn ich jünger wäre, denkt Hans, könnte die nicht so mit mir umspringen. Aber stimmte das? Als er jünger war, sprangen sein Sohn und seine Tochter nach Belieben mit ihm um. Und seine Frau? Wo die wohl alle jetzt steckten, jetzt, in diesem Moment, während er sich in seiner beschissenen kleinen Wohnung die Kleider anzieht, die er seit einer Woche trägt. Sie stinken, Hans stinkt. Aber mich kann keiner riechen, denkt er und lacht halb belustigt, halb bitter über sein Wortspiel. Er geht in die Küche. Leere Milchkartons türmen sich vom Boden bis unter das Fenster. Bis fünfzig hat er sie gezählt, es war sein perverses Hobby: den eigenen Niedergang akribisch genau zu beziffern. Dann hat er aufgehört, weil er nicht pervers genug ist, oder weil diese Perversion ihm zu viel Selbsterkenntnis abverlangte. Ich bin das Gegenteil von Robinson Crusoe, denkt er, als er den alten Kühlschrank öffnet und nachsieht, ob noch Milch da ist. Er liebte das Buch als Kind, und er hat nie Zweifel gehabt, dass es auch ihm gelänge, sich selbst zu organisieren, wenn er in der gleichen Lage wäre wie Robinson. Es gab Zeiten, da hat er sich gewünscht, auf eine Südseeinsel zu geraten. Aber wie hätte er dorthin gelangen sollen, er, der nie Geld für eine so weite Reise hatte? Jetzt war er mitten in der Zivilisation gestrandet, mitten in einer Welt, in der alles organisiert ist, in der jeder weiß, der Wievielte heute ist. Nur er nicht. Er macht sich keine Kerben ins Gedächtnis, nein, er arbeitet daran, alle Kerben zu löschen, bis nichts mehr übrig bleibt.
Wo soll das hinführen, denkt er, als er den einzigen Milchkarton, der im Kühlschrank steht, schüttelt und feststellt, dass er leer ist. Dann trinke ich den Kaffee eben schwarz. Hans hasst schwarzen Kaffee. Aber Not macht erfinderisch, denkt er und grinst freudlos. Er setzt die Espressokanne auf den Elektroherd, der übersät ist mit Flecken. Seit Wochen hat Hans ihn nicht mehr geputzt. Neben dem Herd steht ein altes Transistorradio, die Antenne ist auf halber Höhe abgebrochen, aber es funktioniert noch. Hans schaltet es an. Das Erste, was er hört, ist die Uhrzeit – »Zwölf Uhr«, sagt der Sprecher – und das Zweite ist das Datum: »Fünfundzwanzigster Oktober«.
»Mist!«, entfährt es ihm. Der Weiterbewilligungsantrag! Frau Mohn wartet nur darauf, dass er wieder einmal den Termin verpasst, das weiß Hans sicher. Sie hat ihm schon zweimal einen ganzen Monat gestrichen, nur weil er einen oder zwei Tage zu spät dran war. Er hasst diese Frau.
Als die Espressokanne röchelt und damit kundtut, dass alles Wasser durchgelaufen ist, greift er in die Spüle, wo sich Geschirr und Besteck türmen, und zieht eine Tasse heraus. Er spült sie kurz mit Wasser aus und schenkt sich den schwarzen Kaffee ein. Er sucht den Zucker, bis ihm einfällt, dass er keinen mehr hat. Dann schlurft er in seinen abgetragenen Pantoffeln ins Wohnzimmer, setzt sich an die Ecke seines Tisches und schaltet den Fernseher ein. Während er den Kaffee trinkt und dabei angewidert das Gesicht verzieht, zappt er sich durch die Programme. Am liebsten schaut er Nachrichten, deshalb bleibt er bei n-tv hängen. Es geht um die Finanzkrise. Der Euro-Rettungsschirm wird noch größer. Hans ist fasziniert von der Finanzkrise. Die horrenden Schuldensummen, von denen immer wieder die Rede ist, beeindrucken ihn sehr, und er stellt sich jedes Mal vor, was wäre, wenn er so viel Geld hätte.
Aber jetzt hat er keine Ruhe, der Termin drückt, der Weiterbewilligungsantrag muss das heutige Datum im Poststempel tragen, sonst sieht es schlecht aus. Denn Hans hat kaum noch Geld und die Miete muss pünktlich bezahlt werden, sonst rückt ihm Herr Balci, der Hausverwalter, auf die Pelle. Als er den Kaffee endlich ausgetrunken hat, schaltet er den Fernseher wieder aus. Er bleibt reglos sitzen. Das Ausfüllen des Antrags türmt sich wie ein unbesteigbar hoher Berg vor ihm auf, eine Schwäche macht sich in seinem ganzen Körper breit, am liebsten würde Hans wieder ins Bett gehen, am liebsten würde er überhaupt nichts mehr merken. »Heute ist ein guter Tag zum Sterben«, sagt Hans leise zu sich selbst. Im selben Augenblick sieht er Frau Mohns Gesicht vor sich, wie sie zufrieden lächelt, als sie von seinem Tod erfährt. Wütend steht er auf. Allein wegen Frau Mohn würde er nicht sterben. »Vorher bringe ich sie um!«, sagt er laut in den kleinen Raum hinein und lacht kurz auf. Er gesteht sich nicht ein, dass hinter Frau Mohn weitere Gesichter aufgetaucht sind – die seiner Frau und seiner beiden Kinder. Er vergisst schnell, dass er daran gedacht hat, dass sie womöglich jahrelang nichts von seinem Tod erfahren würden. Er will nicht das Gefühl haben, nicht vermisst zu werden, weil er für seine Frau und seine Kinder längst gestorben ist. Er denkt nicht, dass er ein Zombie ist, einer, der gar nicht mehr sterben kann, weil er schon das ganze Leben hinter sich hat. Aber das Wort ist trotzdem da: ein Untoter. Ein lebendig Begrabener. Wovon? Von der eigenen Vergangenheit? Er geht zur Wohnungstür. Da stehen die Müllsäcke. Gut, denkt Hans, bevor ich den Antrag ausfülle, bringe ich den Müll hinunter. Er weiß, dass er den Müll nur vorschiebt, Aber auf diese Weise tue ich wenigstens etwas Nützliches, denkt er.
Als er, bepackt mit vier Müllsäcken, seine Wohnung verlässt und zum Fahrstuhl geht, begegnet er Herrn Tarsi, dem Nachbarn mit dem steifen Bein. Herr Tarsi putzt ihren gemeinsamen Flur. Selbst dabei sieht er würdevoll aus, ein großer, älterer Mann mit grauem Haar und einem Schnurrbart mit gezwirbelten Enden. Er ist Afghane oder Perser, Hans weiß es nicht genau, es ist ihm auch gleichgültig geworden, seit er ein schlechtes Gewissen hat, weil er vor zwei Monaten einfach aufgehört hat, den Flur zu putzen. Herr Tarsi grüßt Hans so knapp wie möglich, er wirft ihm einen jener missbilligenden Blicke zu, die ihn immer noch nicht entlassen aus den Verpflichtungen der Zivilisation. Hans duckt sich weg hinter seinem Rauschebart und seinen vielen Mülltüten, nicht einmal grüßen mag er ihn noch. Dann ist er vorbei und atmet auf und geht zum Fahrstuhl und hofft, wenigstens dort niemandem zu begegnen. Immer schwerer fällt es ihm, in die Welt da draußen zu gehen. Er möchte nicht mit ansehen, wie andere Leute ihren Pflichten nachgehen, er möchte nicht sehen, welche Dinge sie besitzen, welche Autos sie fahren, die Handys, die sie haben, die guten Kleider, die sie tragen. Vor allem aber erträgt er es nicht, ihnen in die Augen zu sehen. In ihren Augen sieht er nur sich selbst, wie die Leute ihn sehen müssen, und was er sieht, erträgt er kaum. Und er sieht noch etwas: Er sieht den Sinn des Lebens, den die Leute mit sich herumtragen, die Zielstrebigkeit, die sie in die Lage versetzt, ihren Weg zu gehen, die ihnen aus den Blicken herausspringt, diesen Blicken, mit denen sie alles anschauen, alles ergreifen und festhalten, was es gibt. Hans hat längst aufgehört, die Welt zu ergreifen, sie fliegt an ihm vorbei wie ein Traum, der sich Tag für Tag wiederholt. Er unterscheidet die Menschen nicht mehr, weil alle Menschen Fremde sind.
Der Fahrstuhl kommt und ist leer. Zum Glück, denkt Hans und betritt ihn, er drückt auf E und fährt abwärts. Die Müllsäcke stinken. Wenigstens merkt so keiner, dass auch ich stinke, denkt Hans. Aber es steigt niemand hinzu, Hans kommt unten an, er schleppt die Müllsäcke durch den Hausflur, vorbei an den langen Reihen der Briefkästen, er schaut manchmal wochenlang nicht in seinen, weil höchstens Reklame darin steckt. Hans hat sich vorgenommen, nicht mehr auf Post zu warten, aber auch jetzt wandert sein Blick zur fünften Reihe von unten, dritter Kasten von rechts, es ist wie ein Zwang, seine Augen erfassen das kleine Sichtfenster im unteren Teil des Kastens. Es ist schwarz, nichts Weißes schimmert dort, Hans geht weiter und tut, als wäre nichts gewesen, und weiß längst, dass das nicht stimmt und betrügt sich damit, dass er sich selbst durchschaut, und weiß auch das und hält sich damit über Wasser und will jetzt nicht daran denken, dass in seinem Kopf seit vielen Jahren ein Stellungskrieg tobt, in dem alle Angriffe und Gegenangriffe zu Ritualen der Bewegungslosigkeit geworden sind. Er tritt aus dem Gebäude. Auch hier ist niemand, es ist Mittagszeit, die Kinder sitzen zu Hause und essen oder sind noch in der Schule. Die Mütter sind entweder bei der Arbeit oder bewirten ihre Kinder. Die Männer sind nicht da. Auf dem vorgelagerten Bürgersteig gehen Passanten vorbei, die ihn nicht beachten. Die Mülltonnen stehen direkt neben dem Haus, es sind sechs große, schwarze Mülltonnen auf Rädern, die ihren eigenen kleinen Hof bilden. Ihre Deckel müssen mühsam zurückgeschoben werden, Hans kennt das von früher, als er jünger war. Da waren diese Mülltonnen grau und aus Metall. Jetzt sind sie aus Plastik. Er schiebt den Deckel zurück und hievt zwei Müllsäcke hinein. Sein Rücken zwickt ein wenig bei der Anstrengung, aber er achtet nicht darauf. Es ist nur ein kleines Zwicken, das irgendwann begonnen hat und nicht mehr aufhört. Hans nimmt es als Folge des Alterns hin.
Die Tonne ist ziemlich voll, obwohl sie erst vor drei Tagen geleert wurde. Was die Leute alles wegschmeißen, denkt Hans, als er eine lebensgroße Babypuppe sieht, die auf dem Müll liegt. Sie ist eingewickelt wie ein echtes Baby, hat eine Mütze auf wie ein echtes Baby, Hans schüttelt den Kopf. Wie die Leute ihre Kinder verwöhnen, und dann ist es ihnen auch nicht recht und so eine Puppe wird einfach entsorgt. Man hätte sie auch spenden können. Aber irgendwie kreuzt sich dieser Gedanke mit einem uralten Bild in Hans’ Gedächtnis, und auf diesem Bild sieht Hans seine Tochter Hanna, als sie ein Baby war. Wie lange ist das schon her?, fragt er sich flüchtig. »Ewigkeiten«, murmelt er, und dann hievt er die beiden anderen Müllsäcke hoch. Als er sie auf die Puppe legen will, schlägt sie die Augen auf, schaut ihn an und beginnt leise und heiser zu schreien, wie ein Kind, das erst einige Wochen alt ist. Hans starrt die Puppe an, die jetzt ihre Arme bewegt. Die beiden Müllsäcke gleiten Hans durch die Finger, sie fallen auf den Rand der Tonne und von dort auf den Boden, Hans achtet nicht darauf. Er ist damit beschäftigt zu verstehen. Und ganz langsam versteht er. Die Wucht der Erkenntnisse, die gleichzeitig in seinem Gehirn entstehen, wird nur überlagert von dem heiseren, leisen Schreien des Wesens, das da vor ihm im Müll liegt. Vorsichtig greift er zu und nimmt das Baby in den Arm. »Du hast bestimmt Hunger, nicht wahr?«, sagt er mit einem Zittern in der Stimme. Die Tücher, in die das Kind gewickelt ist, sind feucht vom Müll und stinken, Hans nimmt es wahr, aber das ist jetzt nicht wichtig. Er tastet nach seinem Portemonnaie, zum Glück hat er es dabei. Ohne zu überlegen, geht er die Straße entlang bis zum Supermarkt. Als er dort ankommt, erinnert er sich plötzlich an die Wirklichkeit. Er, Hans, ein völlig verwahrloster alter Mann, kann unmöglich mit einem so kleinen Baby den Supermarkt betreten. Er spricht eine Frau an, die gerade genau das tun will. Er sagt: »Entschuldigen Sie, könnten Sie mir etwas aus dem Geschäft mitbringen?«
Die Frau schaut ihn kurz an und geht weiter. »Ich kann es ihr nicht verübeln«, sagt Hans zu dem Baby, »sieh nur, wie ich aussehe, was soll sie denken?«
Das Baby schreit weiter, leise, heiser. Jemand muss helfen, denkt Hans. Als Nächstes kommt ein Jugendlicher vorbei, er ist wohl auf dem Heimweg. Hans sagt: »Entschuldige, ich habe Hausverbot im Supermarkt, aber mein Enkel hat Hunger, ich gebe dir Geld und du kaufst mir eine Babymilch, okay?«
Der Jugendliche ist ein schlaksiger Kerl, einen Kopf größer als Hans, vielleicht vierzehn Jahre alt, Lederjacke, eine Jeans, die tief im Schritt hängt, Schuhe ohne Schnürsenkel, aber mit Ösen, um die Schulter eine Ledertasche an langer Schlaufe. Keine Körperspannung. Er betrachtet Hans mit einer Mischung aus Scheu und Verachtung. Das Baby schreit. Der Jugendliche sagt: »Okay, ich mach’s.«
Hans gibt ihm sein Portemonnaie, der Jugendliche greift es mit spitzen Fingern, die Glastüren öffnen sich, als er sich ihnen nähert. Dann ist er drinnen. Erst jetzt fällt Hans auf, dass er ihm gar nicht gesagt hat, was genau er kaufen soll. Durch die Glasfront beobachtet er den Jugendlichen, wie er eine Verkäuferin anspricht und ihr folgt. Sie drückt ihm eine Schachtel in die Hand, er nimmt sie und geht zur Kasse. Die Verkäuferin schaut ihm nach und schüttelt den Kopf, bevor sie sich wieder ihrer Arbeit widmet. Hans steht da und wiegt das Baby. Es hat ein ganz kleines Gesicht, es kann kaum geradeaus schauen, aber es starrt ihn an und reißt seinen Mund auf und schreit. »Mach dir keine Sorgen«, flüstert Hans, »es wird alles gut.« Er spürt, wie die Trauer ihn übermannt, seine Beine werden schwach, sein Magen wird flau, Tränen quellen aus seinen Augen hervor. Während er weint, wird ihm bewusst, dass er das seit vielen Jahren nicht mehr getan hat.
Als der Jugendliche endlich wieder herauskommt, reißt Hans sich zusammen, wischt sich mit dem Ärmel seines Mantels die Tränen ab. Der Jugendliche sagt: »Ich hab sie nach Milch für ein ganz kleines Baby gefragt, war doch richtig, oder?«
Hans lächelt dankbar und sagt: »Ja, das hast du gut gemacht, ich danke dir.«
Der Jugendliche überreicht ihm die Schachtel und das Portemonnaie, Hans nimmt es irgendwie entgegen, aber die Schachtel fällt ihm auf den Boden. Der Jugendliche hebt sie auf. »Wohnen Sie hier in der Nähe?«
Hans nickt, er will ihn jetzt loswerden, aber mit dem Baby auf dem Arm kann er die Schachtel nicht tragen. Gemeinsam gehen sie die Straße entlang. Der Jugendliche zögert, dann sagt er: »Ich glaub, die Verkäuferin hat gedacht, ich kauf das für mein Kind. War ein bisschen peinlich.«
Hans schaut ihn von der Seite an. »Wie heißt du, junger Mann?«, fragt er ihn.
»Arthur«, sagt Arthur. »Ist auch ein bisschen peinlich.«
Hans hat es eilig, das Baby auf seinem Arm wirkt erschöpft, wer weiß, seit wann es nichts mehr zu essen bekommen hat. Er sagt flüchtig: »Aber das ist doch ein schöner Name. Erinnert an die Ritter der Tafelrunde.«
»Ja, eben«, sagt Arthur und verzieht das Gesicht. »Das ist so was von nicht angesagt!«
Hans versteht. Er sagt: »Mach dir nichts draus. Es gibt Schlimmeres. Schau mich an.« Arthur wirft ihm einen erstaunten Blick zu. Hans grinst ihn kurz an und ist selbst erstaunt über seine Antwort. Jetzt sind sie an Hans’ Haus angelangt. Hans verabschiedet sich, er sagt: »Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Mach’s gut, König Arthur.« Er lässt Arthur stehen und betritt das Haus, die Schachtel liegt auf dem Baby. Im Fahrstuhl kommen die Tränen wieder, Hans weint stoisch, ohne sich zu bewegen, das schreiende Baby hält er fest im Arm. Er kommt oben an, Herr Tarsi ist verschwunden und hat einen sauberen Flur hinterlassen. Endlich ist Hans in seiner Wohnung angekommen. Er legt das Kind vorsichtig auf den Küchentisch. »Es geht ganz schnell, ganz schnell«, flüstert er ihm zu. Er überfliegt die Anleitung. Wasser erhitzen. Er kramt einen schmutzigen Topf aus dem Spülbecken hervor. Das macht einen Höllenlärm, weil sein Geschirrberg in sich zusammenfällt. Es ist kein Spülmittel da, deshalb schrubbt Hans den Topf mit heißem Wasser ab, dann stellt er ihn auf den Herd und erhitzt Wasser. Es muss kochen, sagt er sich, schon allein, weil hier alles schmutzig ist. Er sitzt auf dem Stuhl, auf dem er immer sitzt, das Baby im Arm, und wartet. »Es geht ganz schnell«, sagt er wieder, »du wirst schon sehen.« Aber es geht zu langsam, das Kind schreit jetzt noch schwächer, es öffnet die Augen gar nicht mehr, seine Bewegungen werden langsamer, Hans bekommt Angst. Er steckt den Finger ins Wasser, es ist noch nicht einmal heiß. »Das muss genügen«, sagt er laut. Er stellt die Herdplatte ab und bereitet die Milch im Topf zu. Dann fällt ihm auf, dass er keine Babyflasche hat. Verzweiflung breitet sich in seinem Körper aus wie eine große Schwäche, es ist dieselbe Schwäche, die er fühlt, wenn er an den Weiterbewilligungsantrag denkt. Aber der erscheint ihm jetzt wie eine Kleinigkeit. »Was mach ich nur, was mach ich nur?«, jammert er. Da fällt ihm ein, dass er irgendwo einen Schnuller hat. Er gehörte seinem Sohn, als der ein Baby war, wie lange ist das her? »Eine Ewigkeit«, murmelt Hans und rennt mit dem Kind im Arm ins Wohnzimmer. Er legt es auf den staubigen Boden und kramt in der Kommode, auf der der Fernseher steht. Da ist er, ein uralter Schnuller. Ohne zu zögern, reißt Hans das Gummistück aus dem Plastikrahmen heraus und schneidet das Mundstück vom Fuß ab. Erleichtert stellt er fest, dass er sich richtig erinnert hat: Das Mundstück ist hohl. Eine Nadel, jetzt braucht er eine, aber er besitzt kein Nähzeug. Doch er hat einen schwarzen Kamm mit einem dünnen Griff aus Metall, so dünn, dass man ihn kaum festhalten kann. Am Ende läuft er spitz zu. Damit macht Hans ein Loch in die Spitze des Mundstücks. Das Baby schreit jetzt etwas lauter, etwas verzweifelter. Hastig kehrt Hans ins Wohnzimmer zurück. Sein Blick fällt auf den Wäschekorb, der in einer Ecke neben dem Fernseher steht. Er ist voller leerer Bierflaschen. Hans nimmt eine Flasche heraus, spült sie heiß aus, schüttet die Babymilch hinein. Das Mundstück passt drauf, aber er muss es abdichten. Er nimmt Tesafilm und umwickelt Flaschenhals und Schnuller so oft, bis er glaubt, dass es halten wird. Dann nimmt er vorsichtig das Baby und hält ihm die Flasche hin. Das Baby schreit, es reagiert nicht auf den Kontakt. »Du rechnest gar nicht mehr damit, nicht wahr, Kleiner?«, sagt Hans. »Das versteh ich gut«, sagt er, »aber jetzt ist alles anders, du wirst schon sehen.« Immer wieder schiebt Hans dem Kind den Schnuller in den Mund. Endlich versteht das Baby. Es saugt sich fest und trinkt. Doch sehr bald kommt aus der Flasche nichts mehr heraus, denn Hans hat vergessen, ein zweites Loch zu stechen, durch das Luft nachströmen kann. Er zerrt an dem Tesafilm, bis eine kleine Öffnung entsteht. Jetzt funktioniert es, das Baby trinkt. Gleichzeitig sickert Milch heraus, aber das macht nichts. Das Kind trinkt. Es trinkt, bis es nicht mehr kann, und schläft sofort ein, der Schnuller steckt noch in seinem Mund. Die Milch, die herausgesickert ist, hat die Decke, in die das Kind eingewickelt ist, durchnässt. Hans wickelt das Kind aus und sieht, dass es keine Windel trägt. Es war nicht feucht vom Müll, sondern von seinem eigenen Urin. Der Anblick des winzigen Wesens treibt Hans erneut Tränen in die Augen. »Es ist ein Mädchen«, flüstert er und lächelt durch die Tränen hindurch. Ich nenne dich Felizia, ja, du sollst Felizia heißen, denn du hast heute sehr viel Glück gehabt. Behutsam trägt Hans Felizia ins Badezimmer. Aus dem Wäschehaufen, der dort auf dem Boden liegt, kramt er ein Handtuch hervor. Es riecht muffig, aber das spielt keine Rolle. Hans wickelt Felizia in das Handtuch, dann trägt er sie ins Schlafzimmer, legt sie ins Bett und deckt sie zu. »Jetzt aber schnell«, murmelt er. Er zieht sich den Mantel wieder an, vergewissert sich, dass sein Portemonnaie in der Manteltasche steckt, und verlässt die Wohnung. Geht die Straße entlang. Als er wieder vor dem Supermarkt steht, zögert er. Ich kann doch unmöglich Babysachen kaufen, so wie ich aussehe, denkt er. Die kennen mich doch nur als einen, der nur deshalb kein Penner ist, weil er noch nicht auf der Straße gelandet ist. Was werden die denken, denkt er. Die werden denken, dass ich ein Kind geklaut habe. »Scheiße!«, flucht er leise. Dann geht er eilig weiter. So schnell ist Hans schon lange nicht mehr gegangen, bald ist er außer Atem, aber die Zeit drängt. Kurz darauf steht er vor einem anderen Supermarkt. Hier kennen sie mich nicht, denkt er und betritt das Geschäft. Er kauft drei Babyflaschen, neun Bodys, jeweils drei in einer Größe, er kauft noch mehr Milchpulver, er kauft einen Wasserkocher, Windeln für ganz kleine Babys, zwei Strampler, drei Kleidchen mit Blumenmustern in Rot, Blau und Lila, geringelte Strumpfhosen, Socken, vier Schnuller. Und dann kauft er noch Milch für sich, Zucker, ein Steak, ein Brot, Butter, Käse, Spülmittel, Waschpulver. Er kauft noch ein paar andere Dinge, die er bald benötigen wird, darunter eine Rolle grüner, durchscheinender Mülltüten, die man verschließen kann, damit der Inhalt nicht so stinkt. Aber die sechs Bierflaschen, die er sich in den Einkaufswagen lädt, lässt er an der Kasse einfach stehen. Er hat jetzt keine Zeit dafür. Die Kassiererin beobachtet ihn neugierig, während sie die Waren am Lesegerät vorbeiführt. Eine junge Frau, die das ganze Leben noch vor sich hat. Hans fühlt sich unwohl, er sagt: »Das können Sie schon im Schlaf, was?« Die Frau erschrickt, sie hat nicht damit gerechnet, dass Hans sie anspricht, jetzt ist er ihr unangenehm, sie nickt kurz und kümmert sich um die Waren, senkt den Kopf und wirkt ganz verschlossen. Hans ist erleichtert, aber auch gekränkt, und zugleich kann er sie gut verstehen. Er bezahlt mit dem Gefühl, einen Beweis zu führen für seine Würde, und verabschiedet sich wie ein normaler Mensch, aber die Kassiererin begrüßt schon die nächste Kundin. Hans seufzt. Nur sein Geld lebt noch, sein Geld nehmen sie, ihn nicht, er ist schon … er wischt den Gedanken weg, der Gedanke ist ein alter Bekannter, der ihn täglich besucht, er muss nicht einmal mehr zu Ende gedacht werden, um da gewesen zu sein. Es gibt jetzt Wichtigeres. Da war doch so ein Geschäft für Kindersachen, denkt er, als er alles in zwei Plastiktüten verstaut, die erstaunlich schwer sind. Er geht um zwei Häuserecken und steht plötzlich vor einem Schaufenster, in dem lauter Kinderwagen mit Puppen darin zu sehen sind. Es ist ein Secondhandgeschäft für Babys und Kleinkinder. Lauter Dinge, die Hans an früher erinnern, gibt es dort, wie lange ist das alles schon her? Er betritt den Laden und will einen Tragegurt kaufen. Die Verkäuferin rümpft die Nase über den Geruch, den Hans verbreitet, sie wirft ihm einen Blick zu, als hätte ein Obdachloser sich zu ihr verirrt. Hans bemerkt es, er kennt das, er achtet nicht darauf. Sie sagt ungläubig: »Wie alt ist denn Ihr Kind?«
Hans lächelt mit gespielter Verlegenheit, er sagt: »Schauen Sie mich an, junge Frau. Glauben Sie wirklich, so einer wie ich hat ein Kind?«
Die Verkäuferin lächelt nun ihrerseits verlegen und schüttelt etwas schüchtern den Kopf. »Sehen Sie«, sagt Hans zufrieden, »es ist für eine Freundin, die genauso verwahrlost ist wie ich. Aber sie hat eine Tochter, die es nicht ist, und diese Tochter hat ein ganz kleines Baby, dem es sehr gut geht, und jetzt möchte meine Freundin ihrer Tochter einen Tragegurt für die Kleine schenken, aber sie kann nicht mehr gehen, weil sie so alt ist und weil sie sich schämt, weil sie so verwahrlost ist, verstehen Sie? Und deshalb habe ich ihr gesagt: Das macht gar nichts, Klärchen – so heißt sie, wissen Sie, das heißt, so heißt sie eigentlich gar nicht, weil sie Klara heißt, aber ich kenne sie nun schon so lange, verstehen Sie?« Hans hält inne und schaut in das verwirrte Gesicht der Verkäuferin. Sie fasst sich und sagt zögernd: »Also, das ist die Enkelin Ihrer Freundin?« Hans strahlt sie an und ruft aus: »Sie haben es auf den Punkt gebracht, junges Fräulein! Besser hätte auch ich es nicht ausdrücken können!«
Die Verkäuferin sagt ungerührt: »So ein Tragegurt ist nichts für Säuglinge, die ihren Kopf noch nicht selbst halten können.«
»Oh!«, macht Hans enttäuscht. »Aber wie kann ich … wie kann die Tochter meiner Freundin denn ihre Tochter vor dem Bauch tragen?«
Die Verkäuferin verkauft Hans ein Wickeltuch. Hans kauft noch eine Mütze, einen kleinen Mantel und Hüttenschuhe in Größe 16, dann hat er kein Geld mehr und eilt nach Hause. Jetzt schleppt er drei Plastiktüten. »Hoffentlich ist Felizia nicht wach geworden«, murmelt er, während er so schnell geht, wie seine alten Beine ihn tragen. Andererseits, denkt er dann, wenn man schon im Müll gelegen hat, ist es nicht mehr so schlimm, in der Wohnung eines Untoten aufzuwachen, oder?
Mehrere Male muss er kurz stehen bleiben, um zu verschnaufen. Endlich kommt er am Haus an, endlich fährt er im Fahrstuhl in den fünften Stock, mit zitternden Fingern schließt er seine Wohnungstür auf und bleibt in der offenen Tür stehen und lauscht. Alles ist still. Und wenn sie jetzt tot ist, fährt es ihm durch den Kopf. Er stellt die Tüten in den Staub und eilt ins Schlafzimmer. Dort liegt Felizia und schläft. Ihr winziger Kopf lugt unter der Decke hervor, sie sieht ein wenig wie eine Außerirdische aus, wie E.T., findet Hans und lächelt zärtlich. Jetzt ist alles gut, Hans geht erleichtert zu den Plastiktüten zurück und trägt sie in die Küche. Morgen kaufe ich einen Kinderwagen, denkt er. Aber da fällt ihm ein, dass er sein ganzes Geld ausgegeben hat. Und dann fällt ihm der Weiterbewilligungsantrag ein. »Scheiße!«, flucht Hans und verharrt verzweifelt. Er schaut zum Wecker: zwei Uhr. Er kann kaum glauben, dass nur zwei Stunden vergangen sind. Wo ist dieser blöde Antrag? Er hat ihn sich das letzte Mal, als Frau Mohn ihn ins Arbeitsamt zitierte, mitgenommen. Er erinnert sich nicht. »Irgendwo muss er ja sein«, murmelt er und geht auf seinen Pfaden durch die Wohnung und findet den Antrag oben auf dem Fernseher unter einem Stapel alter Fernsehzeitschriften, die aktuellste ist zwei Monate alt. Seitdem schaltet Hans den Fernseher wahllos ein.
Jetzt sucht er einen Kugelschreiber, es dauert eine Weile, bis er einen findet, der schreibt. Dann setzt er sich hin und füllt den Antrag aus. Als Erstes muss er seinen Namen und sein Geburtsdatum eintragen. Als ob die das nicht alles schon wüssten, denkt er. Dabei fällt ihm das Wort ›Bedarfsgemeinschaft‹ auf, das er bisher immer überlesen hat. Mit Felizia bildet er jetzt eine solche Gemeinschaft. Aber er darf sie nicht angeben, denn wenn alles richtig verlaufen wäre, denkt Hans und denkt wirklich das Wort ›richtig‹, dann wäre Felizia jetzt tot. Er verscheucht diesen Gedanken und geht zum nächsten Punkt über. Nein, seine Wohnanschrift und seine Telefonnummer haben sich nicht geändert, auch seine Bankverbindung ist immer noch dieselbe. Nein, seine E-Mail-Adresse hat sich nicht geändert, es gibt sie nach wie vor nicht. Hans trägt seinen Namen ein und alle Kontaktdaten. Ja, seine persönlichen Verhältnisse haben sich geändert, er ist nicht mehr seit achtzehneinhalb Jahren geschieden, sondern seit neunzehn, seine Kinder haben sich nicht mehr seit zwanzig, sondern seit zwanzigeinhalb Jahren nicht mehr bei ihm gemeldet. Aber er kreuzt ›Nein‹ an und muss diesen Kasten nicht weiter beachten. Seine Erwerbsfähigkeit? Hans stockt. Bisher hat er immer ›nicht erwerbsfähig‹ angekreuzt, und das ist einer der Gründe gewesen, weshalb Frau Mohn ihn immer wieder einbestellt hat. »Sie können nicht einmal drei Stunden pro Tag arbeiten?«, hat sie mit ihrer schnippischen Stimme gefragt, die immer ein wenig zu schrill klingt.
Hans sieht sie vor seinem inneren Auge, wie sie hinter ihrem Schreibtisch thront, die falschen Locken, das feiste, runde Gesicht, die viel zu großen Ringe an den Fingern, eine dickliche, kurz geratene Person, die ihn mit routinierter Gnadenlosigkeit betrachtet. Er will es nicht wahrhaben, aber sie erinnert ihn an seine Frau. Er hat sich angewöhnt, in ihrer Gegenwart zu hinken und einen Buckel zu machen, doch es nützt nichts, denn entweder Frau Mohn durchschaut ihn oder sie ist unfähig, Mitleid zu empfinden. Jetzt überlegt Hans kurz, bevor er sich erneut für ›nicht erwerbsfähig‹ entscheidet. »Mit gutem Grund«, murmelt er und lächelt, weil er an Felizia denkt, die ihn jetzt braucht und für die er da sein wird. Beim nächsten Punkt taucht wieder das Wort ›Bedarfsgemeinschaft‹ auf. »Ihr wollt wissen, ob jemand bei mir eingezogen ist«, sagt er laut in den Raum hinein. »Kann man so sagen«, sagt er und lacht, und wieder kommen ihm die Tränen. Aber er muss weiter ausfüllen. Er kreuzt ›Nein‹ an. Nächster Punkt. Familienstand? Kinder? Mehrbedarf (Schwangere haben einen Anspruch darauf)? Behinderung (Hans’ Gehirn, denkt Hans)? Einkommensverhältnisse? Kein Einkommen. Vermögensverhältnisse? Kein Vermögen. Weder materiell noch sonst, denkt Hans. Sonstige Ansprüche: Unterhaltsforderungen? Könnte ich an Felizias Mutter stellen, denkt Hans und lacht kurz auf und fragt sich, was für ein Mensch wohl sein eigenes Kind … aber er denkt den Gedanken nicht weiter. Zum Schluss unterschreibt Hans, dass seine Angaben zutreffend sind, und wenn er sich früher wie ein Lügner gefühlt hat, dann kommt er sich jetzt wie ein professioneller Betrüger vor. Aber früher war es ein schlechtes Gefühl, weil Hans immer Angst hatte, dass Frau Mohn ihn erwischt. Jetzt ist es ein gutes Gefühl.
Nach einer Viertelstunde ist der Antrag vollständig ausgefüllt. Hans lehnt sich zurück. Dann faltet er einen Briefumschlag aus einem Blatt Papier und mit viel Tesafilm. Er schreibt an die Agentur für Arbeit, die Adresse kennt er auswendig, zu Händen Frau Mohn, zuständig für den Buchstaben D. Irgendwo muss es noch eine Briefmarke geben, Hans sucht sie, aber er findet sie nicht. Plötzlich hört er Felizias Schreien aus dem Schlafzimmer. Er wirbelt Staub auf, so schnell eilt er zu ihr. Da liegt sie, ihre Augen sind noch geschlossen, Hans hebt sie hoch. Dort, wo sie gelegen hat, ist ein dunkler Fleck. »Du bist ja ganz nass«, sagt Hans. Dann fällt ihm ein, dass er ihr keine Windel angezogen hat. Sie hat in ihre Kleidung uriniert und die ganze Zeit darin gelegen, jetzt ist sie kalt, ihre kleinen Hände sind kalt und das Bett ist bis auf die Matratze durchnässt. Hans fühlt, wie die Verzweiflung zurückkehrt. Er eilt mit Felizia ins Badezimmer, wirft das nasse Handtuch auf den Wäscheberg, wäscht sie mit warmem Wasser ab. Felizia macht die Augen auf und sieht ihn erschrocken an und schreit. Er fischt ein anderes schmutziges Handtuch aus dem Wäscheberg, trocknet sie ab. Er wickelt sie notdürftig in das Handtuch ein und eilt mit ihr zu den Einkaufstüten. Während Felizia schreit, reißt Hans Plastikverpackungen auf, zuerst die Windeln, dann einen Body, eine Strumpfhose, Socken, die Mütze, ein Kleid. Bald ist Felizia in lauter saubere, neue Sachen gekleidet und schreit immer noch. Hans legt sie sich in die linke Armbeuge. Mit der Rechten packt er den Wasserkocher aus, füllt ein wenig Leitungswasser hinein, schließt ihn an Stelle des Transistorradios ans Stromnetz an und erhitzt das Wasser. Er reißt die Plastikverpackung einer Babyflasche auf, dabei fällt ihm Felizia beinahe aus der Armbeuge. Er füllt das Milchpulver hinein, dann das heiße Wasser, mit kaltem Leitungswasser reguliert er die Temperatur. Endlich kann er sich auf seinen Stuhl setzen und Felizia füttern. Sie trinkt gierig fast fünfzig Milliliter. Anschließend schläft sie sofort wieder ein. Hans lehnt sich erschöpft zurück. »Wo soll ich dich jetzt hinlegen?«, sagt er leise. Er steht auf und sieht sich in seiner schmutzigen Wohnung um. Felizia ist wie ein Kontrastmittel, ganz gleich wohin er sie legen will, überall würde ihre saubere neue Kleidung sofort staubig und schmutzig werden, sogar wenn er sie sich mit dem neuen Tragetuch vor seine schmutzige Brust hängt. »Dieses Kind passt nicht hierher«, murmelt Hans traurig. »Aber es passt auch nicht in den Müll«, sagt er dann, »und wenn es hier schmutzig ist, dann ist im Müll nichts anderes mehr als Schmutz.« Hans schüttelt den Kopf. »Nein, nein«, sagt er trotzig, »du hast es gut hier, du bist bei einem alten Taugenichts gelandet, das ist großartig, ganz großartig, machen wir uns nichts vor.«
Hans wird sich Felizia umhängen, auch wenn sein Hemd so speckig ist, dass er selbst nicht mehr genau hinschauen und -fühlen will. Er legt Felizia auf den Tisch. Sie dreht ihren Kopf zur Seite und schläft weiter. Dann macht er sich an dem Tragetuch zu schaffen. Er hat einige Probleme damit, aber nach einer Weile begreift er, wie es funktioniert. Vorsichtig schiebt er sie so hinein, dass auch ihr Kopf gehalten wird. Dann den Mantel drüber, und wenn er den zuknöpft, Sieht man kaum, dass ich sozusagen schwanger bin, denkt Hans und grinst. Er will die Wohnung verlassen, aber plötzlich bleibt er ganz still stehen und fühlt Felizias Herzschlag gleich unter seiner Brust. Ganz schnell ist das Pochen ihres Herzens. Wie das Herz eines Vögelchens, denkt Hans und erinnert sich. Als er klein war, ging er in eine Schule, die warum einen Innenhof herum gebaut, den niemand betreten konnte. Es war einfach nur ein besonders breiter Lichtschacht. Aber eines Tages kam Leben in diesen Schacht, denn eine Elster war dort hineingeraten und kam nicht wieder heraus, weil sie so steil nicht aufsteigen konnte. Er lief mit einem Schulkameraden ganz aufgeregt zum Hausmeister, und der schloss ihnen eine schmale Tür zu dem Lichtschacht auf, die er sonst nur benutzte, um dort sauber zu machen. Sie rannten über die Kieselsteine zu der Elster hin und die Elster versuchte verzweifelt, ihnen zu entkommen, aber Hans ergriff sie von hinten und trug sie durch die Schule hinaus in die Freiheit. Und während er sie trug, fühlten seine Hände das Herz der Elster, ein kleines, ängstliches Vogelherz, das so schnell schlug, dass Hans sich wunderte, wie es das aushielt. »Eines Tages«, sagt Hans leise zu Felizia, »werde ich dich auch fliegen lassen. Hoffentlich erst, wenn du es schon kannst.« Er steckt den Brief an das Arbeitsamt ein und verlässt die Wohnung.
Hans geht zum Lotto-Toto-Laden, der direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite liegt. Dort hat er früher seine Zigaretten und Zeitschriften gekauft. Jetzt braucht er eine Briefmarke. Der Besitzer geht auf die siebzig zu, ein gepflegter Witwer. Sie kennen sich, seit Hans vor zehn Jahren hierhergezogen ist.
Als Hans die Tür öffnet, bimmelt es, dann erscheint Herr Wenzel aus einem Hinterzimmer. Er geht sehr gebeugt, aber sein Gesicht mit den wasserblauen Augen und dem schlohweißen Haar ist klar und ebenmäßig. Er sagt: »Tag, Hans! Was führt dich her?« Herr Wenzels Blick fällt auf die Wölbung vor Hans’ Brust. Er sagt: »Wirst du jetzt schon dick vom Nixtun?«
Hans lacht wie über einen guten Witz. Ohne länger zu überlegen, knöpft er seinen Mantel auf und sagt: »Schauen Sie einmal her!«
Herr Wenzel beugt sich über die Theke, Hans dreht sich so weit zur Seite, dass der andere Felizias Gesicht sehen kann. Herr Wenzel reißt erstaunt seine wasserblauen Augen auf, und Hans fühlt einen Stolz, den er noch nie gefühlt hat, nicht einmal damals, als seine Tochter zur Welt gekommen war und die Verwandtschaft seiner Frau auflief, um das Kind zu begutachten. Da war er nur ein Anhängsel gewesen, während Mutter und Kind alle Aufmerksamkeit bekamen. Aber jetzt steht er hier und ist ein echter Großvater, echter als jeder andere Großvater, der sein Enkelkind nur leihweise haben darf.
Nachdem Herr Wenzel Felizia begutachtet hat, blinzelt er Hans an und sagt: »Und wo ist die Mutter?«
Hans schaut ihn verdattert an. Mit einer so direkten Frage hat er nicht gerechnet.
Herr Wenzel sieht Hans direkt ins Gesicht, und als Hans nichts sagt, sagt er: »Dein Enkelkind, nicht wahr?«
Hans erholt sich von seinem Schreck und nickt. Hastig sagt er: »Ja, stellen Sie sich vor, Herr Wenzel, meine Tochter ist zu Besuch aus Neuseeland, und da hat sie mir ihr Kind kurz dagelassen, weil sie ein paar Besorgungen machen muss, so war das.«
Herr Wenzel nickt, als sei es genau so, wie Hans sagt. »Natürlich«, sagt er und lächelt freundlich. »Wie kann ich dir helfen?«
Hans kauft ihm eine Briefmarke ab, frankiert den Brief und lässt ihn gleich da, denn um vier Uhr kommt der Postwagen am Lotto-Toto-Laden vorbei. Hans will jetzt nur noch weg, er murmelt eine Verabschiedung und wendet sich zur Ladentür, aber Herr Wenzel sagt: »Hans, wart noch eben!«
Er kommt mit kleinen Schritten um die Theke herum und greift im Vorbeigehen nach einer Lokalzeitung, die auf einem ganzen Stapel liegt. Er rollt sie zusammen, gibt sie Hans und sagt: »Die ist heute sehr lesenswert, Hans. Ich schenke sie dir.«
Verwirrt bedankt Hans sich. Herr Wenzel hat ihm noch nie eine Zeitung geschenkt, er hatte bislang sogar das Gefühl gehabt, dass Herr Wenzel ein wenig geizig ist, weil er jeden Cent Wechselgeld korrekt abrechnet. Hans verlässt das Geschäft mit der Zeitung in der Hand und geht schnell weg. Felizias Herz pocht gegen seine Brust, aber das alte Herz darin pocht jetzt auch schneller. Der hat mir nicht geglaubt, denkt Hans und malt sich aus, wie Herr Wenzel genau jetzt zum Telefon greift, um die Polizei zu verständigen.
Hans bleibt auf dem Bürgersteig stehen. »Meine Tochter!«, sagt er laut. »So ein Schmarrn! Wie alt soll denn das Fräulein Tochter bitteschön sein? Zwanzig? Dreißig? Vierzig? Du Hornochse! Du Gockel, musstest ja groß auftrumpfen, du Rindviech!« Hans ist ganz außer sich. Er geht weiter, dann bleibt er wieder stehen und will zurückgehen und Herrn Wenzel eine andere, bessere Geschichte erzählen. Aber es ist zu spät und er geht weiter. Nach Hause. Hans muss verschwinden aus der äußeren Welt, die ihm seine neue Enkeltochter sofort wieder abnehmen will. Er fährt mit einer Nachbarin aus dem Neunten hinauf. Man kennt sich nur vom Sehen und Grüßen. Der Frau fällt nicht einmal auf, dass Hans dicker ist als sonst. Warum musste er auch ausgerechnet zu Herrn Wenzel gehen? Hans kann gar nicht aufhören, sich zu ärgern.
Als er seine Wohnung betritt und den Schmutz und die Unordnung, lässt er die Schultern hängen. Er setzt sich auf seinen Stuhl im Wohnzimmer, ohne den Mantel auszuziehen, und schaltet den Fernseher ein. Felizia schnauft laut, aber Hans muss jetzt abschalten. Im Fernsehen läuft eine Ratgebersendung über die besten Geldanlagen. Hans hat keine Lust zu zappen, er schaltet den Fernseher wieder aus. Auf dem Tisch liegt die Zeitung, die Herr Wenzel ihm geschenkt hat. Es ist eine Boulevardzeitung, Hans liest so etwas nicht. Warum hat der Wenzel mir die geschenkt?, fragt er sich und beginnt, darin zu blättern. Auf der dritten Seite in der Rubrik ›Stadtviertel‹ findet er die Antwort. Es ist ein kurzer Artikel. Er liest ihn mehrere Male.
Dann steht er auf, verlässt die Wohnung, fährt mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss, verlässt das Haus, überquert die Straße und betritt den Lotto-Toto-Laden von Herrn Wenzel. Die Türglocke läutet. Drei Kinder, die höchstens acht Jahre alt sind, stehen dort unschlüssig vor runden Plastikdosen und zeigen zögerlich auf schwarze Lakritzschnecken, grüne Gummifrösche, rote Zuckerstangen. Immer wieder schauen sie die Münzen an, die sie in ihren Händen halten, rechnen halblaut nach und halten Rat. Herr Wenzel steht bei ihnen und wartet. Als er Hans erblickt, nickt er ihm kurz zu.
Die Kinder versuchen, die richtige Wahl zu treffen, so viele Süßigkeiten zu kaufen, wie ihr Geld es ihnen erlaubt, und zugleich für alle drei die gleiche Menge zu erstehen, damit es gerecht ist. Hans kann sich kaum beherrschen, so ungeduldig ist er. Am liebsten würde er die Kinder anfahren, sich zu beeilen, aber als er schon kurz davor ist, betritt eine junge Frau den Laden und Hans sagt lieber nichts. Er konzentriert sich auf Felizia. Er spürt ihren Herzschlag wie ein fernes Pochen, so fern, dass er sich plötzlich an seine Tochter Hanna erinnert, Wie lange ist das her?, fragt er sich, aber bevor er an die Ewigkeit denken kann, taucht ein Bild vor ihm auf, seine Frau mit Hanna in ihren Armen, beide lächeln ihn an, Hanna ist höchstens ein Jahr alt, Hans lächelt nicht zurück, er fühlt sich eingeengt von den Forderungen nach Liebe und Aufmerksamkeit, die in den lächelnden Gesichtern liegen, er hat das Gefühl, fortlaufen zu müssen, um endlich frei zu sein. Frei wovon? Das wusste er damals nicht, und deshalb blieb er und ertrug dieses Gefühl wie ein endgültiges Urteil, und deshalb hat er dieses Bild nicht vergessen, es steht für sein Versagen als Vater und als Mann. In welcher Verfassung war ich?, fragt Hans sich ratlos und schüttelt traurig den Kopf, aber da sind die Kinder endlich fertig und gehen zur Ladentheke. Herr Wenzel geht um die Theke herum, taucht dahinter wieder auf, er ist jetzt der Kassierer, Herr Wenzel spielt ein Ein-Mann-Stück mit zwei Rollen. Er lächelt freundlich, als er sagt: »Das macht dann drei Euro fünfzig.«
Die Kinder händigen ihm nacheinander ihre Münzen aus, dann gehen sie, und jetzt ist Hans an der Reihe, aber hinter ihm steht die junge Frau, und was er zu sagen hat, ist nicht für ihre Ohren bestimmt.
Hans weiß nicht, was er tun soll, aber da lächelt Herr Wenzel wieder freundlich und sagt: »Kommen Sie doch schon einmal vor, junge Dame.«
Während er sie bedient, lauscht Hans wieder Felizias Atem. Sie schläft immer noch, Schlafen kleine Babys so lange?, fragt er sich und kann sich nicht erinnern. Warum kann ich mich nicht erinnern?, fragt er sich. Weil ich mich so lange nicht erinnert habe oder weil ich es noch nie wusste? Hab ich meine eigene Tochter je so nah bei mir gehabt? Er verscheucht die Gedanken. »Was geschehen ist, ist geschehen«, murmelt er. Er ruft sich seine halbwüchsigen Kinder in Erinnerung: Hanna, so streitbar, so schnell mit den Worten, dass er, der Vater, keine andere Waffe hatte als die Lautstärke seiner Stimme. Und Rolf, sein Sohn, einen Kopf größer als er selbst, ein breitschultriger Hüne, der vor niemandem Angst zu haben brauchte, auch nicht vor ihm. Rolf hatte Rede und Antwort gestanden, wenn Hans es verlangte, hatte alle Freiheiten verraten, die Hanna sich herausnahm, hatte zu seinem Vater gehalten, bis er fünfzehn Jahre alt wurde. Dann war alles anders geworden, und Hans hatte zuerst noch gedacht: Es sind Kinder, die kriegen sich schon wieder ein, mein Vater hat nie eine Erklärung gegeben, sich nicht einmal entschuldigt, warum sollte ich damit anfangen? Aber sie haben sich nicht mehr eingekriegt, nicht wahr, Hans, denkt Hans, bis heute nicht.
In diesem Augenblick geht die junge Frau an Hans vorbei und verlässt den Laden. Hans hebt den Kopf, Herr Wenzel schaut ihn erwartungsvoll an.
»Nun, Hans«, sagt er, »hast du die Zeitung gelesen?«
Hans nickt.
»Und?«, fragt Herr Wenzel.
Hans weiß nicht, was er sagen will. Deshalb sagt er: »Sie lag in der Mülltonne, ich habe sie gerettet, sie hat niemanden, sie braucht mich, wollen Sie sie mir wegnehmen?« Hans ist immer lauter geworden, jetzt hält er erschrocken inne.
Herr Wenzel kommt um die Theke herum mit seinen kleinen Schritten und seinem gebeugten Körper, jetzt steht er vor Hans und ist nicht mehr der Ladenbesitzer. Er macht ein bekümmertes Gesicht, leise sagt er: »Das ist schrecklich, Hans, schrecklich.« Er kommt ganz nahe, er will das Kind aus dem Müll noch einmal neu anschauen, aber Hans weicht jetzt zurück, er will Felizia nicht mehr herzeigen. Herr Wenzel lächelt traurig. Er sagt: »Was wirst du jetzt tun, Hans?«
Hans sagt trotzig: »Ich werde sie großziehen, ich habe sie aus dem Müll gezogen, sie wird bei mir bleiben, sie wird in den Kindergarten gehen, in die Schule, sie wird ein ganz normales Leben haben, ich werde ihr erzählen, dass ihre Eltern tot sind, dass ich ihr Großvater bin, sie wird nie erfahren, was wirklich geschehen ist …« Er hört auf zu sprechen, denn Herr Wenzel sieht ihn auf einmal ganz verstört an. Hans wartet.
Herr Wenzel fasst sich wieder. Dann sagt er mit seiner sanften Stimme und seinem traurigen Lächeln: »Aber Hans, hast du sie denn gerettet, um sie anzulügen?«
Hans macht den Mund auf und dann wieder zu. Er hat keine Antwort. Er legt die Hände schützend um Felizia, die immer noch schläft und nicht ahnt, dass hier zwei alte Männer über ihr Schicksal verhandeln. Hans schluchzt. Herr Wenzel klopft ihm ungeschickt auf die Schulter.