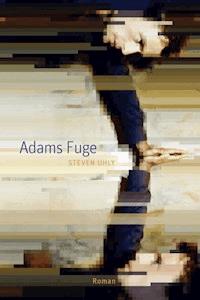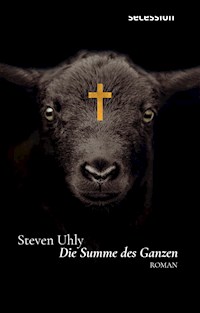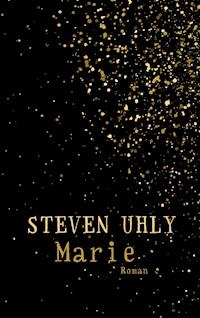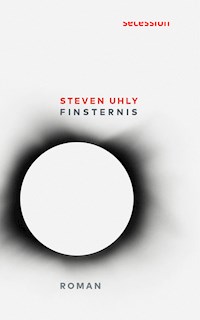
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Abid Malik, ein junger Kriminalbeamter, folgt der dringenden Empfehlung seines Vorgesetzten, sich einer Therapie zu unterziehen. Ein Sexualverbrechen greift, so scheint es, seine Psyche an. Die Indizien verweisen auf einen sadomasochistischen Hintergrund – doch die Identität der Leiche kann nicht festgestellt werden. Ein Video, anonym zugespielt, entfaltet seine infame Wirkung. In den zwölf Gesprächen zwischen Malik und seiner Therapeutin zeichnet sich ab, wie das Verbrechen sämtliche Betroffenen aus ihren gewohnten Bahnen wirft, obwohl sie weiterhin versuchen, die Augen vor einer Wirklichkeit zu verschließen, die von Macht, Ohnmacht und Loyalität geprägt ist. Nach und nach wird deutlich, dass es hier nicht nur um einen kriminalistischen Fall geht, sondern um Zusammenhänge, die tief in unserer Gesellschaft und in uns selbst verwurzelt sind. Steven Uhly hat mit Finsternis einen Thriller geschrieben, dessen Protagonisten immer wieder daran scheitern, ihre Rollen zu spielen. Er zeigt ein Panorama der Unfreiheit, der Abhängigkeiten und Verstrickungen, das tiefer und tiefer in eine ohnmächtige Welt führt. Bis zur letzten Zeile zeichnet Steven Uhly das Porträt einer Gesellschaft, deren Herrschaftsmechanismen unauffindbar bleiben, weil jeder, ob nun willentlich oder nicht, zu deren Erhaltung beiträgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
STEVEN UHLY
FINSTERNIS
ROMAN
Erste Auflage
© 2020 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Peter Natter
www.secession-verlag.com
Gestaltung und Satz:
Erik Spiekermann und Marco Stölk, Berlin
ISBN 978-3-906910-86-4
eISBN 978-3-906910-87-1
Dank an John
Inhalt
Erstes Gespräch
Zweites Gespräch
Drittes Gespräch
Viertes Gespräch
Fünftes Gespräch
Sechstes Gespräch
Siebtes Gespräch
Achtes Gespräch
Neuntes Gespräch
Zehntes Gespräch
Elftes Gespräch
Zwölftes Gespräch
Erstes Gespräch
»Die Edinburger Straße befindet sich im Zuständigkeitsbereich der Direktion 3 – das ist meine Dienststelle, Fachkommissariat 33, Delikte am Menschen, also auch Tötungsdelikte. In der Edinburger Straße fehlt die Hausnummer 34. Die 33 ist ein Neubau mit einer großen Glasfassade. Die 35 ein Altbau. Dazwischen gibt es eine Lücke, vermutlich stand dort früher ein Gebäude. Heute hat man Einblick in eine Grünanlage. Der Zugang ist durch ein zwei Meter hohes schmiedeeisernes Gatter auf Höhe der Hausfronten versperrt. Nur die unmittelbaren Anrainer haben zu der Grünanlage Zutritt. Die Fassaden der Edinburger Straße schauen nach Nordosten zum Schillerpark. Nach Südwesten liegt der Häuserblock an der Müllerstraße. Auf der östlichen Seite grenzt er an die Türkenstraße, auf der westlichen an die Barfusstraße.«
»Warum beschreiben Sie mir das so genau?«
»Ich habe ein gutes Gedächtnis. Das hilft mir bei der Arbeit. Soll ich weitermachen?«
»Bitte!«
»Am 13. Januar 2019 fand eine Bewohnerin der Edinburger Straße 31 kurz nach Mitternacht während eines Spaziergangs mit ihrem Hund die Leiche einer Frau. Die Bewohnerin verständigte sofort die Polizei. Etwa fünf Minuten später traf eine Streife ein und begann mit der Sicherung des Tatorts. Die Polizisten hatten noch während der Anfahrt den Kriminaldauerdienst benachrichtigt und dieser wiederum unsere Dienststelle, so dass wir alle unmittelbar nacheinander in der Grünanlage der Edinburger Straße zusammenkamen. Man nennt das den ›ersten Angriff‹. Die Nacht war klar, die Temperatur lag bei minus drei Grad. Wir waren nicht warm genug angezogen.«
»Hatten Sie zuvor schon einmal eine Leiche gesehen?«
»Nein. Selbst in einer Stadt wie Berlin sind Tötungsdelikte eher die Ausnahme als die Regel. Zum Zeitpunkt des Leichenfundes war ich erst seit einem knappen Jahr bei der Kripo. Mein Kollege ist acht Jahre älter als ich, er besaß mehr Erfahrung im Job. Er hatte schon Tötungsdelikte bearbeitet. Hatte mir auch davon erzählt. Hatte gesagt, nur das erste Mal sei schwierig.«
»Wie heißt Ihr Kollege?«
»Jan West.«
»Und dieser Jan West, was ist das für einer, ein Zyniker?«
»Absolut nicht. Er ist nur abgehärtet. Wir haben den Beruf aus ähnlichen Gründen gewählt.«
»Was sind das für Gründe?«
»Menschen beschützen. Straftäter aus dem Verkehr ziehen, damit die Gesellschaft in Sicherheit leben kann.«
»Das sind ehrenwerte Absichten.«
»Das denke ich auch.«
»Wie ging es weiter?«
»Wir nannten den Tatort ›Edinburger 34‹, weil die Leiche in der Nähe und auf Höhe der Lücke gefunden worden war. Als mein Kollege und ich dort eintrafen, hatte die Streife den Tatort bereits gesichert. Der Kriminaldauerdienst hatte Scheinwerfer aufgestellt, um alles auszuleuchten, und war bereits damit beschäftigt, Spuren zu sichern, Elger Stochow und Maria Kämmer, beide älter und erfahrener als ich. Sie gehören zu unserem Fachkommissariat. Die Tote lag auf einer Trage, wie Notärzte sie benutzen. Ungefähr Anfang bis Mitte sechzig, schlank. Sie war vollkommen unbekleidet und lag auf dem Rücken, die Arme an den Seiten, die Beine ausgestreckt. Ordentlich aufgebahrt. Ihre Brüste wiesen Spuren von Gewalteinwirkung auf, sie waren grün und blau, vermutlich von Schlägen mit der Faust oder einem stumpfen Gegenstand. Ihr Schambereich war komplett enthaart, die Vagina rot angeschwollen. Auch das Gesicht wirkte verquollen. Die Kollegen vom Dauerdienst spreizten ihr die Beine, um eine Sonde in den Anus einzuführen und die Körperkerntemperatur zu messen. Das ist eine übliche Vorgehensweise. Auf diese Weise sahen wir, dass auch der Anus der Toten verletzt war. Die Körperkerntemperatur betrug knapp 34 Grad. Da die Außentemperatur in der Tatnacht wie gesagt bei minus drei Grad lag, kalkulierten wir, dass die Frau noch nicht sehr lange dort gelegen haben konnte. Inzwischen waren Bewohner der umliegenden Häuser auf uns aufmerksam geworden. Einige hatten sich in die Grünanlage begeben und standen nun außerhalb der Absperrung. Mein Kollege und ich stellten den Leuten Fragen. Ein Nachbar war zwanzig Minuten vor der Bewohnerin, die die Leiche gemeldet hatte, ebenfalls mit seinem Hund Gassi gegangen und hatte den Tatort passiert. Ihm war nichts aufgefallen, obwohl er eine Weile dort gestanden hatte. Trotz der Dunkelheit hätte er die Tote bemerken müssen, zumal sie nicht versteckt worden war. Im Gegenteil. Es wirkte eher so, als sollte sie gefunden werden. In der Zwischenzeit hatten die Kollegen vom Dauerdienst petechiale Einblutungen an den Augen festgestellt. Das wies darauf hin, dass der Tod durch Ersticken eingetreten war. Allerdings fanden sich keine Würgemale am Hals. Als der Gerichtsmediziner ein paar Minuten später eintraf, öffnete er der Toten den Mund und fand Reste von Sperma vor. Auch in der Vagina und im Anus stellte er Sperma fest, konnte vor Ort aber nicht bestimmen, ob es sich um Ejakulate desselben Mannes handelte. Er deutete an, dass sie durch einen erigierten Penis erstickt sein könnte – eine Sexualpraktik, die als ›Deep Throat‹ bezeichnet wird. Er stellte außerdem fest, dass die äußeren Schamlippen des Opfers jeweils in regelmäßigen Abständen vier kleine Löcher aufwiesen. Er schloss daraus, dass die Frau dort Ringe getragen hatte, und erklärte uns, dies weise auf die BDSM-Szene hin, wo solche Ringe dazu benutzt werden, die Vaginas sogenannter Sklavinnen zu entblößen oder verschlossen zu halten. Aufgrund des Zustandes dieser Löcher vermutete er zudem, dass die Ringe erst kurz nach dem Eintritt des Todes entfernt worden waren, vielleicht, um Spuren zu verwischen. Außerdem bemerkte er noch, dass dieses Intim-Piercing offenbar erst in jüngster Zeit vorgenommen worden war.«
»Wie hat das alles auf Sie gewirkt?«
»Man hat keine Zeit für Gefühle, man hat einen Job zu erledigen und muss so professionell wie möglich handeln. Dafür sind wir ausgebildet worden.«
»Waren Sie nicht wütend?«
»Wütend?«
»Auf den Täter?«
»Natürlich hat man Emotionen.«
»Verspürten Sie den Wunsch, ihn zu töten?«
»Warum fragen Sie mich das?«
»Ich will Sie kennenlernen. Das ist mein Beruf.«
»Wie gesagt: Man hat Emotionen, auch als Polizist. Aber man hat ja einen Eid geleistet. Ich gehöre nicht zu denen, die die Todesstrafe für Kinderschänder fordern, wie manche Kollegen, nicht nur solche, die sich als Reichsbürger bezeichnen.«
»Reichsbürger gibt es bei der Berliner Kriminalpolizei auch?«
»Darüber will ich lieber nicht sprechen.«
»Kein Problem. Das hier ist kein Verhör. Was geschah dann?«
»Der Gerichtsmediziner fand noch heraus, dass die Brustwarzen des Opfers ebenfalls beringt gewesen sein mussten. Auch dieser Eingriff schien jüngeren Datums zu sein. Was seiner Meinung nach erneut auf die BDSM-Szene hinwies. Er meinte, sie sei womöglich bei einem sogenannten ›Gang Bang‹ ums Leben gekommen. Das ist eine Sexualpraxis, bei der viele Männer gleichzeitig mit einer einzigen Frau Geschlechtsverkehr haben. Sind meine Erklärungen überflüssig?«
»Keineswegs. Was dachten Sie darüber?«
»Für mich war das neu, klang aber plausibel. Das fanden auch die Leute vom Dauerdienst und die Tatortgruppe, die später noch hinzukam. Die Tatortgruppe gehört mit zum ersten Angriff, wenn klar wird, dass es sich um ein schweres Verbrechen handelt. Jan West hatte sie nach Rücksprache mit dem K angefordert.«
»Dem Kommissariat?«
»Korrekt. Die Tatortgruppe ist besser ausgestattet als der Kriminaldauerdienst. Sie verfügt über einen Tatortbus mit entsprechender Ausrüstung. In der Tatnacht handelte es sich um einen Mann und eine Frau von unserer Dienststelle.«
»Fanden sie Spuren?«
»Nein. Die Erde war zu hartgefroren, deshalb gab es keine Spuren von Schuhprofilen. Die Trage war auf einem Rasenstück abgesetzt worden. Wir besprachen unsere ersten Eindrücke. Allein die Tatsache, dass die Leiche mit einer Trage transportiert worden war, wies auf mindestens zwei Täter oder einen Täter und seinen Komplizen hin. Sie hatten Handschuhe getragen, was bei der Außentemperatur nicht überraschend war. Es gab also keine Fingerabdrücke an den Griffen der Trage. Inzwischen standen etwa zwanzig Anwohner außerhalb der Absperrung und debattierten. Sie erzählten uns, die Grünanlage verfüge über drei abgeschlossene Tore, die auf die Straße führten, und nur unmittelbare Anrainer besäßen einen Schlüssel. Sie machten sich Sorgen, weil sie glaubten, die Täter könnten im Häuserblock leben. Mein Kollege und ich versuchten, sie zu beruhigen. Ein Bewohner aus der Müllerstraße wies uns auf Ausländer hin, die in diesem Block lebten, und forderte uns auf, wir sollten uns erst einmal um die kümmern.
»Was empfanden Sie?«
»Mein Kollege informierte ihn darüber, dass wir alle Bewohner befragen würden.«
»Herr Malik, ich habe ein wenig über Sie recherchiert.«
»Über mich? Was gibt’s denn da zu recherchieren?«
»Einiges. Ihre Familie stammt ursprünglich aus Pakistan, genauer aus Kaschmir. Ihre Eltern sind vor dem Konflikt zwischen Ihrem Land und Indien geflohen.«
»Das ist kein Geheimnis. Steht alles in meiner Personalakte.«
»Ihre Familie gehört dem Malik-Clan an, nicht wahr?«
»Stimmt auch. Hat aber nichts mit irgendwelchen Berliner Clans zu tun. Unser Clan ist uralt. Malik ist eigentlich kein Name, sondern ein Titel: Seeah-Malik. Unter den Moguln waren wir für die Sicherung der königlichen Wege zuständig. Vor dem 13. Jahrhundert und vor unserer Konvertierung zum Islam gehörten wir einer indischen Kriegerkaste an, den Rajputs.«
»Interessant.«
»Schnee von gestern.«
»Empfinden Sie sich als Deutscher?«
»Ich bin Deutscher. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen.«
»Und dass dieser Anwohner sofort Ausländer verdächtigte, machte Sie das nicht wütend?«
»Wie gesagt …«
»Ich weiß schon: Man hat Emotionen. Hatten Sie denn welche?«
»Das war nicht wichtig. Wir hatten die Lage unter Kontrolle.«
»Okay. Erzählen Sie bitte weiter!«
»Eine Ambulanz kam und brachte die Leiche in die Gerichtsmedizin. Der Arzt fuhr mit. Er sollte sie noch in der Tatnacht gerichtsmedizinisch untersuchen und am nächsten Morgen seine Ergebnisse präsentieren. Die Tatortgruppe kam zu dem Schluss, dass es keinen Sinn hatte, in der Dunkelheit nach weiteren Spuren zu suchen. Die beiden Streifenpolizisten wurden von Kollegen abgelöst, deren Aufgabe darin bestand, den Tatort bis zum Morgen zu sichern. Dann konnten wir nach Hause fahren. Es war ungefähr fünf Uhr früh, als ich schlafen ging.«
»Sie haben zwei Kinder, nicht wahr? Einen Jungen, der in die erste Klasse geht, und ein kleines Mädchen im Kindergartenalter, richtig?«
»Korrekt. Warum fragen Sie?«
»Wie gesagt: Ich will Sie kennenlernen. Das gehört zu meiner Arbeit. Wenn man so will, bin auch ich eine Ermittlerin. Nur dass ich nach einer anderen Art von Hinweisen suche.«
»Meine Polizeidiensttauglichkeit wurde seinerzeit von einem Psychologen bestätigt, das liegt schriftlich vor.«
»Sie sind doch freiwillig zu mir gekommen, nicht wahr?«
»Wie man’s nimmt. Der Dienststellenleiter vom K33, Kriminalhauptkommissar Ballmann, riet mir, jemanden aufzusuchen.«
»Warum tat er das?«
»Meine Frau und ich … wir haben derzeit Differenzen.«
»Was für Differenzen?«
»Sie sagt, ich arbeite zu viel, wäre nie zu Hause, würde keine Zeit mehr mit den Kindern verbringen. Sie und Ballmann behaupten unabhängig voneinander, mein Verhalten habe sich geändert seit …«
»Seit dem Verschwinden von Jan West?«
»Ja.«
»Wie sehen Sie das?«
»In meinem Beruf dürfen die eigenen emotionalen Reaktionen keine Rolle spielen, weil man sonst parteiisch wird. Empathie kann außerdem ausgenutzt werden – von Tätern wie Opfern. Davor müssen wir uns schützen. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen, müssen sachlich bleiben, sonst schadet das den Ermittlungen und kann zu Kurzschlusshandlungen führen. Das kann Folgen haben. Ich bin Pragmatiker.«
Stille.
»Gut, die Ereignisse, die mit der Toten von der Edinburger 34 in Zusammenhang standen … Es ist nicht ganz leicht, diese Ereignisse wegzustecken, das gebe ich zu. Aber es gehört zum Job. Im Moment hilft es mir, viel zu arbeiten. Das wird auch wieder vorbeigehen.«
»Haben Sie versucht, das Ihrer Frau zu erklären?«
»Meine Frau ist im Gegensatz zu mir eher emotional.«
»Es ist Ihnen also schwergefallen, Ihren Standpunkt klarzumachen?«
»Wir haben uns in letzter Zeit etwas auseinandergelebt. Seit … der Sache mit Jan – mit Herrn West.«
»Aus welchem Grund?«
»Ist das wirklich wichtig? Das ist privat.«
»Alles, was Sie mir sagen, bleibt unter uns, Herr Malik. Nicht nur während unserer Sitzungen, sondern für immer. Das ist einer der Unterschiede zwischen Ihrem und meinem Beruf.«
»Das weiß ich. Aber Sie sind kein Fluss. Sie sind eine Person.«
»Kein Fluss? Erklären Sie mir das?«
»In der Kultur meiner Eltern kann man Dinge, die man niemandem anvertrauen will, einem Fluss, dem Wind oder dem Meer erzählen, wenn man sie unbedingt aussprechen muss. Das ist anders als der psychologische Dienst der Berliner Polizei.«
»Sie meinen, nicht so persönlich?«
»So ungefähr.«
»Haben Sie das schon ausprobiert?«
»Den Fluss? Nein. Ich glaube nicht wirklich, dass das funktioniert.«
»Was soll da funktionieren?«
»Dass man es los wird.«
»Sie sagten vorhin, dass Sie ein gutes Gedächtnis haben – dann können Sie sowieso nicht damit rechnen, etwas Gravierendes zu vergessen. Wobei ich, ehrlich gesagt, noch nichts Genaues weiß. Ihr Vorgesetzter hat jedoch Andeutungen gemacht, als er mich anrief. Das geschah doch in Ihrem Auftrag, nicht wahr?«
»Korrekt. Ich hatte ihn darum gebeten, jemand Geeignetes für mich zu suchen.«
»Erstaunlich, dass er mich ausgewählt hat.«
»Warum?«
»Weil ich erst seit kurzer Zeit für den psychologischen Dienst der Berliner Polizei arbeite. Ich bin die Neue hier.«
»Was haben Sie vorher gemacht?«
»Ich hatte eine eigene Praxis. Auch hier in Berlin.«
»Aha.«
»Wollen Sie mir nicht erst einmal möglichst lückenlos berichten, was alles passiert ist, und dann schauen wir, wie Sie am besten damit umgehen können? Ich kenne ein paar Tricks, die Ihnen vielleicht helfen werden. Was halten Sie davon?«
»Wenn Sie Herrn Ballmann sagen, dass ich voll diensttauglich bin.«
»Warum sollte ich das tun? Niemand hat mich darum gebeten, ein psychologisches Gutachten über Sie vorzulegen. Ballmann hat jedenfalls nichts dergleichen verlangt.«
»Trotzdem. In letzter Zeit lässt er mich kaum noch aus dem Kommissariat. Wenn Sie ihm sagen, dass es mir gutgeht, erzähle ich Ihnen alles.«
»Das würde er nicht glauben. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ihm zu erklären, dass Arbeit stabilisierend auf Sie wirkt, vorausgesetzt, Sie erscheinen so lange jede Woche in meiner Praxis, bis ich den Eindruck habe, dass es Ihnen wirklich wieder gutgeht. Einverstanden?«
Stille.
»In Ordnung.«
»Schön. Kehren wir zur Tatnacht zurück.«
»Ich kam, wie gesagt, erst frühmorgens nach Hause, konnte dann aber nur kurz schlafen, weil meine Frau unseren Sohn um sieben Uhr weckt. Ich habe einen leichten Schlaf, deshalb wurde ich davon wach.«
»Dachten Sie an die Tote?«
»Weniger an sie als an die Ermittlungen, die vor uns lagen.«
»Sprachen Sie mit Ihrer Frau über den Fall?«
»Nein. Man sollte die Familie mit solchen Dingen nicht belasten. Außerdem dürfen wir über laufende Ermittlungen mit niemandem reden.«
»Wie ging es Ihnen denn am nächsten Tag?«
»Wie immer. Als meine Frau mit Timo auf dem Weg zur Schule war, stand ich auf, weckte Mona, unsere Tochter, machte das Frühstück für sie, zog sie an. Als meine Frau von der Schule zurückkam, brach ich mit Mona Richtung Kindergarten auf. Nach meiner Rückkehr frühstückten meine Frau und ich gemeinsam. Anschließend fuhr ich ins Kommissariat.«
»Was macht Ihre Frau beruflich?«
»Meine Frau promoviert. Sie will Anwältin werden.«
»Hat sie auch einen Migrationshintergrund?«
»Nein. Sie ist blond und hat blaue Augen. Man könnte sie eher für eine Schwedin halten.«
»Wie ging es nach dem Frühstück weiter?«
»Im Kommissariat war das gesamte K33 versammelt. Insgesamt sechs Leute und unser Dienststellenleiter, Herr Ballmann. Die Ergebnisse der Gerichtsmedizin waren bereits eingetroffen. Es stellte sich heraus, dass das Sperma in allen drei Körperöffnungen tatsächlich von demselben Mann stammte. Er hatte offenbar zuerst in ihren Anus ejakuliert, anschließend in ihre Vagina und zum Schluss in ihren Rachen – das schloss der Gerichtsmediziner aus der abnehmenden Qualität und Menge der Spermien und Samenflüssigkeit. Währenddessen war sie immer wieder geschlagen worden, auf das Gesäß, die Scheide, die Brüste, ins Gesicht und sogar in den Magen. Der Todeszeitpunkt wurde auf 22:40 festgelegt. Karin Schirgel von der Erkennung hatte Fingerabdrücke und ein Foto der Toten durch die Datenbanken von Kriminalpolizei, BKA und Europol geschickt – ohne Ergebnis. Sie war vermutlich Linkshänderin, weil die Muskulatur am linken Arm und der Hand stärker ausgebildet war. Anus und Mastdarm der Leiche waren außergewöhnlich sauber. Einer unserer älteren Kollegen, Polizeikommissar Jens Lauterbach, meinte diesbezüglich, dass sogenannte Sklavinnen in der BDSM-Szene vor dem Geschlechtsverkehr oft ein Klistier mit warmem Wasser erhalten, damit der Darm frei von Exkrementen ist und weniger Infektionsgefahr droht. Er sagte, sie sei vermutlich eine sogenannte ›Dreilochstute‹ gewesen, eine Sklavin, die, wie er erläuterte, in alle ›Löcher begehbar‹ war. Er schien viel darüber zu wissen. Da er einer der dienstältesten Polizisten im K33 ist, ging ich davon aus, dass er aus beruflicher Erfahrung sprach. Es wurde eine Sonderkommission mit der Bezeichnung ›Edinburger 34‹ gegründet. Der Vorschlag für diesen Namen kam von Herrn West, und Ballmann war einverstanden. Aus anderen Fachkommissariaten wurden Leute bestimmt, die uns bei Bedarf unterstützen sollten. Jan West und ich wurden zum Tatort zurückgeschickt. Wir sollten im gesamten Häuserblock die Bewohner befragen, ob ihnen etwas aufgefallen war. Während der Fahrt erzählte mir West von einem Mord im Jahr zuvor. Ein Rocker hatte seine Frau vor den Augen der gemeinsamen Kinder erstochen, weil sie sich scheiden lassen wollte. Eine klare Angelegenheit, und doch hatten sich die Ermittlungen hingezogen. Er sagte, ich solle mich auf eine lange Soko einstellen. Am Tatort angekommen, beschlossen wir, uns im Uhrzeigersinn vorzuarbeiten. Wir begannen mit den Nummern 33 und 35. Beide Häuser, der Neubau und der Altbau auf der anderen Seite der Lücke, gehören zum Paul Gerhardt Stift mit Hauptsitz in der Müllerstraße auf der Süd-West-Seite des Häuserblocks – also genau gegenüber. Die dort ansässigen Senioren gehören zu den Hauptnutzern der Grünanlage. Obwohl wir über die Verwaltung zu allen Bewohnern leichten Zugang erhielten, stellten wir bald fest, dass die meisten von ihnen vom Leben nicht mehr so viel mitbekamen. Einige der Rüstigeren begannen wieder, von den Ausländern zu sprechen, aber keiner war zur fraglichen Zeit in der Grünanlage gewesen, da die meisten zu diesem Zeitpunkt längst geschlafen hatten oder vor dem Fernseher saßen. Nach einer halben Stunde waren wir durch. Ohne Ergebnis.«
»Waren Sie frustriert?«
»Das gehört zum Job. Routine. Wir gingen zum nächsten Haus, klingelten die Bewohner heraus und baten um ihre Mithilfe. Die meisten Leute wollen gern helfen, selbst wenn sie nichts mitbekommen haben. Manche reimen sich auch was zusammen. Andere betrachten uns als Feinde – je nach politischem Hintergrund. Man lernt, damit umzugehen.«
»Fanden Sie etwas heraus?«
»Am Ende der Türkenstraße, kurz vor der Müllerstraße, machten uns die Hausbewohner auf eine Wohnung im vierten Stockwerk aufmerksam, aus der häufig Schreie einer Frau und Gebrüll eines Mannes drangen. Herr und Frau Kramm. Man erzählte uns, auch in der Tatnacht sei es laut gewesen. Da keiner der Kramms auf unser Läuten reagierte, begaben wir uns zur Wohnungstür, klopften an und forderten die Kramms auf, die Tür zu öffnen. Nach kurzer Zeit erschien ein Mann Mitte dreißig, mittelgroß, von eher schmächtiger Statur. Er trug eine Hornbrille, sein Haar war schütter. Keine auffälligen Merkmale. Wir befragten ihn zunächst routinemäßig. Er behauptete, nichts gesehen oder gehört zu haben. Anschließend wollten wir mit seiner Frau reden. Er druckste herum und meinte dann, sie sei krank. Obwohl er nach konventionellen Maßstäben eigentlich zu jung war – die Tote war ja schätzungsweise dreißig Jahre älter als er –, machte ihn seine Nervosität verdächtig. Da wir keinen Durchsuchungsbefehl hatten, konnten wir die Wohnung nicht betreten. Herr West sagte zu ihm: ›Herr Kramm, wenn Sie uns nicht mit Ihrer Frau sprechen lassen, müssen wir Sie zum Verhör auf die Wache mitnehmen.‹ Das schien ihm Angst zu machen. Er stotterte herum, sie könne vielleicht doch schon aufstehen und rief dann nach hinten gewandt: ›Schatz, komm mal bitte!‹ Sein Tonfall wirkte aufgesetzt. Nach einer Weile näherte sich eine Frau im hellblauen Morgenmantel aus einem der hinteren Zimmer. Sie war klein und schmal gebaut, trug eine Sonnenbrille und war notdürftig geschminkt. Man sah, dass beide Augen blau und dick geschwollen waren. Auch der Rest des Gesichts wies Spuren von Gewalteinwirkung auf. Auf die Frage, ob ihr etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei, schüttelte Frau Kramm den Kopf und erwiderte, alles sei normal gewesen. Mein Kollege fragte sie daraufhin, wo sich ihr Mann zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt befunden habe.«
»Warum tat er das, wenn er es bereits wusste?«
»Ich nehme an, er wollte Herrn Kramm unter Druck setzen. Die Frage zeigte tatsächlich Wirkung: Kramm blickte erkennbar nervös zu seiner Frau. Vielleicht befürchtete er, dass sie ihm etwas anhängen könnte. Frau Kramm bestätigte allerdings, dass sich ihr Mann zum Tatzeitpunkt bei ihr in der Wohnung aufgehalten und sie gemeinsam Fernsehen geschaut hätten. Mein Kollege sagte daraufhin: ›Frau Kramm, Ihre Nachbarn haben ausgesagt, dass Ihr Mann Sie regelmäßig schlägt. Nach dem Zustand Ihres Gesichts zu urteilen, entspricht das der Wahrheit. Möchten Sie ihn wegen Körperverletzung anzeigen? Wir können Sie jetzt gleich mitnehmen und an einen sicheren Ort bringen‹. Sie blieb einen Moment lang stumm und schüttelte anschließend den Kopf.«
»Und Sie konnten nichts tun?«
»Uns sind in Fällen wie diesem die Hände gebunden. Sie ist volljährig. Wenn sie sich die Misshandlungen gefallen lässt, können wir nichts unternehmen.«
»War das nicht frustrierend für Sie?«
»Frustration kann ich mir nicht leisten. Es geht hier um Gewaltenteilung.«
»Wie meinen Sie das?«
»Wenn ich als Polizist anfange, das Verhalten der Bürger zu beurteilen, hebe ich de facto die Gewaltenteilung auf. Ich mache mich zum Richter. Der Staat funktioniert aber nur, solange die Exekutive nicht damit beginnt, die Kompetenzen der Judikative auszuüben. Das erfordert Disziplin. Dafür wurden wir ausgebildet.«
»Da haben Sie den sogenannten Reichsbürgern ja schon einiges voraus. Es wäre aber ganz unnatürlich, wenn es Ihnen tatsächlich gelänge, in einer solchen Situation keine Gefühle zu haben. Sie sagen doch selbst, dass Sie Polizist geworden sind, um Menschen zu beschützen. Was, wenn das eindeutige Opfer Ihren Schutz ablehnt? Müssen Sie sich dann nicht von sich selbst abspalten?«
»Wenn Sie es so nennen wollen. Gehört halt zum Job.«
»Was geschah danach?«
»Im Haupthaus des Paul Gerhardt Stifts informierte uns ein Mitarbeiter darüber, dass eine ihrer Tragen fehlte. Wir inspizierten deshalb die vorrätigen Tragen und stellten fest, dass sie baugleich mit der Trage waren, auf der die Tote gelegen hatte. Mein Kollege meldete das umgehend im K. Anschließend fuhren wir in eines unserer Stammrestaurants in der Nähe der Direktion 3, um etwas zu essen. Es war inzwischen 14 Uhr.«
»Nahm Jan West den Zwischenfall mit den Kramms auch so diszipliniert hin wie Sie?«
»Das weiß ich nicht. Er äußerte sich nicht dazu. Ich hatte keinen Anlass, etwas anderes zu vermuten. Er war, wie gesagt, erfahrener als ich.«
»Sprachen Sie nicht miteinander über Ihre Einsätze?«
»Doch. Aber wir waren hungrig und brauchten eine Pause. Wenn ich mich korrekt erinnere, redeten wir beim Essen überhaupt nicht.«
»Herr Ballmann sagte mir, Sie und Herr West hätten sich auch außerhalb der Dienstzeit getroffen.«
»Korrekt. Manchmal kam er zu uns nach Hause.«
»Wie lief das ab?«
»Normal. Wir aßen gemeinsam, unterhielten uns, manchmal spielte er mit den Kindern. Dann ging er wieder.«
»Worüber unterhielten Sie sich, als er das letzte Mal bei Ihnen war?«
»Das letzte Mal? Das war zwei Wochen vor der Tatnacht.«
»An Silvester?«
»An Neujahr. Wir machten eine Spazierfahrt, Herr West, meine Frau, unsere Kinder und ich. Nach Fergitz. Dort gibt es ein Feriengut. Wir hatten einen Pavillon gemietet.«
»Was unternahmen Sie dort?«
»Das Übliche: Schlitten fahren, wandern, essen, etwas trinken.«
»Okay. Geschah noch etwas von Bedeutung an diesem ersten Ermittlungstag?«
»Die fehlende Trage war ein erster wichtiger Hinweis. Man konnte davon ausgehen, dass der oder die Täter sich über das Haupthaus des Paul Gerhardt Stifts Zugang zur Grünanlage verschafft hatten. Der Mitarbeiter konnte allerdings keine Angaben darüber machen, seit wann diese Trage verschwunden war, da die Bestände halbjährlich kontrolliert werden, zu Jahresbeginn und im Sommer. Sie konnte in der Tatnacht entwendet worden sein oder Wochen beziehungsweise Monate zuvor. Solche Dinge sind wichtig bei der Erarbeitung eines Tathergangs. In jedem Fall mussten die Täter genau gewusst haben, dass diese Tragen existierten und wo sie sich befanden. Es gab also eine Verbindung zum Paul Gerhardt Stift. Unsere Arbeit bestand im Folgenden darin, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter genauer unter die Lupe zu nehmen.«
»Gut, Herr Malik. Bis hierher. Sollen wir einen Termin für nächste Woche vereinbaren?«
»Kein Problem.«
Zweites Gespräch
»Wie war Ihre Woche?«
»Ich dachte, wir hätten einen Deal!«
»Ich verstehe nicht.«
»Zwei Tage, nachdem ich bei Ihnen war, zitierte Ballmann mich in sein Büro und teilte mir mit, dass ich bis auf Weiteres beurlaubt bin. Er hatte davor mit Ihnen telefoniert!«
»Aber ich habe mich an unsere Verabredung gehalten. Ich weiß nicht, warum er so entschieden hat.«
»Was haben Sie ihm erzählt?«
»Genau das, was ich Ihnen gesagt hatte: Dass die Arbeit stabilisierend auf Sie wirkt.«
»Verdammt!«
»Was denken Sie, Herr Malik?«
»Dass er genau das nicht will!«
»Und warum sollte er wollen, dass Sie aus dem Gleichgewicht geraten?«
»Es muss wegen der Soko West sein.«
»Davon haben Sie mir bislang nichts erzählt.«
»Nach West wird gefahndet. Er ist nicht einfach verschwunden. Er ist dringend tatverdächtig. Und ich werde von Lauterbach und Richter, dem neuen Mitarbeiter, beschattet.«
»Weil Sie wissen, wo er ist?«
»Weil die denken, dass ich es weiß. Das Ganze ist bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Ballmann hat mir mit einem internen Verfahren gedroht, falls sich herausstellt, dass ich West decke. Das ist alles so …«
»Tun Sie es denn? Decken Sie West?«
»Alles, was ich sage, bleibt unter uns?«
»Nun ja. Wenn Sie einen Mörder decken, dann … ich bin kein Beichtvater, Herr Malik, bitte verstehen Sie. Es gibt Grenzen.«
»Nein. Ich weiß nicht, wo West steckt.«
»Okay. Wollen Sie dann einfach da weitermachen, wo Sie letzte Woche aufgehört haben?«
»Das hat doch jetzt gar keinen Sinn mehr! Ich bin beurlaubt, der Chef will, dass ich die Nerven verliere, weil er hofft, dass ich dann auspacke. Warum sollte ich also nicht einfach aufstehen und gehen, nennen Sie mir einen Grund?«
»Ich nenne Ihnen zwei, Herr Malik. Erstens: Wenn Sie jetzt aufhören, könnte Ihr Chef denken, dass Sie aus taktischen Gründen zu mir gekommen sind. Den posttraumatischen Stress, den ich Ihnen während meines Telefonats mit ihm bescheinigt habe, wird er Ihnen dann vielleicht nicht mehr abkaufen. Und zweitens: Wenn Sie keine Arbeit mehr haben, die Sie stützen kann, dann schlage ich vor, dass wir uns ab jetzt zweimal pro Woche treffen, damit Sie auf diese Weise eine Routine beibehalten, die nur Sie betrifft – nicht Ihre Arbeit oder Ihre Familie. Auch das kann positiv wirken. Außerdem: Wer weiß, vielleicht fällt Ihnen ja beim Erzählen irgendetwas auf, was Ihnen bisher entgangen ist. Ist das nicht auch der Grund, weshalb die Polizei ihre Verhöre so oft wiederholt?«
Stille.
»West und ich ließen uns vom Paul Gerhardt Stift Einsicht in die Personalakten der vorangegangenen vier Jahre geben. Das Torschloss im Hauptgebäude war vier Jahre zuvor ausgetauscht worden, deshalb gingen wir davon aus, dass nur dieser Zeitraum relevant war. Der oder die Täter hätten auch durch ein anderes Tor eindringen können, doch da der Mitarbeiter des Stifts die Trage vom Tatort eindeutig als diejenige identifiziert hatte, die in seinem Bestand fehlte, folgten wir erst einmal der These, dass das auch etwas über den Zugangsort zur Grünanlage verriet. Diese Annahme war zu dem Zeitpunkt das Beste, was wir hatten. Die Recherche ergab nichts Verdächtiges: Leute, die aufgehört hatten, andere, die neu eingestellt worden waren. Eine ziemliche Fluktuation insgesamt. Viele jüngere Frauen aus Osteuropa oder Asien. Was uns jedoch auffiel, war der Umstand, dass ausgerechnet der Mitarbeiter, der uns auf das Fehlen der Trage aufmerksam gemacht hatte, als einziger seit zwanzig Jahren dort arbeitete. Er war Anfang sechzig. Wir scherzten, dass er gar nicht den Ort wechseln musste, wenn man ihn pensionierte. Aber er wirkte nicht wie einer, der in den Sechzigern ist. Eher wie Anfang fünfzig. Ein großer Typ, breit gebaut, muskulös. Einer, der sich fit hielt. Hatte ein paar Tattoos an den Unterarmen und am Hals. Die Haare schwarz – vielleicht gefärbt. Ganz kurz geschoren. War aber eher der umgängliche Typ. Er besaß natürlich einen Schlüssel zum Gebäude. Hätte nicht mal durch das Tor gemusst. Wir recherchierten und fanden heraus, dass er in Neukölln wohnte. Also fuhren wir hin. Die Fahrt mit dem PKW dauert ungefähr fünfzig Minuten, nachts vermutlich zehn bis fünfzehn Minuten weniger. Seine Wohnung lag in einer kleinen Seitenstraße der Karl-Marx-Straße, in einem Mietshaus aus den 1920er Jahren. Ziemlich vernachlässigt. Der Putz schmutzig braun – war offenbar schon lange nicht mehr erneuert worden. Unser Mann hieß Walter Kunau, vierter Stock. Er war der einzige deutsche Mieter, die übrigen Parteien hatten afrikanische, arabische oder türkische Namen. Wir läuteten. Die Gegensprechanlage funktionierte nicht, die Tür wurde einfach geöffnet. Es war ziemlich laut im Flur, eine Menge Kinderstimmen, aber auch Erwachsene. Im Erdgeschoss gab es eine buddhistische Gemeinde, dort war es still. Kein Fahrstuhl, eine ziemlich steile, enge Holztreppe, die instabil wirkte. Oben erwartete uns eine ältere Frau – etwa Anfang fünfzig. Sie war unauffällig gekleidet – bis auf ein breites, schwarzes Lederband mit Eisenbeschlägen, das sie um den Hals trug. Es wirkte wie ein Hundehalsband. Sie klärte uns darüber auf, dass Kunau erst spät abends zurück sein würde. Wir fragten sie, ob wir uns in der Wohnung umschauen durften. Sie antwortete, sie sei nicht die Besitzerin. In einem solchen Fall dürfen wir natürlich nicht in die Privatsphäre eindringen. Wie gesagt: ohne Durchsuchungsbefehl … Wir verabschiedeten uns. Auf dem Weg nach unten machte West mich auf ein Tattoo aufmerksam, das sie auf dem rechten Handrücken getragen hatte. Im Auto malte er es mir auf: Ein ›W‹ und ein ›K‹, die ineinander verschlungen waren. Es musste sich um Kunaus Initialen handeln. Zurück im Kommissariat klärte Lauterbach uns darüber auf, dass sogenannte ›Master‹ oder ›Doms‹ – von ›dominant‹ – ihre Sklaven oft auf diese Weise markierten, um sie als ihr Eigentum auszuweisen. Auch dieser … Brauch wies also auf die BDSM-Szene hin. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell eine heiße Spur geben würde. Zu dem Zeitpunkt hatte ja noch nicht einmal die Identität des Opfers festgestellt werden können, obwohl Karin Schirgel sämtliche aktuellen Vermisstenmeldungen überprüft hatte. Niemand schien das Fehlen der Toten bemerkt zu haben. Das deutete entweder darauf hin, dass sie keine Familie hatte, oder dass der Kontakt zur Familie schon seit Längerem abgebrochen war.«
»Ließen Sie Kunau verhaften?«
»Dafür reichte es nicht aus. Es gab bislang nur Verdachtsmomente. Außer dem hatte uns ausgerechnet Kunau auf das Fehlen der Trage aufmerksam gemacht. Das ergab zunächst keinen Sinn.«
Stille.
»Wir suchten ihn im Stift auf. Er war freundlich wie immer, aber ich hatte den Eindruck, er wusste, dass wir bei ihm zu Hause gewesen waren. Schien uns erwartet zu haben. Wir fragten ihn nach der Tatnacht. Er behauptete, er hätte sich zu Hause aufgehalten. West erzählte ihm dann von unserem Besuch bei seiner Frau. Daraufhin lächelte Kunau und erwiderte: ›Sie ist nicht meine Frau. Sie ist meine Sklavin.‹ Das war überraschend. ›Sie geben also zu, dass Sie BDSM praktizieren?‹, fragte West ihn. Kunau zuckte mit den Schultern. Sagte: ›Das ist mein Lifestyle, und der ist nicht verboten.‹«
»Lifestyle? So nannte er das?«
»Ja. Das ist wohl auch ein typischer Begriff aus der Szene, wie wir später von Lauterbach erfuhren.«
»Dieser Lauterbach scheint ja wirklich ein Faible dafür zu haben. Was ist das für einer?«
»Der Lauterbach? Sehr erfahren, kennt sich in vielen Bereichen aus. Ballmann verlässt sich zu hundert Prozent auf ihn.«
»Und menschlich?«
»Hm. Ich persönlich habe wenig Kontakt zu ihm gehabt. Er nennt mich ›internationale Brigade‹, wohl wegen meiner Herkunft. Verhält sich aber insgesamt korrekt.«
»Was verstehen Sie unter ›korrekt‹ in diesem Fall?«
»Bis auf diese eine Äußerung … kein Grund zur Beschwerde.«
»Und diese eine Äußerung?«
»Kann ich nicht sagen. Ist vermutlich sein Sinn für Humor.«
»Und Ihr Kollege, wie kam der mit Lauterbach klar?«
»West und Lauterbach mögen sich nicht besonders, oder West mag Lauterbach nicht. Ich weiß es nicht genau – aus solchen Sachen halte ich mich möglichst heraus.«
»Okay. Wie ging es weiter mit Kunau?«
»West klärte ihn darüber auf, die Tote habe allem Anschein nach ebenfalls zur Berliner BDSM