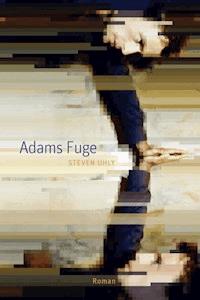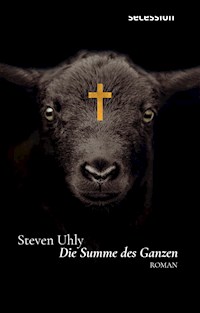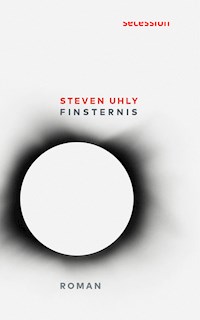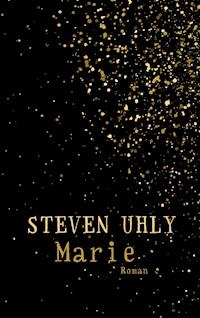Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag für Literatur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dunkle, regenreiche Nacht im Herbst 1944: Der Laut eines Schusses jagt durch die Gassen einer kleinen Stadt in Polen, abgefeuert von einer Jüdin auf einen SS-Sturmbannführer, 37 Jahre alt. Tags darauf werden 37 Menschen öffentlich hingerichtet. Willkür und Widerstand sind gleichermaßen Teil der gewaltigen Anfangszenen des Romans, der mit großer emotionaler Kraft einen Erzählbogen von den letzten Kriegsmonaten bis in die jüngste Vergangenheit spannt. Königreich der Dämmerung berichtet vom Leben einer jüdischen Flüchtlingsgruppe, von einer umgesiedelten Bauernfamilie aus der Bukowina, von den ungeheueren Lebensumständen der Entwurzelten in den Camps für »Displaced Persons« und verwebt dabei Weltpolitik und den Lebenswillen der häufig im Untergrund agierenden Menschen zu einer bislang nicht erzählten Wirklichkeit der Jahre nach 1945. Steven Uhly bettet das Schicksal dieser Menschen in die historischen Ereignisse. Ihre Wahrheitssuche, in der sich die Frage nach Schuld und Erbe spiegelt, führt aus dem Grauen der Vernichtung in den zupackenden Mut einer neuen Generation. Diese Geschichten sind es, die Königreich der Dämmerung zu einem zeitgenössischen historischen Roman über die Kraft des Lebens und der Veränderung machen. Steven Uhly ist mit seiner ebenso präzisen wie poetisch facettenreichen Sprache stets nah an den Menschen und zieht uns in den Bann mit einer Leuchtkraft, die unsere eigenen verborgenen Wahrheiten spüren lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 920
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steven Uhly
Königreichder Dämmerung
Roman
secessionVERLAG FÜR LITERATUR
Steven Uhly
Königreichder Dämmerung
Roman
secessionVERLAG FÜR LITERATUR
Erste Auflage
© 2014 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Patrick Schär
www.secession-verlag.com
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere
Künstlerisches Motiv: Ransome Stanley
Gesetzt aus 9/13 Cordale regular/italic
Printed in Germany
ISBN 978-3-905951-41-7 (Buchausgabe)
ISBN 978-3-905951-42-4 (E-Book)
Mein Dank gilt:
Tsvi
Anat
Lilach
Israel (Izi)
Christian
Joachim
Achi
Avner
Naomi
Helmut
Nili
Matej
Helga
Walter
Hanno
Georg
Klaudia
Michel
Carsten
Für Ricarda
(1938)
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern.
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
Jochen Klepper
(1903–1942)
EINS
Er war einem hageren kleinen Mann in abgetragener Kleidung gefolgt, der niederträchtig genug schien, ein paar seiner Landsleute zu verraten. Sie verstecken sich in der Kirche, hatte der Pole mit breitem Akzent gesagt, und er hatte erwidert, Aber in der Kirche haben wir jeden Winkel durchsucht, dort war niemand. Der Pole sagte nichts weiter, zuckte nur mit den Schultern, als wolle er sagen, Es ist nicht meine Schuld, dass ihr sie nicht gefunden habt. Er wusste, dass der Deutsche ihm folgen würde, ganz gleich, ob er vermutete, der Pole wolle ihn in die Irre führen, ihn ein wenig hinhalten, um selbst am Leben zu bleiben, oder sonst irgendeine kleine Gemeinheit begehen. Der Deutsche würde ihm folgen, weil Aussicht auf noch mehr Juden bestand, vielleicht sogar Frauen, von Frauen hatte der kleine Mann vage gesprochen, wie um seine Verheißung nicht allzu marktschreierisch feilzubieten. Und er hatte recht gehabt. Der Deutsche folgte ihm durch die verwinkelten Gässchen, achtete nicht auf den Regen, der fein und unablässig wie ein kaltes, seidenes Tuch auf die Stadt fiel und allem einen silbergrauen Glanz verlieh, den geduckten schiefen Häuschen, die schmal waren und so dicht gedrängt standen, als wäre ihnen immerzu kalt. Die steilen Schieferdächer glänzten wie flüssiges Pech, und das unebene Straßenpflaster war schlüpfrig. Der Pole trug alte, ausgetretene Halbschuhe, seine Schritte erzeugten nur ein dumpfes Reiben auf den Steinen, das vom harten Klopfen der ihm folgenden Militärstiefel übertönt wurde. Der Deutsche schritt mit der Selbstverständlichkeit eines Unantastbaren an den lauernden Fenstern vorbei. Überall verwehrten ergraute Vorhänge und verschlossene Fensterläden den Einblick in das Innere, aber er wusste, dass der Klang seiner Schritte von unzähligen Ohren verfolgt wurde, deren Besitzer schweigend verharrten, als könne sie die Bewegungslosigkeit vor seinem Zugriff retten. Er genoss das Gefühl der Macht, und noch mehr genoss er die Gewohnheit dieses Genusses. Zwei Jahre zuvor, als er nach Polen gekommen war, mit dem ersten wichtigen Auftrag seiner Karriere in der Tasche, hatte ihn die unvermittelte Bestätigung seiner Überlegenheit verwirrt und verunsichert. Er hatte kaum glauben können, dass die Besiegten wirklich so sehr und in jeder Beziehung unterlegen waren. Gleich am ersten Tag hatte ihn der Obersturmbannführer nach Turck mitgenommen, einer verwaschenen Stadt am Bug, einem schmalen, aber langen Flüsschen, das fünfzig Kilometer westlich in die Weichsel mündete. Wir werden ein Exempel statuieren, hatte der Obersturmbannführer gesagt, sein Name war Ranzner, ein großer, hartgesichtiger Mann, dessen schmaler Schädel von einer ledernen Haut bedeckt war, die im Alter keine tiefen Falten aufweisen würde, eher unzählige kleine Einschnitte an der Oberfläche, wie ausgetrocknete Flussläufe von den Schläfen zu den Augen und von den Mundwinkeln in alle Richtungen strebend. Vielleicht rührte die fehlende Tiefe seiner Gesichtszüge aus der Unbeweglichkeit seiner Mimik, vielleicht war sie rein physiologischen Ursprungs. Ranzner zeigte niemals öffentlich Genugtuung über einen Sieg oder eine Hinrichtung, und auch seine sonstigen Regungen wirkten alle seltsam gebremst, als spare er stets Kraft für einen entscheidenden Augenblick. Er sah sich als strengen Leitwolf, der mit unerbittlicher Disziplin über ein blutrünstiges Rudel herrschte. Die betonte Passivität seines Auftretens und die kleine, runde Intellektuellenbrille auf seiner Adlernase wirkten nur auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zur Maskenhaftigkeit seines Gesichts. In Wirklichkeit waren es genau die Komponenten, die sich jener zulegt, der weiß, dass ihm nicht zwei, sondern tausend Hände jederzeit zur Verfügung stehen, wofür auch immer, und so wirkte Ranzner nicht schrecklich oder furchteinflößend, sondern eher wie eine wandelnde Statue, eine Allegorie menschgewordener Macht, glaubwürdiger als der Reichsführer SS, mehr Himmler als Himmler selbst, als wäre Letzterer eine Kopie von diesem und nicht umgekehrt.
Sie waren in einem Kübelwagen mit offenem Verdeck über holprige Feldwege gefahren, in deren getrocknetem Schlamm die Spuren von Hufen, Stiefeln und Panzern zu einem chaotischen Relief erstarrt waren.
Vor ihnen zwei Reihen Motorräder, hinter ihnen zwei Reihen Motorräder. Die Sonne hatte geschienen und er hatte neben Ranzner im Fond geschwitzt und sich gefragt, was wohl geschehen würde. Der Obersturmbannführer hatte ihn sogleich mit jener unbesorgten Milde des Ranghöheren behandelt, in deren Obhut er groß geworden war und die er stets zu pflegen gewusst hatte. Vorgesetzte mochten ihn, und das hing nicht allein mit seinem Äußeren zusammen, seinem dicken strohblonden Haar, seinen perfekten arischen Gesichtszügen mit dem jungenhaften Blick. Sie fühlten auf Anhieb, dass er sie als das akzeptieren würde, was sie sein wollten, ganz gleich, was es war, und das beruhigte sie und weckte in ihnen etwas Väterliches. Während er aus den Augenwinkeln die sanft geschwungene Landschaft beobachtete, mit ihren reifen Feldern und den dunkelgrünen, saftigen Wäldern im Hintergrund, klärte Ranzner ihn im Plauderton über seine zukünftigen Aufgaben auf. Als Sturmbannführer würde er Ranzners Befehle in konkrete Ablaufpläne übersetzen.
»Sie werden Judenverstecke finden«, sagte er leichthin, als handele es sich um Waldbeeren, die es zu pflücken galt. »Wie Sie das machen, ist mir ganz gleich. Aber Sie müssen alle finden. Ein einziges Versteck, das Sie nicht finden, kann die Brut einer neuen Pest bergen, denken Sie immer daran.«
Ein einziges Versteck. Auch das wusste der schmächtige Pole, der vor ihm herging, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, um den Hals vor dem kalten Nieselregen zu schützen, die Revers seiner verschlissenen Lederjacke mit der linken Hand zusammenhaltend.
»Wir sind gleich da«, sagte er zu dem Deutschen, der ihn gleichgültig aus seiner arischen Höhe ansah, wie man einen vorbeihuschenden Hund betrachtet. Dieser Pole war das notwendige Mittel zu einem notwendigen Zweck. Nicht mehr und nicht weniger. Er würde alles tun, um am Leben zu bleiben, jetzt gleich, hier zwischen den lauschenden Häusern, vor den blinden, triefenden Fenstern, die doch voller Augen und Ohren waren, konnte er ihm den Befehl geben, die Hosen herunterzulassen und zu masturbieren, und er würde es tun. So wie damals, im ersten Kriegsjahr, die Juden von Turck singend durch die Bänke ihrer Synagoge krochen, während man ihnen die nackten Gesäße peitschte, so wie der Jude, der sich vor Angst in die Hosen gemacht hatte, den anderen Juden seinen Kot ins Gesicht schmierte. Weil er den Befehl erhalten hatte, weil in der Ausführung selbst des perversesten Befehls die Verheißung des Lebens enthalten war wie eine verschlüsselte Botschaft, die nur der Empfänger verstand. Scheinbar teilnahmslos hatte Ranzner den Ekel und die Faszination im Antlitz seines neuen Sturmbannführers registriert, hatte ihm kurz auf die Schulter geklopft, wie um ihn wieder zu sich zu bringen, während die Juden mit ihren kotverschmierten Gesichtern und ihren blutigen Ärschen unter dem Gelächter ihrer Peiniger Ringelreihen tanzten und dann kurzerhand niedergestochen wurden.
»Warum erschießt man sie nicht?«, hatte er Ranzner gefragt, als sie nur noch übereinander gesunkene Leiber inmitten einer sich allmählich ausbreitenden roten Pfütze waren.
»Zu laut hier drinnen«, hatte Ranzner knapp geantwortet, »ist nicht gut für das Trommelfell.« Dann hatten sie die Synagoge verlassen, damit sie angezündet werden konnte. Fern in seinem Innern hatte er damals eine Stimme vernommen, die darauf bestand, dass hier etwas Ungeheuerliches geschehen war, eine zutiefst erschrockene Stimme, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gehört hatte. Aber anders als in seiner Kindheit gelang es ihm jetzt, in Turck, diese Stimme der Angst und der Schwäche niederzukämpfen mit jener Stimme, die er sich im Laufe der Jahre angeeignet hatte wie ein Gegengift, das man heimlich jemandem entwendet hat.
Er hatte gelernt, sein Leben lang hatte er gelernt, ein Mann zu sein. Jetzt wollte er seiner Aufgabe gewachsen sein, kein anderer Wunsch durfte Platz haben in seinem Herzen, und er begriff, dass Ranzner ihn nicht zufällig mitgenommen hatte. Das Exempel hatte ihm gegolten, war nichts als eine Inszenierung für einen einzigen Zuschauer gewesen, damit dieser gleich zu Beginn erkannte, auf welcher Bühne er hier stand.
Es regnete jetzt stärker, aus der kalten Seide war unverhofft ein schwerer Vorhang geworden, der die Sicht behinderte. Die Gasse war hier noch enger geworden, und die Häuser schienen sich vornüber zu lehnen, um einander an den Giebeln zu berühren. Die Gegend wirkte noch ärmer, die Häuser waren in einem verwahrlosten Zustand. Zwischen den Pflastersteinen war Schlamm hervorgequollen, der an manchen Stellen zäh fließende Pfützen bildete, so dass sie an die Hauswand ausweichen mussten. Zum ersten Mal seit sie aus dem Lager losgegangen waren, hatte er das Gefühl von Leichtsinn. Der Pole vor ihm war zu einem dunkelgrauen Schemen geworden, zu einem Kobold, der ihn durch eine Stadt führte, die sich nicht mehr über, sondern unter der Erdoberfläche befand. Während er weiter durch die enge Gasse ging, tadelte er sich für seine unmännlichen Gefühle. Sie waren höchstens zwei Minuten gegangen, sie mussten jeden Moment zur Kirche gelangen. Leise, damit der Pole vor ihm nichts bemerkte, zog er seine Pistole aus dem Halfter an seiner rechten Hüfte. Das schwere Gewicht der Waffe in seiner Hand war wie ein Anker, den er in die Wirklichkeit warf, damit die Angst ihn nicht abtrieb. Er war ein großer starker Arier, geboren, über andere Völker zu herrschen, und mit einer Waffe in der Hand würde ihn nichts und niemand besiegen. Der Pole blieb stehen, wandte sich halb zu seinem Begleiter und streckte mit einer kurzen kraftlosen Bewegung den Arm aus. Zu ihrer Rechten gab eine leicht abschüssige Gasse den Blick auf eine kleine Kirche frei. Wie alle anderen Gebäude in dieser Stadt war auch sie so klein und stämmig gebaut, wirkte so niedrig und in sich kauernd, als presse sie sich an die Erde, anstatt auf ihr zu stehen. In dem kurzen, breiten Turm gab es genau zwei Glocken, eine kleine und eine mittelgroße, er hatte sie bei der ersten Durchsuchung gesehen.
Die Gasse war höchstens zehn Meter lang. Schlammiges Wasser rann über das Pflaster nach unten. Der Deutsche atmete auf, die Kirche war eine Orientierungsboje im verwirrenden Geflecht der Altstadt. Ohne es zu bemerken, vertraute er dem Polen ein wenig mehr, und als sie die kurze Gasse betraten, ging er nicht mehr hinter, sondern neben ihm. Zur Linken öffnete sich eine kleine, knarrende Haustür. Eine junge Frau trat heraus. Sie trug einen langen, schweren Rock, der einmal rot gewesen sein mochte, jetzt aber ein blasses Grau-Rosa aufwies. Kopf und Oberkörper waren in schwarze Tücher gehüllt, wie viele, konnte man unmöglich sagen, es schienen unendlich viele zu sein, denn ihre Körperformen verschwammen vollständig unter der Kleidung. Allein ihr Gesicht war zu sehen, ein hübsches, längliches Gesicht mit schmaler Nase und vollen, ebenmäßig geschwungenen Lippen, die eigentümlich bebten. Ihre braunen Augen waren länglich geformt und standen ein klein wenig schräg, was ihr ein orientalisches Aussehen verlieh. Sie sah ihn intensiv an, während sie auf ihn zukam. Aus der Haustür drang ein Duft von frischem Brot. Der Pole blieb stehen und wies mit einer weiteren kraftlosen Armbewegung auf die Frau, die jetzt vor ihnen stand.
»Das ist Margarita Ejzenstain.«
Seine Stimme verriet keine Gefühle, sie war so gleichgültig, als stelle er zwei Menschen, die ihm nichts bedeuteten, einander vor. Unter einem der vielen schwarzen Tücher von Margarita Ejzenstain erschienen zwei Hände, die sich um einen unwahrscheinlichen Revolver klammerten. Er sah so alt aus, dass der Deutsche noch dachte, er müsse aus dem letzten Jahrhundert stammen. Als sie mit beiden Daumen den Hahn spannte, verzog sie das Gesicht zu einer Grimasse, und der Deutsche dachte noch, die Waffe müsse recht schwergängig sein. Die Pistole in seiner eigenen Hand hatte er vollkommen vergessen, spürte nicht mehr ihr Gewicht, nur noch das Gewicht in den Händen des Mädchens, er entschied, sie müsse fast noch ein Mädchen sein, so jung sah sie aus, als sie die Stirn runzelte, während ihre beiden Zeigefinger mühsam den Abzug betätigten. Als der Schuss donnernd an seine Trommelfelle fuhr und dann wie ein wildes Tier durch die Gassen jagte, wurde der Deutsche nach links herumgerissen und stand jetzt genau vor dem Polen. Er wollte die Pistole hochreißen und den Polen töten, aber stattdessen fiel sein Arm herab und gaben seine Finger die Pistole frei, die mit einem scheppernden Geräusch auf das Pflaster schlug. Er dachte noch, dass es nichts mache, weil er sie ohnehin nicht entsichert hatte. Ein zweiter Schuss donnerte an seine Ohren und riss ihn von den Füßen, zuerst gegen die Hauswand hinter ihm, dann auf das kalte, nasse Pflaster. Er lag auf dem Rücken und sah, wie sich der Pole und das Mädchen über ihn beugten. Der Pole bückte sich und hob die Pistole auf. Er sah ihm dabei zu, wie er sie entsicherte und mehrmals auf ihn abfeuerte. Jetzt erschien erneut das Gesicht des Mädchens vor ihm. Ihre schönen vollen Lippen bebten immer noch, und Regen oder Tränen liefen ihr über die Wangen. Er sah ihr dabei zu, wie sie etwas sagte, das er nicht verstand, wie sie die Lippen schürzte und ihm ins Gesicht spie, wie der Pole sie hochriss und davonzerrte. Das Letzte, was er sah, waren unendlich viele Regentropfen, die durch den dunkelgrauen Spalt zwischen zwei schwarzen Giebeln direkt auf ihn herabfielen, immer weiter, bis der Spalt schwarz wurde und die Tropfen weiß, als betrachte man das Negativ eines Fotos oder als drücke man die Handflächen fest auf die geschlossenen Augenlider. Er roch noch den Duft von frischem Brot und fühlte noch die Kälte, die sich in seinem Körper ausbreitete, leise und schnell wie eine Armee im Dunkeln.
ZWEI
Als man ihn fand, waren seine Augen starr in den Himmel gerichtet. Der Regen hatte ihn durchnässt, und dunkelroter, sandiger Schlamm hatte sich von unten an seiner schwarzen Uniform festgesaugt. Sein Blut floss gemeinsam mit dem Regenwasser zur Kirche hin, und statt des Brotduftes hing ein schwerer Geruch nach Exkrementen und Eisen in der Gasse. Bald brachten sie einen alten Holzkarren, einen Einachser, den zwei Polen zogen. Die Polen schoben das Gefährt von der Kirche her die Gasse hinauf, bis sie bei ihm angelangt waren. Dann hoben sie ihn hoch und legten ihn auf die nassen Bretter. Danach trieben zwei SS-Männer, ein stämmiger Ungar, der kaum Deutsch sprach, und ein schmächtiger Bayer, den niemand verstand, sie mit Stockhieben zum Hauptquartier. Es wurde langsam dunkel, doch der Regen hatte nicht nachgelassen. Diesmal nahmen sie den direkten Weg von der Kirche zum Rathausplatz.
Es war ein hübscher viereckiger Platz, der schon bessere Tage gesehen hatte. Bis auf das Rathaus standen auch hier verputzte Fachwerkhäuser dicht an dicht gedrängt. Das Rathaus dagegen war großzügig gebaut, ein Stilgemisch aus nordischer Renaissance und Bauernhaus, wie man es in dieser Gegend häufig bei öffentlichen Gebäuden antraf. Es wirkte ein wenig wie ein Eindringling, der sich breitgemacht hatte. Vor der Freitreppe hielten die beiden Polen entkräftet und mit schmerzenden Rücken den Karren an. Weitere Hiebe bedeuteten ihnen, den Sturmbannführer herunterzuheben und in das Gebäude zu tragen. Auf der Treppe rutschte einer von ihnen aus, der Tote entglitt seinen Händen und schlug schwer mit dem Kopf auf den Stein. Der Bayer erlitt einen Wutanfall und prügelte den Polen bewusstlos. Er blieb auf der Treppe liegen, während die beiden SS-Männer dem anderen Polen halfen, den Sturmbannführer ins Rathaus zu tragen.
Obersturmbannführer Ranzner hatte bereits von der Ermordung seines Untergebenen erfahren. Aus diesem Anlass würde er die Truppe am nächsten Morgen auf dem Platz zum Appell antreten lassen und eine Rede halten. Er zählte das Halten von Reden zu einer seiner vielen Stärken. Jetzt aber, als die drei Männer den nassen und schmutzigen Körper hereintrugen, als er den Geruch nach Blut und Erde, nach Kot und Feuchtigkeit durch die Nase einsog, fühlte er einen leichten Ekel in sich aufsteigen. Er hatte es zu seinem Privileg gemacht, gefallenen Offizieren eigenhändig die Augen zu schließen, denn, so pflegte er auf seine distanzierte Art zu sagen, sie alle waren wie seine eigenen Söhne. Aber es kostete ihn jedes Mal Überwindung. Wenn sie tot waren, hörten sie auf, etwas zu sein, waren sie nur noch eine düstere Ermahnung des Nichts an das Leben, ohne Stolz und Würde, sinnloses Fleisch, das schon jetzt stank, er wusste nie, wonach, es war wie Gummi, wie manche Frauen, eigenartig.
Die SS-Männer scheuchten den Polen hinaus und legten den Toten im Vestibül nieder. Arcimboldo-Imitate aus der Tschechei hingen an den Wänden, eine zierliche Jugendstil-Kommode stand unter einem von ihnen. Es zeigte ein Gesicht, das ganz aus Gemüse bestand und einen schwarzen Helm auf dem Kopf trug, der ein wenig an eine Suppenschüssel erinnerte. Diese und einige andere Stücke waren auf Ranzners Befehl eigens aus Deutschland hergebracht worden. Sie sollten dieser Untermenschenarchitektur, wie er sie nannte, eine zivilisierte Atmosphäre verleihen. Ranzner trat zu dem Toten. Er beugte sich mit ausgestreckten Beinen leicht über das blasse Gesicht des Sturmbannführers, die Arme auf dem Rücken verschränkt, und blickte ihm in die toten Augen.
»Minsns siam Schuss, Obastuambannfiahra!«, bellte der Bayer, als habe man ihn um einen Rapport gebeten. Die Anwesenheit der beiden machte Ranzner nervös.
»Warten Sie vor der Tür, bis ich Sie rufe!«
»Zu Befehl, Obersturmbannführer!«, riefen sie. Dann schlugen sie die Hacken zusammen, streckten ihre Brüste vor und machten auf dem Absatz kehrt.
Als sie draußen waren, kniete Ranzner nieder, überwand das Ekelgefühl und blickte dem Toten aus nächster Nähe in die Augen. Wie ein Dieb vor der Tat blickte er sich im Vestibül um, dann streckte er die Hand aus, führte sie direkt vor den Augen des Toten zwei-, dreimal hin und her und beobachtete ihn gespannt. Als nichts geschah, beugte er sich noch weiter nach unten und flüsterte dem Leichnam ins Ohr:
»Treitz? Sturmbannführer Treitz? Karl Treitz, sind Sie noch da? Wenn Sie noch da sind, befehle ich Ihnen, mir ein Zeichen zu geben. Haben Sie gehört?« Er blickte ihm wieder in die Augen, und genau in diesem Moment glaubte er, ein kurzes Glimmen in der linken Pupille zu sehen. War es möglich? Er hatte dieses Glimmen schon bei anderen Toten gesehen, doch er war nie sicher gewesen, ob es nicht ein Produkt seiner Einbildung war. Er beugte sich wieder zu Treitz’ Ohr.
»Sturmbannführer, ich erteile Ihnen hiermit den Befehl, Ihre Mörder zu suchen und zu stellen. Vergessen Sie es nicht, vergessen Sie nichts!«
Nachdem Ranzner eine Weile vergeblich auf ein weiteres Zeichen gewartet hatte, streifte er sich einen schwarzen Lederhandschuh über und schloss dem Sturmbannführer die Augen. Er erhob sich, setzte einen distanzierten Ausdruck des Bedauerns auf und rief die SS-Männer herein. Als sie den Leichnam hochhoben, zuckte sein rechter Arm in einer kurzen, wilden Bewegung, die sofort wieder erstarb. Die SS-Männer kümmerten sich nicht darum, zu oft hatten sie solche und andere Phänomene bei Toten beobachtet. Ranzner aber wandte sich ab, damit sie seine Überraschung und Genugtuung nicht bemerkten. Das musste ein Zeichen gewesen sein. Der rechte Arm! Zweifellos hatte Treitz versucht, zum Abschied den Deutschen Gruß zu machen. Hatte der Reichsführer SS also tatsächlich recht? In diesem Augenblick traf Ranzner zwei Entscheidungen: Am nächsten Morgen würde er in der Gasse, in welcher Treitz ermordet worden war, siebenunddreißig Polen erschießen lassen, einen für jedes Lebensjahr des Sturmbannführers. Er wollte kein Massaker, nur einen symbolischen Akt. Außerdem würde er noch diese Nacht eine Rede einstudieren. Er rief Anna, seine Haushälterin, damit sie den Schmutzfleck im Vestibül beseitigte.
Anna Stirnweiss war eine junge, auffallend große und schmale Erscheinung. Ranzner hatte sie zwei Jahre zuvor bei einer Judenverladung im Berliner Ostbahnhof gesehen. Seitdem war sie sein Mädchen für alles. Annas Gesicht wäre schön gewesen, hätte es nicht irgendwann einen Ausdruck unsäglicher Lebensmüdigkeit angenommen, als wäre ihr nicht nur der zerbeulte Wassereimer zu schwer oder der Abzieher mit dem dunkelgrauen Putzlappen, sondern auch ihre zerschlissenen Schuhe, die viel zu groß für ihre zierlichen Füße sein mussten, und ihre Schultern, die nach vorn gewölbt waren, als wollte sie ihre Brüste abschirmen, und schließlich der Kopf, den sie immerzu hängen ließ, als wäre er selbst ohne ihre frühere Haarpracht zu schwer für den zerbrechlich wirkenden Hals. Ranzner hatte durchaus etwas für Anna übrig. Er verbot sich jedoch jeden Gedanken, der zu weit ging, denn er war sich seiner Höherwertigkeit sehr bewusst.
Er beobachtete sie, während sie auf die Knie ging und den blutgefärbten Schlamm abwusch, das Wasser, das dem Toten entronnen war, die Erinnerung an den Ekel, den er verursacht hatte, den Ekel und die Hoffnung. Ranzner sah, wie sich Annas Gesäß unter ihrem schwarzen Rock abzeichnete. Unter seiner Spannhaut zuckte kurz die Backenmuskulatur, dann wandte er sich um und verließ das Vestibül durch eine große hölzerne Flügeltür, deren einziger Schmuck zwei runde Türknäufe aus Messing waren. Dahinter öffnete sich ein großzügiges Treppenhaus mit einer überraschend weißen Marmortreppe. Sie hatte am Fuß die gleiche halbovale Form wie die Freitreppe vor dem Gebäude, doch nach zehn oder elf Stufen teilte sie sich in eine linke und eine rechte Treppe, die auf eine Galerie führten. Auch hier hingen erbeutete Bilder aus der Prager Renaissance zwischen hohen, gotisch anmutenden Fenstern und standen Biedermeiermöbel aus Deutschland ein wenig verloren an den Wänden. Das gesamte Treppenhaus war dunkel getäfelt und wirkte eher behäbig mit seinen klobigen Steinsäulen. Hier hatte ganz offensichtlich mehr als eine Epoche gebaut, und es wirkte ein wenig, als hätte jeder neue Stil gegen seine Vorgänger aufbegehrt. Das Ergebnis bestätigte auf eigenartige Weise das Provinzhafte des Rathauses.
Mit der Selbstverständlichkeit eines Königs stieg Ranzner die Stufen hinauf, wählte die linke Treppe zur Galerie und begab sich auf die rückwärtige Seite. Seine Gemächer befanden sich genau über dem Vestibül.
DREI
Anna stand in ihrer Kammer und zog die Schürze aus. Sie schaute in den Spiegel, ein nacktes, altes Ding, das ohne Rahmen an der Wand hing, voller blinder Flecken, ein Riss zog sich von unten hoch, der jetzt mitten durch ihr Gesicht ging. Anna schaute sich an, so dass der Riss ihre Nase entlangwanderte und zwischen ihren Augen hindurch zur Stirn. Ranzner hatte sie rufen lassen, Fritz, sein Adjutant, hatte einfach die Tür aufgerissen, sie genüsslich von oben bis unten angeschaut und ihr knapp verkündet, Der Häuptling will dich sehen, beeil dich. Sie hatte ihren Rock angezogen, während Fritz noch in der Tür stand und schaute, dann hatte er übertrieben laut geseufzt und war gegangen, ohne die Tür zu schließen.
Der Riss war ganz fein. Und doch gab es eine kleine Verschiebung zwischen den Gesichtshälften. Genau dort, wo ihr rechtes Auge war, befand sich ein runder schwarzer Fleck. Anna konzentrierte sich darauf. Sie musste jetzt das Spiel spielen. Ranzners Spiel, denn er hatte es erfunden. Nur wusste er nicht, dass sie auf ihre Weise mitspielte. Ich werde jetzt das Spiel spielen, sagte sie zu dem Gesicht im Spiegel und versuchte, ihren müden Augen etwas Entschlossenes zu verleihen.
Sie drehte sich um und stieß dabei leicht gegen das Bettgestell. Ihre Kammer war so klein, dass sie vom Bett fast vollständig ausgefüllt wurde, ein altes Ungetüm aus Eisen, mit hohem Kopf- und Fußende und einer durchgelegenen Strohmatratze. In der Kammer gab es kein Fenster. Sie lag in einem Seitenflügel des Rathauses und musste einst als Abstellkammer gedient haben. Oder als Vorratsraum. Anna hatte gelernt, auf diese äußeren Umstände ihres Lebens als Rechtlose nicht weiter zu achten.
Sie durfte Ranzner nicht zu lange warten lassen. Sie hatte sich länger vorbereiten wollen, aber sie wusste auch, dass ihr Spiel nur funktionierte, wenn der Druck groß genug war. Also verließ sie ihre Kammer und ging durch einen langen, schmalen Flur auf eine weitere Tür zu. Dahinter lag das große Treppenhaus. Anna ging langsam, als messe sie jeden ihrer Schritte genau. Von draußen hörte man das tiefe Brummen eines Dieselmotors im Leerlauf. Anna konzentrierte sich. Das Spiel hatte begonnen. Sie war die Untermenschin. Sie ging die Treppe hinauf, wählte, am Absatz angekommen, den rechten Aufgang und stand bald darauf vor der Tür. Sie klopfte an – Herein! – und öffnete. Dort stand er schon, Obersturmbannführer Josef Ranzner, in seiner allwöchentlichen Lieblingsrolle, er trug seine graue Uniform und sah sie aus seinem Indianergesicht ausdruckslos an. Sie, die Untermenschin, zuckte zusammen unter diesem Blick. Das tat sie jedes Mal, ganz wie eine Hure, die stöhnt, als käme es ihr, damit es ihrem Kunden kommt. Ranzner war ihr Kunde. Sie wusste, was ihn aufgeilte. Angst. Wie bei einer Hure, so gab es auch tief in ihr eine andere Frau, die unerreichbar war und alles beobachtete, was geschah, berechnend, nur auf den Lohn schielend. Diese Frau hatte einen geheimen Namen, und ihr Lohn war Leben. Und noch tiefer verborgen, das hatte Anna erst vor kurzem mit Erleichterung und Schrecken entdeckt, gab es ein kleines Mädchen, das von all dem nichts mitbekam. Es saß auf einer Wiese und pflückte Blumen und lächelte selbstvergessen. Es war fünf Jahre alt und wusste noch nicht, dass ihre Mutter ihr an diesem Tag sagen würde, Dein Vater kommt nicht mehr wieder, wir müssen jetzt allein zurechtkommen. Der letzte glückliche Tag in Annas Leben. Eines Tages würde sie diesen Tag wiederholen, sie würde sich auf die Wiese ihres Heimatdorfes in Brandenburg setzen und Blumen pflücken und alles wäre wieder gut, der Vater wäre nie fortgegangen und drei Jahre später zurückgekehrt mit jener Fremdheit im Gesicht, die sie nicht mehr vergessen sollte. Die Mutter hätte nie sagen müssen, Jetzt bist du angekommen, als hätte es ihre Familie zuvor gar nicht gegeben. Der Riss im Spiegel wäre der Riss im Spiegel, sonst nichts.
»Setz dich dorthin, Anna!«, sagte Ranzner und wies auf einen Stuhl, der in der Mitte des Raumes stand. Dann stellte er sich hinter sie und fasste sie sanft an den Schultern. Die Hure zuckte unterwürfig zusammen, die geheime Frau schätzte die Lage ab. Das Mädchen hielt inne und wartete.
»Weißt du, was geschieht, wenn einer von euch einen unserer Soldaten ermordet?«
»Nein, nein, ich weiß es nicht.«
»Oh doch, du weißt es. Du weißt, dass ich dann wütend werde und viele von euch hinrichten lasse, denn einer von uns ist so viel wert wie siebenunddreißig von euch.«
»Siebenunddreißig?«
Ranzner lächelte überlegen.
»Siebenunddreißig Jahre war Sturmbannführer Treitz alt. Ich werde meinen Männern morgen verkünden, dass siebenunddreißig von euch sterben werden, und ich frage mich, ob du nicht mit den anderen unter einer Decke steckst.«
»Nein, bestimmt nicht.« Ranzner lächelte. Er steckte die Hände in die Hosentaschen und schlenderte um Anna herum.
»Was sollst du auch sonst sagen, Jüdin, dir steht das Wasser bis zum Hals.«
»Warum hassen Sie uns?«
»Ich hasse euch nicht, du kleiner Dummkopf. Ich habe euch nie gehasst. Wenn ich euch hassen würde, dann wäre deine Gegenwart mir unerträglich und ich hätte dich schon längst getötet. Weißt du, warum ich dich vielleicht töten lassen muss?«
»Nein.«
»Aus rein taktischen Gründen. Viele andere Offiziere haben auch Jüdinnen, Polinnen oder anderes Kroppzeug. Offiziell darf das natürlich niemand wissen, aber in Wahrheit wissen es alle. Die da oben«, er machte eine Bewegung mit dem rechten Zeigefinger, »drücken beide Augen zu, solange wir effizient arbeiten. Aber die Zeiten sind kritisch, meine Truppe ist nicht mehr die, die sie einmal war. Früher«, er blieb stehen und blickte durch ein hohes Fenster in die Nacht hinaus, »früher waren wir eine arische Armee, die Besten von allen. Gott, was habe ich Jünglinge gesehen in jenen Zeiten, groß, stark und schön, unerschrocken und klug. Wiedergeburten von Siegfried.« Er seufzte und wandte sich wieder zu Anna um. »Aber heute muss ich eine Horde Ausländer und Verbrecher dazu bewegen, gegen die Russen zu kämpfen. Glaubst du, das ist leicht?«
Anna wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte nie gesehen, dass Ranzner besonders viel arbeitete. Er ließ sich in der Gegend herumkutschieren, trank gerne Wein und Schnäpse und schlief morgens lange. Außerdem onanierte er sehr viel, Anna wusste es, denn sie wusch seine Kleidung.
»Antworte! Glaubst du, das ist leicht?«
»Nein.«
»Nein. Du hast recht, Anna. Es ist nicht leicht. Die Soldaten dort draußen«, er wies auf das Fenster, »kommen inzwischen aus Litauen, Schweden, Ungarn, Holland. Viele von ihnen verstehen weniger Deutsch als du, Anna.«
»Ich verstehe.«
»Wirklich? Ja, ich glaube, du verstehst sehr gut. Siehst du, wenn ich mit Ausländern, die selbst halbe Untermenschen sind, gegen Untermenschen kämpfe und auch noch eine Jüdin als Hausmädchen anstelle, dann können wir auch gleich aufhören, Leute umzubringen, und den ganzen Krieg vergessen. Meinst du nicht?«
»Ich weiß nicht.«
»Lüge mich nicht an, Anna, oder tu es so, dass ich es nicht bemerke. Natürlich wäre es dir am liebsten, wir würden alles einfach abbrechen, wie man ein Fußballspiel abbricht, weil es zu stark regnet. Aber so ist das nicht.« Ranzner machte eine Pause und ging zu seinem Schreibtisch. »Ich habe hier eine kleine Rede vorbereitet. Ich möchte, dass du sie dir anhörst. Morgen früh werde ich zu meinen Männern sprechen, und«, fügte er leiser hinzu, »wenigstens einer soll sie verstanden haben. Bist du bereit?«
Anna nickte. Ranzner stellte sich drei Meter von ihr entfernt auf und verharrte mit geschlossenen Augen. Er konzentrierte sich, er hörte das Zwitschern der Vögel, er sah die Dächer der Häuser, die feucht glänzten, er roch die frische Morgenluft und sah den Nebel aufsteigen, er blickte hinab auf seine Männer, die den Platz ausfüllten, es mochten dreitausend sein, so groß war seine Truppe inzwischen geworden, er blickte in die Gesichter und sah ihre arischen Züge, ausschließlich arische Züge, und er überließ sich einige Minuten diesem Anblick, während Anna dasaß und wartete und sich ihrerseits konzentrierte. Sie wusste, dass dies in Wahrheit keine Generalprobe für eine Rede war, das hatte Ranzner gar nicht nötig. Sie wusste längst, dass die Blätter, die er in der Hand hielt, irgendwelche Dokumente waren. In Wahrheit improvisierte Ranzner, in Wahrheit galten diese Reden nur ihr allein. Wie eine Hure spürte sie, dass ihr Freier sie insgeheim liebte, obwohl er vorgab, sie zu verachten. Und wie eine Hure zog sie die Verachtung vor, um seiner Liebe zu entgehen. Wenn er so mit geschlossenen Augen dastand, mit seiner langen, gebogenen Nase und seiner gespannten Haut, sah er beinahe wirklich aus wie ein Indianer, der in ein Ritual versunken war. Anna dachte daran, wie er ein paar Stunden zuvor im Vestibül neben dem toten Körper seines Sturmbannführers gehockt und mit ihm gesprochen hatte. Sie hatte ihn von der Treppe aus beobachtet.
»Männer!«, brüllte Ranzner plötzlich, und Anna zuckte zusammen. Er öffnete die Augen und starrte sie an, sein Gesicht hatte einen fiebrigen Ausdruck angenommen.
»Männer! Ihr alle wisst, weshalb wir hier sind.« Erneut machte er eine kleine Pause, lächelte dann und hob die Hände: »Wir sind auf einer Entlausungsaktion!«
Das war einer jener Witze, die Ranzner stets am Beginn seiner Reden machte. Er hatte ihr einmal erklärt, was es mit diesen Witzen auf sich hatte, sie dienten der Auflockerung der Gemüter. Seine Männer sollten spüren, dass er, Ranzner, niemals nervös war, ganz gleich wie nah die Russen waren. Anna hatte aufgehorcht: Die Russen waren nah. Ohne es zu wissen, hatte Ranzner ihrer Hoffnung Nahrung gegeben.
Jetzt aber hörten sie beide vor ihrem inneren Ohr, wie dreitausend raue Kehlen im Chor Laute ausstießen, kehlige und bewundernde und männliche, Ranzner hörte es in seiner Phantasie, und Anna hörte es in ihrer Phantasie, die sich Ranzners Phantasie vorstellte. »Aber wie Läuse nun einmal sind, verstecken sie sich überall zu dem einzigen Zweck, ihrer gerechten Ausrottung zu entgehen! Und manchmal, Freunde, fallen sie über einen von uns her, wenn er friedlich und unaufmerksam ist, denn das ist die einzige Art, wie sich Läuse trauen, über Menschen herzufallen!«
Anna hatte Ranzners Metaphorik nie besonders originell gefunden, aber er sah sie auf eine Art und Weise an, die ihr sagte, dass es ihm nicht um gute Vergleiche ging, sondern allein darum, sie zu treffen. Sie verstand und gehorchte. Sollte er sie doch getroffen sehen, wenn ihn das glücklich machte. Wie eine Hure verspürte sie irgendwo tief in sich nichts als Mitleid für ihren Freier. Mitleid und Abscheu.
Ranzner ließ seinen Blick schweifen.
»Die jüdischen Ratten haben einen der Edelsten in unseren Reihen barbarisch hingeschlachtet!«, brüllte er so laut, als gelte es, seine Wut durch die Wände hindurch hörbar zu machen. Dabei bohrte sich sein Blick in die besiegten Augen der Frau, die mit vorgezogenen Schultern vor ihm auf dem Stuhl kauerte. »Wir aber werden ein Exempel statuieren, um allen in dieser Stadt zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist, wer hier das Sagen hat, wer hier über Leben und Tod entscheidet!«
Eines Tages würde er sie wirklich mit anderen Gefangenen vor ein Exekutionskommando stellen lassen, das wusste Anna. Ein Mann, der sogar unfähig war, sie zu vergewaltigen, musste noch weitaus gefährlicher sein als einer, der seine Triebe ungehemmt auslebte. Manchmal wünschte sie sich, er würde sie nehmen, sie zu seiner Gespielin machen, wie andere Offiziere es mit ihren Mädchen taten. Es hätte eine körperliche, eine handfeste Abhängigkeit gegeben, auf die sie sich hätte verlassen können. Aber Ranzner war ein Gefangener seiner eigenen Ferne, das hatte sie inzwischen begriffen. Er würde sie eher töten lassen, als sich seine Liebe einzugestehen.
Ranzner strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und schüttelte drohend die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. Mit solchen Gesten hatte alles angefangen in Deutschland, in ihrem Deutschland, das sie vielleicht für immer verloren hatte. Die Wiese vor ihrem Dorf tauchte kurz auf, die Gänseblümchen, aber Anna durfte jetzt nicht abschweifen. Sie wischte das Bild weg.
»Wir werden nicht zulassen, dass irgendeiner glaubt, er könne Katz und Maus mit uns spielen. Wir wissen genau, dass der Jude nach wie vor der große Hetzer zur restlosen Zerstörung Deutschlands ist. Wo immer wir in der Welt Angriffe gegen Deutschland lesen, sind Juden ihre Fabrikanten! Gibt es denn einen Unrat, eine Schamlosigkeit in irgendeiner Form, vor allem des kulturellen Lebens, an der nicht wenigstens ein Jude beteiligt gewesen wäre? Sowie man nur vorsichtig in eine solche Geschwulst hineinschneidet, findet man, wie die Made im faulenden Leibe, oft ganz geblendet vom plötzlichen Lichte, ein Jüdlein! Deshalb, Männer, vergesst niemals den ureigensten Sinn unserer Mission: die restlose Germanisierung des Warthelandes. Dies ist unser heiliger Auftrag, damals wie heute!« Welch ein Widerspruch, dachte Anna, Die einzige, die ihn verstehen kann, ist eine Jüdin. Seinen Männern waren diese verqueren Ideen sicher längst gleichgültig geworden. Aus Gesprächen, die sie belauscht hatte, wusste sie, dass der Krieg härter wurde, Ranzner schickte seine Soldaten immer häufiger zur Unterstützung der Wehrmacht an die Ostfront. Wegen der hohen Verluste musste er ständig neue Leute rekrutieren. Aber das focht ihn nicht an. Während Anna die erschrockene Untermenschin spielte, war sie zugleich fasziniert und angewidert von Ranzners Kunst, sein Rathaus wie eine Filmkulisse zu bewohnen. Sie waren beide Schauspieler darin, Ranzner ebenso wie sie.
Und doch, irgendetwas war anders als gewöhnlich. Ranzner wirkte aufgeregt und ungeduldig, als sei ihm die Probe in Wahrheit lästig. Natürlich verriet sein Gesicht nichts dergleichen, es glühte, als wäre er wirklich der Fanatiker, für den er sich ausgab. Aber Anna hatte sich angewöhnt, auf die Füße des Häuptlings zu achten. Das konnte sie inzwischen aus den Augenwinkeln, ja, sogar ihre ängstliche Mimik nutzte sie, um Ranzner unbemerkt zu beobachten. Dabei kam sie sich manchmal wie ein Hund vor, der die Laune seines Herrchens auskundschaftet. Es lohnte sich, denn Ranzners Füße führten ein Eigenleben, das ihrem Besitzer verborgen blieb. Oder vielleicht waren sie eine Geheimsprache, in der er zu ihr sprach – nicht der große SS-Darsteller Ranzner, sondern der geheime Josef Ranzner, der sich gewiss irgendwo verborgen hielt, wie sie sich hinter der Untermenschin verbarg.
Die Sprache der Füße war leicht zu verstehen. Wann immer Ranzner von Gefühlen bewegt wurde, sah Anna es dort. War er ungeduldig, so wippte einer der beiden Füße oder vollführte schnelle Taktschläge auf dem Boden. Zweifelte er, so bewegten sie sich seitwärts über den Boden, nach links und wieder zurück nach rechts und wieder nach links, so lange, bis Ranzner zu einer Sicherheit gelangt war.
Heute vibrierte sein ganzes rechtes Bein unablässig, sogar wenn er sprach oder brüllte wie jetzt:
»Der von den Juden geleistete Widerstand kann nur durch energischen, unermüdlichen Tag- und Nachteinsatz unserer Stoßtrupps gebrochen werden. Äußerste Wachsamkeit ist geboten. Es geht um die totale Vernichtung der jüdischen Untermenschen, das kann nicht deutlich genug gesagt werden.« Und dann rief er noch lauter, so dass seine Stimme sich überschlug und heiser klang: »In treuer Waffenbrüderschaft werden wir unermüdlich an die Erfüllung unserer Aufgaben herangehen und stets beispielhaft und vorbildlich unseren Mann stehen! Sieg Heil!«
Dabei sah er sie aus seinen lauernden Augen an wie ein Wolf, der nach einer Gelegenheit suchte, sie anzufallen und aufzufressen. Und doch war heute etwas Flatterhaftes in diesem Blick, das auch ihn als Pose entlarvte. Anna erschrak jetzt wirklich. Manche Dinge wollte sie nicht sehen. Sie musste an den gnadenlosen Ranzner glauben können, um ihr Spiel zu spielen. Wann immer er es ihr zu leicht machte, hinter seine Fassade zu blicken, wurde die Angst plötzlich sehr greifbar. Wo war die Grenze? Wie viel musste man gesehen haben, um nicht mehr lügen zu können? Sicher, sie war darauf angewiesen, Ranzner gut einschätzen zu können. Aber gegen Ranzners unfreiwillige Ehrlichkeit konnte sie sich nicht wappnen, sie drang ungehindert zu ihr durch. Niemals, niemals durfte die schemenhafte Gestalt, die sich dort abzeichnete, klare Umrisse bekommen.
Ranzner hatte offenbar nichts bemerkt. Er brüllte weiter, während sein Blick ziellos im Raum wanderte, als gelte es, eine Heerschar in Bann zu halten. Er brüllte von dem vorbildlichen Leben des Sturmbannführers, von seinen arischen Tugenden, von dem großen Verlust für die SS, von seinen Vatergefühlen, vor allem aber von Rache. Er brüllte: »Wären die Juden auf dieser Welt allein, so würden sie ebenso sehr in Schmutz und Unrat ersticken, wie in hasserfülltem Kampfe sich gegenseitig zu übervorteilen und auszurotten versuchen, sofern nicht der sich in ihrer Feigheit ausdrückende restlose Mangel jedes Aufopferungssinnes auch hier den Kampf zum Theater werden ließe!«
Plötzlich war es zu Ende. Ranzner blickte Anna feierlich in die Augen und sagte:
»Sturmbannführer Karl Treitz war ein guter Kamerad, ein hervorragender Soldat und ein glühender Patriot! Wir werden ihn und seine solide Arbeit vermissen.«
Ranzner hielt inne. Er war unschlüssig. Einerseits hatte Treitz ihm ein untrügliches Zeichen gegeben. Andererseits hatte er sich von einem Juden in einen dummen Hinterhalt locken lassen. Das war nicht das Handeln eines Herrenmenschen. Am Ende hatte Treitz jüdische Vorfahren gehabt, und dann war es gut, dass er von seinesgleichen umgebracht worden war. Ranzner wusste, dass er diesem Gedanken nicht wirklich Glauben schenken durfte, denn dann würde sich jeder tote SS-Mann in einen Juden verwandeln, nur weil er tot war, und ihm selbst könnte Ähnliches widerfahren. Aber der Gedanke war da, er wusste nicht, warum.
Er blickte Anna an. Er musste noch etwas sagen:
»Sturmbannführer Treitz ist in Erfüllung seiner heiligen Pflicht gegenüber Volk und Führer als ein arischer Held gestorben, und mehr noch, als ein Held der SS, der rassischen Führung unseres geliebten Vaterlandes!«
Er machte wieder eine kurze Pause, blickte sich im Raum um wie jemand, der etwas sucht. Dann öffnete sich sein Mund und sagte: »Die Schwarze Sonne leuchtet dir heim, Karl Treitz, du wirst wiederkehren und Rache üben.«
In diesem Augenblick geschah etwas Seltsames. Anna selbst saß auf dem Stuhl, vor ihr stand Ranzner, sie waren allein im Raum. Fort war der Riss im Spiegel, fort die imaginäre Armee. Das Spiel war vorzeitig beendet. Sie war verwirrt. Sie beobachtete Ranzner. Sie fing Scham in seinen Augen auf. Das hatte sie noch nie gesehen, und einen Augenblick lang zweifelte sie an ihrer Wahrnehmung. In ihrem Kopf hallte es nach: ›Die Schwarze Sonne leuchtet dir heim.‹ Ranzner stand immer noch zögernd da, als wisse er nicht weiter. Schließlich wandte er sich ab und setzte sich hinter seinen schweren englischen Schreibtisch aus dem neunzehnten Jahrhundert. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, seine Kiefermuskeln arbeiteten, er war nervös. Anna wollte wegsehen, sie wollte nicht wahrnehmen, wie Ranzner um seine Fassung rang, die Gefahr, die von ihm ausging, war so greifbar, dass sie ihre Panik niederkämpfen musste. Aber sie rührte sich nicht, sie saß nur auf ihrem Stuhl und schaute ihn an wie eingefroren.
Ranzner fühlte sich nackt. Er wusste nicht, warum er die Schwarze Sonne erwähnt hatte, und noch weniger wusste er, warum er sich jetzt so schutzlos fühlte. Aber es war, als hätte er Anna Einblick in ein intimes Geheimnis gegeben. In Ranzners Rücken führte eine breite getäfelte Flügeltür mit rechteckigen Fensterkassetten auf die große Terrasse hinaus. Die Stadt lag in völliger Dunkelheit, die Straßenbeleuchtung war ausgeschaltet und die Fenster der Privathäuser waren verdunkelt.
»Weißt du, was die Schwarze Sonne ist, Anna?«, fragte Ranzner nach einer Weile, ohne das Mädchen anzusehen.
»Nein.«
»Die Schwarze Sonne«, sagte Ranzner gedehnt, wie jemand, der zu verstehen gibt, dass es sich um etwas Besonderes handelt. Aber Anna erkannte die verzweifelte Pose.
»Der Sturmbannführer, den ihr ermordet habt, er wird zurückkehren. Und er wird sich erinnern, an mich, an dich und an seine Mörder. Er wird sich rächen. Glaubst du das?«
»Nein.«
»Natürlich nicht, denn dann müsstest du einsehen, dass ihr uns niemals loswerdet.«
Anna blickte an Ranzner vorbei, als sei er nicht mehr im Raum. Sie wirkte jetzt wie ein Tier, das nach einem langen Winterschlaf zum ersten Mal die Augen öffnet. Langsam und mit tonloser Stimme sagte sie:
»Wenn wir alle zurückkehren, warum wollen die Deutschen uns vernichten?«
»Wer sagt denn, dass ihr alle …?«, gab Ranzner unwirsch zurück, unterbrach sich und stand auf. »Geh, die Probe ist vorbei!«
Anna erhob sich langsam und mechanisch, sie war jetzt wieder eine Schauspielerin in der Rolle des Hausmädchens. Sie verließ den Raum und schloss die Tür. Erst, als sie die Treppe hinunterstieg, um zu ihrer Kammer zu gelangen, begriff sie, was geschehen war: Ranzner hatte ihr seine Angst vor dem Tod gebeichtet und es dann bereut. Er musste sehr viel Angst vor dem Tod haben, wenn er sich an diese absurde Hoffnung klammerte. In Wahrheit, dachte sie, als sie im Vestibül auf die Tür zuging, die zu ihrer Kammer führte, Gibt es keine Übermenschen oder Untermenschen. In Wahrheit, dachte sie, Ist er nichts von dem, was er zu sein vorgibt, ist er kein Häuptling, sondern nur ein Mitmensch, der zu einem Gegenmenschen geworden ist aus unbekannten Gründen. Er hatte sie hintergangen, zwei Jahre lang hatte sie geglaubt, er sei wirklich der Unmensch, den nichts Normales rühren konnte, der keine Schwäche hatte, weil seine Härte ihn vor allem schützte. Ja, bei allem Gehabe und aller Wirklichkeitsferne, die Ranzner an den Tag legte, hatte sie doch stets an seine unbedingte Härte und Rücksichtslosigkeit geglaubt, und sie hatte gehofft, er sei konsequent genug, um dafür auch sie zu opfern, sobald sie ihn nicht mehr unterhielt. Das war die Grundlage ihres gemeinsamen Spiels gewesen und ihre Überlebensgarantie. Nun aber war es anders gekommen. Ranzner hatte ihre stille Übereinkunft gebrochen, weil er zu schwach war. Er war nichts als ein ängstlicher Schauspieler, der sich an das Leben klammerte, wie sie selbst sich an das Leben klammerte. Sie fühlte Enttäuschung, als sie die Tür zu ihrer Kammer öffnete. Enttäuschung und Angst, eine Angst, vor der sie sich nicht mehr würde schützen können.
Als Anna fort war, öffnete Ranzner die Tür zur Terrasse und trat hinaus. Die Terrasse befand sich genau über dem Portal des Rathauses, durch das ein paar Stunden zuvor sein toter Untergebener getragen worden war. Der Platz lag im Dunkeln, man hörte die regelmäßigen Schritte der Wachsoldaten, sonst nichts. Der Regen hatte endlich aufgehört. Nur in der Ferne erklang ab und zu ein Grollen wie aus den Tiefen der Unterwelt. Das war der Krieg, der langsam näherkam.
VIER
Kein Licht in der Dunkelheit.
Kein Gedanke an Licht.
Überhaupt kein Gedanke.
Eine Ewigkeit lang.
Als sie endlich zu Bewusstsein kam, war es zunächst nur ein Dämmern. Sie ließ sich treiben und fühlte sich fern von allem. Sie erinnerte sich. Er war tot. Erschossen von einer Frau. Margarita Ejzenstain. Polnische Jüdin. Untermensch. Sie. Welches Jahr? Sie wusste es nicht mehr. Wie lange lag sie schon hier? Diese Schmerzen, alles schmerzte, wenn sie noch länger so lag, würde sie einen Blutstau bekommen und ohnehin sterben. Sie musste hinaus, ans Licht, sich bewegen, frei sein, ganz gleich, was geschehen würde. Aber sie blieb reglos liegen und versuchte, wieder in das Nichts zu gelangen, aus dem sie erwacht war. Begraben, dachte sie, Lebendig begraben bin ich. Wenn sie jemals wieder herauskäme, wäre es wie eine Wiedergeburt. Nicht einmal, wenn die Kramers die Dielen anhoben, um ihr Essen zu bringen, nicht einmal, wenn sie selbst aufstand, um ihr Geschäft zu verrichten, sah sie das Tageslicht. Sie lag im Keller, direkt auf der harten Erde, die nur spärlich mit ein paar Decken ausgekleidet war. Feucht war es, und immer noch bestand Gefahr, dass der Bach über die Ufer trat. Dann würde es eine Überschwemmung geben und sie hätte kein Versteck mehr. Wie absurd, dass ausgerechnet Deutsche sie aufgenommen hatten, wo sie doch die Deutschen hasste. Sie wäre gern zu Polen gekommen, aber es fanden sich in der Eile keine, die eine Jüdin aufgenommen hätten. Als der Pfarrer gesagt hatte, es seien Deutsche, wollte sie sich weigern. Aber Piotr hatte gesagt, Was willst du, von Deutschen versteckt werden oder von Deutschen umgebracht werden, etwas anderes gibt es nicht. Da hatte sie sich gefügt.
Die Kramers hatten sie sehr freundlich aufgenommen, hatten sie von Anfang an behandelt wie eine Tochter. Vor allem Frau Kramer vermittelte ihr das Gefühl, willkommen zu sein. Das hatte sie nicht erwartet, es hatte ihre Ansichten über die Deutschen wie ein Kartenhaus zusammenfallen lassen, und sie fühlte sich desorientiert, ohne zu verstehen, warum ein Teil dieses Volkes sie töten wollte, während ein anderer sie beschützte. Anfangs fühlte sie sich, als hätte ihr jemand den Glauben an die Menschen zurückgegeben, doch nach und nach war sie wütend geworden. Denn jetzt waren die Deutschen keine unbarmherzige Rasse mehr, jetzt waren die Deutschen Menschen, die verrückt geworden waren und denen niemand Einhalt geboten hatte.
Die Kramers waren nicht aus dieser Gegend, sie waren verpflanzt worden, ohne zu wissen, worauf sie sich eingelassen hatten. Das Haus, ein Bauernhof mit ein paar Hektar Ackerland, hatte früher Polen gehört, die vertrieben, deportiert, umgebracht worden waren, wer wusste das schon? Man konnte es sich denken. Auch das Loch im Keller war von den Polen gegraben worden. Zwei Tage nachdem die Kramers eingezogen waren, stand plötzlich ein Mann in schmutziger Kleidung in der Stube und stellte sich als Adam Herschel vor, Lodzer Jude, von den Vorbesitzern versteckt. Die Kramers, hatte Frau Kramer ihr einmal erzählt, waren sprachlos gewesen, hatten sich dann aber schnell gefasst und Herrn Herschel so lange beherbergt, bis er eine Möglichkeit fand, an die Küste zu gelangen. Dort wollte er mit einem Schiff nach Schweden hinüber. Sie haben nie wieder etwas von ihm gehört.
Der Pfarrer hatte sich natürlich gemerkt, was geschehen war. So war sie, Margarita Ejzenstain, in das Loch gekommen, in dem sie jetzt schon seit vier Monaten lag. Wenn sie nicht schwanger wäre, alles wäre leichter. Sie hätte in Bewegung bleiben, sich vielleicht auch zur Küste durchschlagen können. Aber so. Frau Kramer kümmerte sich rührend um sie. Einmal am Tag machte sie sogar Gymnastik mit ihr, weil sie glaubte, das sei gut für Schwangere. Sie hatte selbst zwei Kinder zur Welt gebracht, einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge war an der Front gestorben, Operation Barbarossa, hatte Frau Kramer ihr erzählt, mit Bitterkeit in der Stimme und Tränen im Gesicht, die beide gar nicht zu ihrer Fröhlichkeit passten. Dann hatte sie die Tränen mit kurzen, heftigen Handbewegungen weggewischt, als wolle sie einen Spuk beenden, und sie angelächelt wie jemand, der um Verzeihung bittet.
Vielleicht hatten sie Margarita deshalb in ihrem Keller aufgenommen. Aus Rache für den gefallenen Sohn. Manchmal, in den langen Stunden, die sie untätig in der Dunkelheit ihres Verstecks verbrachte, dachte sie darüber nach. Dann stellte sie sich eine kaum wahrnehmbare Verbindung zwischen dem toten Kramersohn und sich selbst vor, wie ein feines Garn, das vielleicht an ihrer Seele befestigt war und sich durch die Spalten zwischen den Brettern über ihr aus dem Keller zog, zu den Fenstern, hinaus aufs Feld, durch Wälder hindurch und über Flüsse hinweg, grüne, leuchtende Wälder und kristallklare Flüsse, in denen Kinder schreiend badeten und das feine Garn nicht bemerkten, das über ihren Köpfen gespannt war oder vielleicht zu ihren Füßen am Grund des Flusses, wo es sich durch das Geröll zog, zum anderen Ufer hin und weiter, immer weiter, bis es zuletzt in der Erde verschwände, dort, wo der Kramersohn begraben läge, wenn er denn begraben lag. Margarita fragte sich häufig nach der Natur dieses Garns, aber sie fand keine andere Vorstellung, kein anderes Gefühl als Vergeltung.
Eigentlich konnten ihr die Gründe für die Barmherzigkeit der Kramers gleichgültig sein. Vielleicht hatten sie nur das Herz am rechten Fleck, vielleicht gab es ja wirklich gute Menschen, ganz unabhängig von ihrer Rasse. Wenn sie nur nicht so viel Zeit zum Grübeln hätte. Und zum Erinnern. Oft fielen die Bilder sie wie eine Horde wilder Tiere an, gegen die sie sich nicht wehren konnte, und je länger sie hinsah, desto stärker machte das Gefühl sich in ihr breit, jedes Bild sei eine eigene Wirklichkeit und ein anderes Leben gewesen. So zerfiel ihr die Vergangenheit, sie verlor ihren Zusammenhalt und wurde zu einer losen Sammlung von Eindrücken, die nicht mehr ihr zu gehören schienen. Tomasz. Die Hochzeitsreise nach Lodz. Tomasz’ erstes Auto. Seine Anstellung in Krakau. Tomasz hätte Karriere gemacht, das wusste sie. Und dann wären sie vielleicht nach Amerika ausgewandert, wie sein Bruder. Der Überfall. Tomasz war ganz ruhig gewesen, er hatte gesagt, Frankreich und England werden das nicht zulassen. Und zunächst schien er recht zu behalten. Aber dann kam Dünkirchen. Die Deutschen vertrieben die Engländer vom Festland und eroberten Frankreich. Wer sollte ihnen jetzt noch helfen? Tomasz war ratlos gewesen, zum ersten Mal hatte sie ihn verzweifelt gesehen. Es hatte geschmerzt. Sie wollte ihn trösten, aber es gab nichts, womit sie es hätte tun können. Ihre Eltern drängten zur Flucht. Aber es war zu spät gewesen, viel zu spät.
Sie wollte jetzt nicht daran denken, nicht schon wieder. Sie würde lernen, nicht zu denken, wenn dies notwendig war. Nicht denken, bis die Deutschen wieder fort sind. Wenn sie jemals wieder fortgingen. Wer die Gedanken müßig treiben lässt, vernachlässigt die Seele. Das hatte ihre Großmutter gesagt, wenn sie andere Leute beim Grübeln erwischte. Der Spruch ging noch weiter, am Ende hieß es, Sie alle verwirken ihr Leben – auch wenn sie leben, sind sie wie tot. Aber wie tot war sie ja jetzt schon, sie, die nach Berlin zu Onkel Max ziehen und Kunst studieren wollte, ausgerechnet nach Berlin. Von Onkel Max hatten sie bis 38 gehört. Seitdem nichts mehr, und schon damals munkelte man, es geschähen ungeheuerliche Dinge in Deutschland. Aber niemand wollte sie so recht glauben, Gerüchte wirken immer so übertrieben, dass man meint, man müsse zwei Drittel abziehen, um zur Wahrheit zu gelangen. Nun, diesmal war es umgekehrt gewesen, und wer hätte sie darüber informieren sollen? Das alles war fast wie eine Naturkatastrophe über sie hereingebrochen, auch die Deutschen wirkten, als gehorchten sie einem düsteren Schicksal, dessen langer Arm sich irgendwo aus der Vergangenheit ins Jetzt reckte und sie wie Marionetten führte. Dieser Deutsche, den sie getötet hatte. Er war in die Gasse gekommen wie ein Lamm zum Passahfest. Sie hatte hinter der Tür gewartet, wie vereinbart, hatte seine schweren Stiefel gehört und die leichteren Schritte von Piotr, der ihn in sein Verderben führte, zu ihr. Sie hatte die Tür geöffnet und zugesehen, wie die beiden Männer durch die Gasse auf sie zukamen, nebeneinander. Für jemanden, der nichts außer diesem Bild sah, hätten sie auch Freunde sein können. Und sie hätte eine gemeinsame Freundin sein können. Sie dachte oft an jene Augenblicke vor dem ersten Schuss aus dem uralten Revolver, den Piotr dem Pfarrer gestohlen hatte. Ein Museumsstück, der Pfarrer war stolz darauf gewesen, einen solchen Besitz zu hüten, und er hatte ihn gern jedem gezeigt, der ihn sehen wollte. Er bewahrte ihn in der Sakristei auf, direkt beim Wein und den Hostien, Wie passend, dachte Margarita. Von dort hatte Piotr ihn weggenommen, nachdem er gesehen hatte, was die Deutschen mit Tadeusz und einer Handvoll anderer Juden gemacht hatten. Er hatte gesagt, dieser eine Deutsche habe das Kommando gehabt. Ich bringe ihn dir, Margarita, das schwöre ich. Und er hatte ihn ihr gebracht. Wie lange war das jetzt her? Viereinhalb Monate? Ungefähr. Als sie in der Gasse beieinanderstanden wie gute Freunde, hatte sie die Augen des Deutschen gesehen. Böse Augen hatte sie erwartet, stattdessen blickte sie in blaue, unschuldige Kinderaugen. Darauf war sie nicht vorbereitet gewesen. Kinderaugen und Mörderhände, hatte sie gedacht und einen plötzlichen Ekel empfunden, als wäre der Deutsche ein glitschiges Monstrum, kein Mensch, eine Missgeburt, halb Embryo halb Gewaltverbrecher. Wie ungläubig er dreingeschaut hatte, als ihn der erste Schuss traf. Als hätte man ihm überraschend Heimaturlaub gegeben. Er hatte einen schönen Tod, er war erschossen worden und Schluss. Viel zu kurz, viel zu schmerzlos für das, was er mit Tadeusz gemacht hatte. Mit Tadeusz und den anderen.
Sie hörte Schritte auf der Steintreppe, die in den Keller führte. Sehr schnell erkannte sie Frau Kramer an ihrer Art, fast zögerlich die Stufen herabzusteigen, die typische Vorsicht einer älteren Frau, die von der Sicherheit der Jugend verlassen worden war oder sie vielleicht nie gekannt hatte. Die Kramers hatten ihr eingeschärft, niemals selbst die Dielen anzuheben. Wir müssen stets aufmerksam sein, wenn wir leben wollen, hatte Herr Kramer gesagt. Ohne Aufmerksamkeit gibt es kein Leben, hatte ihre Großmutter oft gemurmelt, wenn sie wieder einmal abwesend aus dem Fenster geblickt hatte, versunken in Erinnerungen an ihre ferne Jugend.
Margarita wartete auf den ersten Lichtspalt, der sie blendete, obwohl er von einer trüben Petroleumlampe kam, die Frau Kramer neben sich auf den Boden gestellt hatte, während sie die Dielenbretter anhob und zur Seite legte. Frau Kramer war eine kleine, stämmige Frau, die sehr gut in dieses niedrige Bauernhaus passte. Im trüben Licht der Funzel wirkte sie wie eine der herben Gestalten eines niederländischen Sittengemäldes. Das Lächeln ihrer schmalen Lippen entblößte große, weiße Zähne, die ein wenig unregelmäßig standen. Sie war sicher nie eine schöne Frau gewesen, aber sie strahlte eine unaufdringliche Wärme aus, die ihre Gegenwart angenehm machte. Margarita lächelte zurück und ließ sich aus dem Loch helfen. Sie war ganz steif vom langen Liegen, die Gelenke schmerzten und der Kreislauf kam nur langsam in Gang. Ihre Freude über die Befreiung aus dem Loch währte nur kurz. Der Keller war trostlos. Es gab keinen Putz an den Wänden, und die düstere Stimmung, die von den dunkelroten Ziegeln ausging, machte ihr erst recht bewusst, in welcher Lage sie sich befand. Die Einrichtung bestand aus Gerümpel, das wahllos im Raum verteilt war, alte Möbel und Gerätschaften, die von den polnischen Vorbesitzern zurückgelassen worden waren und für die jetzt niemand mehr Verwendung hatte. Auf einer Seite befanden sich zwei Oberlichter, die mit Holzbrettern vernagelt waren. An der gegenüberliegenden Wand standen grob gearbeitete Holzregale, in denen dicke Einmachgläser standen, die im Schein der Petroleumlampe in verschiedenen Farben glommen, dunkelrot, dunkelgelb, orange, grün. Vor den Regalen hingen drei oder vier Dauerwürste von der Decke herab. Der Keller war so niedrig, dass Margarita sich nicht vollständig aufrichten konnte. Sie war groß, Frau Kramer wirkte neben ihr wie ein Quader neben einem Obelisken. Hand in Hand machten sich die beiden Frauen auf einen langsamen Spaziergang durch den Keller, immer im Kreis, schweigend, Margarita mit gesenktem Kopf wie die Büßerin einer Prozession, Frau Kramer aufrecht und zuversichtlich, als wäre der Keller in Wirklichkeit ein besserer Ort. Nach einer Weile blieb Margarita stehen.
»Ich glaube, jetzt geht es.«
»Komm, Kind, setzen wir uns, vom Stehen verrenkst du dir nur den Nacken«, sagte Frau Kramer mit ihrer melodiösen Stimme. Sie gehörte zu den wenigen Menschen, die sich scheinbar immer genau auf der Grenze zwischen Sprechen und Singen befinden.
Margarita dachte, dass sie in Wahrheit ein Vögelchen war, ein kleiner, dicker Spatz, der versuchte, ein Mensch zu sein, und sich doch durch seine Stimme verriet. Und durch sein freundliches Wesen. Sie setzten sich auf zwei kleine Schemel, die den polnischen Vorbesitzern gehört haben mussten. Erst jetzt bemerkte Margarita, dass Frau Kramer sie feierlich ansah. Sie sagte nichts und wartete.
»Ich habe gestern mit meinem Mann über dich gesprochen«, sagte sie mit ihrer Singstimme. »Es ist jetzt alles geklärt.«
Margarita sah sie fragend an. Sie verstand nur, dass Frau Kramer es sich nicht nehmen ließ, ein Ritual zu veranstalten, um ihr etwas Wichtiges mitzuteilen. Es musste etwas Gutes sein.
»Du bist eine junge, schöne Frau, die ein Kind erwartet. So jemand kann doch nicht in einem Erdloch liegen, wer weiß wie lange.« Sie rieb Margarita am Ärmel und lächelte aufmunternd. Dabei bildeten sich zwei kleine Grübchen in ihren Pausbacken.
»Wir haben beschlossen, dass du ab jetzt den ganzen Keller bewohnen sollst.«
Margarita erschrak.
»Aber wenn man mich findet! Dann sind wir alle verloren.«
»Sei still, Kind, sei still. Niemand wird dich finden, so Gott will. Die Barbaren können tun, was sie wollen, aber finden werden sie dich nicht.«
»Wenn ich nur so sicher sein könnte wie Sie, Frau Kramer.«
»Du musst sicher sein, Kind, du musst. Sonst schaffst du es nicht.«
Sie schwiegen. Frau Kramer tätschelte ihr immer noch den Arm und sah sie aufmunternd an. Margarita starrte vor sich hin. Bislang hatte sie in einem engen Erdloch gelegen, das in ein großes Erdloch gegraben worden war, in diesen dunklen Keller. Jetzt sollte sie nicht mehr doppelt, sondern nur noch einfach begraben sein. Die Kramers hatten wirklich ihren ganzen Mut zusammengenommen, um ihr ein solches Wagnis anzubieten. Aber sie hatten recht. Sie konnte nicht schwanger sein und immerzu auf kalter, feuchter Erde liegen. Das würde sie nicht überleben.
»Werde ich Licht haben?«
»Nur am Tage, das musst du verstehen.«
Sie verstand. Nachts konnte das Licht durch die Bretterfugen vor den Oberlichtern dringen und ihre Anwesenheit verraten. Licht zu haben, wäre beinahe wie eine Wiedergeburt. Zum ersten Mal seit langem spürte sie, wie Hoffnung in ihr aufkeimte. Eine seltsame Hoffnung. Als wäre diese Veränderung bereits Teil des Weges, den sie bis zu ihrer endgültigen Befreiung zurücklegen musste. Als könnte nicht plötzlich alles vorbei sein, sondern nur allmählich, als wären lange Dunkelheit und lange Gefangenschaft dasselbe und als könnte man ebenso wenig plötzlich frei sein, wie man plötzlich das Tageslicht ertrüge. Sie durchschaute den Mechanismus der Hoffnung so deutlich, dass sie glaubte, das entlarvte Gefühl müsste sich augenblicklich in Nichts auflösen, verschreckt wie ein scheues Tier. Aber es blieb. Sie lächelte.
»Gut. Es ist gut, wir werden es so machen. Ich danke Ihnen, Frau Kramer. Ihnen und Ihrem Mann.«
Frau Kramer umarmte sie jetzt überschwänglich, legte eine Hand auf ihren Bauch und rieb ein wenig ungeschickt darauf herum. Dann begann sie zu weinen.
»Es kann doch nicht Gottes Wille sein«, sagte sie nach einiger Zeit mit erstickter Stimme, »dass es kein neues Leben mehr geben darf. Das kann doch nicht sein.«
Margarita war nicht auf einen Gefühlsausbruch vorbereitet gewesen. Sie lauschte stumm der anderen Frau, als spiele diese eine lange nicht gehörte Melodie. Eine der Tränen, die Frau Kramer vergoss, während sie sich an Margarita klammerte, rollte aus ihrem rechten Auge die Wange hinab und fiel der jungen Frau auf den Hals. Margarita spürte diese kleine Stelle so intensiv, wie sie sonst nur ihre Rückenschmerzen wahrnahm. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich darauf. Die Stelle schien größer zu werden, je mehr Sekunden verstrichen. Sie bemerkte nicht, dass ihr selbst Tränen in den Augen standen. Es war, als gäbe es nur diese eine feuchte Stelle in ihrem Bewusstsein. Plötzlich hatte sie das starke Verlangen, den Geschmack von Frau Kramers Tränen im Mund zu spüren. Sie nahm ihr Gesicht in beide Hände, fühlte die zarte Haut auf ihren Handflächen und küsste sie auf die Augen. Fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Schmeckte das Salz. Frau Kramers Salz. Küsste sie wieder.
»Mütterchen, Mütterchen«, flüsterte sie. »Nicht weinen. Alles wird gut.«
FÜNF
»Mein liebes Kind. In Wirklichkeit ist die Erde hohl. Alles dies, was uns umgibt und was du bald schon sehen wirst, ist das tiefe Innere unseres Planeten.« Sie zeigte auf die Petroleumlampe, die vor ihr auf einem kleinen, klobigen Holztisch stand.