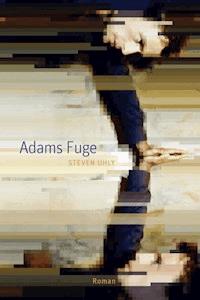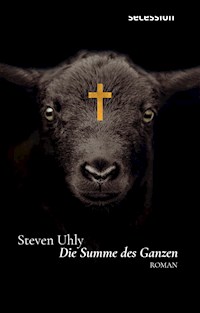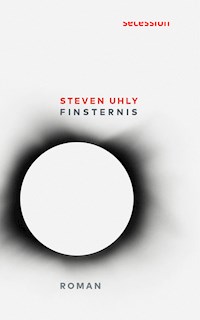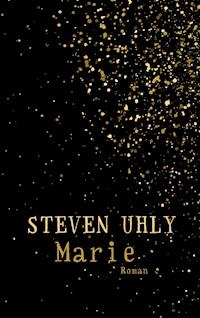17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dem Buchhändler Friedrich Keller wird von einem verwahrlosten Unbekannten ein Manuskript mit Gedichten zugespielt. Keller, neurotischer Einzelgänger und passionierter Kenner der Dichtkunst, beginnt eines Tages das Manuskript zu lesen und entdeckt bald, dass ihm ein Meisterwerk vorliegt. Geraume Zeit später erkennt er den Mann auf der Straße wieder und folgt ihm spontan in die derbe Welt einer Säufer- und Hurenkneipe, wo er das Gespräch mit dem Genie sucht. Die Begegnung bringt seine Welt ins Wanken. Als der Dichter eines Tages bei Keller zuhause aufkreuzt, gerät sie vollends aus den Fugen. Was war geschehen? Steven Uhly nutzt das Spiel von Dichtung und Wahrheit in so raffinierter Weise, dass man nicht zu entscheiden vermag, ob "Den blinden Göttern" Krimi, Burleske oder hermeneutische Deutung ist. Vor allem aber wird nicht klar, ob hier eine wahre Geschichte vorliegt oder aber die Persiflage einer solchen. Denn die Gedichte gibt es wirklich und sie sind – zumindest will es uns so scheinen – meisterhaft. Steven Uhly hat dem Verlag gegenüber diesbezüglich sehr widersprüchliche Äußerungen gemacht. Wir hatten daher kurzfristig in Erwägung gezogen, auf eine Veröffentlichung zu verzichten, da wir die Befürchtung hegten, in eine Grauzone zu geraten. Doch die außergewöhnliche Qualität beider Manuskripte – die Sonett-Sammlung und die ihr zur Seite gestellte Erzählung – ließ uns keine andere Wahl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
STEVEN UHLY
DenblindenGöttern
ROMAN
Erste Auflage
© 2018 by Secession Verlag für Literatur, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Kristina Wengorz
www.secession-verlag.com
Gestaltung und Satz:
Erik Spiekermann, Berlin
Herstellung:
Renate Stefan, Berlin
Druck und buchbinderische Verarbeitung:
Friedrich Pustet, Regensburg
Papier Innenteil: 100g Fly 05
Papier Vor- und Nachsatz: 115g Fly 05
Papier Überzug: 130g Munken Lynx
Gesetzt aus FF Meta & FF Mark
Printed in Germany
ISBN 978-3-906910-44-4
eISBN 978-3-906910-45-1
In memoriamRadi Zeiler
»and our little life is rounded with a sleep«
PROSPERO
Inhalt
Inseln der Verlorenheit
Im Sturm fauler Winde
Ein Kommen und Gehen
Die Liebe, ein Schicksalsspiel
Von größtem Gewicht
Das Rätsel der Lösung
Zur erfundenen Wirklichkeit
Als stünde alles still
Als wäre alles nicht
Aus dem Leim gegangen
Die Liebe, ein Wimmelbild
Ein Bad in hellstem Licht
Ein Sturz durch alle Zeit
Und jeder Tropfen aufgefangen
Inseln der Verlorenheit
Friedrich Keller überquerte die vierspurige Straße mit ihrer schmalen Verkehrsinsel in der Mitte, um auf der anderen Seite ein Lebensmittelgeschäft zu betreten. Er hatte ein trostloses Gefühl, das ihn in letzter Zeit des Öfteren überkam, sobald der Wecker ihm morgens unmissverständlich die erste Pflicht des Tages mitteilte, die darin bestand aufzuwachen, nachdem er einen ereignislosen Schlaf absolviert hatte, der seit einiger Zeit nichts als einen vagen Eindruck von Weiß in seinem Gedächtnis hinterließ, ein Phänomen, das er sich nicht erklären konnte. Er betrat das Geschäft, einen kleinen Supermarkt, den er seit vielen Jahren regelmäßig aufsuchte, um sich für zwei oder drei Tage zu versorgen. Hier kannte er jeden Gang, jedes Regal, jedes Produkt. Die Angestellten waren mürrisch und wortkarg, beides begrüßte er sehr, da er sich so der Illusion hingeben konnte, während des Einkaufs und vor allem an der Kasse keinem allzu menschlichen Kontakt ausgesetzt zu sein.
Nachdem er effizient eingekauft hatte – sämtliche Grundnahrungsmittel für das bevorstehende Wochenende, Spül- und Waschmittel, Mülltüten in unterschiedlichen Farben –, begab er sich auf dem kürzesten Weg zur Kasse und stellte sich in die Schlange der Wartenden. Er warf einen Blick nach rechts zu den Tages- und Wochenzeitungen. Sogleich fuhr ihn eine Schlagzeile an:
Krise außer Kontrolle!
Er blickte weg, als wäre nichts gewesen, doch die fett gedruckten Lettern hinterließen ein Echo in seinem Innern, das lange nachhallen sollte.
Auf dem Rückweg, der ihn über den zentralen Platz seines Wohnviertels führte, wo Busse, Autos, Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen sich gegenseitig nach den Regeln der Verkehrsordnung behinderten, begegnete er seiner Kollegin Irma Meyer, Abteilungsleiterin der Reiseliteratur im ersten Stock der Buchhandlung, in der sie beide arbeiteten. Irma war jung, attraktiv und ehrgeizig. Außerdem erinnerte sie ihn entfernt an jemanden aus seiner Jugend, ohne dass er sich Genaueres eingestehen mochte.
Sie entdeckte ihn von der gegenüberliegenden Straßenseite, wo sie stand und darauf wartete, dass die Fußgängerampel auf Grün umsprang. Als dies geschah und der dichte Strom der Autos jäh unterbrochen wurde, um eine Schneise für die Fußgänger freizugeben, gingen sie aufeinander zu und begegneten sich auf der schmalen Verkehrsinsel, auf der nur Unglückliche strandeten, meist alte Leute und Gehbehinderte. Trotz des kühlen Wetters trug Irma ein weißes, geblümtes Sommerkleid, das ihr um die schlanken Beine wehte, während sie mit einem hübschen Lächeln im Gesicht direkt vor ihm stehen blieb.
Keller versuchte vergeblich, ein freundliches Gefühl zu entwickeln. Irmas Gegenwart machte ihn verlegen, und diese Verlegenheit lehnte er nun schon seit zwei Jahren, fünf Monaten und zwölf Tagen kategorisch ab.
Im letzten Moment, bevor sie den Mund öffnen und etwas hätte sagen können, ergriff Keller gequält lächelnd die Flucht und überquerte mit hastigen kleinen Schritten die zweite Fahrbahn, wobei ihn die schweren Einkaufstüten arg behinderten. Er hatte sich zu spät in Bewegung gesetzt, denn bevor er die andere Seite erreichte, wurde er von den anfahrenden Autos mit hupendem Gezeter bedacht, bis er es endlich hinübergeschafft hatte.
Erst da blickte er sich um und sah Irma allein auf der von Autos umfluteten Verkehrsinsel stehen. Sie starrte ihm mit geöffnetem Mund nach. Wie eine Schiffbrüchige wirkte sie auf ihn, und er fühlte sich ein wenig schuldig, weil er sie allein zurückgelassen hatte. Bevor Mitgefühl daraus werden konnte, wandte er rasch seinen Blick ab und bog in die Seitenstraße ein, die ihn nach Hause führen würde.
»Passionierte Liebe ist eine unwahrscheinliche Institution«, murmelte er wie zum Abschied.
Als er sein dunkelblaues, mannshohes Gartentor von fern erblickte, fühlte er sich zum ersten Mal an diesem Morgen erleichtert. Als er den Schlüsselbund aus der Hosentasche gekramt, das Tor auf- und hinter sich wieder zugesperrt hatte, überkam ihn ein erhebendes Gefühl von Freiheit. Als ihn seine englischen Rosen mit ihren gefüllten Blüten grüßten, während er den schmalen, gepflasterten Weg zur Haustür beschritt, hörten sogar seine Handflächen auf zu schmerzen, und als er die Glastür aufgeschlossen, die fünf Stufen der sienarot gestrichenen Treppe erklommen, die massive graue Eichentür entsperrt und sein Haus betreten hatte, vergaß er Irma Meyer und alles, was bis dahin geschehen war.
Er verstaute seinen Einkauf im Kühlschrank und begab sich anschließend in die Bibliothek. Ursprünglich ein Wohnsaal von fünfzig Quadratmetern Fläche, nahm sie die gesamte Breite des Hauses ein; vier hohe Doppelfenster zur Straße hin und ein Alkoven zum Garten verliehen dem Raum ein lichtes Ambiente, das jedoch von der erdrückend wirkenden Einrichtung zunichtegemacht wurde. Alle Wände waren mit dunklen, übervollen Bücherregalen bis unter die drei Meter fünfzig hohe Stuckdecke zugestellt, nirgends gab es eine Lücke. Sein einziger Freund, der sich inzwischen nicht mehr meldete, hatte ihm während seines letzten Besuchs, der inzwischen drei Jahre zurücklag, geraten, die vielen »nutzlosen« Bücher zu digitalisieren und anschließend wegzuwerfen.
Jean, so hieß er – französische Aussprache –, arbeitete erfolgreich in der IT-Branche, außerdem spekulierte er im Auftrag eines der größten Medienclans des Landes an der Börse und vermehrte dessen Reichtum unablässig. Er erlaubte sich die Offenherzigkeit, Leute, die »heutzutage« noch Bücher kauften, als »Idioten« zu bezeichnen, während er mitten in der Bibliothek stand und seinen Blick missbilligend über die vielen Buchrücken schweifen ließ.
Wohl, weil er gefühlt hatte, dass er dieses Dictum nicht so stehen lassen konnte, hatte er sich lächelnd zu seinem Freund und Gastgeber umgewandt und hinzugefügt: »Fritz, sei kein Dummkopf! Außerdem kannst du digitalisierte Bücher überallhin mitnehmen, stell dir nur vor!«
Anschließend hatte er auf seine digitale Armbanduhr geschaut und festgestellt, dass ihm keine Zeit mehr blieb, um das geplante gemeinsame Mittagessen einzunehmen. Dann war er gegangen und nicht mehr wiedergekommen.
Seitdem betrat nur noch Elvira, die kolumbianische Putzfrau, sein Haus. Zweimal die Woche kam sie, putzte, wusch, bügelte, staubte die Bücher ab und nannte ihn »Cherrr Federico« oder »Jefe«. Sie sprach kaum Deutsch, was er begrüßte, weil es auf diese Weise nie zu längeren Gesprächen kam.
Elvira war von Beruf Krankenschwester und in jungen Jahren vor dem gewalttätigen Vater ihres einzigen Kindes, einer inzwischen sechzehnjährigen Tochter namens Lola, weggelaufen. Seitdem lebte sie offiziell und Versicherung zahlend in Spanien, aber illegal und arbeitend in Deutschland, während Lola bei den Großeltern im heimischen Ipiales, einer unbedeutenden Stadt an der Grenze zu Ecuador, aufwuchs. Friedrich Keller schätzte sie auf Ende vierzig, warum, wusste er selbst nicht, denn sie hätte auch sechzig oder dreißig Jahre alt sein können, ihr indianisches Gesicht ließ derartige Einschätzungen nicht zu. Er mochte Elvira eigentlich nicht, sie putzte weder in den Ecken noch unter den Möbeln, bügelte zu heiß und ruinierte ihm beim Waschen die Kleidung, weil sie sich weigerte, eine Lesebrille aufzusetzen und die Anweisungen auf den Waschzetteln zu befolgen. Er fand jedoch, dass es eine zu große Umstellung bedeuten würde, Elvira nach zehn Jahren zu entlassen und jemand noch Fremderes anzustellen.
Ihm war durchaus bewusst, dass er diesen Gedanken seit dem Tag ihrer Einstellung hegte, lediglich die Kalenderdaten hatten sich geändert. Streng betrachtet verstand er nicht, aus welchem Grund er an Elvira festhielt. Vielleicht, weil der Schritt, jemanden einzustellen, der sogar einen eigenen Hausschlüssel besaß, so groß war, dass er ihn kein zweites Mal wagte? Hatte er nicht sogar Glück gehabt mit Elvira? Sie bestahl ihn nicht, brachte niemanden mit, kam regelmäßig und ging ebenso regelmäßig wieder fort.
Er seufzte. Man muss Kompromisse eingehen, dachte er, während er sich zum Alkoven seiner Bibliothek begab, dort in seinen roten Ohrensessel setzte, das blau geblümte Kissen in seinem Rücken justierte und nach dem Buch griff, das rechts neben ihm auf einem Beistelltischchen lag.
Es war eigentlich kein richtiges Buch, sondern eine Leimbindung aus dem Kopierladen zwei Straßen weiter südlich. Er hatte sie selbst anfertigen lassen, nachdem ihm klar geworden war, dass der Inhalt der losen Blätter lebensrettende Medizin für seinen Geist darstellte.
Der abgerissene, nach Schmutz und Alkohol riechende Mann, dessen Gesicht hinter einem ungepflegten Bart verborgen geblieben war, würde niemals in seinem ansonsten eher unzuverlässigen Gedächtnis verblassen. Eines Abends kurz vor Ladenschluss hatte er unvermittelt in der Lyrikabteilung vor ihm gestanden, in der ausgestreckten linken Hand einen Stapel loser Blätter. Kein Wort war über seine überwucherten Lippen gekommen, und als Keller nicht reagierte, hatte er den Stapel auf die nahe Theke gelegt und war gegangen. So war dieser Schatz auf ihn gekommen.
Damals hatte es eine Weile gedauert, bis er den ersten Blick hineinwarf. Er konnte nicht einmal sagen, warum er die Blätter nicht einfach einer Kollegin oder dem Papierkorb übergeben, sondern eingesteckt und dabei wie ein Dieb um sich geblickt hatte. Anschließend war er nach Hause gegangen, hatte den Stapel in einem Regalfach auf die Bücher gelegt und erst einmal vergessen. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen lang.
Es war Elvira gewesen, der beim achtlosen Abstauben mehrere Blätter zu Boden segelten und die somit offiziell das Werk geöffnet hatte, denn ein Werk war es, und was für eines!
Zufall oder Fügung – kurze Zeit später hatte er die Bibliothek betreten und Elviras großes Gesäß erblickt, wie es dicht vor einem der Regale aufragte. Eines der Blätter war darunter geraten, und Elvira fischte nun im Staub danach.
Als sie es hervorgezogen und abgeklopft hatte, so dass eine kleine Wolke aus glitzernden Partikeln im Raum schwebte, erhob sie sich, drehte sich um und reichte ihm das Blatt mit den Worten: »Rrrrunterrrgefalleng.«
Er nahm es entgegen. Darauf stand in den typisch unregelmäßigen Typen einer Schreibmaschine aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts:
Den blinden Göttern.
Radi Zeiler
Er blickte auf, ohne zu verstehen, doch Elvira streckte nur ihren Arm aus und wies mit einem Ausdruck, der ebenso gut vorwurfsvoll wie gleichgültig sein konnte, auf den Blätterstapel im Regal.
Nachdem sie die Bibliothek verlassen hatte, ohne einen weiteren Gedanken an den Staub unter den Regalen zu verschwenden, näherte er sich dem Stapel, zog ihn heraus und nahm im Ohrensessel Platz, um zu lesen. Genau wie jetzt.
Zwei Jahre waren seitdem vergangen, und in diesen zwei Jahren hatten die Gedichte von Radi Zeiler ihre Wirkung entfaltet, bis Friedrich Keller sich eines Tages hatte eingestehen müssen, dass er in Wahrheit nicht mehr in diesem Haus oder in dieser Bibliothek oder in diesem Sessel Geborgenheit fand, sondern nur noch in diesem Buch. Wenn er darin las, verschwanden die Niederungen des Daseins so vollständig, als hätte es sie nie gegeben und würde sie nie mehr geben.
Ganz gleich, wie banal das Thema auch sein mochte, das Radi Zeiler behandelte – Liebe, Tod oder Ähnliches –, stets verspürte Keller eine Kraft in dessen Worten, die es absurd erscheinen ließ, dass er am nächsten Morgen dem Wecker Folge leisten, sich ankleiden, ernähren und anschließend auf den Weg in die größte Buchhandlung des Viertels machen würde, um dort einen weiteren unerträglich langweiligen Tag mit lauter im besten Fall nichtssagenden Menschen zu verbringen. Nach der Lektüre von Zeiler war die Wirklichkeit noch glanzloser als sonst. Und obwohl er sich der Tatsache bewusst war, dass er vermutlich viel zu viel in dessen Verse hineininterpretierte, sie womöglich sogar missbrauchte, um seine Weltabgewandtheit noch zu steigern, gaben sie ihm etwas, das er nicht für möglich gehalten hatte: Gelassenheit. Laborgelassenheit, das musste er zugeben, denn Begegnungen jener Art wie eben noch mit Irma Meyer ließen ihn alles Universale vergessen und brachten ihn im Handumdrehen zurück in sein individuelles Ungleichgewicht. Aber Laborgelassenheit war besser als gar keine, daran bestand kein Zweifel.
Inzwischen hätte er den Rat seines verschwundenen Freundes sogar befolgen und alle anderen Bücher wegwerfen können, auch ohne sie zu digitalisieren, denn er hatte kein einziges mehr angerührt, seit Radi Zeiler ihm sein Opus überreicht hatte und spurlos verschwunden war. Nicht ganz spurlos allerdings. Wenige Monate nach jener Begebenheit in der Lyrikabteilung war er ihm auf der Straße begegnet. Keller war unterwegs gewesen, um einzukaufen, hatte bereits die vierspurige Ausfallstraße mit der schmalen Verkehrsinsel hinter sich gelassen und steuerte auf das Lebensmittelgeschäft zu, als ihm eine zerlumpte Gestalt auffiel, die ihm entgegenkam. Er erkannte ihn sofort, dem vom Bart überwucherten Gesicht zum Trotz.
Radi Zeiler war so betrunken, dass er nur auf das Gleichgewicht seines Körpers zu achten schien. Sein Blick war glasig und verlor sich im Unbestimmten. Er hätte seinen größten und vielleicht einzigen Bewunderer vermutlich selbst dann nicht erkannt, wenn dieser ihn an den Schultern gepackt und geschüttelt hätte. Friedrich Keller musste ihm ausweichen, denn Zeiler konnte nur noch eingeschränkt navigieren. Als er vorbeigewankt war und seinen Geruch nach schmutzigem Leib und hochprozentigem Alkohol wie eine Schleppe hinter sich hergezogen hatte, blickte Keller ihm eine Weile nach, bevor er ihm schließlich folgte. Er tat es, ohne nachzudenken, als würde er von Zeiler einfach mitgezogen. Seinen Plan einzukaufen hatte er vollkommen vergessen. Zeiler bog nach rechts ab, dann erneut nach rechts, so dass er nun wieder in die Richtung ging, aus der er auf der Hauptstraße gekommen war. Der Weg nach Süden Richtung Stadtmitte war lang, die Straße schmal und von alten Wohnhäusern gesäumt, eine Dorfstraße geradezu. Radi Zeiler ging langsam und methodisch, wie Betrunkene, die ein Ziel haben, es tun.
Keller folgte ihm vorsichtig, fast ängstlich, aber ohne den Blick von ihm abzuwenden. Er kam sich vor wie ein schüchterner Verehrer, und das war er, er war es in kürzester Zeit geworden, und nun erschien Zeiler ihm wie ein Engel, den ein unbekannter Gott ihm gesandt hatte. Doch zu welchem Zweck? Und warum ein Engel in der unengelhaftesten Gestalt, die man sich vorstellen konnte? Wie war ein solcher Trunkenbold in der Lage, solche Zeilen zu schreiben?
Als wollte es ihm Antwort auf diese Frage geben, erklang in seinem Kopf eines der Gedichte von Zeiler. Es handelte davon, dass der Körper zwar ein Lebewesen sei, der Geist jedoch weder ein solches noch kein solches – eine offensichtlich paradoxale Konstruktion, deren Sinn sich Keller wie ein schemenhafter Hintergrund erschloss, vor dem eine helle, blendende Kerze stand und die genaue Sicht versperrte, wobei die Kerze paradoxerweise den Hintergrund überhaupt erst beleuchtete. Immer wieder zogen die Verse durch seine Gedanken und ähnelten darin eher einem Mantra als einem Gedicht.
Und plötzlich glaubte er zu verstehen: Zeiler war der lebende Beweis dafür, dass der Geist nichts als ein Gefangener des Körpers war, dem er Leben und Richtung gab! Das Wesen des Geistes war dagegen Freiheit, die selbst ein unter stärkstem Drogeneinfluss stehender Körper nicht zunichtemachen konnte!
Diese vermeintliche Erkenntnis beflügelte ihn in seiner verehrenden Verfolgung, und so wurde er mutiger, wagte sich bis ans Ende von Zeilers Duftschleppe, um dann allerdings erneut zurückzufallen. Der Geist zieht den Geist an, aber der Körper stößt den Körper ab, dachte er und rümpfte die Nase.
Zeiler war nun an der inneren Ringstraße angelangt, auch sie vierspurig mit einer schmalen Verkehrsinsel, die hier jedoch als begrünter Streifen zwischen zwei Bordsteinen in Erscheinung trat. Weit und breit keine Ampel. Der Verkehr war nicht dicht, sondern schnell. Zeiler aber machte keine Anstalten, stehen zu bleiben oder auch nur nach links und rechts zu schauen. Er wankte einfach weiter, und wie durch ein Wunder blieb die Straße in dieser Zeit leer.
Als Friedrich Keller dorthin gelangte, rasten Autos aus beiden Richtungen so zahlreich heran, dass es beinahe wirkte, als sollte er an der weiteren Verfolgung des Dichters gehindert werden. Dann jedoch wurde es irgendwo rot, erneut leerten sich beide Fahrtrichtungen, und der Weg war wieder frei.
Radi Zeiler hatte sich inzwischen nach schräg rechts gewandt und stapfte nun über einen Fußweg zu jener Anhöhe, auf deren flachem Scheitel sich die ehemalige Residenz des Königs befand. Oben angelangt durchquerte er den Hofgarten auf dem kürzesten Weg und ging anschließend zwischen Theatervorplatz und spanischem Kulturinstitut weiter Richtung Altstadt.
Wohin wollte Radi Zeiler? Hatte er überhaupt ein Ziel, oder ging er einfach immer weiter? Einen Moment lang überlegte Friedrich Keller, ob er die Verfolgung abbrechen sollte. Allein, er konnte nicht anders, er musste diesem Lumpenengel, diesem stinkenden göttlichen Dichter, dessen spröde Verse ihn seit Monaten elektrisierten, weiter folgen.
Und so wurde er schließlich Zeuge, wie Radi Zeiler in einer Seitengasse des Viktualienmarktes in das Wirtshaus Zum heißen Sporn einkehrte.
Friedrich Keller kannte das Etablissement aus Erzählungen lokaler Literaturgrößen, wäre jedoch niemals auf den Gedanken gekommen, es aus eigenem Antrieb aufzusuchen. Nun stand er vor der dunkel gebeizten Holzfassade einer altmodischen deutschen Kneipe und spähte durch die kleinen, gelblich getönten Fenster ins Innere, wo Radi Zeiler sich an einen freien Tisch setzte.
Eine halbe Stunde lang zögerte Keller, ging auf dem Bordstein hin und her, schaute ziellos in die Umgebung, wo dichtes Treiben herrschte – Einheimische, die auf dem Markt einkauften, Touristen aus Fernost und Fernwest, die mit Kameras bewaffnet auf alles schossen, was typisch oder urig oder traditionell wirkte, Studenten, die sich zum Plaudern auf einer der vielen Terrassen trafen, herumlungernde Gestalten, denen selbst an einem so hellen Tag das Zwielicht ins Angesicht schien –, bis er sich ein Herz fasste und das Wirtshaus betrat.
Dicke Luft empfing ihn. Die Menschen saßen dicht gedrängt an groben Holztischen, immer jeweils vier oder fünf, brüllten einander wohlwollend an und rauchten Zigaretten, tranken Bier und Spirituosen, junge Männer mit gierigen ungenauen Blicken, alte Frauen in aufreizender Kleidung und ganz allein an einem Tisch in der Mitte des Lokals Radi Zeiler, der Dichter.
Aus scheppernden Lautsprechern drang Schlagermusik, eine leicht quiekende Frauenstimme sang frenetisch: »Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür.«
Bevor Friedrich Keller einen klaren Gedanken fassen konnte, strebte die dicke Wirtin, eine ältliche Frau im Dirndl, deren reichliches Fett sie vor Faltenbildung bewahrte, auf ihn zu und rief: »Was darf’s sein, der feine Herr?«
Ihre Vokale waren vulgär geweitet, und ihre Stimme zeugte davon, dass sie ähnlich den Marktfrauen ans Schreien gewöhnt war, ja, dass sie normalerweise schreiend sprach.
Keller räusperte sich verlegen, denn er hatte sich keinen konkreten Plan zurechtgelegt. Seine Augen huschten kurz zu Zeiler, und die Wirtin sah es mit dem geübten Blick einer Frau, deren Beruf in diesem Milieu es erforderte, stets zu wissen, was ihre Kunden wirklich wollten. Sie stemmte die Hände in die Hüften, wandte sich halb zum Dichter um und schrie anschließend zu Friedrich Keller: »Der? Das ist der Radi, der redet mit keinem, den er nicht kennt, das können Sie vergessen, feiner Herr!«
»Aber er … er schreibt doch, nicht wahr?«, stammelte Keller wie ein Schuljunge, der zum ersten Mal bei der bewussten Wahrnehmung wogender Brüste ertappt wird.
Die Wirtin zog die Augenbrauen hoch, lachte kurz auf und rief: »Der und schreiben? Was weiß ich! Einmal hat er mir ein paar Zeilen geschenkt, ob die von ihm selbst waren?« Sie zuckte mit den Schultern, blickte sich routiniert und schnell nach allen Seiten um, damit ihr niemand entginge, der etwas bestellen wollte, fasste anschließend Friedrich Keller schärfer ins Auge, und zwar von oben bis unten, und stellte dann sachlich und erstaunlich leise fest: »Sie gehören aber nicht hierher.«
Die Lage wurde heikel für Friedrich Keller, er war ja keiner, der besonders gut improvisieren konnte. Der Drang, auf dem Absatz kehrtzumachen und das Wirtshaus grußlos zu verlassen, wurde so übermächtig, dass er nun erst recht nichts mehr sagen konnte.
Plötzlich griff die Wirtin nach einem freien Stuhl, der an einem nahen Tisch gestanden hatte, und schrie erneut in normaler Lautstärke, während sie ihn direkt vor Radi Zeiler platzierte: »Versuchen Sie’s halt! Aber trinken müssen Sie was!«
Und das klang in Kellers Ohren wie eine Aufforderung, den unbedingten Ritus einzuhalten, der allein Zugang zum Meister gewähren konnte, während ihm durchaus bewusst war, dass es bloß eine Rückversicherung ökonomischer Natur war.
Zeiler hatte überhaupt nicht reagiert, er schien sie nicht einmal wahrzunehmen. Sein Blick schwamm irgendwo auf der Tischplatte herum.
Erst als die Wirtin ihn aus nächster Nähe anbrüllte: »Radi, du, hör mal! Da ist einer, der will was von dir!«, hob er die Augen und folgte ihrem ausgestreckten Arm, an dessen Ende ein wurstdicker Zeigefinger auf Friedrich Keller wies.
Und in diesem Augenblick geschah ein Wunder: Radi Zeilers Augen wurden klar, und er erkannte den Buchhändler, dem er eben erst eine Sammlung seiner Gedichte in die Hand gedrückt hatte. Eben erst oder vor Jahrzehnten, da war Zeiler sich nicht sicher. Aber diese an Durchschnittlichkeit kaum zu überbietende Gestalt! Er winkte Friedrich Keller mit einer kurzen schwerfälligen Geste heran.
Zögernd näherte sich dieser und nahm schließlich Platz.
»Und?«
Friedrich Keller verstand nicht. Das verwilderte Gesicht vor ihm, der allgemeine Lärm im Wirtshaus, des Dichters Gestank, seine erstaunlich tiefe, kräftige Stimme, diese unvermittelte Frage – das war alles zu viel für ihn. Ohne die Flucht ergreifen zu wollen oder zu können, war er vollkommen aufgeschmissen, und so starrte er Zeiler ratlos an.
Dieser verlor schließlich die Geduld und sagte unwirsch: »Die Gedichte!«
Jetzt verstand Keller: Radi Zeiler verlangte ein kritisches Urteil. Sogleich wurde er vom verwirrten, anbetenden Leser zum Buchverkäufer. Phrasen, mit denen er gewöhnlich seine unqualifizierte Kundschaft abspeiste, schossen ihm durch den Kopf, Standardsätze, die er im Schlaf herunterbeten konnte. Doch er sagte keinen Ton. Denn hier saß kein Kunde, hier saß ein König vor ihm, ein König von einem Autor, und der verlangte ein echtes, ein wahres Urteil zu hören.
Als Friedrich Keller sich diesen Umstand klargemacht hatte, tauchte ein einziges Wort in seinem Geist auf, und er sagte es, ohne nachzudenken, er sagte es leise und unschuldig wie ein Verliebter, der zum ersten Mal der Auserwählten seine tiefsten Gefühle gesteht: »Göttlich.«
Radi Zeiler blickte ihn einen Moment lang verdutzt an und brach anschließend in brüllendes Gelächter aus. »Göttlich! Er hat ›göttlich‹ gesagt! Göttlich!« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es einen lauten Knall gab und sich alle nach ihnen umdrehten.
Friedrich Keller glaubte, im Boden versinken zu müssen. Er hatte seine Liebe gestanden und wurde verlacht.
Er irrte. Radi Zeiler lachte nicht höhnisch, sondern glücklich. Mit beiden Händen ergriff er Kellers Rechte und schüttelte sie heftig, während er immer noch »göttlich!« rief.
Die Wirtin kam herbei und stellte einen großen mit Bier gefüllten Krug vor Keller auf den Tisch. »Wie haben Sie denn das geschafft?«, fragte sie erstaunlich leise und ging, ohne eine Antwort abzuwarten.
Bei ihrem Abgang machte Radi Zeiler ihr ein Zeichen. Kurz darauf kehrte sie mit drei kleinen Gläsern zurück, in denen eine klare Flüssigkeit schwappte. Ohne weitere Umstände kippte er sich alle drei in den Rachen.
Anschließend stierte er Friedrich Keller an und dröhnte: »Trinken Sie!« Keller gehorchte dem Imperativ des Meisters und hob den schweren Krug an seine Lippen. Seit Jahren hatte er kein Bier mehr getrunken, geschweige denn Stärkeres. In seinem Inneren aber behauptete eine leise Stimme, er dürfe dies angesichts der besonderen Umstände ruhig tun. Also trank er. Er trank unter den Augen von Radi Zeiler. Und während er trank, überkam ihn eine Art jugendlicher Übermut, er fühlte sich plötzlich in der Lage, dem Dichter etwas zu beweisen, was genau, wusste er nicht und wollte es nicht wissen, denn hier ging es allein um die Tat. Und so lehrte er den Krug in einem Zug.
In der Zwischenzeit hatte Zeiler drei weitere Gläser bestellt und bekommen. Auch die stürzte er ansatzlos hinunter.
Friedrich Keller beobachtete ihn dabei und fragte zu seiner eigenen Überraschung: »Was ist das denn für ein Zeug?«
»Sliwowitz«, brummte Zeiler, dessen Augen bereits ihren Fokus zu verlieren begannen.
Keller dagegen fühlte sich von Moment zu Moment besser, gelöster, geradezu befreit. Ohne einen weiteren Gedanken an die Lage, in der er sich befand, zu verschwenden, sagte er erstaunlich laut: »Ich habe so viele Fragen!«
»Schießen Sie los«, murmelte Zeiler kaum hörbar. Seinen Blick, der sich erneut auf der Tischplatte verlor, hob er nicht.
»Warum schreiben Sie solche Sachen und leben so?«, wollte Keller wissen.
Zur Antwort gab Zeiler ein gutturales Geräusch von sich, das Keller als Auflachen deutete. Der Dichter schloss die Augen und sagte leise und undeutlich: »Wenn ich nicht trinke, hört es nicht auf.«
Keller, dem das harmlose Bier zu Kopf gestiegen war, glotzte sein Gegenüber einen Moment lang verwirrt an. Dann rief er so laut, als wäre er Stammgast im Heißen Sporn: »Was denn? Was hört nicht auf? Etwa das Schreiben?«
Der Dichter ließ den Kopf nach vorn baumeln und schüttelte ihn schwach. Er flüsterte kaum hörbar: »Das Sehen.« Anschließend sank er vollends auf die Tischplatte und blieb liegen.
Die Wirtin kam herbei, zog die Sliwowitz-Gläser unter Zeilers eingesunkenem Oberkörper hervor, nahm auch Kellers Krug an sich und sagte beiläufig: »Aus dem kriegen Sie jetzt nix mehr raus.«
Und so war es. Obwohl Friedrich Keller noch geraume Zeit vor dem schlafenden Dichter saß, geschah nichts außer einer leichten Ernüchterung, gepaart mit einem dumpf pochenden Kopfschmerz.
Als er schließlich einsah, dass sein Gespräch mit Radi Zeiler unwiderruflich beendet war, zahlte er seine Zeche und verließ den Heißen Sporn, nicht ohne zuvor eine Visitenkarte der Buchhandlung, die ihn in rhetorischer Übertreibung seiner wahren Bedeutung als »Abteilungsleiter Belletristik und Lyrik« auswies, aus der Innentasche seines Jacketts zu fischen und mit einem Kugelschreiber seine Privatadresse auf die Rückseite zu kritzeln. Dann steckte er sie dem schlafenden Dichter mit spitzen Fingern in dessen rechte Manteltasche.
Auf dem Rückweg von dieser denkwürdigen Begegnung wollte ihm eines der Gedichte des trunkenen Meisters nicht aus dem Kopf gehen. Es sprach von Nackten, die laufend versuchen, sich zu verbergen, obgleich niemand ihre Nacktheit sieht – außer ihnen selbst.
Es handelte sich um eines der Ersten im Buch, wobei die genaue Ordnung der Gedichte ausgerechnet am Anfang durch Elviras Untat nicht mehr nachvollziehbar war. Mindestens zehn Blätter hatte sie zu Boden gewedelt und anschließend völlig ungeordnet zusammengeschoben, so dass einige Gedichte sogar auf dem Kopf standen oder die Rückseite der einseitig beschriebenen Blätter nach vorn zeigte. Wann immer Friedrich Keller daran dachte, überkam ihn ein geheimer Groll gegen die Putzfrau, der seinen alten, Elviras Schlampigkeit gewidmeten Ärger gleichsam als Sprungschanze für ein intensiveres Gefühl nutzte. Wie auch immer, seit seiner Begegnung mit Radi Zeiler und dessen Lyrik hatte sich sein Leben dramatisch verändert. Früher hatte er jeden angsteinflößenden Ausflug in die Welt jenseits der Gartenmauer seines Hauses als sinnvolle Herausforderung betrachtet, begleitet von der unverwüstlichen Hoffnung, sich dort eines Tages wohlfühlen zu können und ein normaler Mensch zu werden. »Befreiung von der Furcht« lautete sein heimliches Lebensprojekt, das er freilich mit niemandem besprechen konnte, aus Furcht vor Verachtung oder ähnlichen allzu menschlichen Regungen, die im Reich des Homo Sapiens so üppig wucherten wie Unkraut in seinem Garten, gäbe er nicht acht und patrouillierte fast täglich durch die fast tausend Quadratmeter ordentlich angelegte Blumenbeete, Busch-Arrangements, die kleine Obstplantage hinten links, das Wilderdbeerbeet nahe dem Haus, die Farne mit dem künstlich angelegten Tümpel rechts und die Rosen, die Rosen, vor allem sie.
Doch seit Radi Zeiler war eine neue Ära angebrochen. Nicht geringes Selbstbewusstsein, fehlendes Talent, geschickten Small Talk zu betreiben, oder ungenügende Voraussetzungen für ein akzeptables Mannsein waren nun Kellers Problem, sondern die Aussicht, dass nichts half, nicht einmal die Bewältigung sämtlicher Neurosen, Ticks oder Komplexe, da diese gegenüber der Endlichkeit des Daseins und der Vergänglichkeit aller Dinge wie Kindersorgen wirkten. Und im Lichte dieser Vergänglichkeit änderten sich die Farben der Welt, und alles wurde ein wenig düsterer, fragwürdiger, sinnloser.
Radi Zeiler erschien ihm wie ein Seher, der vor den Visionen des Schreckens, die ihm seine Fähigkeit offenbarte, in den Rausch und die Selbstzerstörung geflohen war, um paradoxe Rettung zu suchen. »Du wirst sehen!«, rief der letzte Vers eines der Gedichte, das davon sprach, dass es nicht leicht werden würde ganz am Ende. Die Wahrheit zu erblicken, wurde zur Drohung. Und er, Friedrich Keller, hatte geglaubt, die Freiheit von der Angst, die Konventionen der Gesellschaft nicht erfüllen zu können, würde ihm Zutritt zur Wahrheit des Daseins verschaffen. Wie naiv von mir!, dachte er und blätterte in Zeilers Buch, las hier und dort ein Gedicht – es handelte sich ausschließlich um Sonette – wie jemand, der seine tägliche Medizin einnahm, die ihn am Leben hielt und zugleich vergiftete.
In Wahrheit aber suchte er in den Versen des trunkenen Dichters nach einer Erklärung für die Tatsache, dass ihm, dem gesellschaftsunfähigen Menschenflüchtling, diese eigenartige Lyrik zur letzten Heimat geworden war, obwohl sie alle Fassaden, alle Masken herunterriss und nichts übrig ließ, hinter dem er, Keller, sich hätte verstecken können.
Ein paar Stunden lang las er im Buch des Meisters. Immer wieder schloss er die Augen, lehnte den Kopf an die Lehne des Sessels und rezitierte Zeilers Verse halblaut und mit entrücktem Lächeln. Er vergaß die Welt und alle ihre Probleme und genoss die vollkommene Schönheit dieser eigentümlichen Lyrik, die sich ihm nie ganz erschloss, weil sie stets fremd und unergründlich blieb.
Als der Rausch verflog und Keller nur noch Müdigkeit empfand, schloss er das Buch, legte es auf das Beistelltischchen zurück, verließ die Bibliothek und begab sich in das erste Stockwerk, um sich im Bad bettfertig zu machen.
Zuletzt betrat er sein Schlafzimmer, das sich neben dem Aufgang in den zweiten Stock befand, und legte er sich auf das mintgrüne Doppelbett, das den größten Teil des Raumes einnahm. Die Wände waren ochsenblutrot gestrichen, jedoch nur bis hinauf zum Goldenen Schnitt. Das letzte Stück bis zur Decke war weiß. Die Farbgebung sowohl des Bettes als auch der Wände hatte die einzige Frau bestimmt, mit der Keller jemals den Versuch unternommen hatte, eine intime Nähe herzustellen. Doch nachdem sie das teure Bett und die zwar beruhigende, aber auch düstere Wandfarbe ausgewählt hatte, war sie mit einem anderen, einem ganz anderen, getürmt, ohne dass irgendetwas Berührendes, etwas wirklich Berührendes zwischen ihr und Keller geschehen wäre.
Im Laufe der vielen Jahre, die seitdem vergangen waren, hatte Friedrich Keller trotz anfänglicher, schier unüberwindlich scheinender innerer Widerstände ihre Hinterlassenschaft zu schätzen gelernt. Das Bett war breit und bequem, und die Farbe an den Wänden versetzte ihn augenblicklich in einen quasi intrauterinen Zustand, der ihm das Einschlafen sehr erleichterte.
Doch in dieser Nacht schlief Keller unruhig. Wirre Träume suchten ihn heim, er sah Radi Zeiler in den Nebel davongehen, und im nächsten Augenblick stand der Meister dicht vor ihm, packte ihn am Kragen und brüllte: »Wahrer Dichter? Falscher Poet?«
Er wachte mehrmals auf, lag schlaflos in der Dunkelheit, dämmerte weg und träumte weiter von Sonetten kurz wie Haikus, von Elvira, die mit dem Staubwedel sämtliche Wörter aus seinen Büchern wischte, bis alle Seiten leer waren, worauf sie vorwurfsvoll den Mund öffnete und ihm eine glitzernde Partikelwolke ins Gesicht blies.
Dann verschwand alles, und er lag in einem weißen Bett in einem weißen Raum. Sogar das Licht, das von links hereinflutete, war weiß. Endlich kam er zur Ruhe.
Im Sturm fauler Winde
Als Keller am nächsten Morgen, einem Sonntag, viel zu früh erwachte, fühlte er sich gerädert. Ein Blick zum Wecker verriet ihm die Uhrzeit: sechs in der Früh. Es war still im Haus. Auch von der Straße her ertönte kein Laut. Und Keller dachte automatisch: »In allem ist Schweigen.« So lauteten die ersten drei Verse des zweiten Gedichts aus dem korrupten Anfang von Zeilers Buch – hätte Keller es gewagt, Notizen hineinzuschreiben, er hätte es »Sonett *II« genannt, zumindest trug es in seinem Kopf diesen Titel. Dass er die römische Zahlschrift benutzte, wollte er als Hommage an die lange Tradition verstanden wissen, in welcher er Zeilers Sammlung verortete.
Er stand auf, zog einen weißen Bademantel aus Frottee über seinen karierten Schlafanzug, wanderte dann ziellos durchs leere Haus, unterdrückte den Impuls, die Bibliothek zu betreten, und beschloss stattdessen, frische Luft schnappen zu gehen. Er öffnete die innere der beiden Haustüren, die graue Eichentür, und stellte drei Dinge gleichzeitig fest. Erstens: Es stank entsetzlich. Zweitens: Auf dem unteren Treppenabsatz lag ein Mensch und schlief. Drittens: Elvira musste wieder einmal vergessen haben, die Glastür und das Gartentor abzuschließen, anders wäre dieser Jemand nicht hereingekommen. Im nächsten Augenblick erkannte er sowohl den Gestank als auch die Lumpen, die der Schlafende am Leib trug.
Es hätte nicht der Wahrheit entsprochen zu sagen, Friedrich Keller sei überrascht gewesen. Aus keinem anderen Grund hatte er Radi Zeiler seine Privatadresse hinterlassen. Aber seitdem waren mehr als anderthalb Jahre verstrichen, und in dieser Zeit hatte sich die Hoffnung, der Dichter werde der unausgesprochenen Einladung folgen, nach und nach verflüchtigt. Auch war es keinesfalls so, dass Keller wirklich einen Besuch erhofft hatte. Eher hatte der Gedanke, der Dichter wisse, wo er, Keller, wohnte, die Qualität eines seidenen Fadens entwickelt, durch welchen sie auch weiterhin verbunden blieben.
Nun also war das Unwahrscheinliche eingetreten: Radi Zeiler war gekommen. Er lag stinkend und schnarchend auf dem unteren Treppenabsatz zwischen seinen beiden Haustüren und rührte sich selbst dann nicht, als Keller über ihn hinwegstieg und die Glastür zum Lüften öffnete. Erst als die kühle Morgenluft hereinkroch und sich um Zeiler und anschließend in Zeiler niederließ, während der Hausherr draußen auf dem Gartenweg stand, tief durchatmete und nicht wusste, was als Nächstes geschehen würde, und wusste, dass dies selten in seinem Leben geschah, weil er Ungewissheit hasste, erwachte Zeiler mit einem Grunzen, wälzte sich aus der embryonalen Stellung auf den Rücken, stützte sich auf die Ellenbogen und blickte sich um wie einer, der keine Ahnung hat, wo er sich befindet.
Als er Friedrich Keller draußen entdeckte, trafen sich ihre Blicke, und Keller stellte verblüfft und ein wenig erschrocken fest, dass der des Dichters vollkommen klar war. Und dieser vollkommen klare Blick schien ihn vollkommen zu durchdringen, so dass er sich nackt und klein fühlte.
Nachdem die Zeit unendlich lange stillgestanden hatte, öffnete der Meister den Mund und brummte: »Ich brauch ʼnen Kaffee.«
Hätte Radi Zeiler gewusst, wie groß die Ehre war, er hätte vielleicht gezögert, Friedrich Kellers zögerlich vorgetragene Einladung, doch bitte hereinzukommen, anzunehmen. Aber er wusste nicht, dass Elvira seit vielen Jahren der einzige Mensch war, der in diesem Haus praktisch nach Belieben ein- und ausgehen konnte, abgesehen von sporadischen und mit verkniffener Miene hingenommenen Installateurbesuchen, die Keller auf seine schweigsame Art so ungemütlich zu gestalten wusste, dass die Handwerker schnell und effizient arbeiteten, um möglichst bald wieder gehen zu können und lange Zeit nicht mehr wiederkommen zu müssen.
Ob Zeiler den Akt gelungener Selbstüberwindung wahrnahm, als Keller stockend und mit trockener Kehle Kaffee und Küche anbot, wird nie geklärt werden können. Er und sein Geruch strömten förmlich herein, nachdem er sich aufgerappelt und mit steifen Beinen die Treppenstufen bis hoch zur zweiten Haustür bewältigt hatte, gefolgt vom Gastgeber, der vergeblich versuchte, ausschließlich durch den Mund zu atmen.
Zeiler verschwendete keinen Blick nach links, wo die getäfelte Tür zur Bibliothek weit offen stand, oder nach rechts, wo eine wuchtige, zwei Meter lange, mit Eisen beschlagene Reisetruhe aus dem achtzehnten Jahrhundert thronte. Über dieser hing ein Ölporträt der Großmutter mütterlicherseits von Friedrich Keller, dem die gleiche Missachtung widerfuhr. Zeiler schien einem sicheren Instinkt zu folgen, der ihn prompt zur Küchentür im hintersten rechten Winkel des Vestibüls führte, noch bevor Keller etwas Wegweisendes hätte äußern können. Dort angekommen, steuerte er zielstrebig auf den großen Esstisch zu, der an einem breiten Fenster mit Ausblick auf den hinteren Teil des Gartens stand. Er umschiffte den großen Küchenblock, der von links in den Raum hineinragte – Gasherd, Anrichte und reichlich Abstellfläche für Kräuter, Öle, Schneidbrettchen und so weiter –, ließ sich auf einen der sechs zierlichen Thonetstühle fallen, genauer auf denjenigen, der ihm sowohl einen Blick nach draußen als auch in den Raum hinein gewährte, und saß dann einfach da.
Friedrich Keller eilte am Tisch vorbei, um die Tür zum Garten aufzureißen, doch Radi Zeiler hob die Hand und deutete ein leichtes Kopfschütteln an. Das genügte. Keller brach sein Vorhaben jäh ab und begab sich mit dem Gefühl dessen, der sich ins Unvermeidliche schickte, an den Küchenblock, ergriff die Espressokanne, die noch vom Vortag dort stand – auch so eine Unart von Elvira –, und machte sich ans Werk. Das beruhigte ihn ungemein, und obwohl es ihm schwerfiel, des Meisters Gestank zu ertragen, fühlte er doch einen Jubel in sich emporsteigen und so viele Fragen, die er nie geglaubt hatte, eines Tages stellen zu können.
Der Duft nach frischem Kaffee, der bald die Küche erfüllte und einen kurzfristigen Sieg über Radi Zeilers Dunstkreis errang, tat das Seine, um die Lage für Keller weiter zu entspannen. Zumindest so lange, bis er ihm gegenübersaß. Er hatte zwei doppelte Espressi zubereitet, die nun dampfend vor ihnen standen.
Zeiler warf von sehr weit oben einen Blick in seine Tasse und fragte anschließend ungläubig: »Keine heiße Milch?«
Keller sprang auf, als hätte er einen Fauxpas begangen, während er »Doch, doch, natürlich, selbstverständlich« sagte und schnell zum Küchenblock zurückeilte, als wartete dort bereits die Milch auf ihn. Das tat sie nicht, und deshalb musste er erneut kehrtmachen und zum Kühlschrank gehen, den er eben erst passiert hatte. Das war natürlich peinlich. Keller überkam eine plötzliche Furcht, der göttliche Zeiler könne ihn für einen Idioten halten, und das wäre gar nicht gut im Hinblick auf die intellektuelle Begegnung, die er anstrebte.
Mit der heißen Milch begab Keller sich kurz darauf zum Tisch zurück. Er hatte auch einen Untersetzer für das Gefäß mitgebracht, den er jetzt neben Zeilers Kaffeetasse positionierte.
Zeiler jedoch sah ihn verständnislos an. Dann brummte er: »Die Tasse ist zu klein.«
»Wie bitte? Ach so! Die Tasse, natürlich, viel zu klein!«