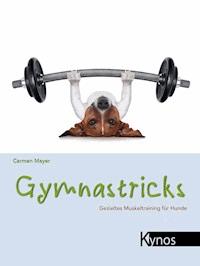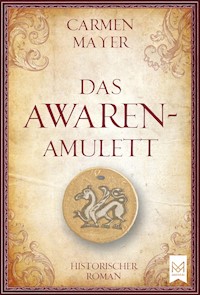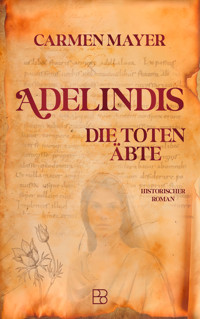
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonifatius Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im düsteren Kloster Bochaugia am Verdersee wächst die junge Adelindis auf, abgeschieden von der Welt und den Geheimnissen um ihre Herkunft als Findelkind. Während sie in den alten, verstaubten Handschriften der Bibliothek forscht, entdeckt sie eine tiefe Leidenschaft: die Heil- und Pflanzenkunde. Ein Wissen, das ihr Leben verändern könnte. Doch als sie ihren eigenen Weg finden will, fernab des strengen Klosters, sind nicht alle bereit, ihr diesen zu gewähren. Im Jahr 1136 wird Adelindis zur Klosterinsel Reichenau gesandt, um eine bedeutende Urkunde abzuholen. Dort gerät sie in ein Netz aus Intrigen, Verrat und dunklen Machenschaften. Der plötzliche und mysteriöse Tod des Abts Uldarich von Zollern erschüttert die Klostergemeinschaft. Schnell fällt der Verdacht auf Adelindis, die des Giftmords beschuldigt wird. In einem Wettlauf gegen die zeit versucht sie, das Rätsel um den Tod des Abts zu läsen, während unerwartete Verbündete ihren Pfad kreuzen. Doch die Intrigen drohen, alles zu zerstören, was sie sich erträumt hat. Wird es Adelindis gelingen, da Geheimnis zu lüften und ihre Freiheit zu erlangen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen Mayer
Adelindis
Die toten Äbte
CARMEN MAYER
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden, denn es ist urheberrechtlich geschützt. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Links im Buch zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat der Verlag keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Verlag hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden und übernimmt für diese keine Haftung. Alle Internetlinks zuletzt abgerufen am 3.4.2025.
Klimaneutrale Produktion.
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.
1. Auflage 2025
Copyright © 2025 Bonifatius GmbH Druck | Buch | Verlag
Karl-Schurz-Str. 26 | 33100 Paderborn | Tel. 05251 153-171 | [email protected]
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München, werkstattmuenchen.com
Umschlagabbildungen: © pikisuperstar/freepik; © freepik; © St. Gallen, Stiftsbibliothek
Motive Innenklappen: Weiss Werkstatt München
Lektorat: Karoline Kuhn
Satz: Bonifatius GmbH, Paderborn
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
eISBN: 978-3-98790-945-0
www.bonifatius-verlag.de
Für meine Mama
1922-2023
Inhalt
Prolog
Kloster Bochaugia am Verdersee am achtundzwanzigsten Tag des Erntemonats 1120
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Von der Autorin
Personenverzeichnis
Begriffserklärungen
Literatur
Prolog
Kloster Bochaugia am Verdersee am achtundzwanzigsten Tag des Erntemonats 1120
Irmentraud wälzte sich erschöpft von einer Seite ihres Lagers auf die andere. Die Hitze des Vortags hatte sich auch in der Nacht kaum abgekühlt und war neben einer Unzahl sirrender Stechmücken der Grund, weshalb die junge Frau keinen Schlaf finden konnte. Das Wasser des Verdersees mit dem Moor, das die kleine Halbinsel mit dem alten Kloster umschloss, bot längst keine Abkühlung mehr. Dort vermehrten sich Mücken und andere Insekten rasend schnell und boten zwar Fischen und Fröschen reiche Nahrung, für Menschen und außerhalb des Wassers lebende Tiere waren sie jedoch zur Plage geworden. Der ersehnte Wind, in dessen Folge man sich kühlenden Regen erhoffte, ließ trotz inniger Gebete seit Wochen auf sich warten.
Am Tag zuvor hatte Irmentraud Sauerteig für gut vier Dutzend Brote vorbereitet, die am nächsten Tag gebacken und an die Fischer- und Bauernfamilien verteilt werden sollten, die in der Nähe des Klosters lebten. Es war der erste Sauerteig, den sie allein hatte herstellen dürfen, und sie war gespannt, ob er gelingen würde.
Mit diesen Broten wollten die Frauen eine längst vergessene Tradition wieder aufleben lassen, von deren Erfolg viel für sie abhing, das durfte Irmentraud nicht verderben. Am liebsten wäre sie deshalb mehrmals in der Nacht aufgestanden und in die Küche gelaufen, um nach dem Sauerteig zu sehen.
Wenn die Menschen am Verdersee auch vom „alten Kloster“ sprachen, handelte es sich in Wahrheit um die heruntergekommenen Reste eines einstmals stolzen Frauenstifts, dessen Blütezeit längst der Vergangenheit angehörte. Die Wände der zum ehemaligen Stift gehörenden Gebäude bestanden damals wohl hauptsächlich aus Gefachen mit Flechtwerk und Lehmverputz, die vor fast einhundert Jahren einem großen Brand zum Opfer gefallen waren.
Gerüchten zufolge wurden die noch einigermaßen bewohnbaren Gebäude im Laufe der Jahrzehnte immer wieder von einer wechselnden Handvoll Frauen bewohnt, die das Schicksal hierher verschlagen hatte. Von ihnen wurde wohl auch das eine oder andere Gemäuer notdürftig wieder hergerichtet und die Kirche instand gesetzt.
Außer hinter vorgehaltener Hand weitergegebenen Gerüchten zeugte jedoch keine Urkunde, kein Eintrag im Kirchenbuch des benachbarten Dorfes Kappel, keine Nekrologie, kein Gedenkbuch davon, wer sich seit der mehr oder weniger unauffällig erfolgten Auflösung des Stifts hier aufgehalten hatte und warum.
Wer auch immer in den vergangenen Jahrzehnten die verrottenden Gemäuer über kurze oder längere Zeit bewohnt haben mochte: Man wollte nichts mehr von ihnen wissen, ließ die Erinnerung an diese Menschen in den Falten der Vergangenheit verschwinden.
Stift oder Kloster? Kanonissen oder Mönchinnen?
Niemand kümmerte es, niemand wusste es so genau. Aber wenn man die Leute in der Gegend nach dem alten Gemäuer auf der kleinen Halbinsel zwischen Moor und See fragte, nannten sie es „das Kloster“.
Kloster Bochaugia.
Monasterium Puahauva.
Während dieses Kloster in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr heruntergekommen war, nahmen die Schutzvögte nach und nach dessen Besitz mit sämtlichen Lehen, Grundholden und Rechten für sich in Anspruch.
Diese Übernahmen waren auch bei anderen Klöstern und Stiften in den vergangenen Jahrzehnten üblich geworden, und nicht nur bei solchen, die von Frauen bewohnt wurden, wie Irmentraud inzwischen wusste. Es war wohl schon immer das Bestreben von Vögten, Ministerialen, ja selbst Bischöfen und anderen wichtigen Männern des Adels und Klerus gewesen, ihren Reichtum und vor allem ihre Macht zu erweitern.
Dass viele Klöster und Stifte zu jener Zeit aufgelöst wurden, lag allerdings oftmals nicht nur an der gierigen Hand ihres Schutzvogtes, sondern auch am unmönchischen Lebenswandel ihrer Bewohner. Vor allem den Mönchen wurde nachgesagt, dass sie eher dem Fressen und Saufen als dem Beten und Lesen heiliger Schriften zugetan seien. Es gab auch Gerüchte, dass sie selbst vor Betrug und Simonie nicht zurückschreckten.
Gaugraf Wolfrad III. von Altshausen, Herr über den Eritgau und Schutzvogt des Bochaugia, war nur widerwillig bereit gewesen, den neuen Bewohnerinnen wenigstens die Nutzung der Besitztümer im direkten Umfeld ihres Klosters zuzugestehen. Die Frauen hatten nach mühsamem Ringen mit den Abgesandten des Grafen ein paar kleinere Wiesen und Felder in der Nähe des Klosters zugesprochen bekommen, die sie für ihren eigenen Bedarf bewirtschafteten. Allerdings waren es äußerst feuchte Stücke, die mehr oder weniger erfolgreich dem Moor abgerungen worden waren, das den Verdersee umgab. Außerdem durften die Frauen einen Teil des Fischfangs aus dem See für sich beanspruchen.
Von alldem waren die Bauern und Fischer nicht sonderlich erbaut, deren Bedenken der Graf nur zu gerne teilte. Dies wohl in der Hoffnung, die kleine Gemeinschaft im Kloster würde sich dadurch lieber früher als später wieder auflösen, wie die anderen zuvor.
Dass zum ursprünglichen Besitz des Bochaugia auch Märkte wie Mangen und Sulgen gehört hatten, wies der Graf weit von der Hand. Zur Bekräftigung seiner Ansprüche berief er sich auf eine Empfehlung des heiligen Benedikt zum Verzicht auf Besitz. Mochte ihm der Teil in den Schriften des Heiligen entgangen sein, in dem von Nächstenliebe und dem behutsamen Umgang mit seinen Mitmenschen die Rede ist, so wusste er sich doch eindringlich auf die Passage zu berufen, in der steht, dass „von den Ordensleuten zu wirtschaften sei, um zu geben, nicht, um zu nehmen und sich damit zu bereichern“. Dabei war dem Herrn Grafen völlig gleichgültig, dass die sieben im Kloster lebenden Frauen keinem Orden angehörten – auch nicht dem des heiligen Benedikt.
Der achtundzwanzigste Tag des Erntemonats nun galt als Ehrentag der mutmaßlichen Stiftsgründerin Haddellind, einer ehemaligen Äbtissin namens Adelinde und deren Mutter Attalind. Ihnen zu Ehren und Gedenken sollten an diesem Tag die Brote gebacken werden, für die Irmentraud den Sauerteig vorbereitet hatte. Außerdem wollten die Schwestern den Menschen in ihrem Umfeld zeigen, dass sie ihnen wohlgesonnen waren und ihre Rechte nur in Anspruch nahmen, um in aller Bescheidenheit zu leben und das kleine Kloster eines Tages wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Das wiederum würde allen zugutekommen.
Irmentraud drehte sich zur Wand und zog sich ihr Leintuch als Schutz gegen die Stechmücken über den Kopf, um vor dem Morgengebet noch ein wenig Ruhe zu finden.
Ihre Gedanken huschten wie Schlafwandler durch den Raum und fingen dabei die Lebensgeschichten der Frauen ein, die sie letztendlich hierhergeführt hatten.
Vor etwas mehr als zwei Jahren hatten zuerst Agnes, dann jeweils kurz hintereinander die zierliche Gabriela mit ihrer im Gegensatz dazu hoch aufgeschossenen jüngeren Schwester Gerlindis, die immer ein wenig kränklich scheinende Anna, die eher stämmige, praktisch veranlagte Wiltrude, die durch ihre Körperfülle ein wenig ungelenk wirkende Hildegard und zuletzt Irmentraud selbst Einzug in die heruntergekommenen Gemäuer des ehemaligen Stifts gehalten.
Agnes, die in einem benediktinischen Kloster aufgewachsen und dort auch geweiht worden war, hatte als von den Frauen gewählte Oberin von Bischof Ulrich I. von Kyburg-Dillingen in Constantia, mit dem sie mütterlicherseits entfernt verwandt war, die Erlaubnis eingeholt, das Gemäuer seiner alten Bestimmung zurückzugeben. Der Bischof stimmte zu, wenn sich die Frauen einigen von ihm auferlegten monastischen Regeln unterwarfen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um die Einhaltung der Stundengebete sowie um Demut, Keuschheit, Besitzlosigkeit und Gehorsam. Diese Regeln entsprachen neben der Liebe zu Gott und den Nächsten den Empfehlungen des heiligen Benedikt von Nursia, an die sich die sieben Frauen ohnehin weitestgehend hielten.
Agnes und Gerlindis waren durchaus gebildet. Sie konnten lesen und schreiben, wie es für Frauen aus höheren Kreisen und unter Handelsleuten üblich war. Gabriela dagegen tat sich ein wenig schwer damit und ließ sich lieber vorlesen, als es selbst zu versuchen.
Hildegard hatte lesen, schreiben und dazu noch Latein von ihrem Onkel gelernt, der im Kloster Petrihusa am Bodmansee lebte. Sie nahm nach seinem Tod den Schleier, verließ jedoch das Kloster, als die Zustände dort immer unerträglicher für sie wurden. Ihr Ziel war ursprünglich das Benediktinerinnenkloster in Gisinvelt gewesen, wohin bereits zwei weitere Schwestern aus Petrihusa gegangen waren. Allerdings kam sie in Gisinvelt nie an, sondern rettete sich während eines heftigen Gewitters in das notdürftig Schutz bietende Gemäuer des Bochaugia. Mit Hilfe der fünf dort lebenden Frauen kurierte sie eine üble Erkältung aus – und blieb.
Gabriela und ihre jüngere Schwester Gerlindis brachten als Mitgift kleinere Besitztümer ein, die sich im Herzogtum Baiern befanden. Agnes, Anna, Hildegard und Wiltrude hatten Stoffe und Garne aus Leinen, Hanf und Wolle als Mitgift dabeigehabt, auch kleinere Summen an Geld, außerdem etliches an Gerätschaften für Haushalt und Garten, die hoch willkommen gewesen waren. Denn gerade solche Dinge fehlten in den alten, leerstehenden Gemäuern, als die Frauen nach und nach dort einzogen.
Die Mitgiften hielt Hildegard gewissenhaft in einem Dokument fest, das sie hütete wie ihren Augapfel. Galt es doch, den Besitz des Klosters mitsamt den neu eingebrachten Gütern der Frauen vor dem Zugriff ihrer Schutzvögte zu bewahren.
Drei Monde zuvor hatte Irmentraud in einem vergessenen Raum hinter der Krypta der kleinen Stiftskirche mehrere mit in Öl getränkten Tüchern umwickelte Kisten gefunden, in denen uralte Dokumente lagerten. Dass diese Kisten nicht einfach irgendwo vergraben, sondern in diesem wohl einstmals zur Krypta gehörenden, vollständig ummauerten und versiegelten kleinen Gewölbe aufbewahrt wurden, zeigte, dass die Dokumente für ihre Besitzerinnen sehr wichtig gewesen sein mussten und nicht verloren gehen sollten. Wem sie wichtig waren, wer sie versteckt hatte, wann und weshalb, würde wohl für immer ihr Geheimnis bleiben.
Irmentraud schüttelte sich, als sie daran dachte, wie sie in das unheimliche Gewölbe gekrochen war, das sie durch Zufall auf der Suche nach einer Katze entdeckt hatte.
Die von den Frauen mühsam geborgenen Kisten wurden im Dachgeschoss ihres Wohngebäudes aufbewahrt, das sie eiligst herrichteten und das Hildegard seitdem als Skriptorium, also Schreibstube und Archiv, nutzte, und wo sie auch ihre Liste mit den Mitgiften der Schwestern aufbewahrte.
Hildegard mühte sich hin und wieder damit ab, ein paar der Dokumente so gut es ging zu lesen und zu archivieren, verlor aber schon bald das Interesse daran, weil es wichtigere Aufgaben zu erledigen gab. Außerdem konnte sie nur Teile der uralten Handschriften entziffern, die zumeist in Latein oder mit sehr altertümlichen Ausdrücken verfasst waren. Die waren für sie oftmals unverständlich, da sie ihre Bedeutung überhaupt nicht kannte. Deshalb lagerten die meisten Schriften weiterhin in ihren alten Holzkisten, die von den Frauen gereinigt, sorgfältig mit Wachs behandelt und an einigen Schadstellen ausgebessert worden waren.
Zu den Tieren, die um das Kloster lebten und von Wiltrude und Anna versorgt wurden, gehörte auch ein struppiger Hund, dessen plötzliches Gebell Irmentraud nun aus ihren Gedanken riss.
„Jagt das Vieh fort!“, ließ sich von Agnes unwirsch vernehmen. „Erst die Mücken, dann unsere Irmentraud mit ihrer Herumwälzerei die ganze Nacht, und jetzt der Hund!“
„Der jagt wahrscheinlich eine Katze“, stellte Gabriela verschlafen fest.
„Ich höre schon die halbe Nacht eine Katze maunzen“, jammerte Wiltrude. „Wird rollig sein.“
„Eine rollige Katze?“, ließ Anna verlauten, die in einer unglücklichen Ehe zwei tote Kinder zur Welt gebracht hatte, weshalb ihr Mann sie aus dem Haus warf. „Das hört sich eher an wie ein Säugling, der Hunger hat.“
„Es ist ohnedies an der Zeit, sich auf das Morgengebet vorzubereiten“, unterbrach Irmentraud das Gespräch, die froh war, einen Grund zum Aufstehen gefunden zu haben. „Ich sehe nach, warum sich der Hund so wild gebärdet. Vielleicht kann ich der armen Katze helfen.“
Sie kroch von ihrem Lager und spähte durch eines der kleinen Fenster hinaus in den mit einer halbhohen Bruchsteinmauer umfriedeten Hof. Erschrocken drehte sie sich zu den Frauen um, die inzwischen ebenfalls aufgestanden waren, um ihre Morgentoilette zu verrichten. „Da liegt ein Bündel unter dem Holunderbusch, in dem sich etwas rührt!“, rief sie ihnen aufgeregt zu.
Barfuß lief sie über den kleinen Hof, verscheuchte den Hund und ging an dem Busch in die Hocke.
Ein hochrotes, völlig verweintes Gesichtchen war über einem weißen Leinentuch zu sehen, das kunstvoll um ein winziges Körperchen gewickelt war. Jemand hatte das Kind auf ein Stück Lammfell gebettet, auf dem inzwischen Ameisen herumkrabbelten.
„Kommt schnell!“, rief Irmentraud aufgeregt zum Haus hinüber. „Das ist keine rollige Katze! Jemand hat einen Säugling unter den Busch gelegt!“ Sie strich mit dem Zeigefinger über die tränennasse Wange des kleinen Menschleins, das sie mit großen Augen ansah und zu weinen aufhörte. „Wer bist du denn?“
„Als ob sie dir antworten könnte“, knurrte eine der Frauen hinter ihr, die inzwischen ebenfalls in den Hof gekommen waren.
„Sie.“ Irmentraud zeigte auf das Bündel.
„Ja: sie. Es wird wohl niemand einen kleinen Buben hier bei uns ablegen“, entgegnete Anna, während sie neben Irmentraud in die Hocke ging. Sie fächerte dem Gesichtchen des Kindes mit der Hand ein wenig Luft zu und erhob sich wieder. „Wenn du nicht willst, dass das arme Würmchen in der Hitze des beginnenden Tages verdurstet, sieh zu, dass es etwas zu trinken bekommt.“
Irmentraud schaute zweifelnd zu der Älteren hoch. „Ich habe noch nie …“, begann sie. „Ich weiß nicht …“
„Dann lernst du es.“ Anna drehte sich um und schaute in die überrascht auf sie gerichteten Augen der anderen Frauen, die inzwischen dazugekommen waren.
Gerlindis kniff die Lippen zusammen und verschränkte die Arme vor der Brust. „Wollen wir das Balg etwa behalten?“
„Das können wir später noch entscheiden“, mischte sich ihre Schwester Gabriela ein und schenkte dem Kind ein liebevolles Lächeln. „Inzwischen sollten wir dafür sorgen, dass es nicht verdurstet oder in der Hitze umkommt, wie Anna gesagt hat.“
„Jetzt mag das hungrige Mäulchen ja noch nicht allzu sehr gestopft werden müssen, aber das Balg wird größer, und es sieht nicht so aus, als hätte es für seinen Unterhalt mehr als die Windeln und das Leintuch mitgebracht, in das es gewickelt wurde“, gab Gerlindis mürrisch zu bedenken.
„Wie das Jesuskind“, erinnerte Gabriela ihre Schwester an das Neue Testament und schlug ein Kreuz über der Brust.
„Das hier ist aber nicht Bethlehem, und wir sind nicht Maria und Josef“, zischte Gerlindis zurück, dass Gabriela sich erschrocken ein zweites Mal bekreuzigte.
Dann streckte sie den Zeigefinger zum Verdersee hin aus. „Du kannst es ja ersäufen, wenn dir nichts Besseres einfällt!“, schlug sie wütend vor.
„Oder wir können es an einen der Bauern oder Fischer verkaufen. Dann hätte es noch einen Sinn gehabt, dass man das Balg hier ablegt. Unserer Geldkatze würde es sicherlich guttun“, gab ihre Schwester zurück und verzog spöttisch den Mund. „Du hast keine rollige Katze gehört heute Nacht“, stellte sie an Wiltrude gewandt fest. „Es war dieses Kind! Ich weiß nicht, was besser …“
„Hört sofort auf damit!“, befahl Agnes, die als Letzte dazugekommen war und sich mit in die Hüfte gestemmten Fäusten vor Gerlindis stellte. „Wenn seine Mutter gewollt hätte, dass es ertränkt wird oder einem Bauern als Magd dienen soll, dann hätte sie sich selbst darum gekümmert und das Kleine nicht in unsere Obhut gegeben.“
„In unsere Obhut! Scheint dem feinen Tuch nach eine vornehme Dame zu sein, diese ach so fürsorgliche Mutter“, stellte Gerlindis mit verächtlich nach unten gezogenen Mundwinkeln fest und zupfte mit spitzen Fingern an dem sorgfältig gewickelten Leintuch.
„Auch unter vornehmen Leuten soll es welche geben, die ihr Kind nicht haben wollen oder behalten können“, warf Wiltrude ein. „Ein Kloster ist nicht der schlechteste Ort, um ein Kind abzugeben.“
„Heimlich und bei Nacht?“, fragte Gerlindis mit nach wie vor spöttisch verzogenem Mund. „Damit nicht herauskommt, wer sich seines Balges entledigen wollte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Eine wahrlich fürsorgliche Mutter!“
„Du selbst musstest doch …“, wagte Gabriela einen Einwand.
„Das alles ist wohl möglich“, unterbrach Agnes die beiden ruhig und schob Gerlindis’ Hand beiseite, die noch immer wie prüfend das feine Leinen festhielt, das um das Kind gewickelt war. „Aber es soll uns nicht weiter kümmern. Das Kleine befindet sich jetzt in unserer Obhut und wir werden alles tun, damit es ihm gut geht.“
„Ich werde eine unserer Ziegen melken und dem Kind etwas von der Milch zu trinken geben“, schlug Wiltrude vor und machte sich eilig auf den Weg zum Stall, nachdem Agnes ihr aufmunternd zugenickt hatte.
„Wir müssen den Bischof in Constantia fragen, ob er uns erlaubt, das Kind zu behalten, oder?“, gab Hildegard mit einem Seitenblick auf Gerlindis zu bedenken, die das Geschehen weiterhin mit finsteren Blicken begleitete. „Vorher müssen allerdings wir uns darüber einigen, ob es hierbleiben kann oder nicht. Dass wir es zunächst einmal versorgen, ist unsere Christenpflicht.“
„Was geschieht mit dem Kind, wenn wir es nicht behalten?“, wandte sich Irmentraud an Agnes, während sie das Bündel behutsam hochhob und in den Armen wiegte. Dabei warf sie einen vorsichtigen Blick zu Gerlindis hinüber, die mit vor der Brust verschränkten Armen dastand und sie mit zusammengezogenen Augenbrauen beobachtete.
„Gerlindis hat leider recht: Die meisten Findelkinder werden an Bauern oder Handwerker verkauft, wenn sich keine Familie bereiterklärt, sie anstelle eines eigenen Kindes aufzunehmen. Wie das Schicksal dieses Kindes dann aussehen könnte, muss ich dir wohl nicht näher beschreiben“, antwortete die Oberin. „Seine Mutter hoffte wohl, dass sich hier genügend Ersatzmütter für ihr Kind fänden, damit es wohlbehütet aufwachsen kann.“ Sie schaute von einer zur anderen, und ihr Blick blieb an Gerlindis’ nach wie vor ablehnendem Gesichtsausdruck hängen. „Ich denke, wir sollten sie nicht enttäuschen.“
„Dann scheint diese Mutter uns zu kennen“, murmelte Hildegard, auf deren Stirn sich eine tiefe Falte gebildet hatte. „Vielleicht war sie erst kürzlich hier und hat gesehen, dass es uns möglich sein könnte, das Kind großzuziehen. Erinnert sich …“
Agnes wandte sich zu ihr um legte eine Hand auf ihren Arm. „Wir werden nicht versuchen herauszufinden, welche Frau in unserer Gegend kürzlich guter Hoffnung war, aber jetzt keinen Säugling an der Brust hat“, unterbrach sie die Schwester. „Wir werden uns an den guten Brauch halten, wonach Frauen, die ein Kind unter dem Herzen tragen, unseres besonderen Schutzes bedürfen und sicher sind. Wenn es ihnen nicht möglich ist, ihr Kind aufzuziehen – ganz gleich, aus welchem Grund –, nehmen wir uns anstelle der Mutter seiner an.“
Sie schaute einer nach der anderen in die Augen. Keine von ihnen wagte ihr zu widersprechen, auch Gerlindis nicht, die daraufhin mit zusammengekniffenen Lippen den Blick senkte.
„Bringen wir das Kind in unser Dormitorium“, forderte Agnes die Frauen schließlich auf und ging ihnen voran ins Haus.
Irmentraud betrachtete das hochrote Gesichtchen liebevoll, aus dem sie zwei große Augen anschauten. Seit die junge Schwester es gefunden hatte, gab das Kleine keinen Ton mehr von sich und schien mit zitternden Lippen abzuwarten, was weiter geschah. „Du hast es gehört: Du wirst in Gottes Namen statt einer ab jetzt sieben Mütter haben, die sich um dich kümmern“, sagte Irmentraud leise und berührte die Stirn des Kindes. „Sie ist ganz heiß!“
„Ihr könnt es halten, wie ihr wollt“, hörte sie Gerlindis neben sich sagen. „Ich habe nicht die Absicht, für egal wessen Kind die Mutter zu spielen.“
Hildegard schob Irmentraud von Gerlindis weg und vor sich her zum Schlafraum. „Geh. Da drin ist es nicht viel kühler, aber immer noch besser als draußen.“
Gerlindis trat wütend nach dem Hund, der in der Hoffnung auf Futter am Weg wartete, dann hob sie das zurückgelassene Lammfell auf und warf es hinter den Frauen her in den Flur, bevor sie sich auf den Weg in die Küche machte. Sollten die anderen Weiber sich doch um das Balg kümmern. Wahrscheinlich hatte es Fieber und war krank.
Umso besser.
Kranke kleine Kinder lebten nicht lange.
*
In dem Bündel steckte tatsächlich ein kleines Mädchen, das weiterhin ohne einen Ton von sich zu geben alles über sich ergehen ließ. Nur die Mundwinkel zuckten immer wieder verdächtig.
„Was ist das?“, wollte Irmentraud wissen, als das Kind ausgewickelt vor ihnen lag.
„Das ist ein Säckchen mit Salz“, erklärte Hildegard naserümpfend, während sie mit den übelriechenden Hinterlassenschaften in der Windel des kleinen Mädchens beschäftigt war. „Es bedeutet, dass die Kleine noch nicht getauft wurde. Aus dem Haus armer Leute stammt sie ganz sicherlich nicht. Die würden niemals so etwas Wertvolles wie Salz weggeben, wenn sie überhaupt welches hätten.“
„Wir können froh sein, dass das Kind zumindest keine sichtbaren Missbildungen hat, und stumm ist es auch nicht“, stellte Agnes fest. „Das dürfte also nicht der Grund dafür gewesen sein, weshalb seine Mutter es unter den Busch gelegt hat. Wie alt die Kleine wohl sein mag?“, fragte sie an Anna gewandt.
„Zehn, zwölf Wochen vielleicht?“, antwortete diese und zeigte auf den bereits verheilten Nabel. „Neugeboren ist sie jedenfalls nicht.“
Während sich die Frauen darüber unterhielten, weshalb jemand ein Neugeborenes so lange bei sich behält, um es dann wegzugeben, tauchte Wiltrude einen Finger in die mitgebrachte warme Ziegenmilch und hielt ihn der Kleinen vorsichtig an die Lippen. Als das erste Tröpfchen in den Mund des Mädchens rann, öffnete es ihn und begann, hungrig an dem Finger zu saugen, den Wiltrude immer wieder in die warme Milch tauchte. Die Kleine begann jedoch wieder jämmerlich zu weinen, weil sie so nicht satt wurde.
„Wir müssen eine Amme für sie finden“, stellte Wiltrude nach einer Weile seufzend fest.
„Das wird nicht leicht werden“, wandte Anna ein, während sie die Kleine in ein frisches Tuch wickelte. „Wir werden uns wohl eher etwas für die Ziegenmilch einfallen lassen müssen.“
„Ah!“ Agnes hinkte in die Küche und fand nach einer kleinen Weile, wonach sie gesucht hatte: das Horn einer Ziege.
„Wir werden es gründlich säubern, an der Spitze durchbohren und mit einem Tuch umwickeln, damit sich die Kleine beim Trinken nicht wehtut“, beantwortete sie die fragend auf sie gerichteten Blicke der Schwestern, als sie zurückkam. „Auf diese Weise kann sie die Milch unserer Ziege trinken, bis sie alt genug ist, um mit einem kleinen Löffel gefüttert zu werden.“ Sie wandte sich an Irmentraud, die den Blick nicht von dem Kind wenden konnte. „Der Sauerteig ist übrigens ganz vorzüglich aufgegangen …“
Irmentraud schlug die Hand vor den Mund und eilte in die Küche, gefolgt von Wiltrude, die ihr beim Backen helfen sollte.
„Vielleicht spricht uns jemand auf das Kind an“, meinte Agnes, als sie zur frühen Abendzeit mit Wiltrude und Anna vor die Pforte trat, um das Brot an die Menschen zu verteilen, die sich langsam dort einfanden. Aber niemand sprach sie auf das Findelkind an, und da Agnes die Schwestern beschworen hatte, Stillschweigen darüber zu bewahren, blieb die Herkunft des Kindes weiterhin ein Geheimnis.
Immerhin schienen sich die Menschen über die Brotgabe zu freuen und hinterließen bei den von ihnen inzwischen „Mönchinnen“ genannten Schwestern das Gefühl, damit auch für sich und ihr kleines Kloster etwas Gutes getan zu haben.
*
Die Mönchinnen beschlossen, das Mädchen nach dem Tag seiner Auffindung auf den Namen Adelindis taufen zu lassen, da sie ja nicht wussten, an wessen Namenstag das Kind geboren war. Nachdem sich Pater Odalrich aus dem benachbarten Kappel mit eigenen Augen davon überzeugt hatte, dass nichts Unrechtes an dem Mädchen war, willigte er ein. Allerdings mussten die Frauen ihm zusagen, dass er und seine Gemeinde nicht für den Unterhalt des Kindes zu sorgen hätten.
Es war der erste Gottesdienst seit Langem, der in der Stiftskirche abgehalten wurde … und sollte vorerst auch der letzte bleiben.
Hatten die Schwestern geglaubt, Anna mit der Verantwortung für das Mädchen über den Schmerz um den Verlust ihrer eigenen Kinder hinwegzuhelfen, mussten sie sich bald eingestehen, dass genau das Gegenteil geschah: Anna verfiel kurze Zeit nach dem Auffinden des Kindes in tiefe Schwermut, und so kümmerte sich Irmentraud um die Kleine.
*
Adelindis wuchs zu einem fröhlichen, lernbegierigen Kind heran, das überall half, wo auch immer es gebraucht wurde. Der kleine Wirbelwind mit den dunklen Locken hütete mit Wiltrude die Ziegen, Enten und Gänse, wenn sie auf eine ihrer kleinen Wiesen in der Nähe des Verdersees gebracht wurden, fütterte mit Gabriela die Hühner, nahm eifrig an den Messen in der Pfarrkirche zu Kappel und an den Stundengebeten im Kloster teil, bei denen sie anfangs allerdings immer einschlief.
Gabriela nähte und bestickte neue Kleider, wenn die alten dem Jungfräulein zu klein wurden, und Wiltrude kümmerte sich um einfaches Schuhwerk für sie. Nur Gerlindis verhielt sich nach wie vor abweisend dem Kind gegenüber, was Adelindis manchmal erschreckte, die mit unschuldigen kleinen Gesten immer wieder versuchte, die Schwester für sich zu gewinnen. Im Laufe der Zeit begegnete Adelindis ihr zwar mit vorsichtiger Zurückhaltung, bedachte sie jedoch weiterhin mit denselben kindlichen Aufmerksamkeiten, die sie auch den anderen sechs Frauen angedeihen ließ. Allerdings ohne auch nur das geringste Zeichen von Zuneigung oder Wertschätzung von der stets mürrisch wirkenden Schwester zu bekommen.
Während Irmentraud versuchte, den Wissensdurst ihrer Ziehtochter zu stillen, bezeichnete Hildegard das alles eher als Neugier, die sie nicht in jedem Fall zu fördern bereit war. Trotzdem unterrichtete sie Adelindis geduldig in Latein, nachdem das Mädchen erstaunlich schnell lesen, schreiben und von Agnes auch rechnen gelernt hatte.
„Siehst du“, sagte Irmentraud eines Abends zu Hildegard, nachdem diese sich lobend über die Fortschritte ihrer Elevin geäußert hatte. „Es geht um Wissen, nicht um Neugier. Außerdem leben wir doch im Geiste des heiligen Benedikt, dem viel an Bildung lag.“ Es war ihr sehr wohl aufgefallen, wie stolz die Schwester auf das Ergebnis ihres Unterrichts war.
Hildegard errötete ob des Lobs. Obgleich sie selbst ständig die größeren und kleineren Verfehlungen ihrer Mitschwestern anmahnte, indem sie die Regeln des heiligen Benedikt oder die Bibel zitierte, so wollte sie doch keinesfalls selbst gerügt oder gar bei der achten Todsünde erwischt werden, die es ihrer Meinung nach unbedingt zu vermeiden galt: der des Stolzes.
Über Irmentrauds Gesicht glitt ein verschmitztes Lächeln, wusste sie doch nur zu gut, dass sich hinter Hildegards oftmals streng anmutenden Äußerungen im Grunde genommen eine tiefe Zuneigung zu ihrer Schülerin verbarg, die sie einfach nicht zeigen konnte. Vielleicht fürchtete sie, das Mädchen zu verweichlichen und nicht gründlich genug auf eine sicherlich schwierige Zukunft vorzubereiten.
„Weder Neugier noch Wissensdurst gehören zu den Todsünden, liebe Schwester“, sagte Irmentraud und legte der Älteren tröstend einen Arm um die Schulter. „Ich finde, dass auch diese Art Stolz nicht dazugehört, und dass du zu Recht stolz auf das sein kannst, was du nicht nur bei unserem Findelkind bewirkt hast.“ Sie zeigte auf sich selbst. „Auch ich habe sehr viel von dir gelernt, wofür ich dir von Herzen dankbar bin.“ Nachdem Hildegard nicht darauf antwortete, fügte sie noch hinzu: „Liebe ist etwas, mit dem verschwenderisch umgegangen werden darf und wofür unser Herr Jesus Christus uns zu allen Zeiten ein Vorbild ist.“
Das verstand Hildegard sehr gut, die sich fürderhin um ein Gleichmaß all dessen bemühte, was sie Adelindis zu geben vermochte.
*
Die Frauen kümmerten sich weiterhin rechtschaffen darum, ihre kleine Kirche und das Wohngebäude des ehemals stolzen Klosters so weit instand zu setzen, dass es nicht mehr durch das Dach regnete und der Wind in der kalten Jahreszeit keinen Weg mehr durch die Ritzen in den Wänden fand. Hin und wieder halfen durchziehende Handwerksburschen dabei, wenn sie dafür etwas zu essen bekamen oder die Mönchinnen ihre Hemden, Kittel oder Beinlinge flickten. Aber den Hauptteil der Arbeiten übernahmen nach wie vor die Frauen selbst.
Es gab inzwischen auch den einen oder anderen Fischer und Bauern, der Werkzeug, Holz, Steine und Mörtel brachte und im Gegenzug die Frauen für die Kranken und Verstorbenen aus seiner Familie beten ließ. Oder Bäuerinnen kamen ins Kloster, die den Mönchinnen allerlei Brauchbares für Küche und Stall schenkten. Man hatte die sieben Frauen mit ihrem Findelkind inzwischen als das angenommen, was sie von Anfang an sein wollten: als Menschen, die, soweit es ihnen möglich war, nach den Regeln des heiligen Benedikt von Nursia leben und überleben wollten.
Im Laufe der Zeit war ein einfach eingerichtetes Dormitorium, ein Refektorium und eine Kammer für mögliche Gottesbesucher entstanden, die Küche mit allen notwendigen Gerätschaften bestückt, und letztendlich war noch das Skriptorium mit grob gezimmerten Regalen, einem Pult, einem kleinen Tisch und zwei Hockern ausgestattet worden. Außer dem Dormitorium konnten inzwischen alle Räume über die Feuerstelle in der Küche ein wenig beheizt werden, sodass sie auch in der kalten Jahreszeit genutzt werden konnten. Das unterschied dieses Haus von den Hütten der einfachen Menschen. Deren Feuerstellen waren teilweise so ungeschickt angelegt, dass der Rauch oftmals das ganze Haus füllte, es aber kaum wärmte. Die Feuerstelle im Bochaugia hingegen hatte einen Rauchabzug. Das mussten sich die Vorgängerinnen, beziehungsweise deren Baumeister, so ausgedacht haben, wofür ihnen die Frauen zutiefst dankbar waren.
Selbst die den beiden Heiligen Cornelius und Cyprianus geweihte kleine Kirche konnte sich inzwischen wieder sehen lassen, nachdem die Wände neu mit Lehm verputzt und der Hochaltar ausgebessert und mit Tüchern bedeckt worden war, die Wiltrude und Gabriela wunderschön bestickt hatten. Der kleine Klostergarten gab ohnehin schon längst alles her, was für die Küche gebraucht wurde.
Irmentraud hatte vergeblich gehofft, dass sie doch noch erfuhren, wer die Mutter ihres Findelkindes war, um ihr die Tochter eines Tages wohlbehalten zurückgeben zu können. Sie hatte unter den Bauern und Fischern munkeln gehört, es sei eine edle Frau gewesen, die einen argen Fehltritt begangen habe und ihr Kind vor den Nachstellungen ihrer Familie schützen wollte. Sie sei nachts um die Klostermauer geschlichen und habe das Kleine abgelegt, als dort alles still gewesen sei. Allerdings blieb dabei die Frage, weshalb der Hund das Kind erst morgens verbellte, was wiederum zu dem Gerücht führte, eine der Mönchinnen habe es heimlich zur Welt gebracht, und ihre Mitschwestern hätten versucht, diese Ungeheuerlichkeit zu vertuschen. Der Hund gehörte indes nicht den Frauen: Er war ein alter Streuner, der sich hin und wieder im Kloster blicken ließ und um ein wenig Futter bettelte. An diesem Morgen war er wohl nur zufällig da gewesen.
Die Jahre vergingen, die Gerüchte verstummten. Adelindis selbst schien sich keine Gedanken um ihre Herkunft zu machen. Sie löcherte die Frauen vielmehr mit Fragen, was zu tun sei, damit sie wie Agnes und Hildegard den Schleier nehmen und mit dem Herrn Jesus vermählt werden könne. Aber darüber wollten die Schwestern nicht entscheiden, die ja selbst nicht alle ein Gelübde abgelegt hatten. Das wollten sie Bischof Ulrich II., dem Nachfolger des im August 1127 im Kloster Märgen verstorbenen Ulrich I. von Kyburg-Dillingen, überlassen. Denn ganz so einfach war das alles nicht, da das Bochaugia ja keinem Orden angehörte.
Ulrich II. blieb ihnen bislang eine Antwort schuldig. Er war in Streitereien um die Burg Castell verwickelt, die sein Vorgänger als möglichen Rückzugsort errichten ließ und die er wieder abzureißen gedachte. Ihn interessierte das Wohl und Wehe des kaum einträglichen Klosters am Verdersee und die Geschicke und Befindlichkeiten der darin hausenden Weiber nicht.
*
Anna verstarb wenige Jahre nach dem Auffinden des kleinen Mädchens, nachdem sie von unsäglicher Schwermut befallen wurde, von der sie sich nicht mehr erholte. Denn als sie erfuhr, dass ihr früherer Mann stolzer Vater eines gesunden Buben geworden war, den er mit seiner zweiten Frau gezeugt hatte, war sie kaum noch von ihrem Lager aufgestanden, hatte jegliche Mahlzeit verweigert und verstarb schließlich völlig entkräftet in den Armen der Mutter Oberin.
Irmentraud teilte die allgemein herrschende Meinung nicht, wonach Frauen ihr Schicksal demütig anzunehmen und darüber hinaus zu akzeptieren hatten, dass Männer dieses Schicksal für sie bestimmten. Nachdem Anna verstorben war, vertraute sie Agnes an, dass sie als fünfte Tochter eines von Armut betroffenen Edelmannes und seiner Frau im Alter von zwölf Jahren einen Kaufmann hatte ehelichen sollen, der mehr als doppelt so alt war wie sie. Ihr Vater hatte diese Heirat eingefädelt, weil der betreffende Mann ein stattliches Vermögen hatte, aus angesehenem Adelshause stammte, eine Heirat mit ihm für beide Seiten ein gutes Geschäft und für sie selbst ein absoluter Glücksfall sei.
Doch drei Wochen vor der Eheschließung erlag der Bräutigam den Folgen einer brandig gewordenen Wunde, die er sich bei der Jagd zugezogen hatte. Da er seine Braut bereits beschlafen hatte, „um herauszufinden, ob sie noch jungfräulich war“, wie er sein Tun vor deren Vater rechtfertigte, blieb ihren Eltern – wohl vornehmlich um ihren eigenen guten Ruf bedacht – nichts anderes übrig, als Irmentraud in einem Kloster unterzubringen. Niemand würde sie mehr ehelichen wollen, sagten sie, und sie müsse sogar damit rechnen, für ihr unsittliches Treiben zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hatte ihre Familie gehofft, sich durch die Verheiratung der Tochter aus ihrer misslichen Lage zu retten, so stand sie jetzt vor dem völligen Ruin. Das wiederum war schlussendlich der Grund dafür, weshalb keines der infrage kommenden Klöster das Mädchen aufnahm.
Irmentraud hörte nie wieder von ihren Eltern, nachdem sie deren Haus verlassen musste, und war heilfroh, dass der von ihrer Seite aus unfreiwillig vollzogene Beischlaf ohne Folgen geblieben war. Dass sie ausgerechnet in den mehr schlecht als recht wieder aufgebauten Mauern eines einstmals abgebrannten Klosters unterkam, empfand Irmentraud anfangs als eine weitere Ungerechtigkeit, mit der sie im Laufe der Zeit jedoch ihren Frieden machte.
Für Anna schien es erleichternd gewesen zu sein, den anderen Frauen ihre Geschichte immer und immer wieder zu erzählen, aber für Irmentraud war es schlichtweg unmöglich, mit jemand anderem als Agnes über ihr Schicksal zu sprechen.
Als um das Weihnachtsfest im Jahr des Herrn 1132 Agnes an einer Lungenkrankheit verstarb, wurde Irmentraud im Alter von zweiunddreißig Jahren von den Schwestern als Nachfolgerin gewählt.
Irmentraud führte fortan das inzwischen wieder recht ansehnliche kleine Kloster Bochaugia am Verdersee, nachdem auch Bischof Ulrich II. sich im folgenden Frühjahr mit dieser Wahl einverstanden erklärt hatte. Dies allerdings unter der Bedingung, dass sich die inzwischen auch als „Nonnen“ bezeichneten Frauen strenger den Regeln des heiligen Benedikt unterordneten, als es bisher offenbar der Fall war. Aber der Bischof war weit …
1. Kapitel
Ich wuchs in der Obhut der Frauen des Klosters Bochaugia zu einem Mädchen heran, das am liebsten mit Hildegard in der kleinen Schreibstube unter dem Dach saß, wenn sich eine Gelegenheit dazu bot. Wir lasen ein paar der einst aus dem Raum hinter der Krypta geretteten alten Schriften, ich schrieb die eine oder andere zur Übung ab, und gemeinsam übersetzten wir sie teilweise auch. Wobei Letzteres ein mühsames Unterfangen war, da Hildegard nach wie vor oftmals nur den grundlegenden Sinn der Schriften erfassen, sie aber nicht in allen Feinheiten übersetzen konnte.
Wir lebten zwar nicht strikt nach den mönchischen Regeln des heiligen Benedikt von Nursia, aber Irmentraud bestand darauf, dass einige seiner Weisungen eingehalten wurden. Dazu gehörten die Morgen- und Mittagshore, das Abendlob und die Komplet vor dem Schlafengehen, zu denen sie uns mit einer kleinen Handglocke rufen ließ. Die Stundengebete sollten nicht nur daran erinnern, wo wir lebten und weshalb, sie sollten im Sinne Benedikts auch dazu dienen, dem Körper neben den anfallenden Arbeiten ein wenig Ruhe und dem Geist Einkehr zu gönnen. Die passenden Verse und Textstellen aus der Bibel hatte uns bereits vor vielen Jahren der alte Pfarrer von Kappel gegeben – in lateinischer Sprache, die zuerst von Hildegard, später auch von mir übersetzt wurden.
Ganz im Sinne der Kirchenväter hielten wir die Gebetszeiten mit Psalmen und kleinen Chorälen, die den Schwestern noch aus früheren Zeiten bekannt waren oder die Hildegard aus ihrem Kloster am Bodmansee mitgebracht hatte.
Ich liebte es, den Frauen beim Singen zuzuhören. Wenn ich die Augen schloss, war mir, als wäre ich im Himmel und lauschte dem Gesang der Engel.
Als ich sieben oder acht Jahre alt war, durfte ich meine Ziehmutter Irmentraud zu den Resten einer Kapelle begleiten, die sich ein gutes Wegstück von Kappel im Wald befand. Der Grund für diese kleine Wanderung war, dass ich in den alten Kisten zwei Briefe eines gewissen Hermannus Contractus an die ehemaligen Bewohnerinnen des Bochaugia gefunden und eifrig studiert hatte. Darin beschrieb er die Legenden, die hinter der Gründung des Klosters standen und die eng mit meinem eigenen Namen verbunden sind. Von einer Haddellind war darin die Rede, einer Adeligen, deren Herkunft weit im Dunkel der Geschichte lag. Alten Überlieferungen zufolge ließ sie ein Stift mit seiner den heiligen Cornelius und Cyprianus geweihten kleinen Kirche um das Jahr 770 nach Christi Geburt als Bleibe für adelige Frauen errichten, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihrer Familie leben konnten oder wollten.
Eine weitere Legende drehte sich um zwei mögliche Nachkommen dieser Haddellind, mit Namen Attalind und Adelinde. Von einer vereitelten Entführung Adelindes aus dem Kloster um das Jahr des Herrn 902 war die Rede. Ihre Brüder Peringer, Reginolph und Kerhart planten, die Jungfer gegen deren Willen zu verheiraten, wurden jedoch überfallen und gemeuchelt. Von Raubrittern war die Rede, die zu jener Zeit die Gegend unsicher gemacht haben sollen und denen die drei Männer eher zufällig zum Opfer fielen.
Bei der Rückkehr von einer Wallfahrt nach Jerusalem trat Adelindes Mutter Attalind, wie es hieß, „als Sühne für den Tod ihrer Söhne“ in das Stift ein, in dem ihre Tochter inzwischen zur Äbtissin bestellt worden war.
Eine weitere Legende besagte, es habe um das Jahr 902 nach Christi Geburt in dieser Gegend eine Schlacht zwischen Madjaren und Mähren gegeben, in der Adelindes Brüder gefallen und von ihrer Mutter in der Nähe des Stifts am Verdersee bestattet worden seien.
Einer weiteren Geschichte zufolge sei Attalinds Ehegatte in einer Schlacht im fernen großmährischen Reich gefallen und seiner Gemahlin in der Nähe von Kappel kopflos auf einem Pferd sitzend erschienen. Das nahm sie als sicheres Zeichen dafür, dass er nicht mehr zurückkehren würde. Attalind ließ daraufhin eine kleine Kapelle an der Stelle errichten, an der ihr der kopflose Gemahl erschienen war und in der sie angeblich auch die Gebeine ihrer Söhne bestattet hat.
Dieser Hermannus, dessen Briefe mir in die Hände gefallen waren, lebte vor gut einhundert Jahren. Er war Chronist und später sogar Abt auf einer „Reichenau“ genannten Insel im fernen Bodmansee gewesen, wie Irmentraud mir erklärte. Er war ein Mann aus dem Hause der Grafen von Altshausen, unserer Vogtei also, und sein Zuname Contractus dem Umstand geschuldet, dass er von Kindheit an gelähmt war. Das jedoch hatte ihn nicht daran gehindert, sich mit allem zu befassen, was ihm wichtig schien, Studien zu betreiben und die Ergebnisse in unzähligen Schriften festzuhalten. In einem der beiden Briefe, die er wohl aufgrund seiner Behinderung einem Schreiber diktiert haben mochte, bezog er sich auf die von ihm verfasste Weltenchronik, aus der er den Schwestern die Kopie eines Abschnitts zukommen hatte lassen. Offenbar erfüllte er damit einer der ehemaligen Äbtissinnen einen diesbezüglich an ihn herangetragenen Wunsch. Das Erfreuliche für mich war, dass das mehrseitige Dokument zweispaltig verfasst wurde: Auf der jeweils linken Seite stand der lateinische, auf der rechten der in unsere Sprache übersetzte Text. Das veranlasste mich dazu, eine Art Wörterbuch zu erstellen.
Mich hatte bei den Studien der alten Schrift eine Mischung aus Ehrfurcht und Neugier über das erfasst, was dieser gelehrte Mönch über die Gründung der Kapelle im sogenannten vallis planctus zu berichten wusste, dem Tal der Tränen oder des Wehklagens in der Nähe unseres Klosters. Seitdem hatte ich den Frauen mit der Bitte in den Ohren gelegen, die Kapelle sehen zu dürfen, über die Hermannus berichtete, und unter der angeblich die Gebeine der erschlagenen Brüder meiner Namenspatronin begraben liegen sollten. Ich wollte, dass endlich einmal aus mit Tinte auf einen Bogen Pergament geschriebenen Worten etwas Greifbares, Sichtbares wurde.
Hier also, mitten im Wald, stand einstmals eine kleine, aus Stein errichtete Kapelle an jener Stelle im Plankental, an der Hermannus zufolge die drei Brüder der Adelinde gemeuchelt und von ihrer Mutter bestattet worden waren.
Ich wagte zuerst nicht, die Ruine zu betreten, als wir an diesem heißen Sommertag nach einem fast eine Stunde währenden Fußmarsch dort angekommen waren. Mit gefalteten Händen stand ich vor dem verfallenen Gemäuer und hatte plötzlich das Gefühl, die schaurigen alten Geschichten um mich herum auf seltsame Weise wahrzunehmen, die sich wie feine Gespinste in meinem Kopf miteinander zu verweben schienen.
Irmentraud erzählte mir später, ich sei völlig lautlos zusammengesunken und für ein paar bange Minuten nicht ansprechbar gewesen. Sie führte die Ohnmacht ihrer kleinen Schutzbefohlenen darauf zurück, dass ich mich auf dem Weg zur Kapelle vor Aufregung übernommen und in der Hitze des Tages zu wenig getrunken hätte.
Ich sagte ihr nichts von den verwirrenden Bildern, die ich in der Zeit meiner Ohnmacht mehr spürte als sah. Dabei erinnerte ich mich daran, dass ich als sehr kleines Mädchen ähnliche Bilder gesehen hatte, wenn ich beim Mittagsmahl Geschichten über das Leben und den grausamen Tod der Heiligen zu hören bekam. Ich wusste selbst nicht, ob ich dabei träumte oder mein Kopf mir einen Streich spielte.
Deutlich habe ich bis heute die Ermahnung von Gerlindis im Ohr, nicht auf Schauermärchen wie die der alten Burgl aus Kappel zu hören, die sich um unheimliche Begebenheiten rund um den Verdersee drehten. Einmal erzählte die Alte mir von einer Stadt, die vor Zeiten im Verdersee versunken war, angeblich weil, ihre Bewohner ein gottloses Leben führten. Bei gutem Wetter könne man noch die Glocke der Kirche über das Schicksal der Stadt klagen hören, sagte Burgl und beschwor mich, immer gottesfürchtig zu sein und die Frauen im Kloster auch dazu anzuhalten.
Ich liebte es, auf unserer kleinen Viehweide bei der alten Burgl zu sitzen und ihren Geschichten zu lauschen, von denen sie behauptete, sie seien so wahr und alt wie der Verdersee selbst.
Gerlindis kam einmal dazu, verscheuchte die Alte schimpfend und verbot mir, ihr wirres Geschwätz weiterhin anzuhören. Menschen, die solcherlei Unfug erzählten, seien dem Herrn ein Gräuel und stünden oftmals mit dem Fürsten der Finsternis im Bunde, sagte sie.
Mit dem Fürsten der Finsternis wollte ich keinesfalls etwas zu tun haben, obwohl ich nicht verstand, weshalb das, was die Burgl erzählte, schlimmer sein sollte als die schrecklichen Heiligenlegenden. Burgls Erzählungen waren nie bis in meinen Kopf vorgedrungen und als furchterregende Bilder dort hängengeblieben wie die Legenden über grausam gemeuchelte Heilige.
Ich bin der Burgl danach nur noch ein, zwei Mal begegnet und habe mich dabei geschämt. Denn ich habe gesehen, wie weh es ihr getan hat, dass ich ihr aus dem Weg gegangen bin. Das hat mich mindestens so traurig gemacht wie sie, ich konnte es ihr aber nicht sagen, weil mir ja verboten war, mich ihr zu nähern.
*
Zwischen all den Beglaubigungen, Urkunden und Verträgen, die ich im Gegensatz zu den Briefen von Hermannus bestenfalls als Leseübungen betrachtete, entdeckte ich eines Tages auch die Kopie einer alten Schrift über Kräuter, Heil- und Nutzpflanzen. Staunend studierte ich die in sauberer Handschrift verfassten Verse eines Walahfrid Strabo, der vor dreihundert Jahren im Kloster Reichenau gelebt hatte wie Hermannus Contractus. Dieser Walahfrid war ebenfalls eine Zeitlang Abt des Klosters gewesen, wie ich von Hildegard erfuhr.
Das gefundene Werk nannte er Liber de cultura hortorum, also „Buch über die Kultivierung von Gärten“, und widmete es einem Grimaldus von Sankt Gallen, den Walahfrid als seinen Lehrmeister bezeichnete.
„Das ist keine von diesem Mönch selbst verfasste Schrift“, erklärte Hildegard mir und fuhr mit dem Zeigefinger ein paar der kunstvoll beschriebenen Zeilen entlang, wie ich es manchmal machte, wenn ich mich unbeobachtet glaubte. Ich fühlte mich in diesem Augenblick meiner Lehrmeisterin verbunden wie selten zuvor. „Man nennt das eine Kopie, eine Abschrift, die von jemand anderem als dem eigentlichen Urheber angefertigt wurde. Ich denke, es gibt einige davon, weil Walahfrid sicherlich wollte, dass viele Klöster ihre Gartenarbeit nach seinen Vorschlägen verrichten und ihre Gärten auf die beschriebene Weise anlegen.“
Sie schmunzelte, als sie meinen Blicken folgte, die jetzt ein wenig enttäuscht zwischen den Versen dieses bereits vor fast dreihundert Jahren verstorbenen Mannes und ihr hin und her huschten. Hatte ich doch geglaubt, etwas in Händen zu halten, das dieser gelehrte Mann erdacht und selbst aufgeschrieben hätte! Ich hatte zwar zur Übung ebenfalls schon alte Texte abgeschrieben oder kopiert, wie Hildegard es nannte, wäre aber niemals auf die Idee gekommen, dass gelehrte Mönche das auch machten. Aber dann gefiel mir der Gedanke, dass es dem Zweck dienen sollte, möglichst viele an den eigenen Erkenntnissen teilhaben zu lassen. So etwas wollte ich eines Tages auch machen. Vielleicht als Kopistin. Dass mir die Möglichkeit offenstehen könnte, selbst Studien zu betreiben, hielt ich nicht für möglich – und selbst wenn, auf welchem Gebiet sollte das sein?
Ich war sehr beeindruckt von dem umfangreichen Wissen, das ich in den lateinisch verfassten Versen des ehemaligen Reichenauer Abtes über vierundzwanzig Kräuter, Nutz- und Heilpflanzen fand und eifrig auswendig lernte. Fortan war ich immer auf der Suche nach den in diesen Versen – und weiteren in den alten Kisten entdeckten Schriften – beschriebenen Pflanzen, sobald ich die Mauern unseres Klosters verlassen konnte, um Gänse und Ziegen zu hüten oder Futter für sie zu schneiden. Dass man mit manchen Kräutern Krankheiten lindern oder gar heilen konnte, war ein Gedanke, der mich nicht mehr losließ.
Fündig wurde ich zu meinem Leidwesen jedoch sehr selten, und wenn, war ich mir nicht ganz sicher, ob sie auch wirklich denen in den Schriften entsprachen. Deshalb musste ich mich anfangs bei den meisten Pflanzen mit den Beschreibungen von Aussehen, Duft und Geschmack begnügen und mich daran erfreuen. Im Laufe der Zeit konnte ich die gefundenen Kräuter jedoch richtig zuordnen, begann sie zu pflücken und ihre Blätter, Wurzeln oder Blüten, wie in den alten Schriften beschrieben, zu trocknen.
Die Schwestern hatten bereits vor Jahren einen Garten angelegt, in dem wir allerlei Gemüse und Obst anbauten und um den ich mich inzwischen gemeinsam mit Wiltrude kümmerte. Dabei achtete ich darauf, mich so gut es ging an die Empfehlungen dieses Walahfrid zu halten, dem es wichtig erschienen war, die einzelnen Pflanzen in getrennten Beeten zu ziehen und zu pflegen.
Anfangs belächelten mich die Frauen ein wenig ob meines Eifers, ließen mich jedoch gewähren – und stellten schnell fest, dass meine Arbeit dank meines längst verblichenen alten Lehrmeisters gute Früchte trug.
Mehrmals schon hatte Hildegard mich ermahnt, niemanden wissen zu lassen, dass es hinter den Mauern unseres Klosters Frauen gab, die alte Schriften studierten, von denen außer ihnen niemand auch nur etwas ahnte. Sie befürchtete, dass man uns die Pergamente wegnehmen würde, von denen wir nicht wussten, worin ihr Wert für diejenigen gelegen haben mochte, die sie versteckt hatten. Weshalb man sie uns wegnehmen sollte, sagte sie mir nicht.
Schon gleich gar nicht sollte ich den alten Pfarrer in Kappel wissen lassen, dass ich genug Latein beherrschte, um zu merken, wie schlampig er seine oftmals in dieser Sprache gehaltenen Messen versah. Warum das so war mit der lateinischen Sprache, verstand ich nach wie vor nicht, denn ich wusste ja, dass die Besucher dieser Messen weder lesen noch schreiben und noch viel weniger Latein verstehen konnten.
Einmal hatte ich Hildegard gefragt, weshalb der Pfarrer seine Messen in Latein hielt, wenn doch niemand sie verstehen konnte. Sie antwortete, dass es eben die Sprache der Kirche und deren Erlernen höchstens Klosterschülern vorbehalten sei.
„Das verstehe ich nicht“, wagte ich noch einmal einzuwenden. „Der heilige Benedikt wollte doch ausdrücklich, dass die Menschen etwas lernen, wenn ich mich richtig an das erinnere, was du mich gelehrt hast. Wie können sie das aber, wenn es außer in Klöstern keine Möglichkeit dazu gibt, die wiederum nur Männern von Adel zugänglich sind? Du hast es doch auch gelernt!“
„Aber nicht in einer Klosterschule …“, erinnerte mich Hildegard.
Aber ich hörte gar nicht richtig zu, so aufgebracht war ich. „Nur, weil wir keinem Orden angehören und keine Männer sind, müssen wir verheimlichen, dass es in unseren Mauern Wissen gibt, das wir uns selbst erlesen haben?“ Ich musste zweimal tief Luft holen, bevor ich Hildegard wütend an den Kopf warf: „Oder ist es eher so, dass in diesen alten Mauern Regeln herrschen, die nichts mit alldem zu tun haben? Die es nur gibt, weil wir Frauen und keine Männer sind?“
„Es gibt auch Männer und Frauen, die nicht von Adel sind und trotzdem lesen, schreiben und rechnen können“, sagte Hildegard, ohne auf meinen Wutanfall einzugehen.
„Es geht um Wissen, nicht um das Zählen und Aufschreiben von Handelswaren“, hielt ich dagegen, wohl wissend, wovon sie sprach.
Darauf konnte Hildegard nur „Das ist so bestimmt“ antworten. Ein Satz, den ich immer wieder zu hören bekam, wenn ich etwas hinterfragte, auf das Hildegard die Antwort verweigerte, verweigern musste – weil sie keine hatte, wie ich heute weiß.
„Es steht uns Frauen nicht zu, den Männern nachzueifern“, erklärte mir meine Lehrmeisterin dann immer wieder. „Der Mann ist das Haupt der Frau, er sagt ihr, was sie tun darf und was nicht. Wir sind als seine Dienerinnen geschaffen, gebären seine Kinder und kümmern uns darum, dass es ihm, der Familie und ihrem Haushalt gut geht. So steht es in der Bibel, so ist es vom Herrn gewollt, das ist nicht zu hinterfragen.“
Das sagt wohl eher der alte Pfarrer in Kappel, fügte ich in Gedanken hinzu, und wenn es sich dabei nicht gerade um Mönchinnen handelt, die ehelos zu bleiben haben. Denn mir war nach wie vor unverständlich, weshalb es diese Bibel nur in Latein und für die meisten Menschen so gut wie nicht zugänglich geben sollte. Manchmal kam mir dabei auch in den Sinn, einige der gelehrten Herren Geistlichen wollten aus gutem Grund nicht, dass ihre Pfarrkinder wussten, wie die in ihren Messen so vertraut und dennoch unverständlich klingenden Worte ausgelegt werden konnten oder tatsächlich gemeint waren, wenn sie die Bibel selbst lesen könnten. Dabei war es völlig belanglos, ob diese Gottesdienste althergebracht in lateinischer oder, wie inzwischen durchaus in manchen Gemeinden üblich, in der Landessprache gehalten wurden.
„Aber wir haben hier doch gar keinen Mann …“, warf ich nach einigem Nachdenken ein, weil mir das alles keine Ruhe ließ. Wieso durfte ich nicht etwas lernen, das ich doch verstehen und vielleicht sogar zum Heil und Nutzen anderer anwenden könnte?
„Gott ist unser Herr und sein Sohn Jesus Christus der Bräutigam vieler Ordensfrauen!“, erinnerte Hildegard mich an das, was sie mir schon so oft gesagt hatte. Ich fragte mich dann zwar immer, mit wem sich denn die Mönche vermählten, traute mich aber nicht, das laut auszusprechen. Ganz abgesehen davon, dass Gott den Männern angeblich verboten hatte, mehr als eine Frau zu ehelichen, sein eigener Sohn aber somit unzählige Bräute hatte. Hildegard war nie gut auf solcherlei Fragen zu sprechen gewesen und hatte mich dann immer ob meiner Neugier gerügt. „Gottes Stellvertreter auf Erden ist unser Heiliger Vater in Rom, und er wiederum wird von unserem Bischof und dem jeweiligen Pfarrer in Kappel vertreten. Das sind Männer genug, meinst du nicht?“
„Und wo ist Gott?“, wollte ich wissen, da ich mir keinen Reim auf all das machen konnte, und einfach nur wütend über solche Aussagen war, die alles und doch nichts erklärten. Hildegards Erläuterungen über den weisen alten Mann, der über uns im Himmel thronte, mit seinem Sohn Jesus Christus und dessen Mutter Maria an seiner Seite, mussten mir jedoch lange Zeit als Erklärung reichen.
Sie reichten mir aber nicht.
Eines Tages, so nahm ich mir insgeheim vor, eines Tages würde ich die Bibel lesen, für mich übersetzen und herausfinden, ob alles auch tatsächlich so geschrieben stand, wie die Schwestern und der Herr Pfarrer mir weismachen wollten. Allerdings: Es gab keine Bibel im Kloster Bochaugia, und der alte Pfarrer hütete das einzige Exemplar wie seinen Augapfel. Ich wusste inzwischen, wie teuer eine Bibel war, für deren pergamentene Seiten ganze Rinder- oder Schafherden ihre Häute hergeben mussten, wie Irmentraud mir gesagt hatte. Deshalb konnten wir uns auch keine Bibel leisten. Ich würde sie wohl entweder stehlen oder heimlich lesen müssen, wenn ich meinen Plan umsetzen wollte. Beides kam natürlich nicht infrage. So würde mein Plan also noch warten müssen, bis ich ihn umsetzen konnte, wenn überhaupt.
Mehr noch als die Auslegung der Heiligen Schrift jedoch beschäftigte mich die Möglichkeit, mit Pflanzen die unterschiedlichsten körperlichen Beschwerden und Krankheiten lindern oder gar heilen zu können. Aber Irmentraud und Hildegard rieten mir auf ziemlich eindringliche Weise davon ab, es auszuprobieren. Auch das stand ausschließlich Männern zu, die Medizin studiert hatten und als Medici, Ärzte also, zugelassen und tätig waren. Wenn ich mich an der Kräuterkunde versuchte, warnten die beiden Frauen mich, würde ich schnell als Quacksalberin und Scharlatanin in Verruf geraten. Meinen Einwand, dass es laut der mir bekannten Schriften Klöster gab, in denen sich auch Frauen um Kranke und Bedürftige kümmerten, wies vor allem Hildegard mit der Begründung zurück, dass wir kein anerkanntes Kloster waren. Außerdem mussten auch diese Infirmarius oder Infirmaria genannten Mönche oder Mönchinnen eine strenge Ausbildung durchlaufen, die letztendlich aber zu der Erkenntnis führte, dass keine Heilung ohne Gottes Zutun möglich ist. Für mich stünde so eine Ausbildung nicht in Aussicht, da wir – immer wieder erwähnt und mir hinreichend bekannt – kein anerkanntes Kloster waren und keine Klosterschule unterhielten. Ich wusste natürlich auch, dass es gefährlich war, mit Heilpflanzen umzugehen, ohne Unterweisung durch jemanden, der sich damit auskannte. Aber so jemanden gab es eben bei uns nicht. Damit war die Diskussion beendet, hinterließ jedoch bei mir ein Gefühl des Unverstandenseins, das mich lange Zeit belastete. Aber es hinderte mich nicht daran, meine Studien der gefundenen Schriften weiter zu betreiben, die ja wohl genau dazu verfasst worden waren. Heimlich suchte ich weiterhin nach den beschriebenen Pflanzen, und wenn mir Aussehen und Geruch zeigten, dass ich die richtigen gefunden hatte, ließ ich sie über dem Ziegenstall trocknen, bis sich eine Gelegenheit fand, sie den alten Rezepten gemäß zu verarbeiten.
2. Kapitel
Ein schweres Gewitter tobte zum Ende des Weidemondes im Jahr des Herrn 1136 über dem Verdersee. Wir im Kloster Bochaugia beobachteten angstvoll, wie die Blitze bedrohlich näherkamen und der ihnen folgende Donner immer lauter wurde, bis die Erde unter seinem Krachen bebte. Dann brach ein heftiger Gewittersturm los und fegte ein paar Holzschindeln vom Dach des kleinen Kirchturms, die auf dem Platz davor zerbarsten.
Wir hielten uns die Hände vor Augen oder Ohren, saßen zusammengekauert in einer Ecke des Dormitoriums und beteten laut zu allen Heiligen um Verschonung und Hilfe, vor allem zu Cornelius und Cyprianus, denen unsere kleine Kirche geweiht war.
„Heilige Mutter Gottes, steh uns bei!“
Dieser Schrei unserer Mutter Oberin ging in einem lauten Krachen unter, dem ein fürchterlicher Donnerschlag folgte, der zuerst wie ein böses, beinahe teuflisches Zischen klang und dann das ganze Haus erbeben ließ. Eine heftige Windböe drückte fast gleichzeitig die Tür vom Hof her auf und wirbelte Staub und trockenes Blattwerk hinein.
„Feuer!“, schrie Hildegard, die der Tür zu Flur und Stiegenhaus am nächsten saß. Entsetzt sprang sie auf und zeigte durch die aufgerissene Eingangstür nach draußen.
Ein Blitz hatte in einen Baum zwischen Kirche und Wohngebäude eingeschlagen und ihn förmlich in der Mitte gespalten. Ein Teil von Stamm und Krone war brennend in den kleinen Nutzgarten hinter dem Haus gefallen, der andere ragte wie eine funkenspeiende Feuersäule in den Himmel. Eine Windböe trieb einen wahren Funkenregen zum Haus herüber und drohte, das Dach in Brand zu setzen.
Wir stürzten hinaus, ergriffen dabei alles, was sich mit Wasser füllen ließ, und begannen verzweifelt, den brennenden Baum zu löschen, bevor das Feuer weiter um sich greifen konnte. Dabei achtete keine von uns mehr auf das nach wie vor über See und Moor tobende Gewitter.
Vom wie die Kirche mit Holzschindeln eingedeckten Dach des Hauses züngelten plötzlich die ersten Flammen. Irmentraud und ich hasteten die Stiege hinauf in unser Skriptorium, um zu retten, was zu retten war, mussten jedoch schnell einsehen, dass wir ohne weitere Hilfe nicht viel ausrichten konnten. Ein Ast musste das Dach getroffen haben, denn ein Loch klaffte dort, wo die Flammen sich jetzt durch die Holzschindeln fraßen. Ein paar Holzsplitter lagen glimmend auf dem Dielenboden, und ich versuchte sie verzweifelt mit einer Schüssel Wasser zu löschen, die ich mit nach oben genommen hatte.
„Lauf runter, hilf den anderen Frauen beim Löschen. Ich komme hier allein zurecht!“, rief mir Irmentraud durch den sich langsam im Raum ausbreitenden Rauch zu und schob mich zum Stiegenhaus.
„Aber …“, versuchte ich hustend einen Einwand. Wir mussten doch die wertvollen Schriften retten!
„Hast du mich nicht verstanden? Lauf!“