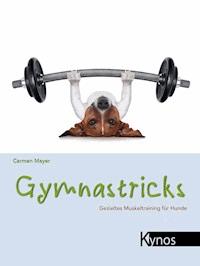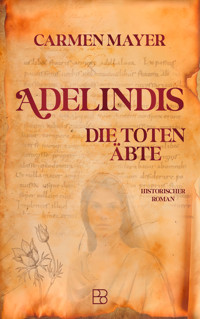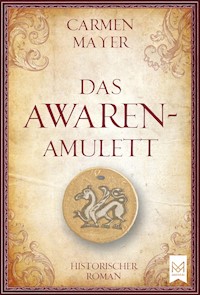8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Carmen Mayer erzählt die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges weiter! Magdalena will sich einfach nicht in ihre gottgewollte Rolle als Mädchen einfügen. Von klein auf wird sie misstrauisch beäugt in ihrem Dorf nahe der österreichisch-böhmischen Grenze. Als die inzwischen handwerklich begabte junge Frau das Pferd eines Fremden beschlägt, wirft ihr Vater sie aus dem Haus. Er kann ihren Ungehorsam nicht dulden. Der durchreisende Reiter nimmt sie mit nach Krems, wo sie zwischen die katholischen und protestantischen Fronten des beginnenden Dreißigjährigen Krieges gerät. Mit der Zeit gelingt es ihr, im Tross verschiedener Heere trotz Mühsal und Härte ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit der Heirat eines Trossführers scheint ihr Leben gesichert. Als ihr Mann jedoch bei einem Überfall stirbt, nimmt Magdalena ein stummes Mädchen in ihre Obhut, das als Hexe gebrandmarkt in Gefahr geraten ist, ohne zu ahnen, dass ihr diese Begegnung zum Verhängnis zu werden droht. Zwischen Liebe und Freundschaft, Krieg und Tod geht Magdalena mutig ihren Weg, auf dem sie nicht nur Freunde, sondern auch Feinde findet. Feinde, die vor keinem Mittel zurückschrecken, Magdalena aus dem Weg zu räumen … Ebenfalls erschienen: "Das Awaren-Amulett" "Der Schwedenschimmel"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Carmen Mayer
Die Trossfrau
Über das Buch
Magdalena, die um 1600 geborene Tochter eines protestantischen Hufschmieds nahe der österreichisch-böhmischen Grenze, wird von klein auf misstrauisch beäugt, kann und will sie sich doch einfach nicht in ihre gottgewollte Rolle als Mädchen fügen. Nachdem die handwerklich begabte junge Frau das Pferd eines Durchreisenden beschlägt, wirft ihr Vater sie aus dem Haus. Der Reiter nimmt sie mit nach Krems, wo sie zwischen die katholischen und protestantischen Fronten des beginnenden Dreißigjährigen Krieges gerät. Es gelingt ihr, im Tross verschiedener Heere ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und sie nimmt ein stummes Mädchen in ihre Obhut, das als Hexe gebrandmarkt in Gefahr geraten ist. Zwischen Liebe, Krieg und Tod geht Magdalena mutig ihren Weg, auf dem sie nicht nur Freunde, sondern auch Feinde findet. Feinde, die vor keinem Mittel zurückschrecken, Magdalena aus dem Weg zu räumen …
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2019 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2019
Lektorat: Bernadette Lindebacher
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Covergestaltung: Alin Mattfeldt
Cover Font © by Joffre LeFevre, Aboutype, Inc, 2001
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI - Clausen & Bosse, Leck
Made in Germany
ISBN 978-3-948346-11-9
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Inhalt
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Epilog
Liebe Leserinnen und Leser,
Glossar
Im Buch benannte reale Personen
Quellennachweis
Die Autorin: Carmen Mayer
Zehn Fragen an … Carmen Mayer
Seit September im Handel
Seit Oktober im Handel
Seit November im Handel
Widmung
Für Rudi
Prolog
„Keiner, den ich kenne, ist jemals wieder nach Hause zurückgekehrt.“
Magdalena wischte mit ihrer mageren Hand über ihr von unzähligen Falten durchfurchtes Gesicht. „Nach Hause“, wiederholte sie fast tonlos. „Nach Hause.“
Sie machte erneut eine Pause, in der sie mit beiden Händen ihren zerschlissenen Rock über den dürren Oberschenkeln glattstrich. Ich wartete geduldig darauf, dass sie weitersprach.
„Ferdinand.“ Sie spie den Namen des ehemaligen Kaisers aus wie eine stinkende Kröte. „Er sollte einen Beinamen bekommen.“
Welchen, sagte sie mir nicht. Schmeicheln würde er ihm keinesfalls.
„Meine Heimat ist verwüstet, Tausende Menschen mussten sterben, in den Köpfen der Überlebenden sitzt nach wie vor Angst, Misstrauen, Zorn und Hilflosigkeit. Und warum? Weil ein von Jesuiten erzogener Hundsfott zum Kaiser ernannt wurde, dessen Treiben niemand Einhalt bieten konnte.“
Magdalena seufzte und machte dann eine ausgreifende Handbewegung.
„Ich habe in diesem Marktflecken so etwas wie eine letzte, wenngleich auch erbärmliche Heimat gefunden und werde hier wohl auch mein Leben beenden.“ Sie verzog dabei den Mund zu einem schmalen Lächeln. „Was für ein Leben.“
Mit ‚diesem Marktflecken‘ meinte sie Dürrmenz, eine kleine Gemeinde im Württembergischen, wo ich geboren wurde und bis heute lebe.
Wir schrieben das Jahr 1649 nach Christi Geburt. Die Ungeheuerlichkeiten, die den Großen Krieg, von dem sie sprach, ausgelöst und bis im Jahr zuvor begleitet hatten, sind bis heute nicht beendet, und die schwärenden Wunden, die er gerissen hat, noch lange nicht verheilt. Auf ihnen ist Magdalena so etwas wie ein Stückchen Schorf.
„Ja, was für ein Leben“, wiederholte sie nach einer nachdenklichen Pause. Sie tastete nach meiner Hand und tätschelte sie gedankenverloren, bevor sie die ihre wieder in den Schoß zurücklegte.
„Angefangen hat eigentlich alles in Linz“, fuhr sie unvermittelt fort. „Ich war damals schon seit einiger Zeit mit einem Haufen Kaiserlicher unterwegs gewesen, weil einer der Männer für kurze Zeit mein Liebster war.“ Sie hielt erneut kurz inne, schien das Gesagte abzuwägen. „Er ist nicht freiwillig mit ihnen gezogen, er war nämlich so wenig katholisch wie ich.“ Es klang fast schon entschuldigend. Aber offensichtlich wollte Magdalena nicht, dass es wirkte, als hätte er seinen Glauben verraten. Was er aber wohl in den Augen anderer dennoch getan hatte, wenn er als Evangelischer mit den Kaiserlichen gegen seine Glaubensbrüder gezogen war. „Aber Religion hatte für den Krieg und seine Betreiber schon lange keine Bedeutung mehr, auch wenn man das nicht wahrhaben mochte.“
Magdalenas Stimme war brüchig geworden. Dann tastete ihre Hand erneut nach der meinen. Vielleicht wollte sie sichergehen, dass ich noch da war und ihr zuhörte. Vielleicht brauchte sie auch etwas, an dem sie sich festhalten konnte.
„Das war damals so.“
Wieder unterbrach sie sich, und ich spürte, wie ihre Hand zitterte.
„Die großen Heerführer, die bis heute hochgelobt werden für ihre Verdienste um das Vaterland – das waren und sind doch lauter Geschäftsleute, die am Krieg ihr Geld verdient haben.“ Magdalena spuckte vor sich auf den Boden. „Denen war es egal, welchem Glauben ihre Söldner angehörten, wie ihnen auch egal war, wie viele von ihnen tagtäglich an Krankheiten, Hunger und Verletzungen wie Vieh verreckt sind.“ Sie senkte den Kopf und fügte leise an: „Oder erschossen, erstochen, niedergemetzelt wurden. Auf beiden Seiten, nicht nur bei den Soldaten, wohlgemerkt!“ Ein kaum hörbarer Fluch kam ihr über die Lippen. Dann fuhr sie fort: „Ich hatte mich eine Zeit lang im Tross dieser Männer als Marketenderin verdingt.“
Ein wehmütiges Lächeln huschte über ihr altes Gesicht. „Mein Liebster … Nun gut. Bei einem Scharmützel hat ihn eine Kugel getroffen. Er war nicht gleich tot. Sie haben ihn mir schwer verwundet gebracht, damit ich mich um ihn kümmere. Aber ich konnte ihm nicht mehr helfen. Er ist wenige Tage später unter elenden Krämpfen am Wundfieber gestorben. Ich musste ihn irgendwo am Wegrand begraben, weil das nächste Dorf, an dem wir vorbeikamen, sich weigerte, einem wie ihm einen Platz auf dem Kirchhof zu geben. Einem wie ihm! Damit meinten sie ‚einem Protestantischen‘, einem Ketzer und Kaiserverräter. Auch wenn er bei den Kaiserlichen gedient hat. Als ob das da noch eine Rolle gespielt hätte. Aber so war das eben.“
Sie zog mit der freien Hand ihr verblichenes, an den Rändern ausgefranstes Kopftuch ein wenig in die Stirn. Die Sonne war ihr wohl zu warm im Gesicht geworden, aber ihren Platz verlassen wollte sie ganz offenbar auch nicht. Es tat ihr sicherlich gut, die alten Knochen ein wenig von der Sonne wärmen zu lassen.
„Eine kurze Wegstrecke vor Linz hatten wir wenige Zeit danach Quartier gemacht und sollten weitere Befehle abwarten. Es hieß, dass die Bauern unruhig geworden seien.“
Magdalena lachte leise. „Als ob sie nicht schon die ganze Zeit über unruhig gewesen wären.“
Sie begann zu husten. Ich klopfte ihr sanft auf den Rücken, bis sie sich wieder beruhigt hatte und weitersprechen konnte.
Der Rücken tat ihr weh, wenn sie lange so saß, das kannte ich. Dafür war die Salbe aus Beinwell und Arnika gedacht, die ich ihr an diesem Morgen gebracht und womit ich ihr den Rücken eingerieben hatte.
„Unruhig, sagten sie. Unruhig. Nein, nicht unruhig! Aufständisch waren sie, aufständisch! Und das waren sie zu Recht.“
Wieder dieser trockene Husten.
„Am Tag zuvor war uns ein Trupp Bairischer begegnet“, fuhr sie nach einer kurzen Atempause fort. „Nein, kein Trupp. Das war ein zusammengewürfelter Haufen Drecksgesindel, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass sie zuvor anständige Leute gewesen wären. Sie zogen unter den Farben des bairischen Statthalters im Land ob der Enns durchs Land, einem Kaisertreuen namens Herberstorff, und raubten Bauern, Händler und fahrende Leute aus oder brachten sie gar um. Dabei hatten sie ihren Spaß am Witwen- und Waisenmachen. Als sie bis zu uns vorgerückt waren, prahlten sie damit, an die südliche Grenze des Landes ob der Enns gezogen zu sein und dort eine kleine Ansiedlung von Bauern überfallen zu haben. Wie ein Heuschreckenschwarm seien sie gekommen und wieder verschwunden, bevor jemand richtig mitbekommen konnte, was sie angerichtet hatten. So erzählten sie uns und lachten dabei, als handele es sich um einen gelungenen Scherz. Dabei wussten alle, dass es sich keinesfalls um einen Spaß gehandelt haben konnte. Zumindest nicht für diejenigen, die diesem Heuschreckenschwarm auf die eine oder andere Weise zum Opfer gefallen waren.“
Wieder unterbrach sie sich, musste sich räuspern.
„Keiner von unserer Seite lachte mit, und so zogen sie schließlich mürrisch weiter. Wir hörten noch, dass sie uns als einen Haufen Memmen und Weiber beschimpften, die das rechte Kriegshandwerk noch lernen mussten.
Kriegshandwerk! Die Bairischen hielten das Land besetzt, das Kaiser Ferdinand aus Geldnot an den Münchener Kurfürsten Maximilian I. verpfändet hatte. Für Ordnung sollten sie sorgen, die Leute katholisch machen. Von Krieg und Verwüstungen war nicht die Rede gewesen. Aufstände gab es immer wieder, ja. Die Bauern wehrten sich gegen die Besatzer, weil die sich zu viel herausnahmen und man sie aus verständlichen Gründen wieder loswerden wollte. Da ist viel Unheil geschehen“, schloss sie aufgebracht. „Viel, viel Unheil. Und der Kaiser hat es zugelassen, der Hundsfott, der elendige.“
Lange schwieg sie dieses Mal, und ich blieb ganz still sitzen, um sie nicht zu unterbrechen.
„Dabei ist es doch sein Volk! Menschen, die ihm anvertraut sind! Ihm irgendwann aber nur noch gnadenlos ausgeliefert waren.“
Verständnislos schüttelte Magdalena den Kopf.
„Auch die Männer in meinem Haufen waren nicht immer zimperlich, das muss ich zugeben. Aber solche Saukerle wie die gab es bei uns nicht“, fuhr sie mit einem kleinen Kopfrucken zur Seite fort, als stünden die dermaßen übel Bezeichneten irgendwo an ihrer Seite. „Sie haben ein junges Weib angeschleppt, kaum mehr als zwölf, dreizehn Lenze zählend, das sie übel zugerichtet hatten. Ich vermutete, dass das arme Kind aus dem überfallenen Tal stammte, von dem sie gesprochen hatten. So, wie sie beieinander war, brauchte ich nicht lange darüber nachzudenken, was mit ihr geschehen sein mochte.
Auch ein verstörter Junge mit einer schlimmen Verletzung im Gesicht war dabei, der mich im Vorbeiziehen verzweifelt bat, mich doch um das Mädchen zu kümmern. Sie seien auf dem Weg nach Linz, da würde ich sie bestimmt finden und ihr helfen können.“
Magdalena verzog das Gesicht zu einem wehmütigen Lächeln.
„Bei mir setzten aber kurz darauf die Wehen ein. Ich schaffte es gerade noch, mich zur Seite zu schleppen und mein Kind auf die Welt zu bringen, einen Buben.
Wir zogen gleich darauf weiter nach Linz, wo ich zunächst einmal blieb, da sich die Männer, denen mein Tross bislang gefolgt war, inzwischen in der Nähe ein neues Quartier gesucht hatten. Außerdem schien es mir leichter, mich um mein inzwischen schwerkrankes Kind zu kümmern, wenn ich in der Stadt weilte. An das Mädchen, das die Kerle aus dem Ennstal mitgeschleppt hatten, dachte ich nicht mehr. Viel zu sehr war ich mit meinem kranken Kindlein beschäftigt, als dass ein anderes Schicksal noch Platz in meinem Herzen hätte finden können. Ich konnte meinem Buben aber nicht helfen. Auch der alte Medicus vermochte es nicht, den ich in Linz aufsuchte und dem ich viel Geld für nichts bezahlte. Und so folgte der Bub seinem Vater nach ein paar Tagen in die Ewigkeit.“
Tränen rannen über ihr Gesicht, die sie mit dem Handrücken wegwischte.
„Ich ließ eine Holzkiste für den kleinen Leichnam schreinern, damit mein Kind wenigstens anständig begraben werden konnte. Es sollte nicht in einem verschlissenen Tuch irgendwo verscharrt liegen wie sein Vater. Also wartete ich vor dem Kirchhof auf den Burschen, der mir den Sarg bringen sollte. Der Schmerz und die Trauer um meinen Sohn hatten mich völlig im Griff, und es bereitete mir viel Mühe, mein Kind in das Kästchen zu betten und dem Burschen das vereinbarte Geld zu geben.“
Wieder hielt Magdalena inne, schien den Blick in eine weit zurückliegende Zeit zu wenden.
„Etwas stand in den Augen dieses Jungen, das mich anrührte. Etwas, das an den Blick jenes Burschen erinnerte, der mich gebeten hatte, der armen Kreatur zu helfen, die jene Bastarde aus dem Ennstal mitgeschleppt hatten. Im Kummer um den Verlust meines kleinen Buben vergaß ich aber auch das sehr schnell wieder.“
Sie zog wie fröstelnd die Schultern hoch.
„Eine Zeit lang noch blieb ich in der Stadt, bevor ich mich entschloss, zusammen mit einem Häufchen Protestanten in den Westen zu ziehen. Dahin, wo man uns aufnehmen und eine neue Heimat bieten würde. Immerhin gab es noch Landesherren, die sich keinen Deut um das scherten, was der Kaiser ihnen vorschrieb. Sie lebten ihre eigenen Vorstellungen von Freiheit und Würde. Hatten nicht wie einige andere eiligst das Fähnlein gewechselt, nachdem der Habsburger ihnen den Krieg angedroht oder einen üblen Handel angeboten hatte. Der Kampf blieb ihnen trotzdem nicht erspart, wenn auch auf andere, viel schlimmere Weise, als sie sich das wohl vorgestellt hatten. Ganze Landstriche lagen wenige Zeit später verwüstet und entvölkert, ganz gleich, auf wessen Seite ihre Herren standen. Die Bauern und Bürger totgeschlagen von Soldaten aller Couleur, die keine Rücksicht darauf nahmen, dass Unschuldige zwischen die Fronten geraten waren. Darunter so viele alte Menschen, Frauen, Kinder, die ihr Leben einem Ziel opfern mussten, das nicht das ihre gewesen war. Viele starben auch an den Krankheiten, die von den Soldaten mitgeschleppt und über das Land verteilt wurden, und die ihre tödlichen Krallen nach Mensch und Vieh ausstreckten.“
Erneut schüttelte sie verständnislos den Kopf.
„Aber wenn man essen will, müssen doch die Felder bestellt, muss Vieh aufgezogen, Handel betrieben werden! Vielerorts ist das bis heute nicht mehr möglich, weil keiner mehr da ist, der sich darum sorgen könnte. Der unsägliche Krieg hat Löcher gerissen, die wieder gefüllt werden müssen, wenn der übrig gebliebene Rest der Bevölkerung überleben will.
Einige kluge Landesherren nutzten und nützen noch immer die Tatsache, dass die vertriebenen oder geflüchteten Protestanten dankbar ihre Arbeitskraft und ihr Wissen zur Verfügung stellen und ihren Gönnern nichts schuldig bleiben würden. Wir waren und sind bei ihnen willkommen. Für die sind wir Menschen, einfach nur Menschen.“
Ein neuer Hustenanfall hinderte sie am Weitersprechen. Mit einer Handbewegung schickte sie mich nach einem Becher Wasser an den Brunnen neben dem Haus, den ich ihr gleich darauf brachte. Sie nahm einen vorsichtigen Schluck, behielt den Becher in der Hand. Dann fuhr sie fort:
„Meinen neuen Wegbegleitern war es wie mir leid geworden, immer wieder den Repressalien der Habsburger, der Baiern, katholischen Pfaffen und all jener ausgesetzt zu sein, die ihren Spaß daran hatten, wehrlose Menschen zu quälen und durch viel zu hohe Abgaben ausbluten zu lassen. Außerdem waren die Soldaten weitergezogen, mit denen ich bislang unterwegs gewesen war, und der Tross mit ihnen. Mein Leben als Marketenderin war zu Ende, ich musste zusehen, wie es mit mir weitergehen sollte.“
Ihre Hand löste sich nach einem leichten Druck von der meinen, die ich heimlich am Hosenbein abwischte. Sie war schweißnass geworden. Das Weib umschloss den Wasserbecher jetzt mit beiden Händen, trank noch einen Schluck. Dann gab sie mir den Becher zurück, und ich stellte ihn neben mich auf die Bank.
Leise fuhr sie fort:
„Ich konnte damals nicht ahnen, dass diese Begegnungen Teil meines weiteren Lebens bleiben würden: die mit dem Mägdlein, das die üblen Kerle aus dem Ennstal mitgeschleppt hatten, und die mit diesem Jungen, der mir den Sarg für mein Kind brachte.“
Magdalena hob kurz den Kopf, drehte ihn in meine Richtung, und ich konnte einen Blick auf ihre blinden Augen werfen. Dass ich hier neben ihr saß und in Ruhe zuhörte, wie sie aus ihrem Leben berichtete, verdankte ich dem Umstand, dass sie unseren Apotheker kannte, der ihr durch mich ab und zu eine schmerzlindernde Salbe bringen ließ. Ich verdiente mir mit solchen Botengängen hin und wieder ein paar Münzen, mit denen ich meine Familie unterstützen konnte. Wir hatten wie viele andere auch nur das, was notwendig zum Überleben war. Da kam jeder kleine Zuverdienst gerade recht.
Magdalena hauste zusammen mit zwei zerlumpten Alten in einem Haus unterhalb der vor ein paar Jahrzehnten abgebrannten Burg Löffelstelz, das sich in jenem desolaten Zustand befand, den viele Häuser unseres kleinen Fleckens teilten. Das Haus war gerade noch bewohnbar, und für Magdalena die einzige Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben.
Ich hatte Magdalena an diesem Tag gefragt, woher sie den Apotheker kenne, der niemals Geld für seine Medizin von ihr forderte und sich über seine Gründe dafür ausschwieg. Er hatte im angrenzenden Weiler Mühlacker ein baufälliges Häuschen erstanden und hergerichtet, worin er mit seinem Weib und seinen Kindern lebte, so gut es eben ging. Dort richtete er eine Arzney-Küche ein, in der er unter anderem Branntwein destillierte und mit allerlei Kräutern zu Heiltränken, Salben und anderen Mitteln verarbeitete, die er dann verkaufte. Ab und zu behandelte er auch Leute, die mit kleineren Gebrechen, Verletzungen oder den üblichen Krankheiten zu ihm kamen. Einen Arzt hatten wir zu der Zeit nicht, und der nächste Bader hauste im gut drei Wegstunden entfernten Pfortzheim. Der hatte seinen eigenen Angaben zufolge genug mit den Kranken und Siechen seiner Stadt zu tun, und zeigte wenig Lust daran, sich auch noch um Kranke aus anderen Orten zu kümmern. Außerdem liegt Pfortzheim im katholischen Baden. Das durfte der wichtigste Grund sein, weshalb der Mann kaum Interesse daran hatte, sich um die Gebrechen württembergischer Protestanten zu kümmern.
An jenem Tag nun hatte ich Magdalena nachdenklich vorgefunden, wie sie auf der grob gezimmerten Bank vor der Hauswand saß. Zuerst hatte ich gedacht, sie würde über die Enz nach Dürrmenz hinüber schauen und über ihr Leben sinnieren. Aber dann fiel mir ein, dass sie ja blind war und so setzte ich mich neben sie, um für eine Weile zusammen mit ihr die Sonne zu genießen.
Da hat sie plötzlich begonnen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Erst langsam und stockend, dann so, als erlebe sie aufs Neue, was in Tausenden von Bildern hinter ihren blinden Augen vorbeiziehen mochte.
1
Geboren wurde Magdalena ungefähr anno 1600 als mittleres von fünf Kindern eines Hufschmieds und seines Eheweibes.
Ihre Familie lebte in einem Nest in Niederösterreich, dessen Name sie vergessen hat, oder an den sie sich nicht mehr erinnern wollte. Es scheint an einer Straße gelegen zu haben, die gerne von Fuhrleuten und Händlern, später auch von durchziehender Soldateska genutzt wurde, die von Norden nach Süden unterwegs waren – entweder an der Donau entlang nach Westen Richtung Linz oder nach Osten Richtung Wien. Ich denke mir, dass es in der Gegend zur Grenze nach Böhmen gewesen sein muss, vielleicht im Wald-, vielleicht im angrenzenden Weinviertel. Sicher bin ich mir aber nicht, weil ich nie nach Österreich gekommen bin, und sie nichts weiter darüber zu erzählen bereit war als das, was ich hier niederschreibe.
Die Schmiede befand sich am südlichen Ende des Dorfes, wie üblich direkt an der Landstraße neben dem Dorfteich gelegen. Sie war aus grob behauenen Steinen gebaut worden und durch einen schmalen Weg und einen kleinen Gemüsegarten von dem Haus getrennt, in dem Lena mit ihrer Familie lebte. Auch dieses Haus war aus Steinen errichtet worden, und nicht, wie die meisten anderen Häuser des Dorfes, aus Holz. Es war gefährlich, ein Holzhaus neben einer Schmiede zu errichten, von der immer eine gewisse Brandgefahr ausging. Im Haus gab es eine Küche und zwei kleine Kammern. In einer davon hatten die Eltern, in der anderen die Kinder ihre Schlafstatt.
Die Schmiede bestand aus einem einzigen großen Raum. Sie hatte zur Straße hin ein schweres Holztor, das zu jeder Jahreszeit tagsüber offen stand und den Blick auf die beeindruckende Esse in der hinteren rechten Ecke freigab, in der die Schmiedekohle mithilfe eines Blasebalgs zum Glühen gebracht wurde. Darüber führte ein schwarz verrußter Rauchfang aufstiebende Funken und Rauch nach außen. Daneben an den Wänden hatte der Vater sein Werkzeug griffbereit und sorgfältig gesäubert aufgehängt, darunter eine Werkbank mit einem Schraubstock gestellt. Es gab alle Größen an Zangen und Hämmern, Kisten mit verschieden großen Nägeln, die er geschmiedet hatte und bevorratet hielt, und allerlei anderes Werkzeug, das er für seine Arbeit brauchte und zum großen Teil selbst hergestellt hatte.
In der Mitte des Raumes stand der Amboss, sicher einer der wichtigsten Bestandteile der Werkstatt, daneben ein Bottich mit Wasser. Darin wurde das glühende Eisen abgekühlt, wobei laut zischend heißer Dampf aufstieg.
Magdalena liebte die Wärme in der Schmiede ebenso, wie sie auch die beruhigende Melodie der Hammerschläge und den Geruch von heißem Eisen und jenem Öl mochte, mit dem der Vater sein Werkzeug pflegte.
Vor allem aber liebte sie die Pferde, die, an der Außenwand der Schmiede an metallenen Ringen angebunden, die Arbeit des Vaters mehr oder weniger geduldig über sich ergehen ließen. Manchmal strich sie ihnen über die weichen Nüstern und freute sich, wenn die Tiere mit leisem Wiehern antworteten. Sie redete auch hin und wieder heimlich mit ihnen und freute sich darüber, dass sie das ganz besonders gern zu mögen schienen. Dabei ahnte sie mehr als sie wusste, dass sie dabei misstrauisch beobachtet wurde.
Der Schmied beschlug nicht nur die Hufe der Pferde durchziehender Soldaten, er zog auch eiserne Reifen auf die Räder der Karren, die den Fuhrleuten und Händlern auf ihrem Weg mürbe geworden oder gar zerbrochen waren. Er stellte Pflugscharen und allerhand Werkzeug für die Bauern her, aber auch Beschläge für Schränke und Truhen, und kistenweise Nägel. So kam die Familie recht gut mit dem aus, was die Arbeit des Vaters einbrachte.
Magdalena bekam schon als kleines Mädchen zu spüren, wie wichtig dem Vater seine Buben waren, die viel zu früh ihr Leben ausgehaucht hatten. Es tat ihr weh, zu hören, dass er dem Herrgott immer wieder lautstark zürnte, der ihm beide genommen und dafür drei unnütze Weiberleute gelassen hatte. Ein paarmal schon hatte ihn der Pfarrer ermahnt, sich nicht zu versündigen, denn es sei der Wille des Herrn gewesen, die Buben zu sich zu rufen, und daran dürfe er nicht zweifeln. Aber wenn die Dinge nicht so liefen, wie der Vater es sich vorgestellt hatte, vergaß er alle Ermahnungen und verfluchte vor allem den Tag, an dem Magdalena geboren wurde. Magdalena wusste schon sehr früh, dass nicht nur der Vater ihr zürnte, sondern dass auch die Leute im Dorf über sie tuschelten. Es ging lange Zeit das Gerücht, die Hebamme habe gesagt, das Mädchen sei bei seiner Geburt viel zu klein gewesen, als dass es zum Überleben gereicht habe. Sie hätte wohl nach und nach das Leben aus ihren Brüdern gesaugt, weshalb die älteren Buben letztendlich an Auszehrung gestorben seien. Ob der Vater das glaubte, wusste Magdalena nicht. Sie ahnte jedoch, dass sie seine ablehnende Haltung ihr gegenüber auch den abergläubischen Dorfbewohnern zu verdanken hatte.
Sie bemühte sich also von klein auf, diese schreckliche, offenbar gottgewollte Ungerechtigkeit so gut sie eben konnte auszugleichen, und half überall nach Kräften mit, wo in der Familie Hilfe gefragt war, sobald sie einigermaßen stehen und gehen konnte. Dabei hoffte sie, dem Vater wenigstens ein bisschen Wohlwollen abzuringen.
Aber der Vater sah darin nichts Gutes.
„Du kannst meine Söhne nicht ersetzen!“, schrie er sie immer wieder an. „Sieh zu, dass du mir aus den Augen kommst. Wenn es ist, wie die Hebamme gesagt hat, bist du schuld daran, dass meine beiden Buben so früh sterben mussten.“
Was solche Worte mit dem kleinen Mädchen anrichteten, schien niemanden zu interessieren. Magdalena wiederum bemühte sich tapfer weiter, diese kaum zu sühnende Schuld auf ihre Weise zu begleichen.
In der Schmiede durfte sie allerdings nicht mithelfen. Der Vater fand, dass Weiberleute dort nichts zu suchen hatten und es außerdem viel zu gefährlich sei, mit dem glühenden Eisen umzugehen und die manchmal ungeduldigen Pferde zu beschlagen. Ganz abgesehen davon, dass Weibsbilder ohnehin nicht in der Lage waren, etwas von dem zu lernen, was Männern schon in die Wiege gelegt wurde. Deshalb schickte man seiner Meinung nach ja auch besser nur Buben in die Schulen und keine Mädchen. Weil die Töchter vom Herrgott nicht mit so einem großen Hirn ausgestattet worden waren wie die Söhne, wie er sagte.
Das stehe auch irgendwo in der Bibel, behaupteten jedenfalls all diejenigen, die den Mädchen den Gang zur Schule verweigerten, und Lenas Vater stimmte dem uneingeschränkt zu. Ich habe besagte Stelle in der Heiligen Schrift übrigens bis heute nicht gefunden.
Lena, wie sie von klein auf genannt wurde, konnte das mit dem kleineren Hirn und dem Schulverbot nicht einsehen. Sie wurde immer mit Schlägen bestraft, wenn sie dem Vater bei Gesprächen über dieses Thema Widerworte gab. Wenn sie sich das nicht aus dem Kopf schlage, so pflegte er zu sagen, dann müsse er das übernehmen. Aber es änderte offenbar nichts an dem, was in ihrem Gehirn vor sich ging. Er konnte Lena biegen, aber nicht brechen.
Sie brachte sich Rechnen und Lesen heimlich selber bei, vor allen Dingen, um sich den Beweis zu liefern, dass der Vater unrecht hatte. Sie wagte es allerdings aus Angst vor den möglichen Konsequenzen nicht, ihm diesen Beweis vorzulegen. Die Mutter mochte um ihre Bemühungen gewusst haben, äußerte sich jedoch nicht dazu. Wie sie auch nie etwas dazu sagte, wie der Vater seine Tochter behandelte und was er ihr und ihren beiden jüngeren Schwestern zumutete. Die beiden bekamen zwar auch seine Ablehnung zu spüren, aber nicht in dem Maß wie Lena. Vermutlich waren sie in der richtigen Größe zur Welt gekommen und mussten kein Leben aus ihren Brüdern saugen, um selber überleben zu können. Zum Zeitpunkt ihrer Geburt waren die beiden Buben außerdem bereits tot.
Den Verboten des Vaters zum Trotz schlich Lena immer wieder heimlich in die Schmiede, wenn ein Fuhrmann oder Reiter gekommen war, um die Hufe eines Pferdes neu beschlagen oder einen Eisenreifen oder ein anderes verschlissenes Eisenteil an seinem Fuhrwerk auswechseln zu lassen. Als Vorwand dienten die schweren Kohleeimer, die sie in die Schmiede schleppte, und mit denen der Vater die Glut in der Esse am Leben hielt. Dagegen hatte er nichts einzuwenden, war es doch die niedrigste Arbeit, die es zu tun gab. Gut genug für sie.
Lena merkte sich jeden seiner Handgriffe beim Beschlagen der Pferde und beim Aufziehen von neuen Reifen auf die Räder der Händlerkarren, wollte sie dem Vater doch eines Tages beweisen, dass sie durchaus in der Lage war, ihm zur Hand zu gehen. Irgendwann musste er – auch ohne von ihren Kenntnissen in Lesen und Rechnen zu wissen – einfach einsehen, dass er falschlag mit seiner Meinung, dass Weiber nicht genauso viel Verstand hatten wie Männer, die ihnen vielleicht kräftemäßig überlegen sein mochten. Mit der Größe des Gehirns hatte das alles ihrer Ansicht nach sehr wenig zu tun. Aber auch das behielt sie besser für sich.
Sein Hoffen war indes, dass sich einer seiner künftigen Schwiegersöhne als tüchtig genug zeigte, in der Schmiede mitzuarbeiten und sie später zu übernehmen. Die Eltern sahen es jedoch nicht so gern, wenn einer aus dem Dorf um ihre Töchter herumschlich, weil es Burschen aus den wenigen, nach der Einführung des protestantischen Glaubens übrig gebliebenen Katholikenfamilien waren. Ein Katholischer kam für sie als Schwiegersohn unter keinen Umständen in Betracht. Unter den Protestanten gab es zu jener Zeit so gut wie keine heiratsfähigen Männer im Dorf und der näheren Umgebung. In ihren Jahrgängen hatten mehr Mädchen als Jungen überlebt, die jetzt allesamt im Wettbewerb um die wenigen jungen Heiratswilligen standen.
Die Eltern hatten bereits mehrmals bei Verwandten in den umliegenden Märkten um einen passenden Tochtermann angefragt, wurden aber nicht fündig.
Außerdem wurde Lena von den wenigen Burschen, die infrage gekommen wären, gemieden, oder sie machten sich ihre Späße mit ihr. Einmal hatte ihr einer vorgegaukelt, an ihr interessiert zu sein, sich mit ihr treffen zu wollen. Nur, um sie dann vor allen anderen auszulachen, die zusammen mit ihm zum vereinbarten Treffpunkt gekommen waren.
„Wir wollen nichts von einer wie dir“, musste sie sich anhören. „Vielleicht willst du uns ja auch aussaugen, wenn wir dir zu nahe kommen! Das hier kannst du haben, mehr nicht.“ Dabei hatten die Burschen ihr Geschlecht aus dem Hosenschlitz genestelt und sie mit Urin bespritzt. Sie hatte sich so geschämt, dass sie niemandem etwas davon erzählte, aber auch nie wieder der Einladung eines Burschen gefolgt war.
Ihr Vater ließ sie immer öfter seinen Unmut darüber spüren, dass sich trotz aller Bemühungen kein Mann für sie finden ließ, der ihr gezeigt hätte, wo ihr Platz war. Dessen nicht genug, musste sie sich mit zunehmendem Alter fast täglich anhören, wie wenig Aussicht in jenen Zeiten darauf bestand, ihre beiden jüngeren Schwestern eines Tages zu verheiraten. Das bedeutete eine große Last für die Familie. Denn Verheiratungen fanden nicht willkürlich, sondern der Reihe nach statt. Zuerst die älteste, dann die mittlere und zum Schluss die jüngste Tochter. Aber wenn sich schon für Lena kein Mann finden ließ …
Ihr inzwischen ausgesprochen scheues Verhalten gab im Dorf Anlass, dahinter etwas Verschlagenes zu vermuten. Man erzählte sich, dass sie nachts heimlich umherschlich und nach Neugeborenen Ausschau hielt, denen sie das Leben aussaugen konnte. Dabei würde sie keinen Unterschied machen zwischen Mensch und Tier. Laut wagte das allerdings niemand zu sagen, da der Schmied seine Tochter trotz allem lautstark und notfalls mit den Fäusten verteidigte. Zum Schutze der Familie, nicht zum Schutze der Tochter.
Es wurde auch darüber geredet, dass sie immer wieder mit den Pferden sprach, die vor der Schmiede darauf warteten, beschlagen zu werden. Jemand, der mit Tieren redete, war auch imstande, sie zu verhexen.
„Sogar unser Herr Martin Luther gibt zu, dass es Hexen und Zauberinnen gibt“, klärte der Pfarrer den Vater einmal auf, der ihn darauf angesprochen hatte. „Aber ich halte das für dummes Geschwätz und üblen Aberglauben, und lasse nicht zu, dass in unserer Gemeinde wieder jemand aus diesem Grund sterben muss.“
Es war im Dorf vor Jahren vorgekommen, dass eine Alte der Hexerei bezichtigt, verhaftet und ins Loch geworfen worden war. Damals gab es noch keinen protestantischen Pfarrer in der Gemeinde, und der katholische Pfaffe aus dem Nachbarort war bekanntermaßen ein Frauen- und Protestantenhasser, der dem allem tatenlos zugesehen, wenn nicht gar selber dahintergesteckt hatte. Die alte Frau hatte wie Lena mit dem Vieh geredet und behauptet, dieses verstünde sie, was zu allerlei Getuschel führte. Dann war im Stall ihres Nachbarn eine Seuche ausgebrochen, und die Tiere verendeten kläglich. Schuld daran konnte nur die Alte gewesen sein, die das Vieh mit heimlichem Zauber verhext hatte. Denn darum handelte es sich bei ihrem Gemurmel, wie die Leute zu wissen glaubten. Die Alte verstarb ein paar Wochen, nachdem man sie eingesperrt hatte. Ihre Leiche wurde verbrannt und die Asche im Wind verstreut.
Nur der Schmied vermutete etwas anderes hinter dem Sterben der Tiere: Ihr Besitzer hatte heimlich Futter von einem Stück Land geschnitten, auf dem giftiges Grünzeug stand. Das wurde bestenfalls einmal im Jahr mit Feuer gerodet, aber es war aus gutem Grund verboten, sich von dort Futter zu holen. Der Bauer hätte natürlich nie zugegeben, gegen das Verbot verstoßen und sein Vieh mit dem Grünzeug vergiftet zu haben. Er hatte lieber in Kauf genommen, dass eine unschuldige Frau der Hexerei beschuldigt wurde und in der Haft verstarb. Wie er auch nicht zugeben wollte, dass die Alte lediglich versucht hatte, die vergifteten Tiere zu beruhigen und ihnen mit ihren Kräutern zu helfen, wie einige im Dorf vermutet hatten, die dem Unsinn keinen Glauben schenken wollten. Der Nachbar bemühte sich kurz nach dem Tod der Alten ungerührt darum, ihr kleines Häuschen zu übernehmen und an seinen Besitz anzugliedern. Was allerdings daran scheiterte, dass es wenige Tage später niederbrannte und niemand sich mehr auch nur noch in die Nähe der verhexten Ruine wagte.
Bis auf Lena. Es war der einzige Platz in ihrer kleinen Welt, wo sie Ruhe fand und ihren Studien in Lesen und Rechnen nachgehen konnte. Wobei sie sich ihre Lektüre heimlich aus der Sakristei der kleinen Kirche besorgte, nicht ahnend, dass der Pfarrer sehr wohl davon wusste, sie aber gewähren ließ. Wie er auch wusste, wer das Häuschen der Alten angezündet hatte. Dieses Geheimnis nahm er allerdings mit ins Grab.
An jenem Tag, der das weitere Schicksal des Mädchens bestimmen sollte, hatte ein durchziehender Reiter den Vater gebeten, sein Pferd neu zu beschlagen. Es hatte an einem der Hinterhufe ein Eisen verloren, aber auch die anderen drei würden einem Ritt bis Krems nicht mehr standhalten.
Lena war gerade dabei, Kohle in die Schmiede zu schleppen, als der Reiter sein Tier an der Außenwand festband. Sie stellte den Eimer mit der Kohle ab und näherte sich neugierig dem offenen Tor. Inzwischen kannte sie sich gut genug mit Pferden aus, um zu erkennen, dass es sich bei dem Falben um ein sehr wertvolles Tier handelte. Verständlich, dass der Reiter es unterwegs nicht gegen einen der Gäule eintauschen wollte, wie sie an manchen Gasthöfen für Reisende zum Tausch bereitgehalten wurden. Noch weitaus weniger dürfte ihm der Sinn danach gestanden haben, es wegen eines lahmenden Beins erschießen zu müssen.
Während der Vater sich um seine Arbeit kümmerte, machte sich der Fremde auf den Weg zum einzigen Gasthaus im Dorf.
Lena sah ihm bewundernd nach. Er hatte nicht nur ein prachtvolles, herrlich aufgezäumtes Pferd, er sah auch noch sehr gut aus und war auffallend gut gekleidet. Unter seinem breitkrempigen schwarzen Hut fielen lange, dunkle Haare bis auf die Schultern. Beinahe schwarze, ein bisschen wehmütig wirkende Augen hatten sie kurz gemustert, bevor ein kleines Lächeln über das Gesicht des Mannes gehuscht war, das Lenas Herz schneller schlagen ließ. Er trug ein hochtailliertes, schwarzes, reich mit Goldfäden besticktes Wams über einem weißen Unterhemd und unter einem grünen, weiten Samtrock. Auf seinen Schultern lag ein edler weißer Spitzenkragen. Rote, geschlitzte Hosenbeine fielen locker bis unter die Knie. Aus den Schlitzen lugte grüner Samtstoff hervor. Über weißen Strümpfen trug er Stulpenstiefel aus feinem hellem Leder. Nie zuvor hatte Lena jemanden gesehen, der so elegant und wohl nach der neuesten Mode gekleidet war wie er. An diesen Anblick konnte sie sich noch Jahrzehnte später erinnern.
Der fremde Reiter fiel auch einigen anderen Mädchen auf, die staunend am Wegrand stehen geblieben waren und ihm mit unverhohlener Bewunderung nachsahen. Er schenkte ihnen ein fröhliches Augenzwinkern, das die Bauerndirnen errötend kichern und dann wie aufgescheuchte Hühner davonlaufen ließ.
Lena wusste, dass Männer wie er sich bestenfalls ein Schäferstündchen mit einer Bauerndirne gönnten, aber niemals ernste Absichten für eine von ihnen hegen würden. Die Folgen dieser schicksalhaften Begegnungen hatten die Mädchen auszutragen, die daran nicht selten auf die eine oder andere Weise zugrunde gingen. Bastarde großzuziehen war nicht einfach in diesen Zeiten, und nicht selten mussten die Frauen ein Leben lang dafür büßen, mehr oder weniger freiwillig dem Drängen eines solchen Kerls nachgegeben zu haben. Schon deshalb war es besser, Männern wie diesem Fremden nur einen Blick zu schenken, schnellstens zu verschwinden und kichernd hinter vorgehaltener Hand über verpasste Möglichkeiten zu tuscheln.
Lena wandte sich seufzend ihrer Arbeit zu und schenkte dem Vater ein verlegenes Nicken, das jener mit einem abweisenden Achselzucken quittierte. Er hatte sehr wohl gesehen, mit welchen Augen seine Tochter dem Fremden nachgesehen hatte, wusste aber auch, dass jener sie schon wieder vergessen haben würde, sobald das kleine Grinsen aus seinem Gesicht verschwunden war.
Drei Hufe hatte der Vater bereits mit neuen Eisen beschlagen, als Lena ein zweites Mal an ihm vorbei in die Schmiede ging, um einen Eimer mit Kohlen abzustellen. Gerade als sie die Schmiede betrat, zischte eine riesige Hornisse an ihr vorbei ins Freie, direkt auf das Pferd des Fremden zu. Das warf erschrocken und laut wiehernd den Kopf hoch, vertrieb die Hornisse mit panischem Schütteln der Mähne und keilte fast gleichzeitig mit allen vieren aus. Einer der Hufe traf dabei den Schmied am rechten Bein, ein anderer an der Hüfte. Nur um Haaresbreite entkam er einem Tritt gegen seinen Kopf, als er nach hinten zu Boden stürzte. Während er sich mühsam außer Reichweite der stampfenden Hufe zog, zerrte der Hengst weiter wiehernd und sich immer wieder aufbäumend am Zügel, der um einen Ring an der Wand geschlungen und verknotet war. Einige Nachbarn kamen, von den Schmerzensschreien des Schmieds und dem aufgeregten Wiehern des Tieres alarmiert, angelaufen.
Lena stand zuerst nur erschrocken da und lief dann zu dem Ross hinaus. Sie griff mutig in die Zügel, zog seinen Kopf nach unten, legte eine Hand auf seinen Hals und beruhigte das Tier, indem sie leise mit ihm zu sprechen begann.
Jemand schrie ihr zu, sofort von dem wilden Vieh wegzugehen, in das der Teufel gefahren sein musste, und von irgendwoher wehte auch das Wort ‚Hexe‘ zu ihr herüber.
Sie spürte, dass sich das Pferd langsam beruhigte, sah, dass das Weiße aus seinen Augen verschwand, ließ ihre Hand an seinem Hals entlang nach oben zwischen die Ohren wandern und begann, es liebevoll zu kraulen. Ein paarmal noch warf der Hengst wiehernd und am ganzen Körper zitternd den Kopf ein wenig hoch, bevor er sich vollends und leise vor sich hin schnaubend beruhigte. Lena löste die Zügel vom Ring an der Wand und band das Tier ein Stück entfernt von ihrem sich vor Schmerzen am Boden windenden Vater fest, sodass es sich nicht losreißen und weiteren Schaden anrichten konnte.
Erst bei einem Blick auf den Vater wurde ihr bewusst, in welcher Gefahr auch sie sich befunden hatte. Ihre Knie begannen zu zittern, Tränen zogen eine nasse Spur über ihr rußverschmiertes Gesicht, ihre Zähne klapperten, ihre Hände waren schweißnass.
Die Mutter kam laut schreiend aus dem Haus gelaufen und beugte sich über ihren verletzten Mann.
„Hast du den Gaul erschreckt?“, fragte sie und warf Lena einen bitterbösen Blick zu, während sie versuchte, den Vater ein wenig aufzurichten.
Lena schüttelte entsetzt den Kopf.
„In den ist der Leibhaftige gefahren!“, rief einer der Umstehenden. „Ich hab’s genau gesehen.“
„Da war eine Hornisse“, versuchte Lena von diesem Unsinn abzulenken. „Wahrscheinlich hat die das Pferd erschreckt.“
„Der Teufel hat viele Gestalten“, hörte sie einen anderen sagen. „Mich überrascht nicht, dass du ihn aus dem Gaul getrieben hast. Ihr kennt euch wohl?“
„Halt’s Maul!“, schrie ihn der Vater an. Dann wandte er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an Lena. „Und du sieh zu, dass du den Kerl findest, dem das verfluchte Vieh gehört.“
Einer der Burschen, die sich zu den Neugierigen gesellt hatte, fühlte sich angesprochen und lief sofort los.
„Hol auch gleich den Bader“, rief Lena ihm nach. „Er müsste beim Schäfer sein, dessen Frau er einen faulen Zahn ziehen wollte!“
Die Mutter begann, ihrem Mann vom Boden aufzuhelfen, ihn zusammen mit einem Nachbarn ins Haus zu schleppen und auf sein Lager zu betten. Während Lenas jüngste Schwester einen Topf mit Wasser auf dem Herd erhitzte, kümmerten sich Lena und ihre Mutter um das verletzte Bein des Schmieds. Sie hatten ihm die schwere Lederschürze abgenommen und den zerfetzten Beinling aufgeschnitten. In einer stark blutenden Wunde waren Knochensplitter zu sehen.
Den Tritt gegen die Hüfte hatte zum Glück die dicke Lederschürze ein wenig abgefangen. Ein immer größer werdender dunkler Fleck zeigte den Frauen, wo der zweite Huf den Mann getroffen hatte.
„Guter Herrgott hilf, dass nichts weiter gebrochen ist“, murmelte die Mutter. Dann rief sie nach ihrer jüngsten Tochter um das heiße Wasser und saubere Tücher.
Während die Frauen die Beinverletzung vorsichtig auswuschen und dem sich vor Schmerz windenden Vater beruhigend zuredeten, betete Lena inbrünstig darum, dass der Bader schnell kommen und helfen möge.
Sie wusste, das mit dem verletzten Bein würde sich irgendwie wieder richten lassen, sofern der Vater nicht das Wundfieber bekam. Nicht auszudenken war jedoch, was geschah, wenn der Vater für lange Zeit nicht mehr in der Schmiede würde arbeiten können. Vielleicht sogar nie wieder, wenn das Bein steif blieb oder gar abgenommen werden musste. Dann würde das Geld über kurz oder lang knapp werden und sie würden die Schmiede verkaufen und sich wohl oder übel eine neue Bleibe suchen müssen. Ganz abgesehen davon, wie sich die ohnehin schon missliche Laune des Vaters weiter auf die Familie – und vor allen Dingen auf Lena – auswirken würde, sollte er seinen Beruf nicht mehr ausüben können.
Während sich die Frauen um den Verletzten kümmerten, mussten sie sich anhören, dass jener seinem Herrgott nicht nur für das Unglück zürnte, das ihm widerfahren war, sondern zum wievielten Mal auch dafür, dass er ihm seine Söhne genommen hatte. Die hätten ihm gerade jetzt alle Sorgen abnehmen können, die ihn so sehr quälten wie der Schmerz in seinem Bein.
„Was nur hat sich unser Himmelvater dabei gedacht, als er mir meine beiden Buben nahm und dafür diese unnützen Weiberleute am Leben ließ? Warum“, fragte der Verletzte mit schmerzverzerrtem Gesicht. „Warum hat er mir ausgerechnet dieses gottverdammte Weibsbild gelassen und meine Söhne genommen?“
Er zeigte mit zitternden Fingern auf die leichenblass mit gefalteten Händen neben seinem Lager stehende Lena.
„Aber Vater …“, begann sie erschrocken. „Machst du mich für das Unglück verantwortlich, das dir zugestoßen ist? Es war doch eine Hornisse …“
„Eine Hornisse hätte das Pferd erschreckt, sagst du?“, schrie er sie an. „Kein Pferd scheut wegen einer verdammten Hornisse! Es wird viel geredet über dich, und manchmal denke ich, die Leute haben recht mit dem, was sie sagen. Geh mir aus den Augen!“
„Versündige dich nicht“, bat ihn die Mutter leise, aber der Vater winkte unwirsch ab.
Lena wusste, worauf der Vater anspielte, und tat so, als habe sie nicht verstanden, was hinter seinen Worten stand. Aber er schlug wütend ihre Hand zur Seite, mit der sie ihm tröstend über die schweißnasse Stirn streichen wollte.
„Habe ich es dir nicht deutlich genug gesagt?“, fauchte er sie erneut an. „Geh mir aus den Augen!“
Lena biss sich auf die Lippe, strich über ihren Handrücken, der vom Schlag mit der kräftigen Pranke des Vaters schmerzte, wandte sich um und schlich aus der Tür. Ihre zweite Schwester kam ihr entgegengelaufen, die im Garten zu tun gehabt hatte. Nach einem Blick in Lenas verstörtes Gesicht verschwand sie wortlos im Haus.
Lena lief hinüber zur Schmiede und setzte sich auf einen umgestülpten Kübel. Jetzt erst wurde ihr mit aller Macht bewusst, welche Gefühle der Vater tatsächlich für sie hegte. Sie hatte seine Ablehnung immer geduldig ertragen, immer wieder verdrängt, entschuldigt, begriff aber jetzt, dass es weitaus mehr als Ablehnung war.
Er hasste sie.
Er hasste sie, weil sie überlebt hatte, während ihre beiden Brüder sterben mussten.
Er hasste sie, weil sie ihn mit ihren verzweifelten Versuchen, sie ihm zu ersetzen, rührte, was er aber niemals zugeben konnte.
Er hasste sie, weil er sie gegen die Leute aus dem Dorf verteidigen musste, die sie hinter vorgehaltener Hand als Hexe bezeichneten.
Die Gedanken um all das kreisten wie böse Geister durch ihren Kopf und ließen sie laut aufschluchzen. Sie hatte die kleinen Buben doch gemocht, denen nur ein kurzes Leben vergönnt gewesen war. Ihretwegen hätten sie nicht sterben müssen. Vielleicht wäre es wirklich besser gewesen, der liebe Herrgott hätte sie an ihrer Stelle von dieser Erde genommen. Das hätte ihnen allen viel erspart.
Ein Schatten fiel auf sie. Jemand war hereingekommen und vor ihr stehen geblieben.
„Was ist jetzt mit meinem Pferd?“, fragte der Mann, zu dem der Schatten gehörte. „Dem fehlt noch ein Eisen. So kann ich nicht weiterziehen.“
Lena schaute ihn verwirrt an. Zu sehr war sie noch in den Gedanken gefangen, die ihr durch den Kopf schwirrten.
„Was meint Ihr?“, fragte sie.
Der Mann vor ihr hob beide Schultern und breitete ratlos die Arme aus.
„Das Pferd!“ Er drehte sich halb um und zeigte nach draußen. „Bist du schwerhörig oder blöde oder beides? Der Schmied hat seine Arbeit nicht fertig gemacht! Was wird jetzt damit?“
Schwerhörig oder blöde oder beides? Das sagte der Mann, der ihr erst vor wenigen Minuten noch ein Lächeln geschenkt hatte, das ihre Knie weich werden ließ?
Lena erwachte langsam aus ihrer Erstarrung. Ihr Blick fiel auf das Ross, das inzwischen ruhig und mit gesenktem Kopf vor sich hindösend draußen angebunden stand und wartete. Natürlich, das Pferd war ja nicht fertig beschlagen worden, bevor es nach dem Vater trat. Dass es den Mann nicht interessierte, was das Unglück für den Schmied und seine Familie bedeutete, war ihm deutlich anzusehen. Falls er überhaupt mitbekommen hatte, was geschehen war. Ein Blick auf den Burschen, der den Reiter hergeführt hatte und der abwartend draußen stehen geblieben war, sagte ihr jedoch, dass jener den Besitzer des Pferdes genauestens über den Vorfall unterrichtet hatte.
Lena erhob sich und strich eine vorwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht. Dann stapfte sie wortlos an dem Fremden vorbei hinaus zu dem Tier, das ihr neugierig und leise schnaubend den Kopf zuwandte.
Ihr Blick fiel auf das Eisen, das dem Vater mitsamt seinem Werkzeug aus der Hand gefallen war und zusammen mit einer Handvoll Nägel verstreut vor dem Tor lag. Alles war so weit vorbereitet, dass der vierte Huf nur noch beschlagen werden musste. Lena hob das Eisen auf und wog es einen Augenblick lang nachdenklich in der Hand. Dann suchte sie Nägel und Werkzeug zusammen und wies den immer noch neugierig vor dem Tor stehenden Burschen an, den Blasebalg zu treten. Sie legte das Eisen in die Glut, wie sie es vom Vater gesehen hatte, kühlte es im bereitstehenden Wassereimer ein wenig ab und trat dann neben das Pferd.
„Hoch!“
Das Ross gehorchte augenblicklich und überließ ihr das Hinterbein, das sie an der Fessel umfasste. Mit einem eisernen Haken befreite sie den Huf vom Dreck, der sich bei der wilden Attacke des Tieres darin festgesetzt hatte, und begann mit der Arbeit. Die gestaltete sich für sie weitaus schwerer, als es bei ihrem Vater ausgesehen hatte, und Lena kam ordentlich ins Schwitzen. Vor allem, weil es nicht einfach für sie war, den Huf des Pferdes auf ihrem durch einen Lederlappen geschützten Oberschenkel abzustützen, festzuhalten, mit der anderen Hand das Eisen aufzulegen und mit kräftigen Hammerschlägen die Nägel einzuschlagen. Gott sei Dank hatte der Vater den Huf bereits vorbereitet und das Eisen angepasst.
Der Zorn darüber, dass der Besitzer des Pferdes keinerlei Anstalten machte, ihr zu helfen, weckte enorme Kräfte in ihr und den eisernen Willen dazu, die Arbeit des Vaters ordentlich zu Ende zu führen.
Als sie nach einer endlos scheinenden Zeit fertig war, erhob sie sich, legte den Hammer zur Seite, wischte mit der schmutzigen Hand über ihre schweißnasse Stirn und streckte sie dann aus, um das mit dem Vater vereinbarte Geld einzufordern. Aber der Besitzer des Pferdes lachte sie aus.
„Ich bezahle nicht für die Arbeit einer Bauerndirne!“, ließ er sie wissen. „Ich werde den nächsten Schmied aufsuchen und nachsehen lassen, ob alles in Ordnung ist und ich mit meinem Pferd gefahrlos weiterreiten kann. Der macht das nicht ohne Bezahlung. Ganz abgesehen von dem Schaden, den das Tier bis dahin genommen haben mag.“
Dabei schlug er Lenas Hand zurück. Es war das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass ihr jemand auf die Hand schlug. Zwei Mal zu viel. Das Blut rauschte in ihren Ohren.
„Sei froh, wenn ich die Kosten für das alles nicht von euch zurückfordere“, hörte sie ihn weiter sagen, während er sich zum Gehen wandte.