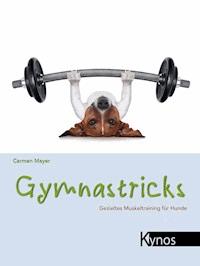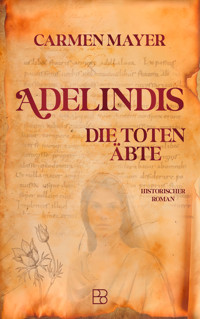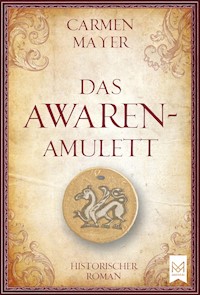Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dreißigjähriger Krieg-Reihe
- Sprache: Deutsch
Was geschah 1632 wirklich? Thomas, der eine besondere Begabung im Umgang mit Pferden zu haben scheint, wird von Hauptmann Leonhart Seitz vom Walde zu sich geholt. Dieser schenkt ihm volles Vertrauen, vor allem als er vom bayerischen Kurfürsten den Befehl erhält, im württembergischen Gestüt Marbach eine kleine Herde wertvoller Pferde zu kaufen. Hier entdeckt er einen einzigartigen Hengst, der für ihn zum Symbol eines besseren Lebens wird. An der Seite seines Hauptmanns sieht Thomas den Prunk, mit dem sich der bayerische Kurfürst umgibt, während sein Volk hungert. Wie sehr unterscheidet sich das Leben des armen Bauernmädchens Rosa aus dem Audorf Oberstimm im Süden Ingolstadts, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, davon. Die Ereignisse überschlagen sich und viel passiert, bis Thomas schließlich den prachtvollen Hengst wiedersieht: Auf seinem Rücken trägt er den Schwedenkönig Gustav Adolf, der kurz davorsteht, Ingolstadt anzugreifen. Wird es Thomas gelingen, die Stadt rechtzeitig zu warnen? Flucht, Kampf und Gewalt prägen diese Tage des Dreißigjährigen Krieges, aber immer geht es auch um den unbändigen Willen eines jungen Mannes um Aufrichtigkeit und Treue gegenüber Menschen, die ihm vertrauen und die er bewundert und liebt. Um seinen Traum von einem Leben ohne Not und Elend und die Enttäuschung darüber, dass genau das den Menschen seines Standes nicht vergönnt ist. Es geht um Träume, aber auch um Hass, Rache und Verzweiflung, und letztendlich immer um die große Liebe. Tauchen Sie ein in die Geschichte von Thomas und Rosa und dem Schicksal des "Schwedenschimmels", der noch heute im städtischen Museum in Ingolstadt zu sehen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen Meyer
Der Schwedenschimmel
Historischer Roman
Zum Buch
Was geschah 1632 wirklich?
Thomas, der eine besondere Begabung im Umgang mit Pferden zu haben scheint, wird von Hauptmann Leonhart Seitz vom Walde zu sich geholt. Dieser schenkt ihm volles Vertrauen, vor allem als er vom bayerischen Kurfürsten den Befehl erhält, im württembergischen Gestüt Marbach eine kleine Herde wertvoller Pferde zu kaufen. Hier entdeckt er einen einzigartigen Hengst, der für ihn zum Symbol eines besseren Lebens wird.
An der Seite seines Hauptmanns sieht Thomas den Prunk, mit dem sich der bayerische Kurfürst umgibt, während sein Volk hungert. Wie sehr unterscheidet sich das Leben des armen Bauernmädchens Rosa aus dem Audorf Oberstimm im Süden Ingolstadts, das ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, davon.
Die Ereignisse überschlagen sich und viel passiert, bis Thomas schließlich den prachtvollen Hengst wiedersieht: Auf seinem Rücken trägt er den Schwedenkönig Gustav Adolf, der kurz davorsteht, Ingolstadt anzugreifen…
Flucht, Kampf und Gewalt prägen diese Tage des Dreißigjährigen Krieges, aber immer geht es auch um den unbändigen Willen eines jungen Mannes um Aufrichtigkeit und Treue gegenüber Menschen, die ihm vertrauen und die er bewundert und liebt. Um seinen Traum von einem Leben ohne Not und Elend und die Enttäuschung darüber, dass genau das den Menschen seines Standes nicht vergönnt ist. Es geht um Träume, aber auch um Hass, Rache und Verzweiflung, und letztendlich immer um die große Liebe.
Tauchen Sie ein in die Geschichte von Thomas und Rosa und dem Schicksal des „Schwedenschimmels“, der noch heute im städtischen Museum in Ingolstadt zu sehen ist.
Inhalt
Zum Buch
Impressum
Widmung
Vorbemerkung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Nachwort
Glossar
Über die Autorin Carmen Mayer
Weitere Bücher dieser Reihe
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2021 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2021
Lektorat: Bernadette Lindebacher
Korrektorat: Dr. Gabriele Rupp
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Covergestaltung: Alin Mattfeldt
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Made in Germany
ISBN 978-3-948346-28-7
Widmung
In Dankbarkeit für meine Familie,
die mich während der Entstehung
dieses und aller meiner Bücher
geduldig begleitet, unterstützt,
immer wieder aufgemuntert
und tapfer ertragen hat.
Vorbemerkung
Zur Erklärung historischer und regionaltypischer Begriffe findet sich am Ende des Buches ein Glossar.
1. Kapitel
Aychstätt, Oktober 1626
„Sag das noch einmal.“
Der Trossführer hatte sich wütend vor dem Burschen aufgebaut.
„Du hast richtig gehört, Oswald, Herr: Es gibt kein Brot“, stotterte der Bub, der sich vor einem erwarteten Schlag duckte und abwehrend die Hand gehoben hatte. „Die Bäckerweiber sind verschwunden.“
Oswald holte so tief Luft, dass der Junge befürchtete, sein Herr würde gleich vor Wut platzen. Der war ein stämmiger, grobschlächtiger Kerl mit tief liegenden Augen in einem immer grantigen Gesicht. Hinter schmalen Lippen waren seine teilweise schwarz verfärbten, schief stehenden Zähne zu sehen, die wohl der Grund dafür waren, weshalb er stank, sobald er den Mund aufmachte. Wobei er meistens herumbrüllte und dabei reichlich Spucke versprühte, was zusammengenommen so gut wie jeden dazu veranlasste, Abstand zu halten.
„Was heißt hier verschwunden? Wie verschwunden, wohin verschwunden? Wovon redest du missratene Ratte überhaupt?“
Der Trossführer packte den Burschen an den Oberarmen, hob ihn hoch und schüttelte ihn wie einen nassen Sack. Dann ließ er ihn wieder los und stieß ihn so abrupt zur Seite, dass er fast gestürzt wäre. Er rappelte sich schnell auf und machte sich aus dem Staub, kannte er doch die Tobsuchtsanfälle des Trossführers. Es war erfahrungsgemäß besser, man geriet ihm nicht ein zweites Mal in die Finger.
Der Söldnertrupp Leonhart Seitz vom Waldes und der dazugehörige Tross lagerten seit Monaten auf dem Hasenbuck, einem lang gestreckten, bewaldeten Hügel, der die Altmühl im Südwesten der Stadt Aychstätt im Kurfürstentum Baiern begleitete. Auf seinem Sporn war drei Jahrhunderte zuvor die Willibaldsburg errichtet worden, die den jeweiligen Bischöfen der Stadt als Wohnsitz diente. Sie alle hatten die Burg ständig mit Umbauten und Erweiterungen ihren jeweiligen Ansprüchen angepasst, sodass sie inzwischen als ausgesprochen imposantes Bauwerk trutzig über die Stadt zu wachen schien. Wer sich Aychstätt näherte, dem fielen zuallererst die beiden Türme mit ihren Zwiebeldächern am nördlichen Ende der Burganlage auf, bevor die Türme der Kirchen und des Doms der Stadt in sein Blickfeld kamen.
Aychstätt war von einer dicken Mauer umgeben, die auf der Altmühlseite am Ufer entlang errichtet worden war. Sie umschloss die Stadt in weitem Bogen und schien sich auf der gegenüberliegenden Seite an den dortigen Berghang zu lehnen. Innerhalb der Mauern ragten die spitzen Türme des Doms in den Himmel, flankiert von Türmen und Türmchen anderer sakraler und weltlicher Bauwerke. Imposant waren dazwischen die unübersehbar reich ausgestatteten Bauwerke der Aychstätter Domherren, die sich die besten Plätze dafür in der Stadt ausgesucht hatten.
Auch außerhalb der Stadtbefestigung gab es ein paar Häuser, die unterhalb des Hasenbuck entlang der Altmühl gebaut worden waren und die Straße begleiteten.
Im Westen des Hügels befanden sich die Klöster der Augustinerchorfrauen und -herren, Marienstein und Rebdorf.
Das Hochstift Aychstätt befand sich seit über einem Jahrzehnt unter der Herrschaft des Fürstbischofs Johann Christoph von Westerstetten. Er hatte als überzeugter Anhänger der Politik seines Freundes und Gönners Maximilian I. von Baiern das Hochstift Aychstätt bereits 1617 der Katholischen Liga zugeführt und den ehemaligen Herzog und jetzigen Kurfürsten gebeten, die Stadt, und vor allem seine hoch über deren Mauern liegende Burg vor möglichen Angriffen protestantischer Heere zu schützen. Eine gut dreihundert Mann starke Truppe samt dazugehörigem, doppelt so großem Tross hatte sich ungefähr oberhalb der Altmühlinsel mit den beiden Mühlen ein Lager eingerichtet, das sich am Kamm des Hügels knapp eine Viertelmeile Richtung Willibaldsburg entlangzog.
Die Söldner lebten zum großen Teil in Zelten, während sich viele der Trossleute kleinere Hütten gebaut hatten. Außer den Marketendern, Hirten, dem Trosspfaffen, einem Schmied und etlichen anderen Handwerkern hatten bislang zwei Bäckerinnen und ihre Gehilfin Truppe und Trossleute mit dem Notwendigsten versorgt.
Es war eine ruhige Zeit gewesen für die Menschen in und um Aychstätt, denn kein feindliches Heer hatte bislang Interesse an der Stadt, ihren Klöstern oder der Burg gezeigt. Die Aktivitäten protestantischer und katholischer Heerführer lagen weit im Norden Deutschlands, in Österreich und im fernen Ungarn. Deshalb war nicht nur den Beschützern der Stadt sehr schnell klar, dass die vom Fürstbischof durchgesetzte Maßnahme lediglich dessen Dünkel förderlich war.
Solange man ihnen ihren Sold bezahlte, hatten die Männer und Frauen nichts gegen ein paar Wochen Ruhe einzuwenden gehabt. Einige unter ihnen waren bereits in blutige Auseinandersetzungen zwischen katholischen und protestantischen Einheiten oder in Konflikte mit aufständischen Bauern in Österreich verwickelt gewesen. Sie kannten die Gräuel, die damit einhergingen, wussten um die Krankheiten, denen die Bevölkerung und Heere samt ihren Trossen zu Tausenden zum Opfer fielen. Manche hatten zwischendurch hin und wieder die Seiten gewechselt, wenn es keinen Sold mehr gab, oder versucht, Arbeit außerhalb eines militärischen Verbandes zu suchen. Sie mussten aber schnell einsehen, dass der Aufenthalt im Tross inzwischen die einzige Möglichkeit für sie war, zu überleben. Zu deutlich standen ihnen die Alternativen noch vor Augen: Sie hatten oftmals mehr oder weniger schwere Verletzungen davongetragen, hatten gefroren, gehungert, waren krank geworden. Und vor allem: Sie hatten kein Zuhause mehr, in das sie zurückkehren konnten.
Aychstätt befand sich zur selben Zeit in allerhöchster Anspannung. Der Fürstbischof, der kraft seines Amtes sowohl die weltliche als auch die kirchliche Macht über das Hochstift Aychstätt besaß, war ein gefürchteter Hexenjäger. Er hatte bereits als Fürstpropst von Ellwangen unzählige der Hexerei beschuldigte Menschen auf den Scheiterhaufen gebracht. Seinem sprichwörtlichen Feuereifer, die Menschheit von diesem mutmaßlichen Natterngezücht zu befreien, waren in Aychstätt seit seiner Weihe zum Bischof bereits ebenfalls unzählige Menschen zum Opfer gefallen.
Gerade in der vergangenen Woche hatten die Büttel wieder eine der als Unholdinnen Beschuldigten gefangen genommen und eingesperrt. Dieser Tage stand außerdem die Verbrennung von wenigstens drei Weibern an, deren schändliche Verbindung zum Höllenfürsten und unheilvolle Umtriebe als Hexen bei peinlichen Befragungen einwandfrei nachgewiesen werden konnten.
Auch unter den Söldnern und Trossleuten auf dem Hasenbuck war diesen Umständen geschuldet eine gewisse Unruhe entstanden. Sie waren bislang von Verdächtigungen unbehelligt geblieben, was daran liegen mochte, dass sie von Aychstätts Bürgern eher als Belagerer denn als Beschützer betrachtet wurden, von denen man sich besser fernhielt. Üblicherweise verlangten solche Trupps Kontribution von den Ortschaften, zu deren Schutz sie abgestellt wurden oder zu dem sie sich selbst ernannten. Da sie jedoch von Kurfürstens Gnaden leben konnten, blieb Aychstätt von solcherlei materiellen und finanziellen Forderungen an seine Bürger verschont.
Gerade in den vergangenen Tagen jedoch war das Misstrauen untereinander aufgrund lautstarker Auseinandersetzungen zwischen einer der Bäckerinnen und dem Trossführer spürbar angewachsen.
Oswald hatte sich an diesem Morgen ein großes Stück gebratenes Huhn bringen lassen und wollte seine Schüssel mit einem Kanten Brot ausstreichen, als er feststellen musste, dass der Korb leer war. Die Nachricht des Burschen, dass es kein Brot gebe, weil die Bäckerinnen unauffindbar seien, hatte den Trossführer aus zweierlei Gründen wütend werden lassen. Zum einen, weil er nicht duldete, dass sich jemand seinen Anordnungen widersetzte, zum Zweiten, weil sich niemand ohne seine Erlaubnis vom Tross zu entfernen hatte.
Gerade die beiden Bäckerinnen und ihre streitbare Gehilfin Magdalena waren ihm seit Wochen ein Dorn im Auge gewesen. Das war der dritte Grund, weshalb er jetzt völlig außer sich geraten war und den armen Jungen am liebsten erwürgt hätte.
Diese Magdalena hatte sich erdreistet, ihn vor den Trossleuten zur Rede zu stellen. Ihr passte nicht, dass er sie immer wieder zurechtwies und ihr letztendlich Prügel androhte, weil er so etwas nicht durchgehen lassen konnte. Dabei widersprach sie ihm ständig und war nicht gewillt, sich ihm unterzuordnen, wie es sich für Weiberleute nun einmal gehörte. Das Allerdreisteste war jedoch, dass sie einen jungen Kerl unter ihre Röcke gelassen, ihn jedoch abgewiesen hatte. Bloßgestellt hatte ihn das Weibsstück, seine Männlichkeit lächerlich gemacht und seine Macht infrage gestellt vor allen Leuten. Das sollte sie ihm büßen.
Oswald wurde als Trossführer nicht respektiert, sondern gefürchtet. Ihm war der Unterschied im Grunde genommen gleichgültig. Aber er wusste, dass seinen Leuten die gelegentlich auch in Handgreiflichkeiten ausartenden Reibereien zwischen ihm und Magdalena deutlich gemacht hatten, woraus dieser Unterschied bestand. Es würde nicht lange dauern, und die Stimmung unter ihnen würde in etwas umschlagen, das es seiner Meinung nach in jedem Fall zu vermeiden galt. Bevor er seine gefühlte Macht über die Trossleute verlor, musste er etwas unternehmen. Magdalena musste für immer verschwinden, und das auf eine Weise, die seine angeschlagene Männlichkeit und seinen verletzten Stolz zutiefst befriedigen sollte.
Er erinnerte sich daran, dass Magdalena eine Zeit lang ein stummes Weib in ihre Obhut genommen hatte. Das Weibsstück musste wohl der Teufel geholt haben, denn es war nichts über ihren weiteren Verbleib bekannt geworden, nachdem die Flüchtlingsgruppe überfallen worden war, in der die beiden mitzogen. Oswald kam darüber hinaus zu Ohren, dass dieses Weib angeblich großes Unheil über die Menschen gebracht hatte, die ihr arglos begegnet waren. Magdalena hatte den Überfall überlebt und war anschließend zusammen mit dem Kerl im Tross aufgetaucht, den sie später unter ihren Rock gelassen hatte. Vielleicht war ja die verdorbene Seele des Hexenweibes in sie gefahren, wer weiß?
Das alles wollte er sich gegen das aufwieglerische Weibsbild zunutze machen, ohne dabei selber schmutzige Hände zu bekommen.
Am Tag zuvor hatte er den Entschluss gefasst, die vermaledeite Zwiderwurzn bei den Aychstätter Bütteln anzuzeigen. Da Magdalena jedoch bei den Trossleuten einen guten Stand hatte und in vielerlei Hinsicht von ihnen respektiert wurde, musste er sehr vorsichtig sein, um die nicht auch noch gegen sich aufzubringen. Er musste alles so geschickt inszenieren, dass in der Folge niemand ihn der Tat verdächtigte, die er tatsächlich im Schilde führte.
Außerdem war ihm nicht verborgen geblieben, dass Hauptmann Leonhart dem Weibsbild immer wieder zur Seite sprang. Aber er war noch nicht dahintergekommen, woran das lag. Hatte sie den auch in ihren Bann gezogen?
Er musste verteufelt – Herr, vergib! Er musste sehr vorsichtig sein.
Sein erster Gedanke war, dass Magdalena vorderhand wegen Holzdiebstahls angezeigt und verhaftet werden könnte, was bereits hohe Strafen nach sich zog, wenn es ruchbar wurde. Mithilfe einiger versteckter Hinweise würde ihm dann schon gelingen, alles so hinzubiegen, dass man ihr den Prozess wegen noch weitaus schwerwiegenderer Verfehlungen machen konnte. Das mit dem Holz – nun ja, da müsste man schon auch ein wenig nachhelfen, um es anzeigen zu können. Gestohlen hatten die drei Frauen es ja nicht, wenn sie es im fürstbischöflichen Wald auf dem Hasenbuck sammelten, während dort Bäume gefällt wurden. Es gab aber auch keine ausdrückliche Erlaubnis dafür.
Die Frauen brauchten das Holz, um ihre Bäckerei betreiben zu können, von welcher sich der Fürstbischof höchstselbst sehr angetan gezeigt hatte. Das belohnte er über seinen Kammerdiener mit der einen oder anderen Münze in die Hand des Trossführers. Davon wiederum wussten die drei Frauen nichts, die den Hof des Fürstbischofs mit Brot versorgten und dafür äußerst knapp bezahlt wurden.
Oswald verwarf den Gedanken mit dem Holzdiebstahl schnell wieder. Er wollte ja aus gutem Grund nur Magdalena loswerden, nicht auch noch die beiden anderen Bäckerinnen.
Nein, er musste anders vorgehen.
Der Trossführer wusste natürlich wie alle im Lager, dass der Hochwohlgeborene nach Gottes Gnaden ein über die Grenzen Baierns hinaus bekannter Hexenverfolger war. Weder Fürstbischof Johann Christoph von Westerstetten noch Oswald hatten ihre Freude an Weibern, die nicht gewillt waren, sich in ihre gottgewollte Rolle zu fügen und dem Manne untertan zu sein, wie es schon die Bibel einforderte. Außerdem war gemeinhin bekannt, dass gerade diese unfolgsamen Weibsbilder nur zu gerne den Verführungen des Leibhaftigen verfielen.
Die Abscheu solchen Weiberleuten gegenüber sowie das Wissen um die Legitimität ihrer Vernichtung, wie sie im Werk des dominikanischen Theologen Heinrich Kramer mit dem Titel ‚Der Hexenhammer‘ beschrieben stand, verband die beiden in gewisser Weise. Oswald selber konnte zwar nur das Allernötigste lesen, hatte sich aber von seinem Trosspfaffen genau über den Inhalt dieser Schrift berichten lassen und sein Wohlgefallen daran gefunden.
Oswald war immer schon bestrebt gewesen, sich gegen alles und jeden zu stellen, das oder der nicht in sein Weltbild passte. Darin schien er mit dem Fürstbischof auf wunderbare Weise übereinzustimmen, was der Trossführer nach reiflicher Überlegung zu seinen Gunsten auszunützen gedachte.
Am selben Abend noch ließ er in einem der Wirtshäuser in Aychstätt ein paar Worte über ein Weibsbild fallen, das sich seit einiger Zeit in seinem Tross aufhalte. Er habe herausgefunden, sagte er wie beiläufig, dass diese Magdalena sich mit Weibsbildern abgegeben haben soll, die gemeinhin als Hexen bekannt gewesen seien. Ihren Namen hatte er wohlweislich eingebracht, damit es später keine Verwechslungen gab. Wobei es sich natürlich auch um reine Vermutungen handeln könnte, wie er ausdrücklich betonte. Aber man wisse ja, dass in jedem Gerücht ein Funke Wahrheit stecke. Er habe also den Verdacht, dass dieses Frauenzimmer, also diese Magdalena, dass die etwas mit den Machenschaften solcher Unholdinnen zu tun haben könnte. Oder noch schlimmer: Dass sie von ihnen angesteckt worden und selber der Hexerei verfallen sei. Schließlich sei das, was diese Weibsbilder antreibe, doch schlimmer und ansteckender als die Pest. Das stehe schon in den Schriften dieses Heinrich Kramer, wie ihm der Trosspfaffe berichtet habe.
Die Tatsache, dass Truppe und Tross unweit der allgemein als Hexentanzplatz bekannten Hinteren Waschette lagerten, in deren Nähe dieses Frauenzimmer immer mal wieder unter dem Vorwand verschwinde, trockenes Holz für die Bäckerei zu sammeln, lasse ihm schon längere Zeit keine Ruhe mehr.
Er rieb sich stolz die Hände darüber, auf diese Weise das mit dem mutmaßlichen Holzdiebstahl und dem Verdacht auf Hexerei geschickt verbunden zu haben. Jetzt konnte die Obrigkeit entweder das eine oder das andere zum Anlass nehmen, ihn von diesem Weib zu befreien.
Er war schlauer als sie alle. Vor allem schlauer als dieses verfluchte Weibsbild, das ihn schon beim Gedanken an sie zur Weißglut brachte. Wenn das kein Hexenwerk war!
Aber das behielt er wohlweislich für sich.
Als einer der Büttel sich nach ihm umdrehte, der an einem der anderen Tische saß und sein Bier soff, tat Oswald so, als fühle er sich bei etwas Unrechtem ertappt, und lenkte das Gespräch schnell auf etwas anderes. Es sollte ja ganz danach aussehen, als habe er sich nur verplappert und nichts mit dem zu tun, was in der Folge geschehen würde. Hoffentlich geschehen würde!
Ausgerechnet in dieser Nacht nun war das verfluchte Weibsstück verschwunden, zusammen mit den beiden Bäckerinnen, mit denen sie gearbeitet hatte.
Wusste er es doch: Das Weib stand mit dem Teufel im Bunde, anders konnte es gar nicht sein! Wie sonst sollte sie etwas von seinem Ansinnen gewusst haben?
Er schäumte vor Wut, hatte sie doch mit ihrem Verschwinden seinen schönen Plan zunichte gemacht, sie als wehrloses Opfer unter der hochnotpeinlichen Befragung zu wissen und in der Folge auf einem der Aychstätter Scheiterhaufen brennen zu sehen.
Jetzt mehr als zuvor wusste er:
Sie war zweifellos eine Hexe.
Er musste sie wiederfinden.
Sie musste bestraft werden.
Er musste sie leiden und brennen sehen.
Sie durfte ihm nicht einfach entwischen.
Wutentbrannt lief Oswald zur verwaisten Bäckerei, vor der ein paar ratlose Trossleute und Söldner standen. Er war drauf und dran, alles kurz und klein zu schlagen, was den Weiberleuten gehört hatte. Doch dann blieb er wie angewurzelt stehen.
Da gab es doch den Kerl, den das liederliche Weibsbild immer wieder unter ihren Rock gelassen hatte. Der zusammen mit Magdalena zum Tross gestoßen war und seither dem Schmied als Geselle zur Seite stand. Auch er war bei diesem Überfall auf die Flüchtlinge mit dem Leben davongekommen. Wenn der auch verschwunden war, wusste er, wie alles zusammenhing.
Das stank wie Schwefel zum Himmel!
Oswald würde ein paar Männer losschicken, um diesen Hundsfott und die Weiber wieder einfangen zu lassen. Wie gut, dass der Hauptmann des Söldnertrupps im Auftrag des Kurfürsten in Ingolstadt weilte. Oswald wusste, dass der sich niemals in Angelegenheiten des Trosses einmischte und ganz bestimmt keinen der Söldner hinter den Weibern und dem Schmiedegesellen herschicken würde. Aber unter den Männern der Truppe befanden sich welche, die für ein paar Kupfermünzen bereit waren, diese Aufgabe für ihn zu erledigen, das wusste er. Er würde den Lumpenhund ordentlich verdreschen lassen und daran erinnern, wo sein Platz war, wenn es ihm dann noch möglich sein sollte. Jedenfalls nicht unter dem Rock dieser gottverdammten Hexe, wo er selber nur einmal und da auch nur beinahe zum Zug gekommen war. Der Vorfall hatte ihm den Spott und die Verachtung vieler aus dem Tross eingebracht – auch dafür sollte sie büßen!
Der Gedanke daran, dieses Weibsstück im Dreck kriechend und heulend um Gnade flehen zu sehen, sie zu verprügeln wie eine räudige Hündin und ihr zu zeigen, was sie einem Mann wie ihm schuldig war, stimmte ihn mit einem Mal frohgemut. Danach war noch genügend Zeit, sie den Bütteln zu überlassen.
Oswald hieb seine rechte Faust in die offene Linke.
Dieses Weib würde ihm nicht entkommen, egal, wie weit sie schon vom Lager entfernt sein mochte.
Genau in diesem Augenblick kroch der junge Kerl, um den sich seine Gedanken in dem Zusammenhang auch gedreht hatten, aus seinem Zelt und schaute sich verschlafen um. Bevor Oswald etwas zu ihm sagen konnte, machte er sich auf den Weg zur Schmiede, wo sein Meister bereits ungeduldig auf ihn wartete.
Oswald stand einen Augenblick lang fassungslos da und starrte dem jungen Schmiedegesellen hinterher. Mit wenigen Schritten war er bei dessen Zelt, riss die Plane hoch, die den Eingang verdeckte, und warf einen Blick ins Innere. Das Zelt war leer.
„Dieses verdammte Teufelsweib!“, brüllte er und holte mit der Faust aus, um auf das Zelt einzuschlagen.
Da tippte ihm jemand auf die Schulter. Oswald fuhr erschrocken herum. Es war Hauptmann Leonhart Seitz vom Walde.
„Ihr seid wieder zurück?“, fragte er ihn mit kaum unterdrücktem Zorn auf den bebenden Lippen. „Ich habe Euch morgen erst erwartet.“
„Bist du deshalb so wütend?“, wollte Leonhart mit hochgezogenen Augenbrauen wissen.
„Nein, natürlich nicht. Es ist nur …“
„Ich suche jemanden, der Bier brauen kann“, unterbrach Leonhart ihn.
„Bier brauen?“
„Bier brauen, ja! Hörst du seit Neuestem schlecht? Dem Fürstbischof gehört die Brauerei unterhalb der Burg, wie du wissen dürftest, und die suchen jemanden, der sich mit dem Handwerk auskennt.“
„Bierbrauer? Findet sich denn in seiner Stadt niemand dafür?“, fragte Oswald stirnrunzelnd, noch immer um Fassung ringend. „Ich wüsste nicht, wer bei uns so etwas kann.“
„Dann sieh zu, dass du es herausfindest, und zwar schleunigst.“
„Ich will zuerst einmal herausfinden, wo die drei Weiberleute stecken, die dafür zuständig sind, dass der Tross mit Brot versorgt wird“, gab Oswald zurück. Er musste sich verdammt noch mal beeilen, wenn er sie noch finden wollte. Außerdem war er nicht gewillt, sich von ganz gleich wem Befehle erteilen zu lassen.
„Ich bin heute Nacht aus Ingolstadt zurückgekommen und habe den Wunsch des Fürstbischofs vorgefunden, eine Hilfe für die Brauerei abzustellen. Du wirst dich umgehend darum kümmern, dass sich einer deiner Männer auf den Weg macht. Mich interessieren deine Weibergeschichten nicht“, gab der Hauptmann ihm nachdrücklich zu verstehen, wandte sich um und machte sich in Richtung des Söldnerlagers auf den Weg.
Oswald schnappte nach Luft, die er mit einem wütenden Fluch wieder ausstieß. Dieser Mistkerl hatte sich nicht in die Angelegenheiten des Trosses einzumischen, was glaubte er eigentlich, wer er war? Allerdings war natürlich dem Wunsch des Fürstbischofs entgegenzukommen, auf dessen Veranlassung sie hier lagerten und der dafür Sorge trug, dass sie anständig bezahlt wurden.
Trotzig verschränkte er die Arme vor der Brust. Er würde sich Zeit damit lassen, diesem Wunsch nachzukommen.
Da erst wurde er der Trossleute gewahr, die um ihn herumstanden und dem laut geführten Gespräch neugierig und mit zum Teil schadenfrohem Gesichtsausdruck gefolgt waren. Das änderte seine Meinung schlagartig. Oswald musste ihnen allen zeigen, wer hier das Sagen hatte, und dass er keinesfalls gewillt war, sich von irgendjemandem auf der Nase herumtanzen zu lassen. Er deutete auf einen Mann mittleren Alters, der ihm am nächsten stand.
„Du gehst zur Brauerei“, herrschte er ihn an und zeigte dann auf einen zweiten, der breit grinsend und mit vor der Brust verschränkten Armen danebenstand. „Und du suchst sofort fünf Mann zusammen und kommst mit mir. Wie ihr gehört habt, sind unsere drei Bäckerinnen heute Nacht aus dem Lager verschwunden. Ich will sie schnellstens wieder hierhaben, sonst geht uns das Brot im Lager aus.“ Erneut schnappte er nach Luft, so wütend war er. „Sollte einer von euch wissen, wo die Weiberleute verblieben sind …“
Weiter kam er nicht. Die meisten Trossleute hatten sich schweigend getrollt. Nur der, der zur Brauerei gehen sollte, stand noch da, und eine Frau war mit in die Hüfte gestemmten Fäusten ebenfalls stehen geblieben.
„Wir wissen nicht, wo die Weibsbilder sind“, keifte sie ihn an. „Wenn sie mit dem Teufel im Bunde stehen, wie du vermutest, dann ist es uns recht, wenn sie nicht mehr wiederkommen.“ Sie spuckte auf den Boden und machte dann ein Abwehrzeichen gegen böse Geister. Oswald entging in seinem Glauben, sie stünde mit ihrer Meinung voll und ganz hinter ihm, dass sie die Finger dabei in seine Richtung ausstreckte. „Such neue Bäckerinnen, damit wir wieder Brot haben, und zwar schnell.“ Mit diesen Worten wandte sie sich um und ließ ihn stehen.
„Dieses Teufelsweib hat alle verhext!“, schrie Oswald hinter ihr her. „Passt auf, dass ich euch nicht bei etwas erwische, das euch auf den Scheiterhaufen bringen könnte! Hurenvolk, verdammtes!“
„Was ist mit mir?“
Oswald drehte sich zu dem Mann um, der ihm diese Frage gestellt hatte. Es war der, den er zur Brauerei schicken wollte.
„Was mit dir ist?“, fuhr er ihn an. „Wenn dir dein jämmerliches Leben lieb ist, stehst du nicht mehr hier herum, sondern bist bereits auf dem Weg zu dieser gottverdammten Brauerei!“
Bevor der Mann es sich versah, trieb ihn der Trossführer mit wütenden Schlägen aus dem Lager.
„Euch werde ich helfen, mir dumm zu kommen, was glaubt ihr elendes Gesindel eigentlich, wer ihr seid?“
„Die Frage ist eher, wer du bist“, hörte er jemanden aus der Gruppe Trossleute sagen, die in sicherem Abstand zwischen den Hütten und Zelten standen und das Geschehen weiterhin neugierig verfolgt hatten. Es war der Feldgeistliche, der sich recht selten im Tross blicken ließ. Er hielt sich lieber unter den Söldnern auf oder bei den Aychstätter Domherren.
Bevor er etwas gegen diese Frechheit unternehmen konnte, kamen fünf Männer auf Oswald zu.
„Woher bekommen wir Pferde?“, wollte einer von ihnen wissen.
„Pferde? Wofür braucht ihr hirnlosen Rindviecher Pferde?“
„Wenn wir die Frauen suchen sollen …?“
„Ja, seid ihr noch nicht weg?“, fauchte er sie an. „Die Weiber sind zu Fuß unterwegs, da werdet ihr sie doch auch zu Fuß einholen können! Besorgt euch von mir aus Pferde, wo ihr wollt, oder reitet auf Hühnern, aber verschwindet endlich und bringt die Bäckerinnen zurück, habt ihr mich verstanden?“
„Wolltest du nicht mitkommen?“, fragte einer der fünf.
Oswald schäumte vor Wut.
„Nein, ich habe anderes zu tun“, zischte er zwischen zusammengebissenen Zähnen und machte sich auf den Weg zur Schmiede.
2. Kapitel
Thomas hatte sich, von den Wachen unbemerkt, in sein Zelt zurückgeschlichen, nachdem er die drei Frauen auf den Weg Richtung Ulm gebracht hatte. Es war ihm schwergefallen, nicht mit ihnen zu kommen, zumal er Magdalena sehr gern mochte und sie als ausgesprochen attraktive und kluge Frau schätzen gelernt hatte. Sie war zwar einige Jahre älter als er und wohl auch schon einmal verheiratet gewesen, bevor sie ihn an jenem Tag aufgelesen hatte, an dem er beinahe sein Leben verloren hätte. Aber das störte ihn nicht. Er wusste, dass einige Trossknechte und sogar der eine oder andere Söldner ihr Anträge gemacht hatten, die sie alle ablehnte. Vor allem aber einen: den Trossführer, der dabei erwischt wurde, als er sie vergewaltigen wollte.
Thomas war hin und wieder mit einer der beiden Bäckerinnen im Gebüsch gewesen und konnte nicht fassen, dass Magdalena eines Abends zu ihm ins Zelt kam und von da an seine Gefährtin war. Er fing nicht nur mit heimlichem Stolz die neidischen Blicke derer auf, die Magdalena zuvor zurückgewiesen hatte. Er wusste auch sehr gut, dass der Trossführer seit einigen Tagen hinter ihr her war. Er hatte sich große Sorgen gemacht, auch ohne zu wissen, was Oswald plante.
Nachdem er von seinem Meister erfahren hatte, was Oswald gegen sie im Schilde führte, überredete er Magdalena dazu, schleunigst den Tross zu verlassen, und brachte sie noch selber auf den Weg. Die beiden Bäckerinnen schlossen sich ihr ohne große Überlegung an. Was ihre Gründe dafür waren, wusste er nicht. Es musste schnell gehen, da war keine Zeit für langes Überlegen und Gerede.
Im ersten Impuls wollte er mit den Frauen zusammen verschwinden, aber dann hielten ihn zwei Dinge davon ab: Einmal war er inzwischen ein anerkannter Geselle des Schmieds geworden, bei dem er seit seiner Aufnahme in den Tross arbeitete. Er liebte seine Arbeit, und sein Meister war wie der Vater für ihn geworden, den er schmerzlich vermisste. Außerdem fehlte ihm inzwischen einfach der Mut, sich außerhalb des Trosses zurechtzufinden. Der Tross war seine Familie geworden, seine Heimat. Er konnte sich nicht vorstellen, ein Leben ohne sie zu führen. Wo auch? Er hatte keine Heimat mehr, keine richtige Familie.
Sie war ausgelöscht worden, als ausgerechnet ein protestantisches Heer über sein ausschließlich von Evangelischen bewohntes Dorf in Österreich hergefallen war, es grundlos in Brand steckte und seine Bewohner niedermetzelte. Nur er war der Hölle entkommen, weil er sich rechtzeitig in Sicherheit hatte bringen können. Danach war er allein losgezogen und hatte sich einer Gruppe Protestanten angeschlossen, denen er kurz darauf begegnete. Zusammen mit ihnen machte er sich auf den Weg nach Deutschland. Er hatte nicht nur wie sie sein Zuhause verloren, sondern auch so wenig Lust wie sie, sich dem Diktat des Kaisers zu beugen, der sein Volk katholisch machen wollte.
Aber dann wurden sie von einem Haufen marodierender Söldner überfallen, die gnadenlos auf alles einstachen, was sich bewegte. Auch ihn traf der Hieb eines der Männer, und der Huf seines Pferdes zerschmetterte ihm fast den Arm. Warum er die Frau in den Armen hielt, der man vor seinen Augen ihr Ungeborenes aus dem Bauch geschnitten und sie verbluten hatte lassen, wusste er nicht mehr. Er erinnerte sich nur noch daran, wie die Kerle das Kindlein an den Füßen gepackt und mit dem Kopf gegen einen Baum geschleudert hatten. Danach waren ihm die Sinne geschwunden.
Als er mit der toten Frau im Arm aufwachte, hatte er in seiner tiefen Verzweiflung zu singen begonnen, bis sich jemand neben ihn setzte und leise mitsang.
Magdalena.
Sie waren gemeinsam weitergezogen und hatten schließlich den Tross gefunden, der zu den Männern um Junker Leonhart gehörte.
Magdalena und den beiden Bäckerinnen Anna und Irmtraud zur Flucht zu verhelfen, war er seiner Gefährtin schuldig gewesen – für alles, was sie für ihn getan und ihm bedeutet hatte.
Er mochte sie, ja. Aber er war sich auch darüber im Klaren, dass er sie ziehen und ihren weiteren Weg selber finden lassen musste. Sie war ihm eine liebe Gefährtin gewesen, hatte ihn aber auch spüren lassen, dass sie nicht mit ganzem Herzen bei ihm war. Er ahnte mehr als er wusste, dass ihr Herz einem anderen Mann gehörte. Wer dieser Mann war, wusste er nicht, wie er auch nicht wusste, warum sie nicht mit ihm zusammen war. Vielleicht lebte er nicht mehr, vielleicht hatten sie sich in den Wirren der Zeit aus den Augen verloren.
Thomas glaubte jedenfalls, dass sie keine gemeinsame Zukunft hatten.
Er wusste zwar nicht, wie die drei Frauen das bewerkstelligen würden, was zweifellos auf sie zukam, aber er wusste, dass sie es schaffen konnten. Magdalena auf jeden Fall.
Ohne ihn.
Vielleicht sogar viel eher ohne ihn.
Als er am Morgen aus dem Zelt kroch, hatte er keinesfalls ausgeschlafen, wie es dem Trossführer scheinen mochte, der genau zu diesem Zeitpunkt auf ihn zulief. Im Gegenteil: Thomas hatte die ganze Nacht über kein Auge zugetan in der Sorge um die Frauen. Er wusste, dass er sich vor Oswald in Acht nehmen musste und die Frauen auf keinen Fall verraten durfte. Es stand jedem frei, den Tross zu verlassen, wann immer er wollte. Der Trossführer sah das aber gerade im Hinblick auf Magdalena anders, wie er wusste. Er würde seine Wut darüber, dass die Frauen verschwunden waren, an ihm auslassen, sollte er herausfinden, dass er ihnen geholfen hatte.
Thomas ging mit Unschuldsmiene an dem aufgebrachten Mann vorbei, um wie gewohnt seiner Arbeit beim Schmied nachzugehen, der an diesem Tag viel zu tun hatte. Die Hufeisen einiger Pferde mussten durch neue ersetzt werden. Eines der Tiere gehörte Hauptmann Leonhart: ein wunderschöner Falbe, um den er ihn heimlich beneidete. Er liebte Pferde, wünschte, er könnte selber einmal eines sein Eigen nennen, was wohl für immer ein Traum bleiben würde.
Diesen Hengst mochte er ganz besonders. Er war eigenwillig, ließ niemanden außer seinem Besitzer an sich heran – und ihn, Thomas. Darauf war er ganz besonders stolz, und auch Hauptmann Leonhart hatte ihm Anerkennung dafür gezollt.
„Du weißt, dass deine Gefährtin heute Nacht aus dem Tross verschwunden ist?“, fragte der Schmied seinen Gesellen, der sich grußlos seiner Arbeit zuwandte.
Thomas nickte stumm.
„Zusammen mit den beiden anderen Bäckerinnen“, fuhr der Schmied fort und ließ seinen schweren Hammer auf ein Stück glühendes Eisen herabsausen, das er mit einer Zange festhielt.
„Ich danke dir, dass du mich gewarnt und den Frauen die Möglichkeit gegeben hast, von hier zu verschwinden“, antwortete Thomas leise.
„Danke mir nicht, sieh zu, dass du dem Trossführer nicht in die Quere kommst“, brummte Jost, während er weiterhin das Stück Eisen bearbeitete.
„Der ist mir bereits über den Weg gelaufen.“
Der Schmied tauchte das Eisen in einen Eimer mit Wasser, dass zischend Dampf aufstieg. Dann gab er Thomas zu verstehen, sich um seine Arbeit zu kümmern und besser den Mund zu halten.
Leonhart stand unweit der Schmiede und kümmerte sich um sein Pferd, für welches das Eisen bestimmt war, an dem der Schmied gerade arbeitete. Er konnte nicht verstehen, worüber die beiden Männer sprachen, ahnte jedoch, worum es ging. In der vergangenen Nacht war er am Versteck der drei Frauen vorbeigeritten, über deren Verschwinden inzwischen das ganze Lager sprach. Er hatte sein Pferd angehalten, als er sie im Gebüsch entdeckt hatte, und seine Begleiter weitergewinkt, angeblich, weil er seine Blase erleichtern wollte. Dass es sich bei einer der Frauen um Magdalena handelte, konnte er nur hoffen.
Er hatte die Streitigkeiten sehr wohl mitbekommen, die sich während der vergangenen Wochen zwischen ihr und dem Trossführer gehäuft und bis zu Handgreiflichkeiten gesteigert hatten. Da er sich nicht einmischen wollte und es auch nicht zu seinen Aufgaben gehörte, sich um derlei Dinge zu kümmern, hatte er nur geplant, Magdalena nach seiner Rückkehr aus Ingolstadt zu warnen. Allem Anschein nach hatte das jedoch jemand anderer bereits vor ihm erledigt, und Magdalena hatte sich dazu entschlossen, den Tross heimlich zu verlassen. Er hätte sie weder daran gehindert noch sie verraten.
Jetzt wusste er, dass Thomas in das Verschwinden der drei Frauen eingeweiht gewesen war, ihnen vielleicht sogar dabei geholfen hatte. Es würde nicht lange dauern, bis Oswald ihm auf die Schliche kam. Die daraus entstehenden Konsequenzen für Thomas galt es in jedem Fall zu verhindern.
Leonhart musterte den Burschen nachdenklich. Der war seit seinem Ankommen im Tross größer und breiter geworden, wie er fand. Er hatte ein wenig struppige, dunkelblonde Haare, wache, braune Augen und ein kantiges Gesicht, das eine Art jugendliche Autorität ausstrahlte, die den Hauptmann in gewisser Weise beeindruckte.
Er mochte den Burschen, der es nicht nur geschafft hatte, ein tüchtiger Schmiedegeselle zu werden, sondern wohl auch das Herz Magdalenas zu erobern, ein Wunsch, den er durchaus verstehen konnte. Das war bislang nur einem gelungen, soweit Leonhart wusste, und den hatte die eigenwillige junge Frau tatsächlich auch geehelicht. Er selber war nie mehr als derjenige gewesen, der ihr immer wieder über den Weg lief, wenn sie sich in irgendeine unmögliche Situation manövriert hatte. Vielleicht lag die Tatsache, dass sie nie ein Liebespaar geworden waren, daran, dass er der Grund dafür gewesen war, weshalb Magdalena ihre Familie verlassen musste. Sie hatte das vermutlich nie verwinden können.
Weshalb der junge Mann nicht mit ihr zusammen verschwunden war, konnte er nur ahnen. Immerhin war Magdalena gute fünf, sechs Jahre älter als er, das allein war vermutlich schon ein Grund, sich nicht enger als unbedingt notwendig an sie zu binden.
Es sollte ihm gleichgültig sein, befand er achselzuckend. Leonhart klopfte seinem Pferd auf den Hals und führte es zur Feldschmiede, wo die beiden Männer inzwischen schweigend ihrer Arbeit nachgingen. Thomas nahm die Zügel des Falben auf und wartete, bis der Schmied ihm ein Zeichen zum Entfernen der alten Hufeisen gab.
„Wenn du hier fertig bist, kommst du mit dem Pferd zu meinem Zelt“, sagte der Hauptmann und nickte Thomas mit so ernster Miene zu, dass jener das Schlimmste befürchtete.
„Ja, Herr“, antwortete er, und schaute ihm über den Widerrist des Tieres hinweg beklommen nach.
„Was wollte er von dir?“, fragte ihn Jost, während er Thomas dabei half, die Hufe des Tieres zum Beschlagen vorzubereiten.
„Ich soll ihm seinen Hengst bringen, sobald wir fertig sind“, gab Thomas zurück und bemühte sich, möglichst unbefangen zu klingen.
„Pass auf dich auf“, riet ihm der Schmied und kümmerte sich wieder um die Eisen, die er im Feuer liegen hatte.
„Das werde ich.“
Der Hauptmann erwartete Thomas bereits vor seinem Zelt, als dieser mit seinem Falben zu ihm kam.
„Du kannst gut mit Pferden umgehen“, stellte er fest. „Mit dem hier ist nicht gut Kirschen essen, aber bei dir bleibt er ganz ruhig.“
Thomas schaute den Hauptmann überrascht an. Er hatte mit etwas völlig anderem gerechnet.
„Der … Das hat mir …“, begann er, unterbrach sich aber, weil er befürchtete, Öl auf ein Feuer zu gießen, dessen Auswirkung er gar nicht erst kennenlernen wollte.
„… Magdalena beigebracht?“, ergänzte Leonhart und legte ihm eine Hand auf die Schulter.
„Ja.“
Thomas senkte den Kopf, damit der Hauptmann nicht sehen konnte, wie aufgewühlt er war.
„Ich nehme an, du weißt, wo sie ist“, fuhr Leonhart ruhig fort und hob das Kinn in die Richtung, in der sie beide den Trossführer wussten.
Thomas schrak entsetzt zusammen.
„Herr?“
Leonhart gab ihm einen Klaps auf die Schulter.
„Behalt es für dich und pass auf dich auf“, riet er ihm, prüfte die neu aufgezogenen Hufeisen seines Pferdes und nickte Thomas anerkennend zu. „Saubere Arbeit.“
„Danke, Herr.“
„Er gefällt dir, habe ich recht?“
„Ja, er ist wunderschön.“
Thomas tätschelte den Hals des Hengstes, der leise schnaubend den Kopf senkte und sich gefallen ließ, auch hinter den Ohren gekrault zu werden.
Leonhart beobachtete ihn nachdenklich dabei und strich dann seinem Pferd sanft über die Nüstern. Er schien im selben Augenblick einen Entschluss gefasst zu haben.
„Ich werde morgen zum Fürstbischof reiten und möchte, dass du mich begleitest“, sagte er. Als Thomas ihn erschrocken ansah, schüttelte Leonhart fast unmerklich den Kopf. „Keine Widerrede. Ich erwarte dich zum Zehnuhrläuten hier vor dem Zelt, möchte aber nicht, dass du auch nur ein Wort darüber zu irgendjemandem verlierst, verstanden? Und jetzt bind mein Ross an dem Pflock neben meinem Zelt an und geh wieder an deine Arbeit.“
Damit wandte er sich zu ein paar unweit wartenden Söldnern um und ließ ihn stehen. Thomas starrte ihm noch einen Augenblick fassungslos nach, bevor er dem leise schnaubenden Falben erneut über den Hals strich, ihn festband und sich dann auf den Rückweg zur Schmiede machte.
Dort stand Oswald und brüllte auf Jost ein, der jedoch so heftig seinen Hammer auf ein Stück Eisen heruntersausen ließ, dass er unmöglich etwas verstehen konnte. Eine Taktik, die Thomas schon öfter bei seinem Meister gesehen hatte. Wer ihn kannte, wusste, dass er seinem Gegenüber wortlos klarmachte, er könne ihm den Buckel runterrutschen, und dass er für ihn seine Arbeit nicht unterbrechen würde. Den Trossführer schien das jedoch nicht zu beeindrucken. Er schrie ihn weiterhin an. Als Thomas auf die beiden zukam, stemmte Oswald beide Fäuste in die Hüften und starrte ihm wütend entgegen.
„Ich will wissen, wo die drei Weibsbilder sind!“, brüllte er jetzt ihn an. „Das sind elende Hexen, die auf den Scheiterhaufen gehören!“
„Wer behauptet das?“, hörte Thomas den Schmied fragen, der kurz innehielt und seine Arbeit begutachtete.
Der Trossführer warf ihm einen wütenden Blick zu.
„Also, wo sind die Weiber?“, wandte er sich erneut an dessen Gesellen.
„Ich weiß nicht, wo sie sind“, antwortete Thomas. Das stimmte allerdings. Er konnte nur hoffen, dass sie inzwischen weit genug vom Lager entfernt waren und niemand sie mehr einholen konnte.
Bevor der Trossführer ihn angreifen konnte, stellte sich der Schmied zwischen die beiden, eine Zange mit glühendem Eisen in den Fäusten.
„Hol den anderen Gaul“, befahl er Thomas und tauchte das Eisen in einen bereitstehenden Kübel mit Wasser, dass es nur so brodelte und dampfte. „Und du lass meinen Gesellen in Frieden. Wir haben zu arbeiten, wie du siehst.“
„Ich will wissen, wo die drei Weibsbilder sind!“, fauchte der Trossführer ihn statt einer Antwort an. Dabei wich er vor dem Eisen zurück, das der Schmied aus dem Wasser hob und ihm vor die Brust hielt. „Wenn du mit drinsteckst, wirst du deines Lebens nicht mehr froh werden, Schmied, das schwöre ich dir beim Grab meiner gottverdammten Mutter!“
„Du solltest nicht so leichtsinnig über deine Mutter reden“, gab der Schmied ungerührt zurück. „Sie lebt noch, wie du weißt.“
Oswalds Gesicht war hochrot angelaufen.
„Das geht dich einen Scheißdreck an!“
„Wie dich einen Scheißdreck angeht, wo die drei Weiber sind. Jeder hier kann gehen, wohin und wann auch immer er will. Die Trossleute stehen unter keinem Eid.“
Der Schmied legte das Eisen erneut ins Feuer, und Thomas trat eifrig den Blasebalg, während er den Trossführer argwöhnisch im Auge behielt.
„Wenn ich rauskriege, dass du was mit ihrem Verschwinden zu tun hast, Freundchen …“
Mit dieser Andeutung in Thomas’ Richtung machte Oswald kehrt und stapfte wütend davon.
Thomas war fassungslos. „Es kann doch nicht sein, dass dieser Mistkerl nur deshalb so aufgebracht ist, weil er Magdalena nicht auf den Scheiterhaufen bringen konnte!“
„Doch. Genau deshalb. Er hätte sie liebend gerne brennen gesehen“, antwortete Jost. „Weil sie sich ihm widersetzt und ihn vor allen bloßgestellt hat. So etwas verträgt er nicht. Er befürchtet, dass sich andere ein Beispiel an ihr nehmen und sich ebenfalls gegen ihn auflehnen könnten. Es herrscht ohnehin Unruhe im Tross, weil es schon zu lange dauert hier.“ Er warf Thomas einen kurzen Blick zu, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwandte. „Wie du vielleicht weißt, hat er ein paar Männer losgeschickt, um sie zu suchen.“
Thomas war blass geworden. Er hoffte inbrünstig, dass sie die Weiberleute nicht finden würden, denn er wusste, worauf das hinauslaufen würde.
3. Kapitel
Hauptmann Leonhart stand neben seinem Pferd, als Thomas am nächsten Morgen im Söldnerlager auftauchte. Der hatte schlecht geschlafen, weil er ständig mit der Rückkehr der Männer rechnete, die der Trossführer losgeschickt hatte, um die Frauen zu suchen. Sie waren dann aber erst wieder im Lager aufgetaucht, als sich Thomas bereits auf den Weg zum Söldnerlager machte, und zu seiner großen Erleichterung hatten sie die Weiberleute nicht mit dabei. Den Wutausbruch des Trossführers ersparte sich der junge Mann, indem er sich so schnell es ging auf den Weg zum Zelt des Hauptmanns machte. Das würde ihm, wie er hoffte, auch ersparen, dass Oswald ihn als nächstes Opfer ins Visier nahm.
„Ich denke, du kannst nicht reiten“, stellte der Hauptmann fest, als er Thomas auf sich zukommen sah.
„Nein, ich kann nicht reiten, Herr“, gab Thomas zu und schielte vorsichtig zu den beiden anderen wartenden Männern hinüber, die gerade mit ihren Pferden neben dem Zelt ihres Hauptmanns auftauchten. Sie hatten ein drittes, gesatteltes und aufgezäumtes Pferd dabei.
„Das wirst du lernen müssen.“ Leonhart schwang sich in den Sattel seines Rosses. „Na los, lass dir auf das Pferd helfen, wir werden erwartet!“
Einer der beiden Männer gab Thomas ein Zeichen, herzukommen. Der holte tief Luft. Er konnte mit Pferden umgehen, aber er war noch nie geritten, geschweige denn, dass er jemals auch nur auf einem Pferderücken gesessen hätte. Das Pferd, das man ihm zugedacht hatte, kannte er und wusste, dass es lammfromm war. Immerhin.
Einer der Männer warf Thomas die Zügel zu, die er geschickt auffing. Um ein wenig Zeit zu gewinnen, strich er dem Pferd sanft über die Nüstern. Es senkte den Kopf ein wenig und schnaubte leise.
„Jetzt steig schon auf“, befahl Leonhart ungeduldig.
Thomas gehorchte. Er hatte oft genug dabei zugesehen, wie andere das machten, aber es klappte erst beim zweiten Anlauf, und da auch nur mithilfe eines kräftigen Schubses, den ihm einer der Männer verpasste.
„Drück die Schenkel zusammen, damit du nicht runterfällst“, empfahl er ihm. „Notfalls kannst du dich mit einer Hand an der Mähne oder da vorne am Sattelknauf festhalten“, fügte er noch grinsend an. „Es sieht allerdings besser aus, wenn du das nicht tust.“
Während sich die anderen zwei in ihre Sättel schwangen, versuchte Thomas angestrengt, den Rat mit dem Schenkeldruck umzusetzen. Zuerst war er ein wenig unsicher, als sich das Tier in Bewegung setzte und den anderen folgte. Aber als sie das Lager des Trosses erreichten, richtete er sich stolz auf und vergaß dabei völlig, dass es einen unter den Trossleuten gab, der das alles eher missgünstig als überrascht zur Kenntnis nahm. Als er an Oswald vorbeiritt, fing er einen bösen Blick auf, der ihn jedoch geradezu herausforderte, selbstbewusster zu scheinen, als er in dem Augenblick tatsächlich war.
„Du wartest mit den anderen beiden im Hof, bis ich wieder zurück bin“, rief Leonhart ihm über die Schulter zu, als sie in Sichtweite des Burgtores gekommen waren. „Sie werden dir sagen, was du zu tun hast.“
Thomas schluckte trocken. Er war so aufgeregt, dass er kein Wort herausbringen konnte. Ein Blick in die ernsten Gesichter seiner neben ihm reitenden Gefährten sagte ihm, dass sie ihn für seine Unbeholfenheit nicht verachteten, sondern ihm zur Seite stehen würden.
Was auch notwendig war, wie er feststellte, als sie im Hof der fürstbischöflichen Burg angekommen waren. Der kurze Ritt hatte genügt, um ihm zu zeigen, dass sein Körper solche Anstrengungen nicht gewohnt war. Er spürte sämtliche Knochen, und die Innenseiten seiner Schenkel brannten. Wie mochte es da erst sein, wenn er längere Strecken reiten musste?
Während er sich erschöpft und mit weichen Knien vom Sattel auf den Boden gleiten ließ, runzelte er kopfschüttelnd die Stirn. Es gab einen triftigen Grund, weshalb sie hierher geritten waren, und dieser Grund war das Verschwinden der drei Weiberleute – womit er in direktem Zusammenhang stand. Der Trossführer hatte die Flucht der angeblichen Hexe und ihrer Freundinnen sicherlich den Bütteln gemeldet und gesagt, wer dahintersteckte, und der Bischof hatte ihn deshalb auf die Burg befohlen. Der würde es nicht einfach so durchgehen lassen, dass er fürderhin auf ihr Brot verzichten musste. Ganz zu schweigen davon, dass er nicht dulden würde, eine Hexe einfach so davonkommen zu lassen.
Thomas klapperten vor Anspannung die Zähne.
Andererseits: Hätte der Hauptmann ihn dann tatsächlich mitgenommen? Hoch zu Ross? Ohne ihn vorher zu warnen? Das wiederum traute er ihm dann doch nicht zu.
Die beiden anderen Begleiter Leonharts bedeuteten ihm, sein Pferd zur Seite zu führen und dort mit ihm stehen zu bleiben.
„Ich bin der Heiner, und das hier ist der Martl“, hörte er den Reiter sagen, der ihm bereits im Söldnerlager auf das Pferd geholfen hatte. Heiner war ein kräftiger junger Mann mit beinahe pechschwarzem Haar und einem modisch gezwirbelten Oberlippenbart. Er hatte dunkle, ein wenig traurig wirkende Augen, die im krassen Gegensatz zu den Grübchen rechts und links auf seinen Wangen standen.
Der Martl war ein ganzes Stück älter als sie beide. Sein leicht angegrautes Haar war ziemlich schütter und hatte sich über der Stirn bereits weit zurückgezogen. Dagegen zierte ein üppig wuchernder, rotblonder Vollbart sein Gesicht, und zwei strahlend blaue Augen blitzten Thomas unter hochgezogenen Augenbrauen an.
„Wir haben hier nichts anderes zu tun, als auf Hauptmann Leonhart zu warten.“ Als Thomas bestätigte, das Gesagte gehört und verstanden zu haben, fuhr er fort: „Kennst dich gut mit Pferden aus, solche Leute braucht der Hauptmann.“
„Was meinst du damit?“, fragte Thomas, den das Lob mehr verwirrte als freute.