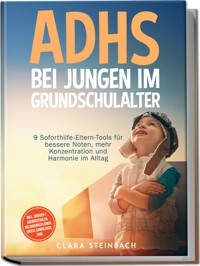
ADHS bei Jungen im Grundschulalter: 9 Soforthilfe-Eltern-Tools für bessere Noten, mehr Konzentration und Harmonie im Alltag – inkl. Morgen-/Abendritualen, Belohnungsplänen, gratis Downloads uvm. E-Book
Clara Steinbach
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
ADHS bei Jungen: ADHS verstehen und mit 9 hocheffizienten Tools Alltagsleben strukturieren, Potenziale ausschöpfen und für Ausgeglichenheit und Entspannung sorgen Ihr Sohn hat die Diagnose "ADHS" erhalten und nun steht Ihre Familienwelt erst einmal auf dem Kopf? Vielleicht haben Sie auch schon einiges an Frust, Verzweiflung und Ratlosigkeit erlebt und wünschen sich nichts sehnlicher, als Ihr Kind optimal auf seinem Weg in eine glückliche Zukunft zu begleiten? Dann zeigt Ihnen dieser Ratgeber, wie das ganz einfach gelingen kann! Körperliche Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität oder auch verträumte Abwesenheit – ADHS kann eine Zerreißprobe für Familien-, Schul- und Alltagsleben sein und für die betroffenen Jungen selbst Anstrengung, Stress und Überforderung bedeuten. Demgegenüber stehen oft schier unerschöpfliche Energie, Kreativität und Begeisterungsfähigkeit – und aus beiden Aspekten zusammen kann mit optimaler Begleitung ein lebhaft-fröhlicher Alltag inklusive bester Bildungschancen entstehen. Dieses Buch zeigt Ihnen zunächst einfühlsam und offen die verschiedenen Facetten der neurologischen Besonderheit auf und macht Sie mit den unterschiedlichen Typen und geschlechtsbezogenen Ausprägungen vertraut. Anschließend wird's praktisch: Sie bekommen einen Werkzeugkoffer mit 9 effizienten Tools zu Themen wie Struktur & Routine, soziale Fähigkeiten oder Stressabbau und können mit einer Vielzahl an sofort anwendbaren Methoden, Übungen oder Strategien gezielt an den wichtigsten Faktoren arbeiten. Pädagogische Ausbildung? Brauchen Sie nicht! Denn dieser Praxisratgeber richtet sich explizit an Eltern, die ihren Sohn mit Verständnis, Mitgefühl und Engagement unterstützen möchten, und leitet Sie Schritt für Schritt durch den oftmals turbulenten ADHS-Alltag. ADHS kompakt: Erfahren Sie in Kürze das Wichtigste zu Ursachen, Folgen, Symptomen und Ausprägung bei Jungen und entdecken Sie, welch entscheidende Rolle Ihnen als Eltern zukommt. 9 Tools: Struktur & Routinen, Selbstwert & Selbstbewusstsein aufbauen, Konzentration fördern durch klare Ziele oder harmonischen Familienalltag aufbauen – anhand von 9 Schlüsselaspekten sorgen Sie für das optimale Setting und maximale Förderung in Familien- und Schulleben. Praktisch & konkret: Eine Vielzahl an Übungen, Routinen & Strategien zu jedem Themenbereich machen die praktische Umsetzung alltagstauglich und kinderleicht. Bonus-Werkzeug-Kit für Eltern: Mit Kommunikationshilfen, Spiel- und Aktivitätsideen, gemeinsamen Entspannungsübungen oder Emotionsthermometer haben Sie nützliche Werkzeuge für jede Situation parat. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie den besonderen Bedürfnissen Ihres Sohnes individuell angepasst begegnen und ihn optimal in seiner Entwicklung unterstützen. Ob Schule, Familienleben oder Freundeskreis – hier entdecken Sie Wege für harmonisches, fröhliches und unbeschwertes Miteinander. Also, worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" und legen Sie mit Ihrem Sohn den Grundstein für ein Leben, in dem ihm alle Möglichkeiten offenstehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
Vorwort
Was ist ADHS?
Jungen im Grundschulalter
Die Rolle der Eltern: Hoffnung und Handlungsfähigkeit
Tool 1: Struktur und Routinen schaffen
Warum Routinen bei ADHS helfen
Tipps für einen geregelten Alltag
Morgen- und Abendrituale gestalten
Tool 2: Konzentration fördern durch klare Ziele
Realistische Erwartungen setzen
Belohnungssysteme für Aufmerksamkeit und Ausdauer
Techniken zur Förderung der Fokussierung
Tool 3: Mitgefühl und soziale Fähigkeiten stärken
Verständnis für andere entwickeln
Freundschaften fördern und pflegen
Umgang mit Konflikten im Schul- und Freizeitbereich
Tool 4: Selbstwert und Selbstbewusstsein aufbauen
Erfolge sichtbar machen
Förderung der individuellen Stärken
Positive Kommunikation mit Ihrem Kind
Tool 5: Impulskontrolle und Selbstregulation verbessern
Atemübungen und kurze Pausen
Emotionen benennen und regulieren
Tool 6: Stress abbauen im Alltag
Entspannungstechniken für Eltern und Kind
Wie Bewegung Stress reduzieren kann
Stressoren identifizieren und eliminieren
Tool 7: Den harmonischen Familienalltag fördern
Kommunikation innerhalb der Familie verbessern
Konflikte lösen, ohne Eskalation
Familienzeit bewusst gestalten
Tool 8: Lernen mit Spaß – besseres Verständnis und Noten
Spielerische Ansätze für das Lernen
Die richtigen Lernumgebungen schaffen
Umgang mit Hausaufgabenstress
Tool 9: Verantwortungsbewusstsein entwickeln
Kleine Aufgaben und Verantwortlichkeiten übertragen
Erfolgserlebnisse durch Eigenverantwortung
Wie Sie Ihr Kind zur Selbstständigkeit ermutigen
Bonus: Werkzeugkit für Eltern
Visualisierungen zum Download
Entspannungsübungen für Kinder und Eltern
Kontaktliste für Unterstützung
Quellenverzeichnis und weiterführende Literatur
Vorwort
Jungen, die eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) aufweisen, fordern uns täglich heraus – aber sie bereichern in jedem Fall auch unser Leben. Sie sind voller Energie, Fantasie, Entdeckergeist und manchmal auch gefühltes Chaos. Ihr Alltag ist oftmals ein Wechselspiel zwischen Kreativität und Überforderung, Begeisterung und Impulsdurchbrüchen. Für Eltern, Lehrkräfte und andere Bezugspersonen bedeutet das oft ein Spagat zwischen Verständnis und Grenzen, Geduld und Klarheit, Liebe und Erschöpfung.
Dieses Buch verfolgt die Absicht, all jenen eine Orientierung zu geben, die von ADHS betroffene Kinder auf ihrem Weg begleiten. Es möchte befähigen und realistische Wege aufzeigen, die sich im Alltag umsetzen lassen. Wege, die getragen sind von Wissen, Respekt und einem ehrlichen Blick auf die Herausforderungen, aber auch auf die Ressourcen dieser Kinder.
Im Zentrum steht dabei eine Haltung: ADHS ist eine neurologische Besonderheit, die verstanden, angenommen und mit gezielter Unterstützung begleitet werden kann. Dabei ist ADHS vor allem eins: individuell, und jedes betroffene Kind ist einzigartig. Deshalb braucht es flexible Strukturen, Klarheit im Denken und vor allem Mitgefühl.
Wenn Sie diesen Ratgeber zur Hand nehmen, dann haben Sie vermutlich bereits Erfahrungen gesammelt mit Diagnosen, Unsicherheiten, Fragen, vielleicht auch mit Frust und Erschöpfung, ganz sicher aber auch mit Momenten tiefen Stolzes, mit einem Blick auf das Potenzial Ihres Kindes und mit dem Wunsch, es bestmöglich zu unterstützen. Genau hier setzt dieses Buch an: Es stärkt Sie in Ihrem Wissen, in Ihrer Haltung und in Ihrem Mut, neue Wege zu gehen.
Hinweis: In diesem Buch finden Sie an verschiedenen Stellen QR-Codes, die Sie zu Audiodateien führen. Falls Sie keine Möglichkeit haben, diese zu scannen, können Sie alle Dateien auch über diesen Link finden: https://bit.ly/3TINk1W
Was ist ADHS?
ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Es handelt sich um eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die sich in drei Hauptbereichen zeigt: Hierzu gehören Unaufmerksamkeit, Impulsivität und körperliche Unruhe (Hyperaktivität). Diese Merkmale treten nicht nur gelegentlich oder in bestimmten Situationen auf, sondern in einem Ausmaß, das den Alltag Ihres Kindes erheblich beeinträchtigt. Das gilt sowohl für zu Hause als auch in der Schule und im sozialen Umfeld.
Im Vergleich zu Mädchen fallen Jungen mit ADHS oft früher und deutlicher auf, da sie häufiger ein stark ausgeprägtes hyperaktives und impulsives Verhalten zeigen. Das kann bedeuten, dass sie ständig in Bewegung sind, ungeduldig reagieren, laut sprechen, andere unterbrechen oder dass es ihnen schwerfällt, sich an Regeln zu halten. Manche Eltern beschreiben ihren Sohn als „ständig unter Strom“ oder „wie von einem Motor angetrieben“. Andere Kinder wiederum träumen sich oft weg, scheinen nicht zuzuhören und verlieren leicht den Faden. Auch diese Symptome gehören zum Bild von ADHS.
Ein paar Fallbeispiele zu den Erläuterungen, wie ADHS in unterschiedlichen Kontexten aussehen kann, finden Sie nachfolgend:
Max (8 J.) steht beim Abendessen immer wieder auf, läuft um den Tisch, spricht dazwischen und nimmt seinem Bruder das Besteck aus der Hand. Er unterbricht ständig die Gespräche seiner Eltern und fällt durch seine Lautstärke auf. Auf Ermahnungen reagiert er nur kurz, um dann sofort erneut in Bewegung zu geraten.
Leon ist 7 Jahre und platzt regelmäßig in den Unterricht, ruft Antworten heraus, ohne sich zu melden oder aufgerufen zu sein, und kann kaum auf seinem Platz sitzen bleiben. Bei Gruppenarbeiten reißt er anderen Kindern das Material aus der Hand, weil er das Gefühl hat, schneller zu wissen, wie etwas geht. Das führt häufig zu Streit.
Lio, 9 Jahre alt, erhält die Aufforderung, seine Sportsachen zu packen, steht aber nach fünf Minuten mit leerem Blick da, weil er vergessen hat, was er tun sollte. Seine Mutter findet ihn schließlich im Kinderzimmer. Er sitzt auf dem Boden und starrt aus dem Fenster, die Tasche bleibt leer.
Paul (8 J.) wirkt im Unterricht abwesend. Er träumt vor sich hin, kritzelt ins Heft und verpasst regelmäßig die Aufgabenstellungen. Seine Lehrerin stellt fest, dass er oft gar nicht mitbekommt, wenn sie ihn direkt anspricht. Obwohl er freundlich ist und selten stört, fallen seine Leistungen merklich ab.
Für Sie wichtig zu wissen ist: ADHS ist keine Erziehungsfrage und kein Ausdruck von „schlechter Führung“ im Rahmen Ihrer Erziehung. Es handelt sich um eine ernst zu nehmende, wissenschaftlich anerkannte Störung, bei der bestimmte Botenstoffe im Gehirn, insbesondere Dopamin und Noradrenalin, aus dem Gleichgewicht geraten sind. Diese Botenstoffe sind extrem wichtig für Aufmerksamkeit, Motivation, Impulskontrolle und die Fähigkeit zur Selbstregulation.
Definition Botenstoffe:
Ein Botenstoff, auch Neurotransmitter genannt, ist eine chemische Substanz, die Informationen zwischen Nervenzellen im Gehirn überträgt. Er wird an den Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, den sogenannten Synapsen, freigesetzt und sorgt dafür, dass Signale von einer Zelle zur nächsten weitergeleitet werden. Bekannte Botenstoffe wie Dopamin oder Noradrenalin spielen eine zentrale Rolle bei Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Motivation.
Als Eltern erleben Sie im Alltag häufig ein Spannungsfeld: Einerseits sehen Sie die Intelligenz, Kreativität und Sensibilität Ihres Kindes, andererseits kämpfen Sie mit Konflikten, Erschöpfung und Unsicherheit. Genau hier setzt dieses Buch an. Es liefert fundiertes Wissen, erklärt Hintergründe und zeigt konkrete Wege, wie Sie Ihr Kind verstehen, unterstützen und stärken können, ohne dass Sie dabei Schuldgefühle haben müssten, dafür aber mit Klarheit, Haltung und Zuversicht jede Situation meistern können.
Viele Eltern fragen sich in diesem Kontext, welche Diagnosekriterien es gibt und welche Ausprägungen möglich sind. Eine kurze Übersicht hierzu finden Sie im Nachgang.
Wann wird von ADHS gesprochen?
Damit eine ADHS diagnostiziert wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, die in internationalen Klassifikationssystemen wie dem DSM-5 (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen) oder der ICD-10 bzw. ICD-11 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) festgelegt sind. Die wichtigsten Merkmale lassen sich in drei Symptomgruppen einteilen.
Unaufmerksamkeit
Kinder mit diesem Schwerpunkt zeigen u. a. folgende Verhaltensweisen:
Sie haben Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Sie wirken oft, als würden sie nicht zuhören.
Sie machen Flüchtigkeitsfehler, verlieren Dinge oder vermeiden Aufgaben, die geistige Anstrengung erfordern.
Sie lassen sich leicht ablenken und vergessen häufig Alltagsaktivitäten.
Hyperaktivität
Auffälligkeiten in diesem Bereich äußern sich auf folgende Weise:
Das Kind ist ständig in Bewegung, kann kaum stillsitzen oder zappelt stark.
Es verlässt häufig seinen Platz in unpassenden Situationen (z. B. im Unterricht).
Es redet übermäßig viel oder wirkt „getrieben“.
Es zeigt eine überdurchschnittliche motorische Unruhe, die sich nicht willentlich regulieren lässt.
Impulsivität
Typische Anzeichen hierfür sind:
Das Kind platzt mit Antworten heraus, bevor eine Frage zu Ende gestellt ist.
Es kann schwer abwarten oder sich in Geduld üben (z. B. in Wartesituationen).
Es unterbricht oder stört andere, mischt sich in Gespräche oder Spiele ein.
Es handelt oft, ohne nachzudenken, was zu Unfällen oder Missverständnissen führen kann.
Außerdem haben die Symptome bestimmte Kriterien zu erfüllen, damit die Diagnose gestellt werden kann. Sie müssen:
seit mindestens sechs Monaten bestehen,
deutlich stärker ausgeprägt sein als bei gleichaltrigen Kindern,
in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig auftreten (z. B. zu Hause, in der Schule, im sozialen Umfeld)
und eine klinisch bedeutsame Beeinträchtigung für das Kind und sein Umfeld verursachen.
In seiner Ausprägung kann ADHS bei Ihrem Kind dabei ganz unterschiedlich sein.
Divergente Ausprägungen von ADHS
Nicht jedes Kind mit ADHS zeigt alle Symptome gleich stark. Fachleute unterscheiden deshalb drei Erscheinungsformen:
Vorwiegend unaufmerksamer Typ (früher: ADS ohne Hyperaktivität)
Diese Kinder wirken ruhig, verträumt, langsam oder vergesslich. Sie fallen oft weniger stark im Verhalten, dafür aber durch Leistungsprobleme oder mangelnde Selbstorganisation auf. Häufig werden sie erst spät erkannt – besonders bei Mädchen ist diese Form häufig.
Typische Verhaltensweisen auf einen Blick:
Das Kind wirkt oft „verträumt“, abwesend oder langsam.
Es hört scheinbar nicht zu, schweift mit Gedanken ab.
Aufgaben werden unvollständig oder gar nicht erledigt, weil der rote Faden fehlt.
Es hat Schwierigkeiten, sich zu organisieren oder konzentriert zu bleiben – besonders bei Routineaufgaben.
Häufiges Vergessen (Hausaufgaben, Schulsachen, Anweisungen).
Aus diesem Verhaltensweisen ergeben sich im Alltag für Ihr Kind die folgenden Herausforderungen:
Dieser Typ fällt oft weniger durch Stören auf, sondern durch Leistungsprobleme.
Lehrer und Eltern interpretieren die Symptome möglicherweise als Faulheit, Desinteresse oder mangelnde Intelligenz.
Das Kind erlebt oftmals Misserfolge, was das Selbstwertgefühl untergräbt.
Durch die fehlende Auffälligkeit wird diese Form besonders bei Mädchen oft erst spät erkannt.
Die bestehenden Faktoren sorgen bei diesem Typ dafür, dass ein Risiko für eine chronische Schulangst vorkommt. Zudem besteht die Gefahr, dass das Kind „durchs Raster fällt“. Das liegt vor allem daran, dass es nicht stört, sondern sich eher zurückzieht. Die innere Anspannung ist bei diesen Kindern häufig hoch, obwohl äußerlich Ruhe vorgetäuscht wird.
Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ
Hier stehen Bewegungsdrang, Impulsivität und Unruhe im Vordergrund. Diese Kinder sind laut, ungeduldig, fordernd und haben Schwierigkeiten mit Grenzen. Sie werden häufig früh auffällig und gelten als „verhaltensauffällig“.
Typische Verhaltensweisen auf einen Blick:
Das Kind redet viel, ist ständig in Bewegung, steht häufig auf.
Es handelt ohne nachzudenken, unterbricht, drängelt sich vor, riskiert Unfälle.
Geduld, Warten oder Einhalten von Regeln fällt ihm schwer.
Emotionen werden stark und schnell ausgedrückt – oft ohne Rücksicht auf die Situation.
Damit gehen für diese Kinder die folgenden Herausforderungen einher:
In Schule, Freizeit und Familie wird dieses Verhalten schnell als „nervig“, „ungezogen“ oder „respektlos“ empfunden.
Kinder dieses Typs geraten schnell in Konflikte – mit Gleichaltrigen, Lehrkräften und Bezugspersonen.
Es besteht ein erhöhtes Risiko für Ausgrenzung oder Sanktionen.
Was bedeutet das im Alltag? Es besteht das Risiko, dass betroffene Kinder häufig Ablehnung erfahren. Im Umkehrschluss führt dies nicht selten zu Trotz, Aggression und Rückzug. Ohne Unterstützung kann sich daher ein negatives Selbstbild entwickeln: „Ich bin immer der Störer.“ Darüber hinaus führt impulsives Verhalten unter Umständen auch zu gefährlichen Situationen (im Straßenverkehr oder beim Spielen etc.).
Kombinierter Typ (häufigste Form)
In diesem Fall sind sowohl unaufmerksame als auch hyperaktiv-impulsive Symptome deutlich ausgeprägt. Die Kombination führt zu besonderen Herausforderungen – sowohl im schulischen als auch im sozialen Miteinander.
Typische Verhaltensweisen auf einen Blick:
Sowohl Unaufmerksamkeit als auch Hyperaktivität und Impulsivität treten deutlich auf.
Das Kind verliert Dinge, beginnt Aufgaben erst gar nicht oder macht sie nicht zu Ende, ist gleichzeitig laut, unruhig und handelt unüberlegt.
Die Symptome beeinflussen alle Lebensbereiche: Schule, Familie, Freizeit, soziale Kontakte.
Folgende Herausforderungen ergeben sich hieraus für das Kind:
Dieser Typus ist der häufigste, aber auch der komplexeste.
Eltern stehen oft vor einem Wechselbad: Einerseits erleben Sie das Kind als kreativ, lebendig, begeisterungsfähig – andererseits ist es schwer steuerbar, schnell gereizt oder komplett blockiert.
Die Herausforderungen entstehen nicht nur durch das Verhalten selbst, sondern auch durch die Reaktionen der Umwelt.
Auch diese Ausprägung birgt Risiken für den Alltag. Diese Kinder erleben besonders häufig Misserfolge, Ablehnung und Überforderung. Es besteht daher ein erhöhtes Risiko für komorbide Störungen wie beispielsweise Ängste, Depressionen oder aber oppositionelles Verhalten. Ohne gezielte Unterstützung geraten diese Kinder leicht in eine Negativspirale – schulisch wie sozial.
Definition: Komorbide Störung
Wenn ein Kind ADHS hat, steht diese Erkrankung oft im Mittelpunkt. Manche Kinder zeigen jedoch zusätzlich noch andere Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten. Wenn neben ADHS eine weitere psychische Störung auftritt, wird von komorbiden Störungen gesprochen. „Komorbid“ bedeutet in diesem Kontext, dass zwei oder mehr Erkrankungen gleichzeitig bestehen. Bei ADHS sind komorbide Störungen übrigens keine Seltenheit. Folgende Störungen sind bei ADHS typisch: Angststörungen, Depressionen, oppositionelles Verhalten, Lern- sowie Tic-Störungen.
Komorbide Störungen beeinflussen den Alltag der Betroffenen stark. Sie können die Behandlung von ADHS erschweren oder den Eindruck erwecken, dass sich die Symptome verschlimmern. Deshalb braucht es eine genaue Diagnose und eine gezielte Unterstützung. Diese muss individuell auf das Kind angepasst werden.
Was ist für Sie als Eltern hier wichtig?
Holen Sie frühzeitig fachliche Hilfe ein und sprechen Sie offen mit dem Fachpersonal über Ihre Beobachtungen, auch wenn diese nicht direkt zu ADHS zu passen scheinen. Suchen Sie Unterstützung für die ganze Familie in Beratungs- oder Elterngruppen. Das kann den Alltag stark entlasten. Vergessen Sie nicht: Komorbide Störungen sind nicht die Schuld des Kindes oder der Eltern. Sie entstehen aus einer Kombination von genetischen, neurologischen und umweltbedingten Faktoren. Mit der richtigen Hilfe lässt sich gut damit umgehen.
Oftmals wird angenommen, dass eine ADHS mit allen Typen gleichzusetzen ist. Die Auflistung zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Vielmehr ist es sogar wichtig, die benannten Unterscheidungen vorzunehmen. Warum? Jede Ausprägung erfordert unterschiedliche pädagogische, therapeutische und familiäre Strategien. Was dem einen Kind hilft (z. B. Bewegung als Ventil), überfordert ein anderes (z. B. wenn es Reize schlecht filtern kann). Für Eltern, Fachkräfte und Therapeuten ist die genaue Einordnung daher entscheidend, um individuell passende Hilfen und Entlastung anbieten zu können. Nur so ist eine effektive Unterstützung Ihres Kindes gezielt möglich.
Jungen im Grundschulalter
Jungen im Grundschulalter mit ADHS stehen wegen ihrer Symptome und auch aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen und entwicklungsbedingter Eigenheiten, die häufig missverstanden werden, oft unter einem besonderen Druck. Ihre Verhaltensweisen werden schneller als „auffällig“, „unangepasst“ oder „störend“ eingeordnet, besonders im schulischen Kontext.
Ein Beispiel:
Julian besucht die zweite Klasse einer Grundschule. Er ist neugierig, lebhaft und stellt viele Fragen. Gleichzeitig fällt es ihm schwer, stillzusitzen, sich längere Zeit zu konzentrieren und sich in der Klasse zurückzunehmen. Er ruft oft dazwischen, kippelt auf seinem Stuhl und steht ohne Erlaubnis auf. Seine Lehrerin empfindet ihn als „unruhestiftend“ und berichtet den Eltern regelmäßig von Störungen im Unterricht. Julian merkt, dass er aneckt. Andere Kinder lachen über ihn oder meiden ihn. Die tägliche Kritik führt dazu, dass er sich immer weniger zutraut und zu Hause häufig traurig und gereizt ist. Seine Eltern erleben einen Jungen, der ständig das Gefühl hat, „nicht richtig zu sein“. Obwohl sie spüren, dass Julian ein aufgewecktes und einfühlsames Kind ist, stoßen sie an Grenzen – sowohl im Gespräch mit der Schule als auch in der Suche nach geeigneter Unterstützung.
Bei Jungen und Mädchen gibt es im Kontext der Symptomatik dabei erhebliche Unterschiede. ADHS zeigt sich bei Jungen und Mädchen unterschiedlich. Jungen neigen häufiger zu einem, wie in unserem Beispiel beschriebenen Verhalten, das lauter, bewegungsbetonter und konfrontativer wirkt. Sie fallen dadurch schneller im Klassenverband auf. Während Mädchen mit ADHS eher träumerisch und still wirken und somit leichter „durchrutschen“, stehen Jungen oft schon zeitig im Fokus von Kritik, Disziplinarmaßnahmen oder Fördergesprächen. Das führt dazu, dass Jungen mit ADHS meist früher diagnostiziert werden, jedoch auch früher mit Ablehnung und Stigmatisierung konfrontiert sind. Insbesondere für den Schulalltag gehen hiermit ein hohes Maß an Druck und sozialen Erwartungen einher. Begründet liegt dies darin, dass der Schulalltag hohe Anforderungen an Aufmerksamkeit, Sitzfleisch, Regelakzeptanz und soziale Anpassung stellt. All die genannten Fähigkeiten fallen dabei in eine Kategorie von Kompetenzen, die Kindern mit ADHS schwerfallen. Jungen werden zudem häufig an tradierten Rollenbildern gemessen. Sie sollen leistungsfähig, durchsetzungsstark und gleichzeitig kontrolliert sein. Wer diesen Erwartungen nicht entspricht, gilt schnell als „Problemfall“. Lehrkräfte, die mehrere solcher Kinder in einer Klasse betreuen, geraten ebenfalls an Belastungsgrenzen. Für die Jungen bedeutet das: Sie erleben oft früh Misserfolge, Überforderung und Ausgrenzung. Das hat nicht selten Folgen für das Selbstwertgefühl.
Mit Blick auf die Entwicklungspsychologie fällt zudem auf, dass es auch hier Besonderheiten gibt. In der kindlichen Entwicklung verlaufen Reifungsprozesse sehr individuell. Jungen hinken Mädchen in der Grundschule häufig in ihrer emotionalen und exekutiven Entwicklung hinterher. Das betrifft insbesondere die Fähigkeit zur Selbststeuerung, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle.
Exekutive Funktionen innerhalb der Entwicklung:
Der Begriff „exekutive Entwicklung“ bezieht sich auf die Reifung der sogenannten exekutiven Funktionen. Das sind zentrale Steuerungs- und Kontrollprozesse im Gehirn, die es Ihrem Kind ermöglichen, sein Verhalten bewusst zu planen, zu steuern und anzupassen.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören hierbei:
das Arbeitsgedächtnis, das Informationen kurzzeitig behalten kann,
die Inhibition (Hemmung/Impulskontrolle), die dafür sorgt, dass Impulse gehemmt und nicht sofort eine Reaktion erfolgt,
kognitive Flexibilität, die für das Umschalten zwischen Aufgaben verantwortlich ist und das Einstellen auf neue Anforderungen ermöglicht sowie Fehler erkennt,
die Planung und Organisation, die die anfallenden Aufgaben strukturiert, Prioritäten setzt und Abläufe überblickt, sowie
die Selbstregulation, die Emotionen, Verhalten und Aufmerksamkeit bewusst steuert.
Bei Kindern mit ADHS – insbesondere Jungen im Grundschulalter – sind diese Funktionen häufig noch unterentwickelt oder unreif. Das zeigt sich im Alltag zum Beispiel darin, dass das Kind Aufgaben nur schwer beginnen oder abschließen kann, Ablenkungen nachgibt, impulsiv handelt oder Schwierigkeiten hat, Fehler zu erkennen und sein Verhalten anzupassen. Sofern ein Kind ohnehin mit einem neurobiologischen Ungleichgewicht durch eine vorliegende ADHS kämpft, verstärken sich diese altersbedingten Reifungsverzögerungen zusätzlich. Gleichzeitig bringen viele der betroffenen Jungen eine große Vorstellungskraft, Bewegungsdrang, Entdeckerfreude und einen starken Gerechtigkeitssinn mit – Ressourcen, die im richtigen Rahmen gezielt gefördert werden können.
Die Rolle der Eltern: Hoffnung und Handlungsfähigkeit
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes – gerade dann, wenn dieses Kind mit besonderen Herausforderungen wie ADHS lebt. Die Diagnose kann zunächst verunsichern, viele Mütter und Väter fragen sich: Was haben wir falsch gemacht? Hätten wir es früher merken müssen? Wie können wir helfen, ohne ständig zu scheitern? Vielleicht haben auch Sie sich bereits einmal so gefühlt.
Diese Fragen sind verständlich, doch sie führen oft zu Ohnmachts- und Schuldgefühlen. Genau hier setzt ein Perspektivwechsel an: Nicht Schuld, sondern Gestaltung stehen im Mittelpunkt Ihres Unterstützungssystems. Sie als Eltern haben entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes. Nicht, weil Sie alles kontrollieren könnten, sondern weil Sie tagtäglich Beziehungen gestalten, Grenzen setzen, Rückhalt geben und Orientierung bieten. Sie bilden damit das Fundament, auf dem Ihr Kind sich den Rest seines Lebens aufbaut.
Gerade Kinder mit ADHS brauchen oftmals mehr Struktur, mehr emotionale Stabilität und noch mehr Verständnis als andere. Aber vor allem brauchen sie Eltern, die an sie glauben. Inzwischen ist medizinisch bekannt: Eine verlässliche, liebevolle und gleichzeitig konsequente Erziehung kann viel bewirken. Auch wenn ADHS nicht „wegzuerziehen“ ist, lässt sich der Umgang mit Symptomen positiv beeinflussen. Das gelingt Ihnen im Alltag mit Ihrem Kind durch klare Rahmenbedingungen, wertschätzende Kommunikation und durch die Bereitschaft, Verhalten nicht als Bosheit, sondern als Ausdruck eines inneren Ungleichgewichts zu sehen – ein Zustand, den Ihr Kind nicht selbstständig kontrollieren kann. Hier setzt der Ansatz der sogenannten positiven Erziehung an.
Exkurs: Positive Erziehung
Der Ansatz der positiven Erziehung basiert auf der Idee, dass Sie als Eltern Ihr Kind durch Bestärkung, Unterstützung und liebevolle Führung fördern, anstatt ausschließlich auf Bestrafung oder Kritik zurückzugreifen. Ziel ist es, das Verhalten Ihres Kindes auf eine Weise zu lenken, dass es sich emotional sicher und respektiert fühlt, was wiederum seine soziale und emotionale Entwicklung stärkt. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt aufbaut. Die Grundprinzipien sind dabei:
Wertschätzung und Respekt
Kinder werden als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen und Gefühlen anerkannt. Es wird ein Klima geschaffen, in dem sich das Kind sicher fühlt, Fehler machen darf und seine Bedürfnisse geäußert werden können. Anstatt das Kind für etwas zu bestrafen, wird die jeweilige Situation als Gelegenheit gesehen, miteinander zu lernen und Lösungen zu finden.
Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl
In der positiven Erziehung wird das Kind nicht nur für Erfolge, sondern auch für Anstrengungen und Fortschritte gelobt. Diese Art der Anerkennung fördert das Selbstvertrauen und die Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Klare und liebevolle Kommunikation
Statt Strafen oder Bestrafungen werden klare, aber einfühlsame Grenzen gesetzt. Die Eltern sprechen in einer respektvollen und verständlichen Weise mit dem Kind, sodass dieses die Regeln und Erwartungen nachvollziehen kann. Konflikte werden nicht mit Wut oder Enttäuschung, sondern mit einem ruhigen und verständnisvollen Gespräch angegangen.
Positives Vorbild
Sie als Eltern fungieren als Vorbilder für Ihre Kinder. Ihr Verhalten, Ihre Haltung und Ihre Reaktionen sind ein direktes Modell für das Kind. Eine positive, respektvolle Kommunikation und der Umgang mit eigenen Gefühlen sind daher besonders wichtig, um dem Kind zu zeigen, wie es seine eigenen Emotionen in schwierigen Situationen regulieren kann.
Förderung von Selbstregulation und Problemlösungsfähigkeiten
Anstatt alles vorzugeben, lernen Kinder bei positiver Erziehung, wie sie ihre eigenen Entscheidungen treffen, Konflikte lösen und Verantwortung übernehmen können. Das gelingt, indem Sie Ihrem Sprössling hierzu den nötigen Raum geben. Dies stärkt die exekutiven Funktionen wie Selbstkontrolle und Flexibilität.
Der Ansatz der positiven Erziehung ist besonders wertvoll, da diese Kinder oft mit einer erhöhten Impulsivität, Unaufmerksamkeit und Schwierigkeiten bei der Selbstregulation kämpfen. Positive Erziehung bedeutet demnach nicht Nachgiebigkeit oder Verzicht auf Regeln. Sie bedeutet, Ihr Kind in seinen Stärken zu sehen; gerade dann, wenn das Verhalten schwierig ist. Es geht darum, bewusst zu loben, kleine Fortschritte zu würdigen, kooperative Momente zu stärken und Konflikte nicht mit Härte, sondern mit Klarheit und innerer Ruhe zu begleiten. Sie als Eltern bewahren dabei eine positive Grundhaltung und wirken regulierend. Damit werden Sie zum sicheren Anker für Ihr Kind, an dem es sich orientieren kann.
Um handlungsfähig zu bleiben, brauchen Sie nicht nur Wissen über ADHS, sondern auch Kraftquellen für sich selbst. Der wichtigste Aspekt ist hier Resilienz.
Definition Resilienz:
Im Kontext mit der Elternschaft wird hier die psychische Widerstandskraft bezeichnet, mit belastenden Situationen, Stress und Rückschlägen konstruktiv umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Dies bedeutet für Sie konkret, die Fähigkeit zu besitzen, trotz ständiger Herausforderungen handlungsfähig, innerlich stabil und emotional verfügbar zu bleiben.
Resilienz erzeugen Sie durch Selbstfürsorge, realistische Erwartungen und tragfähige soziale Netzwerke. Wenn Sie sich Pausen erlauben, Unterstützung suchen und eigene Grenzen achten, bleiben Sie stabiler im Umgang mit dem eigenen Kind.
Tool 1: Struktur und Routinen schaffen
Kinder mit ADHS leben in einer Welt, die für sie oft unübersichtlich, laut und chaotisch wirkt. Das gilt nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren. Gedanken springen, Reize strömen ungefiltert herein, Impulse drängen zur Handlung, bevor die Situation wirklich erfasst wurde. Für viele Jungen mit ADHS ist der Alltag deshalb wie ein unbeschrifteter Stadtplan: Sie wissen, dass es irgendwo einen Weg gibt, aber sie finden ihn nicht immer auf Anhieb.
Genau hier setzt das erste Werkzeug an: Struktur. Sie soll Ihrem Kind einen verlässlichen Rahmen, Orientierung, Sicherheit und Entlastung bieten. Darüber hinaus unterstützt sie natürlich auch Sie im Umgang mit Ihrem Kind. Routinen helfen, den Tag vorhersagbar zu machen, Kräfte zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Klare Abläufe schaffen hier Kontrolle. Vielleicht haben Sie selbst schon versucht, Regeln aufzustellen oder feste Zeiten einzuführen und sind damit gescheitert. Das liegt nicht an Ihnen und auch nicht daran, dass Ihr Kind „nicht will“, sondern an der Art und Weise, wie Struktur bei ADHS funktionieren muss: weniger als Erziehungsmethode, mehr als Unterstützungssystem. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit einfachen Mitteln wirksame Strukturen schaffen, die für Sie alltagstauglich, realistisch und an den Bedürfnissen Ihres Kindes orientiert sind.
Warum Routinen bei ADHS helfen
Kinder mit ADHS erleben den Alltag oft als unberechenbar. Auch dann, wenn von außen betrachtet alles ganz normal scheint. Ihre Aufmerksamkeit springt zwischen Reizen, Gedanken, Gefühlen und Handlungsimpulsen hin und her. Es fehlt die innere Ordnung, um Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Aufgaben zu priorisieren oder Handlungen zu planen. Entscheidungen fallen schwer, Übergänge gelingen nicht gut, und jeder neue Tag beginnt gefühlt wieder bei null und ist mit einem enormen Maß an Anstrengung verbunden.
Routinen unterstützen hier dabei, diesen inneren Aufruhr zu beruhigen. Sie schaffen Vorhersehbarkeit, wo sonst Unsicherheit herrscht. Eine bekannte Abfolge wie beispielsweise das Aufstehen, Anziehen, Frühstücken und Zähneputzen wirkt wie ein inneres Navigationssystem. Je weniger Entscheidungen ein Kind treffen muss, desto mehr Energie bleibt für das, was wirklich schwierig ist: aufmerksam bleiben, sich selbst regulieren, mit anderen in Kontakt treten und interagieren. Das heißt also: Routinen helfen nicht nur Ihrem Kind. Auch Sie als Eltern profitieren davon: Sie müssen weniger erinnern, weniger ermahnen, weniger kämpfen. Stattdessen können Sie sich auf die Beziehung konzentrieren, weil der Rahmen bereits steht. Struktur entlastet, weil sie klare Zuständigkeiten, Zeiten und Abläufe vorgibt. Wichtig ist jedoch, dass sie nicht gleichzusetzen ist mit Strenge. Darüber hinaus sind Routinen nicht gleichbedeutend mit Zwang. Es geht nicht darum, einen perfekt durchgetakteten Tag zu schaffen, sondern um wiedererkennbare Abläufe, die dem Kind Sicherheit geben. Eine stabile Morgenroutine kann schon dadurch entstehen, dass jeden Tag zur selben Zeit geweckt wird, dieselbe Musik läuft und die Abläufe in der gleichen Reihenfolge erfolgen. Kleine Rituale haben eine große Wirkung, wenn sie regelmäßig, liebevoll und konsequent gelebt werden. Für Sie bedeutet das aber nicht, dass Ihr Kind, wenn es von ADHS betroffen ist, nicht mehr Regeln braucht als andere. Es benötigt lediglich klarere, verlässlichere und beständigere Strukturen und Regeln. Zudem sind für Ihr Kind Bezugspersonen unerlässlich, die verstehen, dass Struktur kein Zeichen mangelnder Spontaneität ist, sondern Ausdruck von Fürsorge und Unterstützung.
Reduktion von Überforderung durch klare Abläufe
Grundsätzlich gilt: Was Ihrem Kind im Alltag Ordnung bietet, entlastet sein Gehirn. Vor dem Hintergrund der dauerhaften Reizüberflutung, denen Kinder mit ADHS tagtäglich ausgesetzt sind, ist dieser Grundsatz einer der wichtigsten für den Umgang mit Ihrem Kind. Während andere Kinder Informationen filtern, Prioritäten setzen und störende Eindrücke ausblenden können, trifft bei ADHS alles gleichzeitig und mit voller Wucht auf das Nervensystem. Es fehlt die Fähigkeit der inneren Sortierung. Jeder neue Reiz verlangt Aufmerksamkeit, jede kleine Abweichung vom Gewohnten löst Unruhe aus. Das Gehirn arbeitet im Dauerbetrieb und ist dabei ständig überfordert. Um dieser Überforderung entgegenzuwirken, sollten klare, wiederkehrende Abläufe Abhilfe schaffen. Sie geben Ihrem Kind Struktur, ohne ständig Entscheidungen fordern zu müssen. Denn jede Entscheidung wie beispielsweise „Was mache ich als Nächstes? Wo liegt meine Jacke? Habe ich alles dabei?“ kostet Ihr Kind ein hohes Maß an Energie – Energie, die bei Kindern mit ADHS ohnehin schnell erschöpft ist.
Demnach gilt:





























