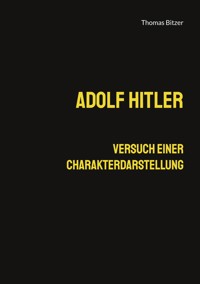
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch möchte der Frage nachgehen, wie es dazu kam, dass Adolf Hitler zu dem wurde, was er im Laufe seines Lebens geworden ist: ein Alptraum der Menschheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Vorbemerkung.
Hitlers Familie und Jugendzeit.
Verdrängung der Wirklichkeit.
Der egozentrische Machtmensch.
Hitler, der halbgebildete Kleinbürger.
Der Bohemien und Chaot.
Der launenhafte Tyrann.
Der Ungeduldige.
Sendungsbewusstsein und Größenwahn.
Die Beziehungen zum weiblichen Geschlecht.
Der Einzelgänger.
Der Hypochonder.
Keine Empathie.
Hitler und die Juden.
Hitler und das Militär.
Selbstmitleid.
Bestrafung des deutschen Volkes, weil es die Erwartungen Hitlers nicht erfüllt hat.
Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte.
War Hitler geisteskrank?
Hitler, ein Mensch wie andere auch?
Hitler, der Narzisst.
Schlussbemerkung.
I. Vorbemerkung.
Neue Forschungsergebnisse vermitteln die nachfolgenden Ausführungen nicht. Mit der Persönlichkeit Hitlers haben sich schon zahlreiche andere Autoren befasst und alles, was in diesem Buch erwähnt wird, kann man auch andernorts nachlesen (siehe Anmerkungen1), sogar noch weit ausführlicher. Es handelt sich hier jedoch nicht um eine Biographie, sondern um den Versuch einer Darstellung der verschiedenen Charakterzüge Adolf Hitlers. Dabei ließen sich Überschneidungen und Wiederholungen nicht ganz vermeiden. Was an einer Stelle abgehandelt wird, kann also durchaus an anderer Stelle unter einem anderen Blickwinkel noch einmal erscheinen.
Herangeführt an die Thematik wurde ich durch die eher einfache Fragestellung, was es eigentlich für ein Mensch gewesen sei, der die ganze Welt in einen Krieg stürzte und der Millionen von Menschen erschießen und ins Gas treiben ließ.
Trotz der nicht zu fassenden Dimension des Holocaust war es mein Bemühen, an die Betrachtung möglichst unvoreingenommen heranzugehen. Man sollte es sich nicht zu einfach machen und die Person des „Führers“ nicht nur auf eine Art Monster reduzieren.2 Zur Klärung der Frage, was Hitler für ein Mensch gewesen sei, trägt eine Dämonisierung nichts bei.
Auch sind es eher nicht die großen Ereignisse, die die Weltgeschichte beeinflusst haben, die hier Erwähnung finden. Vielmehr wurden gerade auch nebensächliche Begebenheiten in den Vordergrund gerückt. Ganz einfach deshalb, weil durch sie der Charakter einer Person eher erkennbar wird, als wenn diese im Rampenlicht steht und ihr Verhalten dementsprechend darauf einrichtet.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, was Hitler für ein Mensch gewesen sei, fiel weniger spektakulär aus, als zumindest ich es erwartet habe. .
Anscheinend liegen das Banale und das Böse oft enger beieinander, als man es gemeinhin annehmen möchte. Gerade so, wie Hannah Arendt es in Bezug auf Adolf Eichmann zum Ausdruck gebracht hat. Auch für die schlimmsten Verbrechen lassen sich nicht selten doch recht einfache Erklärungen finden, wenn man den Ursachen nur erst einmal auf den Grund gegangen ist.
Keinesfalls darf daraus jedoch die Schlussfolgerung gezogen werden, dass damit auch die aus diesen Ursachen resultierenden Taten als banal anzusehen seien. Im Gegenteil: Die Erkenntnis ist vielmehr die, dass gerade auch simple Ursachen sehr böse Folgen nach sich ziehen können.
Wer also verbarg sich hinter der charismatischen Person des „Führers“, der es vermochte, ein ganzes Volk zu verführen und die gesamte Welt ins Unglück zu stürzen?
II. Hitlers Familie und Jugendzeit.
Vergegenwärtigt man sich, dass die Entwicklung eines Menschen schon am Tage seiner Geburt und sogar schon davor im Mutterleib3 beginnt und von da an fortlaufend von einem Tag zum nächsten voranschreitet, dann ist es unerlässlich, sich die familiären Verhältnisse des betreffenden Menschen anzuschauen, aus denen er hervorgegangen ist, wenn man sich ein genaueres Verständnis davon verschaffen möchte, wie dieser Mensch zu dem wurde, was er tatsächlich geworden ist. Es handelt sich hierbei zwar um eine Binsenweisheit, der jedoch, gerade wenn es um die Person Adolf Hitlers geht, meines Erachtens häufig zu wenig Beachtung geschenkt wird.
Das Kind bringt, wenn es zur Welt kommt, gewisse Eigenschaften mit, die es für einen bestimmten Werdegang disponieren mögen. Seine Persönlichkeit ist zunächst aber noch so formbar, dass sich der Charakter innerhalb eines gegebenen Rahmens in vielen verschiedenen Richtungen entwickeln kann. Jeder Schritt im Leben schränkt dann jedoch die Zahl zukünftiger möglicher Entwicklungen ein.4 Jedes neue Erlebnis wird aufgrund der vorangegangenen Erfahrungen verarbeitet. Nicht dieses oder jenes einzelne Erlebnis übt also den stärksten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes aus, sondern der Charakter der Eltern, die das Kind täglich umgeben.5 Ob jemand in gewalttätiger Form agiert, hängt deshalb im wesentlichen immer auch davon ab, in welchem Umfeld die betreffende Person aufwächst bzw. aufgewachsen ist. Erwachsene, und hier zunächst einmal die Eltern, sind prägend für die frühen Erfahrungen eines Menschen.6 Es liegt somit auf der Hand, dass, wie überall, auch im Fall Hitler die Bedingungen im Elternhaus von zentraler Bedeutung für die Bildung der Persönlichkeit des heranwachsenden Sohnes Adolf waren, und es erscheint deshalb fraglich, ob man mit dem Historiker Anton Joachimsthaler sagen kann: „Hitlers Weg begann in München“7, im München nach dem Ersten Weltkrieg nämlich. Hitlers Weg begann vielmehr schon in Braunau, wo er zur Welt kam.
Adolf Hitler entstammte kleinbürgerlichen Verhältnissen. Sein Vater Alois wurde am 7. Juni 1837 als Alois Schicklgruber außerehelich geboren. Alois Schicklgrubers Mutter war Maria Anna Schicklgruber. Wer der leibliche Vater von Alois Schicklgruber war, ist dagegen nicht mit letzter Sicherheit geklärt. In Betracht kommen der Bauer Johann Nepomuk Hiedler sowie dessen Bruder Johann Georg, den die Mutter später heiratete, freilich ohne dass bei dieser Gelegenheit der Sohn Alois legitimiert worden wäre.
Als Vater von Alois Schicklgruber wurden vorübergehend auch noch ein jüdischer Kaufmann namens Frankenberger bzw. dessen Sohn ins Gespräch gebracht.8 Die Familie sollte in Graz ansässig und in ihrem Haushalt Alois Schicklgrubers Mutter tätig gewesen sein. Diese Annahme gilt jedoch als widerlegt.9 In Graz gab es in jener Zeit keine Familie Frankenberger. Ferner ist nichts darüber bekannt, dass Hitlers Großmutter das Waldviertel, in dem sie lebte, jemals verlassen hätte.10
1876 nahm Alois Schicklgruber den Namen „Hitler“ an. Die Namensänderung wurde im Taufbuch als Zusatz zur Taufurkunde von 1837 eingetragen und als Vater der schon 1857 verstorbene Johann Georg Hiedler vermerkt.11 Alois Hitler galt damit als ehelich.
Am 7. Januar 1885 heiratete Alois Hitler in dritter Ehe seine Hausangestellte Klara Pölzl, eine Enkelin von Johann Nepomuk Hiedler. Aus dieser Ehe gingen insgesamt sechs Kinder hervor.
Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 als viertes Kind geboren. Zu diesem Zeitpunkt waren seine drei älteren Geschwister, die allesamt das Kleinkindalter nicht überlebten, jedoch bereits verstorben. Auch der jüngere Bruder Edmund verstarb schon im Alter von knapp 6 Jahren im Jahr 1900. Von den Geschwistern erreichte lediglich die im Jahr 1896 geborene Schwester Paula das Erwachsenenalter. Sie wurde 64 Jahre alt und verstarb im Jahr 1960.
Hitler hatte außerdem noch einen Halbbruder Alois, geb. 1882, und eine Halbschwester Angela, geb. 1883, die beide der Verbindung seines Vaters mit Franziska Matzelsberger entstammten, die er im Jahr 1883 geheiratet hatte. Sie verstarb jedoch schon im Jahr 1884, ein Jahr nach der Geburt der Tochter Angela, an Tuberkulose.
Der Vater Alois, laut Adolf Hitler selbst Sohn „eines armen, kleinen Häuslers“12, absolvierte eine Schuhmacherlehre und bestand mit 17 Jahren die Gesellenprüfung. Ein Jahr später trat er in die österreichische Zollverwaltung ein und brachte es dort schließlich bis zum Zollamtsoberoffizial, Rangklasse IX13, vergleichbar einem Hauptmann, ebenfalls Rangklasse IX. Gehaltmäßig soll er damit dem Direktor einer Bürgerschule gleichgestanden haben.14 Wie dem auch immer sei: Adolf Hitler hatte wohl recht, wenn er seinen Vater als pflichtgetreuen Staatsbeamten schilderte15, und man kann ihm nicht widersprechen, wenn er in „Mein Kampf“ rückschauend feststellte, dass aus seinem Vater „etwas geworden“ sei.16 Dementsprechend erhielt der Vater auch einen Nachruf in der Linzer Tagespost: Er wurde dort als „durch und durch fortschrittlich gesinnter Mann“ geschildert. Er sei „stets heiter, ja von geradezu jugendlichem Frohsinn gewesen“. Sei auch „ab und zu“ ein „schroffes Wort“ aus seinem Mund „gefallen“, so habe sich unter „einer rauhen Hülle“ doch „ein gutes Herz geborgen“.17
Die Mutter, geboren am 12. August 1860, hingegen wird von Hitler als „im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan“ dargestellt.18
Hitler zeichnet in „Mein Kampf“ von seiner Familie rückschauend das Bild eines harmonischen Zusammenlebens. Als einziger Konflikt wird lediglich die Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und dem Vater erwähnt, die sich aus der Frage ergab, welchen Beruf der Sohn ergreifen sollte. Während der Vater den Wunsch hatte, dass Adolf, so wie er, Beamter werden sollte, hatte der Sohn die Absicht, Kunstmaler zu werden. Dieser Konflikt löste sich, als der Vater im Jahr 1903 überraschend starb. Aber das Bild einer ansonsten durchaus intakten Beziehung Hitlers insbesondere zu seinem Vater entsprach nicht der Wirklichkeit.
Der Vater war schon äußerlich von imposanter Gestalt. Zu Hause führte er ein strenges Regiment. Er forderte unbedingten Gehorsam. Der Sohn hatte zu erscheinen auf Pfiff des Vaters auf den Fingern.19
Der Knabe Hitler muss ein begabtes, aufgewecktes Kind gewesen sein.20 Er las viel. Der Vater hatte hierfür jedoch wenig Verständnis. Er beschimpfte den Sohn häufig, und wenn dieser nicht pünktlich zu Hause war, setzte es eine Tracht Prügel. Das soll nach der Erinnerung der Schwester Paula praktisch jeden Abend vorgekommen sein.21
Seiner langjährigen Sekretärin Christa Schroeder erzählte Hitler später, der Vater sei jähzornig gewesen und habe sofort zugeschlagen.22 Hitlers Halbschwester Angela berichtete, Hitler habe ihr gesagt, dass er die Prügel seines Vaters wegen des Zuspätkommens bewusst in Kauf genommen habe, damit er noch die Zeit zum Spielen gehabt hätte. Wäre er früher heimgekommen, wäre er auch geschlagen worden und hätte nicht spielen können.23 Die „arme Mutter“ hätte dann immer Angst um den Sohn gehabt.24
Die Annahme des Psychoanalytikers Erich Fromm, Alois Hitler sei zwar ein autoritärer Typ, jedoch kein Tyrann gewesen, der seinen Sohn, „soweit bekannt“, nie geschlagen habe25, dürfte nach alledem unzutreffend sein. Vielmehr litt Hitler offensichtlich stark unter der Strenge des Vaters.
Und, wenn Hitler in „Mein Kampf“ feststellt, den Vater habe er geachtet, die Mutter jedoch geliebt26, so ist das gewiss nur die halbe Wahrheit. Den Vater hat er, wie er seiner Sekretärin einräumte, nämlich nicht nur nicht geliebt. Er hat ihn vielmehr gefürchtet27, und der Tod des Vaters muss für den Sohn eine Erleichterung gewesen sein.28
Bei der Bedeutung, die der Rolle der Eltern für die Entwicklung ihres Kindes zukommt, drängt sich die Annahme auf, dass die Ambivalenz des Verhältnisses des jungen Adolf zum strengen Vater einerseits und zur gütigen Mutter andererseits für die Entwicklung des Jungen nicht gerade förderlich gewesen sein kann.
Ob ein Mensch, wie Hitler es tat, später zur Gewalttätigkeit neigt, hat, wie bereits angedeutet, stets auch mit der früheren Beziehungsbiographie zu tun. Welche Grunderfahrungen macht ein Kind in seinem Umfeld? Wie verlässlich wird in der Säuglings- und Kleinkindzeit auf es eingegangen? Nur eine emotional stabile Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind ermöglicht es dem Kind, ein positives Weltbild aufzubauen.
Im Alter ab etwa drei Jahren lernen Kinder sozialen Umgang, Konflikte zu bewältigen und Freundschaften zu schließen. Nur, wer in seiner Kindheit Liebe und Geborgenheit erfahren hat, wird später auch selbst lieben und das weitergeben können, was er selbst mitbekommen hat.
Die Qualität der Beziehungen im Elternhaus entscheidet somit darüber, ob das Kind Empathie und Selbstkontrolle entwickeln kann. Beide Kompetenzen sind von zentraler Bedeutung dafür, ob ein Mensch im Erwachsenenalter in der Lage ist, eine mögliche Gewaltbereitschaft unter Kontrolle zu halten oder nicht.29 Wird diese Phase vernachlässigt, dann kann diese soziale Kompetenz nur schwer nachgeholt werden.
Im Hause Hitler fehlte es offensichtlich an einer Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit.
Seine Mutter hatte Hitler zwar von klein auf immer als eine liebevolle und gütige Frau erlebt, die aber selbst unter der Strenge ihres Mannes litt. Nach dem Verlust von drei Kindern war die Mutter in steter Sorge um den kleinen Adolf. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn dürfte sich noch dadurch verstärkt haben, dass beide den Wutausbrüchen des Vaters ausgesetzt waren.
Die ständig vom Vater drohenden Prügel hingegen bedeuteten im Gegensatz zu der liebevollen Sorge der Mutter, dass der junge Adolf Hitler vermutlich in einem Klima steter, zumindest latenter Furcht lebte und dass er nicht in der Lage war, angstfrei eine in sich ruhende Persönlichkeit aufzubauen, die die Voraussetzung für ein ausgewogenes Für- und Miteinander gewesen wäre. Statt dem Sohn die Anerkennung zuteil werden zu lassen, auf die jeder heranwachsende Mensch angewiesen ist, waren Demütigungen durch den Vater an der Tagesordnung. Dabei hätte Hitler gerade der Anerkennung seines Vaters bedurft, denn der Vater war in der Familie die starke Figur. An ihm wollte sich der Sohn orientieren, auch so groß und mächtig sein wie der Vater. Von ihm wäre er gerne gelobt worden. Umso mehr müssen ihn das Ausbleiben der Anerkennung seitens des Vaters und die ständigen Erniedrigungen getroffen haben.
Wie sehr Adolf Hitler empfänglich für die Bestätigung durch andere war, zeigte sich auch später noch, etwa als Hitler während der Festungshaft in Landsberg vor Freude strahlte, als sein Mithäftling Rudolf Heß ihm einige lobende Worte gesagt hatte, nachdem Hitler ihm ein Kapitel aus „Mein Kampf“ vorgelesen hatte, von dem er in Landsberg den ersten Teil verfasste.30
Vom Vater gab es jedoch keine Anerkennung. Die für die Entwicklung des Sohnes notwendige Hinwendung zum Vater, der Prozess der Triangulierung, war gestört. Ein stabiles Selbstbewusstsein konnte der junge Hitler auf diese Weise nicht aufbauen. Daran laborierte Hitler sein ganzes Leben lang herum. Ständig machte ihm ein stets sublim vorhandenes Minderwertigkeitsgefühl zu schaffen.
Stattdessen übernahm der junge Adolf Hitler, ohne sich dessen bewusst zu sein, vom Vorbild des Vaters die durch Lieblosigkeit, Gefühlskälte, Gewalttätigkeit und Mitleidslosigkeit geprägte Verhaltensweise, die für ihn bis zu seinem Lebensende kennzeichnend war und ihn zum millionenfachen Massenmörder werden ließ.
Verschärft wurde das Problem der Vater–Sohn–Beziehung noch durch einen übermäßigen Alkoholkonsum des Vaters. So soll Hitler gegenüber seinem Rechtsanwalt Hans Frank, dem späteren Generalgouverneur im nicht annektierten Teil Polens, geäußert haben, die „grässlichste Scham“, die er, Hitler, je empfunden habe, sei die gewesen, wenn er den betrunkenen Vater aus dem Gasthaus habe nach Hause bringen müssen. Der Alkohol sei – über den Vater – der größte Feind in seiner Jugend gewesen.31
Die emotionale Vernachlässigung des Sohnes durch den Vater brachte es mit sich, dass der Sohn umso stärker auf die Mutter fixiert war.
Die Mutter verhätschelte ihn, schalt ihn nie und bewunderte ihn. Er brauchte sich um nichts zu kümmern. Die Mutter erfüllte ihm jeden Wunsch.32
Der kleine Adolf beherrschte seine Mutter und setzte sie mit Wutanfällen unter Druck, wenn sie ihm einen Wunsch verweigerte. Das hatte er übrigens offenbar mit dem jungen Napoleon gemein, der es als Kind auch gewohnt gewesen sein soll, seinen Willen durchzusetzen, und bei Widerspruch zu Zornausbrüchen geneigt haben soll.33
Da Hitler mit dieser Methode offensichtlich Erfolg hatte, schliff sich dieses Verhaltensmuster bei dem Jungen sehr schnell ein. Er kam immer wieder darauf zurück, sobald es darum ging, einer unangenehmen Realität auszuweichen, oder wenn ihm etwas abverlangt wurde, was ihm nicht passte oder was Anstrengung erforderte.
Die innige, auf den Sohn konzentrierte übersteigerte Mutterliebe nährte bei diesem schon von klein auf ein Gefühl der Auserwähltheit, der Einzigartigkeit, das Gefühl, sich alles erlauben zu können.34 So wurde bei Hitler von Anbeginn der Anschein erweckt, es drehe sich alles um ihn, er könne alles fordern und er brauche nichts zu leisten. Und dabei blieb es.
Hitler stagnierte in seiner Reifeentwicklung damit auf der Stufe eines Kleinkindes, das sich noch allein auf der Welt wähnt. Bei einem Kind von bis zu zweieinhalb Jahren mag das auch altersentsprechend sein35, bei einem älteren Menschen jedoch nicht.
Um freilich einem Missverständnis gleich von vorneherein entgegenzutreten: Mit einer niedlichen Kinderei hat das alles nichts zu tun, denn harmlos ist das überhaupt nicht. Ist nämlich bei einem Menschen die psychische Reifebildung frühzeitig stehen geblieben, wird mit zunehmendem Alter die Möglichkeit der Nachreifung immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Ein solcher Mensch wird sein Leben lang mit den Auswirkungen fehlender psychischer Funktionen wie Frustrationstoleranz oder Gewissensinstanz zu kämpfen haben, und auch sein Umfeld muss dementsprechend darunter leiden.36 Wenn so eine Person zu viel Macht in die Hände bekommt, kann das übel ausgehen. Und genau das war bei Hitler offensichtlich der Fall.
Die Weichen für Hitlers Entwicklung waren also schon in den ersten Tagen seines Lebens gestellt worden. Ein Tyrann wuchs heran. Aus einem kleinen Tyrannen wurde ein großer. Hitler entwickelte eine ebenso narzisstische wie passive Persönlichkeitsstruktur, wobei „passiv“ hier in dem Sinn zu verstehen ist, dass er dazu neigte, die Dinge treiben zu lassen und sich vor Schwierigkeiten zu drücken.
Die Folge war, dass Hitler sich stets im Mittelpunkt sah, alles auf sich bezog und immer nur Forderungen stellte, ohne bereit zu sein, seinerseits etwas zu geben. Hitler war schon von Kindheit an in letzter Konsequenz immer nur um sich selbst besorgt und deshalb auch nicht in der Lage mit anderen Menschen eine tragfähige Beziehung einzugehen. Er wurde vielmehr zum stets misstrauischen und letztendlich auch unsicheren Einzelgänger, ewig unzufrieden und wohl auch voller Selbsthass, den er dann zur eigenen Entlastung auf andere projizierte.
Die gestörte Persönlichkeit Hitlers ist nach alledem offensichtlich das Ergebnis einer tiefgreifenden Verunsicherung, hervorgerufen durch die Überhöhung durch die Mutter einerseits und die Zurückweisung durch den Vater andererseits. In diesem Wechselbad der Gefühle war es Hitler offenbar zu keinem Zeitpunkt möglich, ein Urvertrauen zu seiner Umgebung aufzubauen. Er blieb eine schwache Persönlichkeit und rächte sich dafür an der Menschheit bitter.
Der Historiker Volker Ullrich vertritt in diesem Zusammenhang allerdings die Ansicht, Biographen sollten sich hüten, zu weitreichende Schlüsse aus frühen Kindheitserlebnissen zu ziehen. Körperliche Züchtigung sei damals als Erziehung durchaus noch an der Tagesordnung gewesen. Ein autoritär-repressiver Vater und eine liebevoll-ausgleichende Mutter – diese Konstellation sei in den Mittelstandsfamilien keineswegs ungewöhnlich gewesen37; sie ist es möglicherweise auch heute noch nicht. Und in der Tat mag es so sein, das das einzig Besondere an Hitlers Elternhaus darin bestand, dass es im Vergleich zu zig anderen Elternhäusern gerade keine Besonderheiten aufwies.
Aber daraus zu folgern, dass aus der früheren Kindheit Hitlers keine weitreichenden Schlüsse auf die weitere Entwicklung seiner Persönlichkeit gezogen werden sollten – das sehe ich nicht ganz so. Im Gegenteil: Gerade der Umstand, dass Adolf Hitler einer zumindest nach außen hin ganz alltäglichen, unauffälligen bürgerlichen Familie entstammte, sollte Anlass zum Nachdenken geben. Allem Anschein nach werden jedoch die Mechanismen der Lieblosigkeit und der Gewalt, wie sie sich in der Familie Hitler abspielten, auch heute noch verbreitet als so normal und selbstverständlich empfunden, dass sie als Ursachen für Hitlers Entwicklung hin zu einem Verbrecher meines Erachtens viel zu wenig in Betracht gezogen werden.
Wenn die Kindheit Adolf Hitlers aber tatsächlich so „normal“ war, wie es hier behauptet wird, dann drängt sich allerdings die Annahme auf, dass eine Vielzahl von Menschen, die vermutlich eine ähnliche Kindheit wie Adolf Hitler durchlaufen haben, dementsprechend ähnliche Persönlichkeitsmerkmale wie Hitler entwickelt haben müsste.
Dass es sich so verhält, das mag auch durchaus der Fall sein. Nur ist es natürlich nicht so, dass aus jedem dieser Menschen deshalb auch gleich ein Diktator oder ein Verbrecher werden müsste. Dazu bedurfte es im Fall Hitler noch weiterer, außerhalb seiner Person liegender Faktoren. Insbesondere die schwierigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg kamen ihm bei der Eroberung der Macht sehr zustatten.
Die Ausführungen über das Elternhaus Adolf Hitlers dürfen allerdings nicht etwa zu der Annahme verleiten, Hitler solle hier die Rolle eines Opfers unglücklich zusammengetroffener Umstände zugeschrieben werden, gewiss nicht! Andererseits darf der Einfluss des Elternhauses aber auch nicht übersehen werden.





























