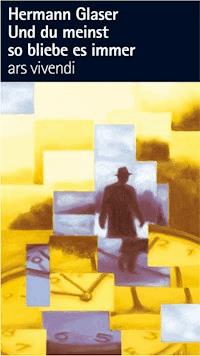Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Adolf Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf« steht in einer langen, weit ins 19. Jahrhundert zurückreichenden fatalen Tradition, an deren Ende die Zerstörung der deutschen Kultur durch ideologische Betrüger stand. Warum aus dem Bildungsbürger der Untertan und dann der »Volksgenosse« mit abgründiger Spießermentalität wurde, dokumentiert Hermann Glaser akribisch in diesem Buch, indem er den nationalsozialistischen Untergrund freilegt, aus dem das Verderben kroch, und so den Blick für die Notwendigkeit staatsbürgerlicher Sensibilität schärft. Ein bahnbrechender Beitrag zur bislang vernachlässigten Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus - aktuell und wichtig wie nie zuvor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Glaser
Adolf Hitlers Hetzschrift
»Mein Kampf«
Ein Beitrag zur
Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de
Mai 2014
Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2014 Buch&media GmbH, München
Umschlaggestaltung Dietlind Pedarnig/Alexander Strathern Foto Hermann Glaser Umschlagklappe © fotura.de Herstellung: Kay Fretwurst, Freienbrink
Printed in Europe ·ISBN978-3-86906-622-6
Inhalt
Einleitung: Anliegen des Buchs
I Hitler und die Deutschen
II Seelenbild des Mädels
III Erziehungsdressur
IV Österreich als Trauma
V Krieg als Lebenserfüllung
VI Rassenwahn und Blutmystik
VII Bestialisierung
VIII Judenhass
IX Wortgewalt und Sprachzerstörung
X Sündenbock »Entartete Kunst«
XI Der Wahn als Buch
Epilog
Der aktuelle Mangel an mentalitätsgeschichtlicher Deutung
Nachwort
Wie war »es« möglich?Für eine Didaktik der Kontroversität
Anhang
Anmerkung des Autors zu den Fußnoten
Ergänzende Literatur*
Personenregister*
Einleitung: Anliegen des Buchs1
Nach einem Wort von Albert Camus entmutigt Dummheit und Gemeinheit empört. Betrachtet man die deutsche Geistes- und Kulturgeschichte des 19. wie des 20. Jahrhunderts, vor allem die dadurch mitbewirkte Realgeschichte, ist man entmutigt über die in diesem Volk angehäufte ideologische Verblendung und entsetzt über die dann im »Dritten Reich« sich zeigende abgründige Gemeinheit der an die Macht gekommenen Massenmörder, die sich einer meist begeistert zustimmenden Bevölkerung sicher sein konnten.
Die stets drängende Frage ist – und dies beschäftigt oder sollte auch die Nachgeborenen beschäftigen –: Wie konnte es dazu kommen, dass Franz Grillparzers dunkle Vision von 1849 bittere Wirklichkeit wurde, dass nämlich der deutsche geschichtliche Weg von der »Humanität durch Nationalität zur Bestialität« (sic!) führe, dass ein Volk, das auf allen Gebieten der Kultur, vor allem seit der Aufklärung und Klassik, so viele wertvolle Beiträge zur Entwicklung der Weltkultur geleistet hatte, auf einen Zustand regredierte, der »deutsch« mit den schändlichsten Verbrechen verband. Das Wort von Karl Kraus, dass aus dem Volk der Dichter und Denker eines der Richter und Henker geworden sei, stimmt zwar so nicht – denn die Deutschen waren als Gesamtheit nicht herausragende Kulturbürger und nicht alle Deutschen waren in den Verbrecherstaat involviert –, ist aber in der Tendenz richtig: Es ereignete sich in Deutschland ein »Zivilisationsbruch«, der selbst von größten Kulturpessimisten etwa jüdischer Provenienz für unmöglich erachtet wurde: die Mutation des Bildungsbürgers zum Untertan und schließlich zum »Volksgenossen«.
Am 13. September 1936 rief Adolf Hitler auf dem Nürnberger Reichsparteitag unter dem Jubel der aufmarschierten Kampfformation der Partei aus: »Das ist das Wunder unserer Zeit, daß ihr mich gefunden habt unter so vielen Millionen! Und daß ich euch gefunden habe, ist Deutschlands Glück!«2 Als er dergestalt im Stil des Johannes-Evangeliums die unio mystica von Volk und Führer pries, sagte er – abgesehen davon, dass diese nicht Glück, sondern Unheil brachte – eine bittere Wahrheit: Hitler und der Nationalsozialismus, mit »Mein Kampf« als weltanschaulicher Grundlage, konnten nur deshalb so erfolgreich sein, weil das Volk seit Jahrzehnten für die Herrschaft der »niederen Dämonen« (Ernst Niekisch) vorbereitet, vorbestimmt worden war (oder wie man die mentalitätsgeschichtlich genau belegbare kollektive ideologische Verdummung nennen will). Das war das Werk der »Agenturen« des Staates und der Gesellschaft (Universität, Militär, Verwaltung, Kirche, Parteien, Organisationen, Vereine, Verbände, vor allem der die Schulen bestimmenden »schwarzen Pädagogik«). Sie zerstörten den deutschen Geist beziehungsweise »entkernten« ihn und füllten die verbleibenden leeren Hülsen mit gegenteiligen »verkehrten« Inhalten.
Wohin man auch schaut: Der Aufstieg des Nationalsozialismus vollzog sich auf der Grundlage einer zerstörten (pervertierten) Kultur. Hitler war als Inkarnation bourgeoiser Durchschnittlichkeit nicht ein raffinierter Verführer, sondern – und das wird in diesem Buch aufgezeigt – vor allem schon mit seinem Buch »Mein Kampf«3, der deutsche abgründige Spießer.4 Man hat die Meinung vertreten, Bedeutung und Einfluss von »Mein Kampf« dürften nicht zu hoch eingeschätzt werden, da das Buch zwar weit verbreitet, aber kaum gelesen wurde. Das mag stimmen; doch kann man daraus auch eine zunächst paradox klingende Folgerung ziehen: Das Buch war so erfolgreich, weil es überhaupt nicht mehr gelesen werden musste. Lebensgefühl und Weltanschauung eines Großteils der deutschen Bevölkerung stimmten mit dem überein, was in »Mein Kampf« dargeboten und propagiert wurde. Der Inhalt des Buchs5 – zudem in Tausenden von Broschüren, in vielen Zeitungen, Zeitschriften und jeglichen Propagandamaterialien, besonders auch durch die Reden Hitlers und seiner Gefolgsleute unters Volk gebracht – enthielt all das, was des »Spießers Wunderhorn« (Gustav Meyrink), die Pandorabüchse kleinbürgerlicher Traktätchenverfasser, bereithielt: abgründige Gemeinheiten, in schiefe Metaphern geschlagene Ressentiments, endlose Tiraden, rhetorisch aufgeschminkte Plattitüden. So wurde Hitlers Mediokrität zum Schicksal eines Volks, das sich Schritt um Schritt von Humanität und Kultur hatte abbringen lassen. Für den Aufstieg der Nationalsozialisten bedurfte es (und das machte die große Stunde des Kleinbürgertums aus) keiner geschickten Verführung, keiner raffinierten Dämonie oder Verlogenheit. Hitler musste nur er selbst sein: das war sein Erfolg. Er musste nur Spießer sein, mittelmäßig, primitiv, ohne Vorzüge und Meriten: das war sein »Verdienst«.6
Neben der Mentalitätsgeschichte von Hitlers weltanschaulichen Hetzschrift – jeweils mit Textauszügen und folgender Herkunftsgeschichte – wird in diesem Buch endlich wieder das umfangreiche Schrifttum (einschließlich empirischer Studien, etwa zum deutschen Lese- und Geschichtsbuch sowie zur autoritären Pädagogik), das aus früheren Jahren vorliegt, aber (mit wenigen Ausnahmen) heute bei den Werken über Hitler und den Nationalsozialismus nicht mehr beachtet wird, gewürdigt. Auch finden an einigen Beispielen (etwa Heinrich Mann und Ödön von Horváth) die aufschlussreichen belletristischen beziehungsweise dramatischen Analysen Beachtung, die oft mehr als Historiografie Antwort auf die Frage nach dem Erfolg des Faschismus geben.
Das Wissenschaftsparadigma, das heute für die NS-Forschung vorherrschend ist, bedarf dringend eines Gegenmodells oder zumindest einer Ergänzung. Auch weil dieses Buch die Vermittlung umfangreichen mentalitätsgeschichtlichen Materials konkret vornimmt, will es anregen, die Forschungsziele wieder auf eine Thematik zu richten, die durch die Frage: »Wie konnte es dazu kommen?« bestimmt ist. »Seelenbilder« können den Menschen als Leitbilder vor Dummheit und Gemeinheit schützen und sie können, wenn sie von ideologischen Betrügern manipuliert und verfälscht werden, schreckliche Folgen haben.
Wird das deutsche Volk aus der Kollektivschuld entlassen, weil es »falsch« erzogen und in seinen Strebungen pervertiert wurde? Oder wird es besonders belastet, weil ihm jede Kraft, vor allem jeder Mut fehlte, der nationalsozialistischen Allianz von Ignoranz und Bösartigkeit entgegenzutreten? Diesem Buch ist jedenfalls, indem es das »Lehrstück« von Hitlers Nationalsozialismus mentalitätsgeschichtlich aufrollt, die Mahnung für Gegenwart und Zukunft ein- geschrieben: Wehret den Anfängen! Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur!
Hermann GlaserRoßtal, März 2014
I Hitler und die Deutschen
Der spätere »Führer des Volkes«, als nach Großdeutschland sich sehnender Österreicher, trug – wie sein Buch »Mein Kampf« deutlich macht – auf seinen Lippen das »Sedanlächeln«, das nach Benedetto Croce die chauvinistische Hybris des Philisters, der eine tiefe Abneigung gegenüber französischer (»welscher«) Lebens- und Denkart empfindet, charakterisiert. Die Ideen der Französischen Revolution konnte der deutsche Untertanengeist nicht akzeptieren und so blieb ihre Wirksamkeit auf eine liberale Minderheit beschränkt, zu welcher der Historiker Theodor Mommsen gehörte. In seinem »Politischen Testament« schrieb er: »In meinem innersten Wesen, und ich meine, mit dem Besten, was in mir ist, bin ich stets ein animal politicum gewesen und wünschte ein Bürger zu sein. Das ist nicht möglich in unserer Nation, bei der der Einzelne, auch der Beste, über den Dienst im Gliede und politischen Fetischismus nicht hinauskommt. Diese innere Entzweiung mit dem Volke, dem ich angehöre, hat mich durchaus bestimmt, mit meiner Persönlichkeit, soweit mir das irgend möglich war, nicht vor das deutsche Publikum zu treten, vor dem mir die Achtung fehlt.«7 Die Identifikation der Deutschen mit Hitler musste er nicht mehr erleben.
Beim Durchstöbern der väterlichen Bibliothek war ich über verschiedene Bücher militärischen Inhalts gekommen, darunter eine Volksausgabe des DeutschFranzösischen Krieges 1870/71. Es waren zwei Bände einer illustrierten Zeitschrift aus diesen Jahren, die nun meine Lieblingslektüre wurden. Nicht lange dauerte es, und der große Heldenkampf war mir zum größten inneren Erlebnis geworden. Von nun an schwärmte ich mehr und mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder doch mit Soldatentum zusammenhing.
Aber auch in anderer Hinsicht sollte dies von Bedeutung für mich werden. Zum ersten Male wurde mir, wenn auch in noch so unklarer Vorstellung, die Frage aufgedrängt, ob und welch ein Unterschied denn zwischen den diese Schlachten schlagenden Deutschen und den anderen sei? Warum hat denn nicht auch Österreich mitgekämpft in diesem Kriege, warum nicht der Vater und nicht all die anderen auch?
Sind wir denn nicht auch dasselbe wie eben alle anderen Deutschen?
Gehören wir denn nicht alle zusammen? Dieses Problem begann zum ersten Male in meinem kleinen Gehirn zu wühlen. Mit innerem Neide mußte ich auf vorsichtige Fragen die Antwort vernehmen, daß nicht jeder Deutsche das Glück besitze, dem Reich Bismarcks anzugehören.
Ich konnte dies nicht begreifen. […]
Die Tiefe des Falles irgendeines Körpers ist immer das Maß der Entfernung seiner augenblicklichen Lage von der ursprünglich eingenommenen. Dasselbe gilt auch über den Sturz von Völkern und Staaten. Damit aber kommt der vorherigen Lage oder besser Höhe eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Nur was sich über die allgemeine Grenze zu heben pflegt, kann auch ersichtlich tief fallen und stürzen. Das macht für jeden Denkenden und Fühlenden den Zusammenbruch des Reiches so schwer und entsetzlich, daß er den Sturz aus einer Höhe brachte, die heute, angesichts des Jammers der jetzigen Erniedrigung, kaum mehr vorstellbar ist.
Schon die Begründung des Reiches schien umgoldet vom Zauber eines die ganze Nation erhebenden Geschehens. Nach einem Siegeslauf ohnegleichen erwächst endlich als Lohn unsterblichen Heldentums den Söhnen und Enkeln ein Reich. Ob bewußt oder unbewußt, ganz einerlei, die Deutschen hatten alle das Gefühl, daß dieses Reich, das sein Dasein nicht dem Gemogel parlamentarischer Fraktionen verdankte, eben schon durch die erhabene Art der Gründung über das Maß sonstiger Staaten emporragte; denn nicht im Geschnatter einer parlamentarischen Redeschlacht, sondern im Donner und Dröhnen der Pariser Einschließungsfront vollzog sich der feierliche Akt einer Willensbekundung, daß die Deutschen, Fürsten und Volk, entschlossen seien, in Zukunft ein Reich zu bilden und aufs neue die Kaiserkrone zum Symbol zu erheben. Und nicht durch Meuchelmord war es geschehen, nicht Deserteure und Drückeberger waren die Begründer des Bismarckschen Staates, sondern die Regimenter der Front.
Diese einzige Geburt und feurige Taufe allein schon umwoben das Reich mit dem Schimmer eines historischen Ruhmes, wie er nur den ältesten Staaten – selten – zuteil zu werden vermochte. Und welch ein Aufstieg setzte nun ein!
Die Freiheit nach Außen gab das tägliche Brot im Innern. Die Nation wurde reich an Zahl und irdischen Gütern. Die Ehre des Staates aber und mit ihr die des ganzen Volkes war gehütet und beschirmt durch ein Heer, das am sichtbarsten den Unterschied zum einstigen deutschen Bunde aufzuzeigen vermochte. So tief ist der Sturz, der das Reich und das deutsche Volk trifft, daß alles, wie vom Schwindel erfaßt, zunächst Gefühl und Besinnung verloren zu haben scheint; man kann sich kaum mehr der früheren Höhe erinnern, so traumhaft unwirklich gegen-über dem heutigen Elend erscheint die damalige Größe und Herrlichkeit.8
Unabhängig von dem steten Diskurs in der Philosophie und Anthropologie seit der Antike über die Seele – die Fragwürdigkeit ihrer Existenz, die Art ihres Wesens, ihre Flüchtig- oder Beständigkeit oder was auch immer – ist das Seelenbild ein brauchbares Konstrukt, wenn man die kommunikativen Bezüge und Verläufe zwischen Menschen, vor allem von Gesellschaften und Gesellschaftssystemen zu beschreiben versucht. Welches Bild man sich vom anderen macht, wie er im Inneren und Innersten strukturiert ist (was man Psychogramm nennt), entscheidet über die Art und Weise, wie der eine den anderen anspricht und wie der andere auf diese verbale oder nonverbale Ansprache reagiert beziehungsweise wie er sie rezipiert.
In einem knapp fünf Seiten umfassenden Aufsatz aus dem Jahr 1924 vergleicht Sigmund Freud, den damaligen Stand seiner Psychoanalyse illustrierend, die seelische Rezeption mit dem damals aufkommenden »Wunderblock«, dessen technische Eigenschaft mit Hilfe von verschiedenen Schichten (aus Wachs und Zelluloid) es ermögliche, darauf zu schreiben, aber auch das Geschriebene wieder zu löschen.9 Heutzutage würde Freud wahrscheinlich von einer »WunderComputer-Festplatte« sprechen, der auch das Gelöschte bleibt und durch eine bestimmte technische Manipulation aus dem Unsichtbaren zurückgeholt, also reaktiviert werden kann.
Der Freudsche »Wunderblock« zeigt – ob es ein schlüssiger Vergleich ist, sei dahingestellt –, dass dem Bewusstsein als dem Lesbaren eine unbewusste Schicht zugrunde liegt, die heraufgeholt dann dieses Bewusstsein bestimmt. Besonders geeignet für diesen Reanimationsprozess – das Ingangsetzen scheinbar erloschener Vorstellungen – sind Bilder als einprägsam kompakte und anschauliche Eindrücke (Einprägungen), die als Seelenbilder, aus dem Unbewussten geholt, ins Bewusstsein eindringen, dieses und damit ein bestimmtes Agieren bestimmen.
Wenn eine dominante, herrschende beziehungsweise vorherrschende Person Seelenbilder in sich trägt, die auch diejenigen der anderen sind, entsteht rasch und geradezu naturhaft eine enge Verbindung, eine bis jenseits rationaler Überprüfung und Kritik stehende Solidarität und kollektive Identität – eine unio mystica, etwa zwischen »Führer« und Gefährten.
Das Zusammenspiel der Obsessionen einer Einzelperson, des »Führers«, dann einer Gefolgschaft von »niederen Dämonen«, Psychopathen, die mit ihm die Macht ergriffen und die er um sich scharte, mit den kollektiven Obsessionen eines ideologisch präparierten und so für die nationalsozialistische Indoktrination prädestinierten Volkes ist der Forschungskern der Psychohistorie des »Dritten Reichs«, der dem »Warum« nachspürt: Warum kam es zu diesem Gleichklang, diesem »Wunder« des Zusammenfindens, das dann nicht nur eine deutsche, sondern eine Weltkatastrophe zur Folge hatte? Warum erfolgte die Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten des deutschen Reiches?10 Warum versanken – bildlich gesprochen – die fruchtbaren Gefilde der deutschen Kulturlandschaft, die doch wichtige und schöne Blüten in allen Bereichen zur Weltkultur beigesteuert hatte,11 in einer Kloake des Ungeistes? Warum wurden aus Bildungsbürgern die Gefolgsleute einer menschenverachtenden Weltanschauung?
Die Geschichte der Seelenbilder, die letztlich das Menschenbild konturieren, zeigt, dass ein fataler Wandlungsprozess sich vollzog, der den Untertan und dann den Volksgenossen (männlich wie weiblich) zur Folge hatte. Die »schöne Seele« – das Leitbild der Kultur der Aufklärung, Klassik und Romantik und der darauf aufbauenden Strömungen – wurde vernichtet und an ihrer Stelle verblieben tote Seelen, die dann in leiblichen Gestalten töteten und mordeten. Der humane und humanistische Hochstand der Deutschen konnte den Absturz in schlimmste Unmenschlichkeit nicht verhindern.
Es zeigte sich – um auf Sigmund Freuds »Wunderblock« zurückzukommen –, dass eben das einst kulturell »Eingeschriebene« den Ungeist und die Gefühllosigkeit nicht verhindern konnte. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut – »gelöscht«! Oder vielmehr: die rudimentär noch vorhandenen humanen Spuren wurden für die Perversion genutzt, die »schönen Seelen« verdreht, umgedreht und damit abgetötet. Die entleerten Hülsen gegenteilig genutzt. Das meint Herbert Marcuse, wenn er von der »affirmativen Kultur« als geistigseelischem Vakuum spricht, das eine unheilvolle Auffüllung erfuhr: »Unter affirmativer Kultur sei jene der bürgerlichen Epoche angehörige Kultur verstanden, welche im Laufe ihrer eigenen Entwicklung dazu geführt hat, die geistigseelische Welt als ein selbstständiges Wertreich von der Zivilisation abzulösen und über sie zu erhöhen. Ihr entscheidender Zug ist die Behauptung einer allgemein verpflichtenden, unbedingt zu bejahenden, ewig besseren, wertvolleren Welt, welche von der tatsächlichen Welt des alltäglichen Daseinskampfes wesentlich verschieden ist, die aber jedes Individuum, ›von innen‹ her, ohne jene Tatsächlichkeiten zu verändern, für sich realisieren kann. Erst in dieser Kultur gewinnen die kulturellen Tä-tigkeiten und Gegenstände ihre hoch über den Alltag emporgesteigerte Würde: ihre Rezeption wird zu einem Akt der Feierstunde und der Erhebung.« Die affirmative Kultur ist in ihren Grundzü-gen idealistisch: »Auf die Not des isolierten Individuums antwortet sie mit der allgemeinen Menschlichkeit, auf das leibliche Elend mit der Schönheit der Seele, auf die äußere Knechtschaft mit der inneren Freiheit, auf den brutalen Egoismus mit dem Tugendreich der Pflicht. Hatten zur Zeit des kämpferischen Aufstiegs der neuen Gesellschaft alle diese Ideen einen fortschrittlichen, über die erreichte Organisation des Daseins hinausweisenden Charakter, so treten sie in steigendem Maße mit der sich stabilisierenden Herrschaft des Bürgertums in den Dienst der Niederhaltung unzufriedener Massen und der bloßen rechtfertigenden Selbsterhebung: sie verdecken die leibliche und psychische Verkümmerung des Individuums.«12
Besonders drastische Beispiele für die Perversion leitbildgebender kultureller Maximen sind die Zitatfälschungen. Geflügelte Worte, die ein auf den Begriff gebrachtes Lebensideal signalisierten, wurden, wie das trojanische Pferd als Vehikel der Zerstörung ihres Sinnes genutzt, aber vom äußeren Anschein her beibehalten. Das Streben des Menschen nach körperlichgeistigseelischer Vollkommenheit, der seit der Antike anzutreffende humane Wunsch der Kalokagathie wurde aus dem Optativ (der Wunschform) in den Indikativ (Wirklichkeitsform) als normsetzendes Faktum bei der gesellschaftlich einflussreichen Turnerbewegung verschoben, was schlimme Folgen für die Vorstellung vom Menschen hatte. Menssana in corpore sano: das hieß nun (bald rassistisch dekretiert): Ein gesunder Geist ist identisch mit einem gesunden Körper und nur ein gesunder Körper kann einen gesunden Geist haben.
Und so wie im allgemeinen die Voraussetzung geistiger Leistungsfähigkeit in der rassischen Qualität des gegebenen Menschenmaterials liegt, so muß auch im einzelnen die Erziehung zuallererst die körperliche Gesundheit ins Auge fassen und fördern; denn in der Masse genommen wird sich ein gesunder, kraftvoller Geist auch nur in einem gesunden und kraftvollen Körper finden. Die Tatsache, daß Genies manches Mal körperlich wenig gutgebildete, ja sogar kranke Wesen sind, hat nichts dagegen zu sagen. Hier handelt es sich um Ausnahmen, die – wie überall – die Regel nur bestätigen. Wenn ein Volk aber in seiner Masse aus körperlichen Degeneraten besteht, so wird sich aus diesem Sumpf nur höchst selten ein wirklich großer Geist erheben. Seinem Wirken aber wird wohl auf keinen Fall mehr ein großer Erfolg beschieden sein. Das heruntergekommene Pack wird ihn entweder überhaupt nicht verstehen, oder es wird willensmäßig so geschwächt sein, daß es dem Höhenflug eines solchen Adlers nicht mehr zu folgen vermag.
Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine gesamte Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körperbildung der geistigen Fähigkeiten. Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung des Charakters, besonders die Förderung der Willens- und Entschlußkraft, verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungsfreudigkeit, und erst als letztes die wissenschaftliche Schulung.
Der völkische Staat muß dabei von der Voraussetzung ausgehen, daß ein zwar wissenschaftlich wenig gebildeter, aber körperlich gesunder Mensch mit gutem, festem Charakter, erfüllt von Entschlußfreudigkeit und Willenskraft, für die Volksgemeinschaft wertvoller ist als ein geistreicher Schwächling. Ein Volk von Gelehrten wird, wenn diese dabei körperlich degenerierte, willensschwache und feige Pazifisten sind, den Himmel nicht zu erobern, ja nicht einmal auf dieser Erde sich das Dasein zu sichern vermögen. Im schweren Schicksalskampf unterliegt selten der, der am wenigsten weiß, sondern immer derjenige, der aus seinem Wissen die schwächsten Konsequenzen zieht und sie am kläglichsten in die Tat umsetzt. Endlich muß auch hier eine bestimmte Harmonie vorhanden sein. Ein verfaulter Körper wird durch einen strahlenden Geist nicht im geringsten ästhetischer gemacht, ja, es ließe sich höchste Geistesbildung gar nicht rechtfertigen, wenn ihre Träger gleichzeitig körperlich verkommene und verkrüppelte, im Charakter willensschwache, schwankende und feige Subjekte wären. Was das griechische Schönheitsideal unsterblich sein läßt, ist die wundervolle Verbindung herrlichster körperlicher Schönheit mit strahlendem Geist und edelster Seele. Wenn der Moltkesche Ausspruch: »Glück hat auf die Dauer doch nur der Tüchtige« Geltung besitzt, so sicherlich für das Verhältnis von Körper und Geist: Auch der Geist wird, wenn er gesund ist, in der Regel und auf die Dauer nur in gesundem Körper wohnen.13
Der römische Satiriker Decimus Junius Juvenalis (gestorben nach 127) hat aber nie die menschenverachtende (den Kranken verachtende) Parole vom mens sana in corpore sano ausgegebe. In seiner zehnten Satire heißt es: Orandum est ut sit mens sana in corporesano. (Mit Opfern bei den Göttern sollst du gesunden Geist in gesundem Leib erflehen.)14
Und was die deutschen Gesangsvereine im 19. und 20. Jahrhundert betrifft – Hitler sprach von einem Volk der Dichter und Sänger15 –, so verfielen sie einem absurden Reim, der ihr Auserwähltsein intonierte: »Wo man singt, da laß’ dich ruhig nieder, / böse Menschen haben keine Lieder.« Das solcher Hybris zugrunde liegende Gedicht von Johann Gottfried Seume aber lautete, unverkürzt: »Wo man singet, laß dich ruhig nieder, / ohne Furcht, was man im Lande glaubt, / wo man singet, wird kein Mensch beraubt, / Bösewichter haben keine Lieder.« Die etwas umständlich formulierte Feststellung, dass Diebe und Räuber bei ihrem Tun nicht singen, diente dazu, den singenden Menschen schlechthin zum guten Menschen zu erheben, was dann der Totalitarismus sehr nützte und zugleich widerlegte: Mord und Musik sind keine Gegensätze.
Auf aphoristische Weise sollen die beiden Beispiele deutlich machen, dass die kulturelle Perversion häufig deshalb so erfolgreich war, weil die Verpackung sehr vertraut schien, während der Inhalt ein ganz anderer geworden war.
Hitler und sein Volk fanden sich in Seelenbildern zusammen, die gleiche Wurzeln hatten, nämlich aus der von den »Agenturen« des Staates und der Gesellschaft oktroyierten affirmativen Kultur stammten. Sie überlagerten und zersetzten die humanen Seelenbilder, die das Bild vom Menschen als eines menschlichen Menschen zeigten. Aus der Pamphlet- und Traktätchenliteratur des 19. Jahrhunderts stammte der Stoff, der dann zum Gewand verwoben wurde, das der deutsche Spießer trug und damit protzte. Die Spie-ßerIdeologie machte nieder, was deutsche Geist- und Seelenhaftigkeit für die Enkulturation – die kulturelle Erziehung des Menschen – bereitgestellt hatte: ein Kahlschlag von Moral und Ethik, wie ihn die Menschheitsgeschichte noch nicht erlebt hatte.
Adolf Hitler ist die Inkarnation des oft in seiner Abgründigkeit nicht erkannten oder verharmlosten Phänotyps des Kleinbürgers gewesen. Er traf auf ein Volk, das »verspießert« war; ein Verschmelzen war die sozialpsychologische Folge.
»Spießer« als anthropologischer und sozialpsychologischer beziehungsweise kulturhistorischer Schlüsselbegriff steht für ein Mentalitätsmuster und für Seelenbilder, die den Niedergang und die Perversion humaner Bildung aufzeigen und im Ersterben jeder Seelenhaftigkeit enden. Als Begriff ist er insofern nicht unproblematisch, da er, häufig umgangssprachlich gebraucht, der begrifflichen Trennschärfe entbehrt, auch verniedlichend wirken mag. Als Terminus, als wissenschaftlich fundierter Fachausdruck, ist er jedoch – freilich, indem man ihn definitorisch auffächert und beschreibt – eine gute klassifikatorische Bestimmung.16
Spießbürger ist seit dem 17. Jahrhundert als Schelte für den Städter bezeugt. Er wird seit dem 19. Jahrhundert zu Spießer verkürzt und fast nur noch spöttisch und abwertend gebraucht. Vor allem im letzten Drittel des 19. Jahrhundert und im ersten Drittel des 20. Jahrhundert entdecken Autoren wie Frank Wedekind, Heinrich Mann, Carl Sternheim, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Marieluise Fleißer, Ödön von Horváth und viele andere die dämonischen Abgründe des Spießers und sehen darin vor allem die Ursache für den Untergang des bürgerlichen Zeitalters. Heinrich Mann und Ödön von Horváth sind im Besonderen Autoren, in deren Werken man Einblick ins Wesen des Spießers erhält.
Klarer als die Historiografie oder Soziologie hat etwa Heinrich Mann, eben in romanhafter Farbigkeit (also erzählend und nicht mit begrifflicher Abstraktion) das Erscheinungsbild des Spießers als Untertan gezeichnet. Bürgerliche Humanität schlägt um in bürgerlichen stiernackigen Nationalismus. Kurt Tucholsky nannte den Roman »Der Untertan« (1918) ein »Herbarium des deutschen Mannes« und einen »AnatomieAtlas des Reichs«. Die Grundlagen des Staates – »eine einflußreiche Kirche, ein handfester Säbel, strikter Gehorsam und starre Sitten« – werden mit aller Schärfe aufgedeckt.17
Der Roman schildert den unaufhaltsamen Aufstieg des getretenen Schwächlings zu kleinstädtischem Ansehen und provinzieller Macht. »Wer treten wollte, mußte sich treten lassen, das war das eherne Gesetz der Macht.« Kommt Diederich als Kind nach einer Abstrafung durch den autoritären Vater mit gedunsenem Gesicht und unter Geheul an der Werkstätte vorbei, dann lachen die Arbeiter. »Sofort aber streckte Diederich nach ihnen die Zunge aus und stampfte. Er war sich bewußt: ›Ich habe Prügel bekommen, aber von meinem Papa. Ihr wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet. Aber dafür seid ihr viel zu wenig.‹«
In Kompensation seiner Minderwertigkeitskomplexes dient sich Diederich Heßling nach oben: über die studentische Korporation in Berlin, mit dem Eintauchen in die nationalkonservative Volksstimmung, zum Fabrikherrn, Familienpatriarchen, Stadtverordneten. Seitdem er vermittels einer Bartbinde seinen Schnurbart in zwei rechten Winkeln hinaufgeführt hat, ist er auch äußerlich zum Mann gereift. Als Unternehmer weiß er, wie man die Proleten anpackt – deutsche Zucht und Sitte verlangend. Seinem Gott schuldet er immer Rechenschaft; aber solches »Wertbewusstsein« hindert ihn nicht, Profitmaximierung intensiv zu betreiben – wobei er mit Hochmut auf die Liberalen und die Juden herabschaut; der jüdische Liberalismus gilt ihm als die Vorfrucht der Sozialdemokratie, die Juden stehen für das Prinzip der Unordnung und Auflösung, des Durcheinanderwerfens, der Respektlosigkeit, des Prinzip des Bösen selbst. Als wahrhaft Deutscher ist er immer für das Gute, Schöne und Wahre zu haben; diese Trias gipfelt in der Nation. Als Popanz macht sie die Unterscheidung von Gut und Böse unwichtig. Als bei einer Demonstration ein Arbeiter erschossen wird, meint Heßling: »›Für mich‹, sagte er, schnaufend vor innerer Bewegung, ›hat der Vorgang etwas direkt Großartiges, sozusagen Majestätisches. Daß da einer, der frech wird, einfach abgeschossen werden kann, ohne Urteil, auf offener Straße! Bedenken Sie: mitten in unserem bürgerlichen Stumpfsinn kommt so was Heroisches vor! Da sieht man doch, was Macht heißt!‹« – Seine geradlinige Deutschheit kennt keine Kompromisse. In Berlin gibt er der Geliebten den Laufpass, weil sein moralisches Empfinden es ihm verbietet, ein Mädchen zu heiraten, das mir seine Reinheit nicht mit in die Ehe bringt. Die Hochzeitsnacht mit einer geldschweren Bürgerstochter steht unter nationalem Vorzeichen, auf der Hochzeitsreise folgt er den Spuren des Kaisers, der in Rom Aufenthalt genommen hat; bei jeder Gelegenheit betätigt er sichals HurraRufer.
Der Spießer idyllisiert im Lesebuchstil – der wurde von »schwarzer Pädagogik« anerzogen – seine Heimat. Diese ist vor allem die kleine saubere gesittete Kleinstadt, in der die gute deutsche Familie zu Hause ist. Dementsprechend beginnt auch Hitlers »Mein Kampf«:
Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, daß das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint!
Deutschösterreich muß wieder zurück zum großen deutschen Mutterlande, und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Nein, nein: Auch wenn diese Vereinigung, wirtschaftlich gedacht, gleichgültig, ja selbst wenn sie schädlich wäre, sie möchte dennoch stattfinden. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Das deutsche Volk besitzt so lange kein moralisches Recht zu kolonialpolitischer Tätigkeit, solange es nicht einmal seine eigenen Söhne in einen gemeinsamen Staat zu fassen vermag. Erst wenn des Reiches Grenze auch den letzten Deutschen umschließt, ohne mehr die Sicherheit seiner Ernährung bieten zu können, ersteht aus der Not des eigenen Volkes das moralische Recht zur Erwerbung fremden Grund und Bodens. Der Pflug ist dann das Schwert, und aus den Tränen des Krieges erwächst für die Nachwelt das tägliche Brot. So scheint mir dieses kleine Grenzstädtchen das Symbol einer großen Aufgabe zu sein. Allein auch noch in einer anderen Hinsicht ragt es mahnend in unsere heutige Zeit. Vor mehr als hundert Jahren hatte dieses unscheinbare Nest, als Schauplatz eines die ganze deutsche Nation ergreifenden tragischen Unglücks, den Vorzug, für immer in den Annalen wenigstens der deutschen Geschichte verewigt zu werden. In der Zeit der tiefsten Erniedrigung unseres Vaterlandes fiel dort für sein auch im Unglück heißgeliebtes Deutschland der Nürnberger Johannes Palm, bürgerlicher Buchhändler, verstockter »Nationalist« und Franzosenfeind. Hartnäckig hatte er sich geweigert, seine Mit-, besser Hauptschuldigen anzugeben. Also wie Leo Schlageter. Er wurde allerdings auch, genau wie dieser, durch einen Regierungsvertreter an Frankreich denunziert. Ein Augsburger Polizeidirektor erwarb sich diesen traurigen Ruhm und gab so das Vorbild neudeutscher Behörden im Reiche des Herrn Severing.
In diesem von den Strahlen deutschen Märtyrertums vergoldeten Innstädtchen, bayerisch dem Blute, österreichisch dem Staate nach, wohnten am Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts meine Eltern; der Vater als pflichtgetreuer Staatsbeamter, die Mutter im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan. Nur wenig haftet aus dieser Zeit noch in meiner Erinnerung, denn schon nach wenigen Jahren mußte der Vater das liebgewonnene Grenzstädtchen wieder verlassen, um innabwärts zu gehen und in Passau eine neue Stelle zu beziehen; also in Deutschland selber.18
Hier ist bereits alles enthalten, was einem in der Enge seiner freiwilligen oder aufgezwungenen Unbildung verkümmerten Kleinbürger ans Herz gehen musste: die in breiten Sentenzen heranrollende wehmütige Erinnerung an die gute alte Zeit, die Idyllik des Familienlebens, die Mutterliebe, das Vaterglück, der Sohnesdank, der Anklang patriotischer Feierlichkeit. Das Ganze ist im Stil schief, voller sentimentaler Metaphern und Klischees – einschließlich äußerlich wirkungsvoller Partizipien.19
Auch wenn Hitler wahrscheinlich Goethes Werk »Hermann und Dorothea« nicht kannte, ist das »klassische« Bild der deutschen Kleinstadt, vor allem durch dieses Epos in den Gymnasien zelebriert, präsent.20 Wie viele andere literarische Ikonen ist es freilich ins Triviale und Nationalistische uminterpretiert und damit Teil der deutschen Ideologie geworden.
Schon 1836 sprach Wolfgang Menzel deshalb von einer »Huldigung aufs Spießbürgertum«. Rezeptionsgeschichtlichhatte er damit recht: wie Schillers »Lied von der Glocke« wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts das Epos, ursprünglich bestimmt von der Intention, »unter dem modernen Kostüm die wahre, echte Menschenproportion« abzubilden, zu einem bevorzugtem Lehrstück deutschtümelnder Germanistik. Als pädagogisches Exempel sollte es vornehmlich die Schülerschaft der Gymnasien in den Ideenhimmel versetzen, der immer weniger von alles versöhnender Menschlichkeit kündete, sondern zunehmend mit nationalen und nationalistischen Symbolen ausstaffiert wurde. Aus »Hermann und Dorothea« spreche, meinte Heinrich Düntzer21, der seine »Erläuterungen zu den deutschen Klassikern« »dem deutschen Volk darbrachte«, »echt deutsche Tüchtigkeit und Innigkeit, ein schlichter, gerader, auf Recht und Billigkeit haltender Sinn, ruhige Verständlichkeit, reine Gemütlichkeit, behagliche Häuslichkeit«. Hermanns Eltern stünden für die »echt deutsche, auf Tüchtigkeit und Innigkeit beruhende Häuslichkeit«, dem Vater gehe als einem »echten Deutschen« das Herz beim Weine auf, er habe eine tüchtige, kernhafte Natur. Hermann sei aus dem »häuslichen deutschen Leben hervorgegangen«, er verkörpere »echt tüchtiges und redliches Wesen«, er beharre »fest auf dem Bestehenden, das er mit aller männlichen Kraft zu bewahren sich gerüstet fühlt; als echter ruhiger Deutscher will er nicht jener ungeheuren Bewegung, welche alles vernichtet hat, sich schwärmerisch anschließen, sondern fest auf deutschem Sinne und deutschem Boden jedem Feind zum Trotz beharren«. Der Pfarrer sei der Inbegriff der »reinen auf edler Bildung ruhenden deutschen Humanität, welche über alle Beschränkungen des Lebens erhaben, unverrückt dem Wahren und Guten zugewandt bleibt, die immer auf den Kern dringt, sich nicht vom oberflächlichen Schein täuschen läßt«. Dorothea sei eine linksrheinische Deutsche mit einem »höheren, dem Leben mit entschiedenem Bewußtsein und freiem Mut zugewandten Sinn«. In den ausführlichen Erläuterungen, die Schulrat Dr. A. Funke, Seminardirektor in Warendorf, dem für den Schulgebrauch und Privatstudium eingerichteten Epos zuteilwerden lässt, wird sogar die Frage aufgeworfen, warum die Trinkszene des ersten Gesanges einen »echt deutschen Charakter an sich trage«.
Nach der Beantwortung der Frage, warum »in der Erwähnung des Mondes, dessen Klarheit und herrlichen Schein Dorothea preist, ein deutscher Zug« hervortrete, wird schließlich im patriotischen Rundumschlag »Hermann und Dorothea« als echtdeutsches Epos definiert:
»1. Es spielt auf deutschem Boden, und zwar
a) in der Nähe des echt deutschen Rheinstromes,
b) in einem anmutigen deutschen Städtchen mit seinem geweiß-ten Kirchturm, seinen reinlichen Straßen, geraden Kanälen, dem ›Goldenen Löwen‹, der Engelapotheke usw.
2. Es spielt in einer echt deutschen Familie
a) mit ihrer Sittlichkeit und strengen Ordnung, die sich zeigt in der Verteilung der Beschäftigung (Hermann: Feld und Stallung; Vater: Gastwirtschaft; Mutter: Hauswesen) und im Gegensatz zum welschen Nachbar (dem Sitte, Zucht und Achtung vor der Ehe abgehen),
b) überhaupt alle Hauptpersonen sind Deutsche: der Löwenwirt (sorgt hausväterlich für die Stadt und die Seinen), die Wirtin (fleißig, gemütvoll, liebevoll), Hermann (Anhänglichkeit an den deutschen Boden, Zartheit seines Benehmens gegen Dorothea), Dorothea (Reinheit bei der Verteidigung der Unschuld ihrer Gespielinnen; Zurückhaltung gegen Hermann, dem sie notgedrungen ihre Liebe verrät).
3. Deutsch sind auch einzelne kleine Züge, namentlich die Trinkszene.«22
Kleinbürger Hitler hat im Lesebuchstil nicht nur seinen Geburtsort, sondern auch seine Familie idyllisiert:
Allein das Los eines österreichischen Zollbeamten hieß damals häufig »wandern«. Schon kurze Zeit später kam der Vater nach Linz und ging endlich dort auch in Pension. Freilich »Ruhe« sollte dies für den alten Herrn nicht bedeuten. Als Sohn eines armen, kleinen Häuslers hatte es ihn schon einst nicht zu Hause gelitten. Mit noch nicht einmal dreizehn Jahren schnürte der damalige kleine Junge sein Ränzlein und lief aus der Heimat, dem Waldviertel, fort. Trotz des Abratens »erfahrener« Dorfinsassen war er nach Wien gewandert, um dort ein Handwerk zu lernen. Das war in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ein bitterer Entschluß, sich mit drei Gulden Wegzehrung so auf die Straße zu machen ins Ungewisse hinein. Als der Dreizehnjährige aber siebzehn alt geworden war,hatte er seine Gesellenprüfung abgelegt, jedoch nicht die Zufriedenheit gewonnen. Eher das Gegenteil. Die lange Zeit der damaligen Not, des ewigen Elends und Jammers festigte den Entschluß, das Handwerk nun doch wieder aufzugeben, um etwas »Höheres« zu werden. Wenn einst dem armen Jungen im Dorfe der Herr Pfarrer als Inbegriff aller menschlich erreichbaren Höhe erschien, so nun in der den Gesichtskreis mächtig erweiternden Großstadt die Würde eines Staatsbeamten. Mit der ganzen Zähigkeit eines durch Not und Harm schon in halber Kindheit »alt« Gewordenen verbohrte sich der Siebzehnjährige in seinen neuen Entschluß – und wurde Beamter. Nach fast dreiundzwanzig Jahren, glaube ich, war das Ziel erreicht. Nun schien auch die Voraussetzung zu einem Gelübde erfüllt, das sich der arme Junge einst gelobt hatte, nämlich nicht eher in das liebe väterliche Dorf zurückzukehren, als bis er etwas geworden wäre.
Jetzt war das Ziel erreicht, allein aus dem Dorfe konnte sich niemand mehr des einstigen kleinen Knaben erinnern, und ihm selber war das Dorf fremd geworden.
Da er endlich als Sechsundfünfzigjähriger in den Ruhestand ging, hätte er doch diese Ruhe keinen Tag als »Nichtstuer« zu ertragen vermocht. Er kaufte in der Nähe des ober-österreichischen Marktfleckens Lambach ein Gut, bewirtschaftete es und kehrte so im Kreislauf eines langen, arbeitsreichen Lebens wieder zum Ursprung seiner Väter zurück.
In dieser Zeit bildeten sich mir wohl die ersten Ideale. Das viele Herumtollen im Freien, der weite Weg zur Schule, sowie ein besonders die Mutter manchmal mit bitterer Sorge erfüllender Umgang mit äußerst robusten Jungen, ließ mich zu allem anderen eher werden als zu einem Stubenhocker. Wenn ich mir also auch damals kaum ernstliche Gedanken über meinen einstigen Lebensberuf machte, so lag doch von vornherein meine Sympathie auf keinen Fall in der Linie des Lebenslaufes meines Vaters. Ich glaube, daß schon damals mein rednerisches Talent sich in Form mehr oder minder eindringlicher Auseinandersetzungen mit meinen Kameraden schulte. Ich war ein kleiner Rädelsführer geworden, der in der Schule leicht und damals auch sehr gut lernte, sonst aber ziemlich schwierig zu behandeln war. Da ich in meiner freien Zeit im Chorherrenstift zu Lambach Gesangsunterricht erhielt, hatte ich beste Gelegenheit, mich oft und oft am feierlichen Prunke der äußerst glanzvollen kirchlichen Feste zu berauschen. Was war natürlicher, als daß, genau so wie einst dem Vater der kleine Herr Dorfpfarrer nun mir der Herr Abt als höchst erstrebenswertes Ideal erschien. Wenigstens zeitweise war dies der Fall. Nachdem aber der Herr Vater bei seinem streitsüchtigen Jungen die rednerischen Talente aus begreiflichen Gründen nicht so zu schätzen vermochte, um aus ihnen etwas günstige Schlüsse für die Zukunft seines Sprößlings zu ziehen, konnte er natürlich auch ein Verständnis für solche Jugendgedanken nicht gewinnen. Besorgt beobachtete er wohl diesen Zwiespalt der Natur. Tatsächlich verlor sich denn auch die zeitweilige Sehnsucht nach diesem Berufe sehr bald, um nun meinem Temperamente besser entsprechenden Hoffnungen Platz zu machen.23
Nach Alan Bullock, der aufgrund umfangreicher Untersuchungen Hitlers Biografie geschrieben hat,24 war der mutmaßliche Großvater des späteren »Führers«, Johann Georg Hiedler, ein österreichischer Vagant, der 1842 die Bauerntochter Maria Anna Schicklgruber aus dem Dorf Strones heiratete. Bereits 1837 hatte sie einen unehelichen Sohn geboren (Alois), von dem freilich nicht feststeht, wer sein Vater war. Er wuchs auch nach der Heirat unter dem Namen seiner Mutter auf – und zwar im Hause Johann Nepomuk Hiedlers, Bruder des Johann Georg, der in Spital wohnte. 1877 bekam Alois Schicklgruber aufgrund der Bemühungen seines mutmaßlichen Onkels den Namen Hitler. Alois Hitler, der mit 13 Jahren das Haus seines Pflegevaters verlassen hatte, trat nach einer Schuhmacherlehre mit 18 Jahren in den Zollwachtdienst ein, 1895 ließ er sich pensionieren. – Dieser Alois Hitler hatte 1864 Anna Glasl geheiratet. Die Ehe war unglücklich und kinderlos, früh erfolgte die Trennung. Nach dem Tod der Frau schloss Hitler eine zweite Ehe mit der jungen Franziska Matzelsberger, die ihm schon vor der Heirat zwei Kinder geboren hatte und an Tuberkulose starb. Hitler heiratete ein halbes Jahr später zum dritten Mal: Klara Pölzl war 23 Jahre jünger und zudem mit Hitler direkt verwandt, sodass ein kirchlicher Dispens beschafft werden musste. Adolf war das dritte Kind dieser Ehe. Von den vier Geschwistern starben drei im Kindesalter.
Warum wuchs Alois Schicklgruber im Haus von Johann Nepomuk Hiedlers auf? »War dieser vielleicht selbst, wie manche Historiker vermuten, der Vater? Dafür könnte sprechen, dass die Initiative zur Namensänderung offenbar von Nepomuk und nicht von Alois selbst ausgegangen war. Aber warum hat er sich dann nicht als leiblicher Vater bekannt, sondern seinen Bruder, der schon lange tot war, vorgeschoben? Wollte er einen geheimen Familienskandal vertuschen? Oder ging es ihm darum, seinen Ziehsohn, auf dessen Aufstieg er stolz war, vom Makel der unehelichen Geburt zu befreien? Dagegen spricht allerdings der späte Zeitpunkt der Legalisierung, denn in all den Jahren zuvor hatte dieser Makel den beruflichen Erfolg von Alois Schicklgruber nicht behindert. Manches deutet darauf hin, dass der geschäftstüchtige Landwirt sein Erbe vor dem Zugriff des Fiskus bewahren wollte. Denn als amtlich anerkanntes Geschwisterkind musste Alois, der Haupterbe des Vermögens, eine niedrigere Erbschaftssteuer entrichten, als er es im anderen Falle hätte tun müssen.
Wie auch immer: Fest steht, dass die Identität von Adolf Hitlers Großvater väterlicherseits unsicher ist. Es entbehrt nicht der Ironie, dass der spätere Diktator, der jedem Deutschen einen Nachweis über seine ›arische Abstammung‹ abverlangte, strenggenommen diesen Nachweis selbst nicht erbringen konnte, auch wenn die offizielle Ahnentafel des ›Führers‹ einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken suchte. Es müsse ›sonderbar berühren‹, schrieb der ›Bayerische Kurier‹ am 12. März 1932, einen Tag vor dem ersten Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl, in der Hitler gegen Hindenburg antrat, dass ›der gesprächige Adolf Hitler über seine Ahnenreihe und über das Alter seines Familiennamens so schweigsam sich zeigt‹. Kurz zuvor hatte die ›Wiener Sonn- und Montagszeitung‹ in sensationeller Aufmachung enthüllt, dass Hitlers Vater eigentlich ›Schücklgruber‹ [sic!] geheißen habe und die Namensänderung wegen der Erbschaft erfolgt sei.
Gerüchte über eine mögliche jüdische Abstammung Hitlers haben sich nicht bestätigt. Sie machten bereits seit den zwanziger Jahren die Runde, und sie erhielten später scheinbar eine Beglaubigung aus zuverlässiger Quelle: In seinen vor der Hinrichtung in Nürnberg 1946 geschriebenen Erinnerungen behauptete Hans Frank, Hitlers Generalgouverneur im besetzten Polen, der Vater des Diktators sei vom jüdischen Kaufmann Frankenberger in Graz gezeugt worden, in dessen Haushalt Maria Anna Schicklgruber gearbeitet habe. Eingehende Nachforschungen haben freilich ergeben, dass eine jü-dische Familie Frankenberger zum damaligen Zeitpunkt weder in Graz noch in der gesamten Steiermark gelebt hatte. Belege dafür, dass Hitler Spekulationen über den angeblichen jüdischen Großvater ernst genommen oder sie gar als bedrohlich empfunden habe, existieren nicht.
Man könnte also die Namensmanipulation von 1876 als eine bizarre Episode auf sich beruhen lassen, wenn sie sich nicht doch für die spätere Karriere Hitlers als folgenreich erwiesen hätte. ›Keine Maßnahme seines ›alten Herrn‹ befriedigte ihn so vollkommen wie diese‹, erinnerte sich Hitlers Jugendfreund August Kubizek, denn ›Schicklgruber‹ erschien ihm so derb, zu bäurisch und außerdem zu umständlich, unpraktisch. ›Hiedler‹ war ihm zu langweilig, zu weich. Aber ›Hitler‹ hörte sich gut an und ließ sich leicht einprä-gen. In der Tat kann man bezweifeln, ob ein Mann mit dem Namen Schicklgruber sich den Deutschen als politischer Messias hätte empfehlen können. Der Gruß ›Heil Schicklgruber‹ jedenfalls hätte wohl nur erheiterte Reaktionen hervorgerufen.«25
In der Tat war »Hitler« besser geeignet – und damit werden die nachfolgenden Ausführungen dieses Buchs zusammengefasst –, als Name und Person den Inbegriff des deutschen Kleinbürgers zu verkörpern – einen Spießer par excellence, der, die Mentaltiät seines Volkes in sich tragend, zum Amokläufer (mit blindwütigem Hass) wurde.
In Hinblick auf sein typisches Deutschtum liegt es nahe, die eigenwillige Formulierung des Aufsatzes »Bruder Hitler« von Thomas Mann zu reflektieren.26 Trotz der bei diesem Dichter und Essayisten seltenen, aber bei diesem Beitrag anzutreffenden ziemlich fahrigen, wenig stringenten, ja konfusen Argumentation, die auch für den Titel zunächst zuzutreffen scheint, dürfte die Platzierung eines Unholds (»dieser Bursch ist eine Katastrophe«) in verwandtschaftliche Nähe (Bruder) ein kollektives psychohistorisches Faktum aussprechen, das zum deutsches Schicksal geworden ist: Nämlich die erschütternde Tatsache, dass der aller Aufklärung und der aus dieser entstammenden Humanität hohnsprechende Terrorist – ein Massenmörder, der Millionen Menschen auf dem Gewissen hat (eben ein Amokläufer) – in inniger deutscher Familiennähe zu sehen ist. »Ein Bruder … Ein etwas unangenehmer und beschämender Bruder; er geht einem auf die Nerven, es ist eine reichlich peinliche Verwandtschaft. Ich will trotzdem die Augen nicht davor schließen, denn: besser, aufrichtiger, heiterer und produktiver als der Haß ist das Sichwieder-Erkennen, die Bereitschaft zur Selbstvereinigung mit dem Hassenswerten, möge sie auch die moralische Gefahr mit sich bringen, das Neinsagen zu verlernen.« – Als Thomas Mann dies 1939 schrieb, konnte man die familiäre identifikatorische Gemeinschaft von Volk und »Führer«, Gesellschaft und Regime vielleicht noch »unangenehm« nennen. Die gewaltige Last der Schuld wurde dann im Krieg mit der Massenvernichtung der Juden und anderer unsäglicher Verbrechen erst voll manifest. Deutschland war Kain und Abel zugleich: Brudermord als gewaltiger Suizid. »Bruder Hitler« war der ungeheuerungeheuerliche Vollstrecker des deutschen apokalyptischen Schicksals, der Untergang jeder Moral, Sittlichkeit und Humanität.
II Seelenbild des Mädels
Der dem Volk suggerierte Status des Junggesellen Hitler machtedeutlich – wie beim katholischen Priester –, dass das Wesen des »Führers« nur vom Wohl des Volkes bestimmt war und jede Liebesstrebung allein diesem Volk galt. Aber die Wirklichkeit sah anders aus: Nicht nur, weil er ein »süßes Mädel« (Eva Braun) zur Geliebten hatte,27 die er auf dem Obersalzberg in Verborgenheit hielt, sondern weil sein Frauenbild ganz vom »Mädel«, wie es seit Beginn des 19.Jahrhunderts zur deutschen Sexualikonografie gehörte, bestimmt war:
Die Ehe kann nicht Selbstzweck sein, sondern muss dem einen großen Ziel, der Vermehrung und Erhaltung der Art und Rasse dienen. Nur das ist ihr Sinn und ihre Aufgabe. Unter diesen Voraussetzungen aber kann ihre Richtigkeit nur an der Art gemessen werden, in der sie diese Aufgabe erfüllt. Daher schon ist die frühe Heirat richtig, gibt sie doch der jungen Ehe noch jene Kraft, aus der allein ein gesunder und widerstandsfähiger Nachwuchs zu kommen vermag. Freilich ist zu ihrer Ermöglichung eine ganze Reihe von sozialen Voraussetzungen nötig, ohne die an eine frühe Verehelichung gar nicht zu denken ist. …
Es gibt nur ein heiligstes Menschenrecht, und dieses Recht ist zugleich die heiligste Verpflichtung, nämlich: zu sorgen, daß das Blut rein erhalten bleibt, um durch die Bewahrung des besten Menschentums die Möglichkeit einer edleren Entwicklung dieser Wesen zu geben. Ein völkischer Staat wird damit in erster Linie die Ehe aus dem Niveau einer dauernden Rassenschande herauszuheben haben, um ihr die Weihe jener Institution zu geben, die berufen ist, Ebenbilder des Herrn zu zeugen und nicht Mißgeburten zwischen Mensch und Affe …
Die Psyche der breiten Masse ist nicht empfänglich für alles Halbe und Schwache.
Gleich dem Weibe, dessen seelisches Empfinden weniger durch Gründe abstrakter Vernunft bestimmt wird als durch solche einer undefinierbaren, gefühlsmäßigen Sehnsucht nach ergänzender Kraft, und das sich deshalb lieber dem Starken beugt als den Schwächling beherrscht, liebt auch die Masse mehr den Herrscher als den Bittenden und fühlt sich im inneren mehr befriedigt durch eine Lehre, die keine andere neben sich duldet, als durch die Genehmigung liberaler Freiheit.28
Würde nicht die körperliche Schönheit heute völlig in den Hintergrund gedrängt durch unser laffiges Modewesen, wäre die Verführung von Hunderttausenden von Mädchen durch krummbeinige, widerwärtige Judenbankerte gar nicht möglich. Auch dies ist im Interesse der Nation, daß sich die schönsten Körper finden und so mithelfen, dem Volkstum neue Schönheit zu schenken.29
Die tief greifenden Ansätze zur Emanzipation der Frau im Gefolge der Aufklärung werden vom Spießbürgertum rückgängig gemacht. Das Rokoko wird von ihm reanimiert. Da war das Mädel zwar keck, burschikos, ziemlich freizügig, aber auch rührend naiv, verängstigt, bekümmert und somit gut zu »gebrauchen«. Der Reiz des sexuellen Abenteuers wurde dadurch erhöht: die Verführung der Unschuld galt als erotische Pikanterie. Die gesellschaftlich engagierten Dichter des Sturm und Drang haben dann mit ihren Werken – getragen von humanitärem Interesse – das Mädel aus seiner geistig verkümmerten, verdumpft häuslichen Welt in den Raum der Bildung und geistigen Mündigkeit überführen wollen; viele Dramen sind Versuche, die Möglichkeiten einer sozialen Emanzipation beziehungsweise die Gründe für den Mangel an Emanzipation aufzuzeigen. Die Romantik und Klassik sind auf diesem Wege fortgeschritten und haben in Dichtung und Wirklichkeit die geistig souveräne Frauengestalt zum Ideal erhoben. Helena und Iphigenie sind Gipfelpunkte solcher Entwicklung. Im deutschen Bewusstsein verblieb jedoch das Bild des Gretchens. Goethe war zu der Naivität eines solchen Wesens durchaus hingezogen, zugleich aber war diese Gestalt ein Protest gegen die geistige Verkümmerung der Frau, die – in Unbildung und »sauberer Häuslichkeit« festgehalten – zum leicht verführbaren Objekt gewissenloser Kavaliere wurde. Der Prototyp des Mädels im 19. Jahrhundert ist das »saubere Mädel« (Gretchen) in einem »sauberen Stübchen « mit einem »schneeweißen Bettchen«, vor dem Faust »heiliger Wonnegraus« erfasst. »Gretchens Seele«, meinte Heinrich Düntzer, »erschließt sich dem geliebten Manne in aller Herzensgüte, Reinheit und Unschuld, ihre Liebe ist gleichsam der Duft aller ihrer Tugenden. «30 Sie war nun nicht mehr Objekt des Mitleids, aus dem sich die Impulse für eine gesellschaftliche Umwandlung hätten ergeben können, sondern Objekt »reiner Verehrung«: ein Jahrhundert der sorgsamen Gattinnen, treuen Mütter, frommen und keuschen Töchter (wie sie zum Grundsatzprogramm der meisten Zeitschriften gehörten) brach an, ein Jahrhundert der Keuschheitsideologie, die nicht die Reinheit als solche hoch schätzte, sondern die Reinheit des »Mädels«, die der Mann »genoss«. Dementsprechend war die Ehe Patriarchat: Gretchen nun unter der Haube. Über Dichtungen, in denen die Ebenbürtigkeit der Frau, der Partnerschaftsgedanke, das geistige Miteinander oder auch Gegeneinander (auf gleicher Ebene) dargestellt wurden, ging man hinweg; die »Wahlverwandtschaften«, der »Wilhelm Meister« oder die »Iphigenie« konnten so nie zu Hausbüchern der deutschen Seele werden. Dort, wo die Dinge nicht so ganz »eindeutig« lagen, bemühte man sich eifrig um Uminterpretation: besonders die »Glocke« hat dieses Schicksal erlitten und eben »Hermann und Dorothea«.
In »Hermann und Dorothea« verehrte man die streng patriarchalische Ordnung des Hauswesens. Kummer bereitete die Tatsache, dass Dorothea schon einmal verlobt gewesen war – also nicht mehr das naiv süße »Mädel« sein konnte, das man sich als Frau eines deutschen Hermann wünschte. Immerhin ist sie »sauber« gekleidet. »Aber ich geb euch noch die Zeichen der reinlichen Kleider: / Denn der rote Latz erhebt den gewölbeten Busen, / Schön geschnürt, und es liegt das schwarze Mieder ihr knapp an; / Sauber hat sie den Saum des Hemdes zur Krause gefaltet, / Die ihr das Kinn umgibt, das runde, mit reinlicher Anmut; / Frei und heiter zeigt sich des Kopfes zierliches Eirund; / Stark sind vielmal die Zöpfe um silberne Nadeln gewickelt; / Vielgefaltet und blau fängt unter dem Latze der Rock an / Und umschlägt ihr im Gehn die wohlgebildeten Knöchel.«31 – Auch sprach Dorothea die der herrschenden Gesellschaftsform angemessenen Sätze vom Dienen als Aufgabe des Weibes. In »Hermann und Dorothea« fanden sich jedoch an entscheidender Stelle Gedanken, die der »Mädel-Ideologie« zutiefst entgegengesetzt waren; sie wurden freilich selten erkannt; man versuchte sie dem Mädel-Keuschheitsideal zu subsumieren, obwohl aus ihnen die gegenseitige Achtung sprach: die Würde der Frau und die Würde des Mannes. Als im Mondlicht auf dem Heimweg Dorothea »unkundig des Steigs und der roheren Stufen« zu fallen droht, streckt gewandt der »sinnige Jüngling« den Arm aus: »Hielt empor die Geliebte; sie sank ihm leis auf die Schulter, / Brust war gesenkt an Brust und Wang’ an Wange. So stand er, / Starr wie ein Marmorbild, vom ernsten Willen gebändigt, / Drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. / Und so fühlt’ er die herrliche Last, die Wärme des Herzens / Und den Balsam des Atems, an seinen Lippen verhauchet, / Trug mit Mannesgefühl die Heldengröße des Weibes.«32
Die Mädelgenerationen fielen in die nervigen, festen Arme ihrer Geliebten, die sie an die breite, hochgewölbte Brust ihrer kräftigen Mannesgestalt »unbändig« drückten. Als holdselige Geschöpfe, deren Reize man mit glühenden Blicken verschlang, als Mädel mit dem Liliensammet der Wangen, den Schwanenhänden, dem Lilienbusen, dem lockigen Haar mit den flatternden Bändern, der freudetrunkenen Seele mit dem Gott der Träume darinnen, waren sie in stummem Entzücken ihm ganz hingegeben.
Das Mädchen- und Frauenbild des Biedermeier33 stand bereits an der Grenze zwischen verinnerlichter Idyllik wie Wahrhaftigkeit und kitschiger Süße und betulicher Verstiegenheit. »Edles, deutsches, frommes Gesicht, tiefblaue Augen mit unbeschreiblichem Liebreiz der Brauen, besonders aber ist die Stirne kindlich frommgütig und doch so geistig« – so beschreibt Nikolaus Lenau sein Idol. Heinrich Heine charakterisierte den biedermeierlichen Frauentyp mit den Worten: »Du bist wie eine Blume / so hold und schön und rein.« Die Werbung traf das Mädchen beschämt und verschämt an. »Ich habe eine innige Sehnsucht, es immer wieder von Dir zu hören, daß Du mich liebst – liebst im ganzen Umfange des Wortes –, denn ich kann es immer noch nicht fassen, Du Herrlicher und ich Armselige «, schrieb die Braut Friedrich Schleiermachers an den Verlobten. Nachtigallen singen, Rosen springen auf – in »Hall und Widerhall « – wenn die Liebe das Mädel ergreift: »Sie war dich sonst ein wildes Blut; / nun geht sie tief in Sinnen, / trägt in der Hand den Sommerhut / und duldet still der Sonne Glut / und weiß nicht, was beginnen.« (Theodor Storm)
Bei der Eheschließung wanden die Freundinnen der Braut den »Jungfernkranz« und ein Stück Leben ging zu Ende, ein neues, das wichtigste, begann. All das war nicht ohne Poesie, oft Zeugnis unverfälschter romantischer Verklärung. Die Ehen waren glücklich oder nicht glücklich, je nachdem, ob die gefühlsinnigen Worte wahre Gefühle wiedergaben oder nur die Metaphern des Briefstellers und ob sie nach der Heirat noch beachtet wurden. Die Realität (die gerade Schiller in seiner »Glocke« ansprach) blieb in dieser Vorstellungswelt ausgeklammert. Als dann die Wirklichkeit des Lebens begann, zeigten diese sphärischen Naturen oft viel Tapferkeit.
Das politische Verhängnis setzte ein, als die wirklichkeitsfremde Idealisierung der Frau als Fassade beibehalten, dem nationalen Leitbildkatalog eingefügt wurde und der Mädelkult schließlich politische Brutalität mit abdecken half. Zwar hatte schon zu allen Zeiten eine unausgegorene, nicht oder noch nicht bewältigte Pubertät die Dichter und Sänger ästhetisch unerträgliche Liebeslieder leiern lassen. Politisch gefährlich wurde dieser schlechte Geschmack, als er das Bild der deutschen Frau nach seinen Vorstellungen prägen wollte. Die literarischen Jugendsünden Goethes mit seinem Mädelgeflüster waren etwas anderes als die Lieder Theodor Körners.
Wenn dieser seine »süße Braut« andichtete, so war dies – zumindest nach dem Urteil seiner späteren Interpreten – der Gesang eines vaterländischen Helden und Götterjünglings an sein deutsches Mädel. Wenn Adelbert von Chamisso das poetische Liebesleben des Mädel ausbreitete – »Ich werd ihm dienen, ihm leben / ihm angehören ganz, / hin selber mich geben und finden / verklärt mich in seinem Glanz; / du Ring an meinem Finger? / mein goldenes Ringelein, / ich drücke dich fromm an die Lippen, / dich fromm an das Herze mein« –, so war diese lyrische Emanation gewissermaßen ästhetische Privatsache. Als diese Strophen jedoch über die »Gartenlaube« ins gesamtdeutsche Gemüt eingingen, ließen sie das Herz des deutschen Mannes ideologisch höher schlagen. So denkt und fühlt ein deutsches Mädel, eine deutsche Frau – sagte sich der Untertan-Spießer und forderte bedingungslose Hingabe von seiner Anverlobten.
Die »Gartenlaube«34 war überhaupt an der Entwürdigung und Verdummung der deutschen Frau maßgeblich beteiligt. Als Familienzeitschrift für das deutsche Haus und die deutsche Familie schob sie auf scheinbar unpolitische Weise (durch die Hintertür des Gemüts) Schritt um Schritt soziale und ethische Fehlvorstellungen ins deutsche Bewusstsein.
In der »Gartenlaube« und anderer Trivialliteratur verstärkte sich mit jedem Jahre der bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts erkennbare ästhetische Schmelz, mit dem Mädel und Frau glasiert wurden. Heiße süße Freude durchschauerte die Vogelherzchen, wenn man küsste und halste, wenn die Hände des Geliebten (immer noch keusch) dem Bau des Rückens, »der wunderbaren Linie von der Armhöhle über die sanftgeschwungene Hüfte« herunter folgten. Diese deutschen Mädel und Jünglinge schritten Hand in Hand durch Parkanlagen, saßen in Lauben, wandelten über Bergeshöhen. »Es winkte von spaltiger Felsenwand / ein Alpenröslein im Moose / ich habe es gepflückt / und damit geschmückt / die allerschönste Rose.« Dem holden Mädel, das vor kurzem noch ein Kind war, erging es wie der Knospe, von welcher der Dichter sang. Mit 18 Jahren steht es in seiner Maiden Maienblüte: »Die Welt steht in Blüten, der Himmel hängt voll von Rosenkränzen, alles, alles ringsumher im Festtagskleide – 18 Jahre! Wie die Augen neugierig sinnend zu fragen scheinen, was wohl das neue Lebensjahr bringen möge! O gewiß nur einen ganzen Berg voll lauter Schönem! Wie könnt’ es anders sein. In einem jungen Mädchenherzen, wenn’s richtig damit bestellt ist, ist’s ja wie im Himmel, und die Engel musizieren eines auf mit Flöten und Schalmeien, daß es eitel Lust und Jubel ist, und aus den Augen guckt ein kleiner lustiger Kobold, und in den Grübchen der vollen roten Wangen, da huscht ein anderer neckischer Kobold aus und ein und spielt mit dem Kameraden, der oben hereinguckt, Versteck.«35 Der Geliebte legt »seine Hände / betend auf das schöne Haupt« der Geliebten. Unzählige Mädchengebete und Liebesglückrhapsodien dieser Art wurden verbreitet; als nationales Sammelbecken solcher Triviallyrik erwies sich das deutsche Kommersbuch. »Mädel und Schätzel und dergleichen stand jetzt poesiefertigt dem allgemeinen Gebrauch zur Verfügung, und als Museion solchen Treibens darf man vielleicht die ›altdeutsche Bierstube‹ um 1900 ansprechen.«36 Eine Freundin der Musik solle die Zukünftige sein, hieß es in den Klischee-Heiratsanzeigen, Sehnsucht nach Goethe und Schiller und Rückert empfinden, dem Schönen aufgetan sein, Bismarck verehren, aus ebenbürtiger Familie stammen, die entsprechenden »Sachen « besitzen, Hellblondine bevorzugt, in der Kochkunst perfekt, am Familienglück interessiert, zu legitimer Wollust verwertbar, deutsche Gesinnung. Die Literatur der Jahrhundertwende und der nachfolgenden Jahrzehnte hat die Fassadenwelt und Puppenwelt der Plüschära entlarvt. Sigmund Freuds Schriften zeigen die Anatomie dieser Gesellschaft mit ihren verborgenen Trieben und gekappten Lüsten. Die Kruste der Zivilisation hielt der verdrängten Triebgewalt, die keine Sublimierung erfuhr, kaum mehr stand. Dort, wo sie durchbrach, maskierte sie sich jedoch sofort wieder. Die Romantik des »süßen Mädel« war teilweise zu »eng«, um den »gro-ßen Lebensrausch«, die »große Begierde« einfangen zu können. Die Sinnenglut auf Plüsch fand Ventile im Ästhetizismus, im Exotismus, im Kult des Übermenschen. Parnass wie Montmartre, der Spießer kokettiert mit der Halb- und Lebewelt, Pläsier im Schein roter Laternen. Aber danach zieht es ihn wieder ins »Allerheiligste«, ins eheliche Schlafzimmer, zum Eheglück zurück. Der Venus von Milo im Butzenscheibenschimmer (Kopien der Statue waren ein beliebtes Repräsentationsstück der bürgerlichen Wohnungseinrichtung) entsprach im literarsoziologisch maßgebenden Schrifttum und in der »offiziellen« bildenden Kunst ein eigentümlich vertrackter Stil: eine Mischung von kleinbürgerlicher Muffigkeit und renaissancehaftem Schönheitsrausch – Gretchen und Lucrezia Borgia, Scheffel und Boccaccio zusammengemischt. »Das Weib«, so philosophierte Richard Wagner, »bekommt volle Individualität erst im Moment der Hingebung; es ist das Wellenmädchen, das seelenlos durch die Wogen seines Elementes dahinrauscht, bis es durch die Liebe eines Mannes erst die Seele empfängt«.37 Hinter dem Tristanwahn verbarg sich rohe Sexualität, so wie in Wagners Biografie Seelenharmonie zum Alibi für Ehebruch wurde. Was für Wagner der Mythus germanischer Gottheiten, war für Wilhelm Bölsche die Mystik der Zelle. Wie jener die ekstatischen Paarungen seiner Götter und Helden bedichtet, so dieser das Liebesspiel der Ichthyosaurier, die Liebe der Mammute, die Urgeschichte des Wurms, die Liebesphilosophie des Bandwurms, den Tristanrausch der Insekten. Das sprudelt, orgelt und »orgastelt« dahin – man weiß nicht, handelt es sich beim »Opfertod einer Mutter« um eine völkische Heldin oder einen Einzeller, beim »neuen Lied« um das Ineinanderwallen rassegleicher Menschen oder um das Liebesmärchen der Bienen (nicht des Kopfbandwurms, denn diesem »ist die hohe Liebe verschlossen, ohne du und du«).38
Wie in einem Brennspiegel – und das beweist in ganz besonderem Maße die Fähigkeit deutscher belletristischer Literatur, faschistische beziehungsweise faschistoide Strömungen in Form narrativer Werke aufzuzeigen – vereinigt Ödön von Horváths Drama »Geschichten aus dem Wiener Wald« die Verhaltensweisen der patriarchalischen Geschlechterverhältnisse, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hatten, mit den daraus sich entwickelnden autoritären, vom herrischen Mann dominierten sexuellen Beziehungsstrukturen, die dann die nationalsozialistischen Gesellschaftsstrukturen bestimmten. Es ist ein Werk tief greifender historischer, sozialpathologischer Analyse und Antizipation des totalitären bürgerlichen Pandämonismus.39
»Dann komm«, sagt Oskar am Ende des Dramas. »Er stützt sie, gibt ihr einen Kuß auf den Mund und langsam ab mit ihr und in der Luft ist ein Klingen und Singen, als spielte ein himmlisches Streichorchester die ›Geschichten aus dem Wiener Wald‹ von Johann Strauß. « Sicherlich einer der deprimierendsten Dramenabschlüsse der Weltliteratur; ein Mädel wird lebendigen Leibes eingesargt im trauten Heim. Der zukünftige Paterfamilias nimmt die Verlobte in seine Arme; er stützt sie, bald wird er sie mit Liebesbanden fesseln; da gibt es kein Entrinnen mehr. Der Kuss auf den Mund – Beginn von Vergewaltigung. Ab mit ihr – hinab in den Orkus der Geborgenheit. Der zukünftige Gebieter wird dafür sorgen, dass das Mä-del nicht mehr auf- beziehungsweise hochkommt. Das » Klingen und Singen« in der Luft intoniert, was – so kann man vermuten – das sentimentalerotische Bild über den breiten Ehebetten mit den dicken Zudecken und den Paradekissen im zukünftigen »Allerheiligsten«, dem Schlafzimmer, visualisiert: ein Panorama des Höheren, das den männlichen Trieben, durch eheliche Pflichten sanktioniert, zur transzendierenden Weihe verhilft. Nun kann das Mädel ihrem Gemahl Kind um Kind gebären, bis sie, ausgelaugt und nicht einmal der Vorspiegelung von Sinnlichkeit mehr fähig, in ehelicher Gleichgültigkeit versinkt. Für ihn bleibt: der Seitensprung.
Marianne, denn so heißt das süße Mädel, das längst Frau ist: »Ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr –. « Oskar: »Dann komm. « Die Eskapade mit dem leichtsinnigen Alfred ist zu Ende. Jungfräulich hätte Oskar sie gewollt; auf Zeit war sie ihm entkommen; nun nimmt er sie auch so noch. Ein höheres Geschick hat dafür gesorgt, dass die Störung der ursprünglichen Partnerbeziehung wieder rückgängig gemacht, Marianne zum » Ehemaligen«, nun ihr »Zukünftiger«, zurückgekehrt ist; ihr uneheliches Kind ist verstorben; die Großmutter hat sich als »Engelmacherin« betätigt.
Beinahe wäre die vorgegebene Ordnung auseinandergebrochen: Das Mädel, Tochter eines autoritären Vaters, der über sie wie über ein Stück Eigentum verfügen will, ist ausgebrochen; den Metzger Oskar mag sie nicht heiraten. Alfred, der windige Galan, bringt sie auf die schiefe Bahn, die in einem Bumskabarett bei Nacktszenen endet. »Die ›Träumerei‹ von Schumann erklingt und der Vorhang teilt sich […] – eine Gruppe nackter Mädchen, die sich gegenseitig niedertreten, versucht einer goldenen Kugel nachzurennen, auf welcher das Glück auf einem Bein steht – das Glück ist ebenfalls unbekleidet und heißt Marianne. «
Wenn Emanzipation scheitert, ist die spießbürgerliche Theodizee wieder eingerenkt. Der Determinismus bourgeoiser Moral funktioniert, das Mädel muss dem Mann, der sie will, gehören, sie darf seiner Liebe nicht entgehen.
Die banalen Sprechtakte des Dramas sind Teile einer Partitur, die »SpießerIdeologie« heißt. Im Überbau hochgemute Romantik, weiter drunten Triebdynamik; amalgamiert ist das Ganze durch Bewusstlosigkeit; Horváth spricht von Dummheit: die individual- wie sozialpsychologische Unfähigkeit, sich selbst erkennen, geschweige denn Gerichtstag über sich selbst halten zu können. »Wahrlich«, heißt es bei Nietzsche, »ihr könntet gar keine bessere Maske tragen, ihr Gegenwärtigen, als euer eigenes Gesicht ist! Wer könnte euch – erkennen! Vollgeschrieben mit den Zeichen der Vergangenheit, und auch diese Zeichen überpinselt mit neuen Zeichen: also habt ihr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern. Und wenn man auch Nierenprüfer ist: wer glaubt wohl noch, daß ihr Nieren habt? Aus Farben scheint ihr gebacken und aus geleimten Zetteln. «40
Das Personenarsenal der »Geschichten aus dem Wiener Wald« illustriert sozusagen die »Vorhölle« des »Reichs der niederen Dä-monen«. Mit Ausnahme von Erich, dem Gast aus Deutschland, der eine eindeutige rassistische Einstellung hat und zackiges deutschnationales Preußentum verkörpert, ist die Unmenschlichkeit oder lädierte Menschlichkeit der Hauptakteure noch weitgehend auf den privaten Bereich beschränkt. Die Nationalsozialisten verstanden es, die Rieselfelder abgesunkenen Seelenlebens dem nationalen Aufbruch zu erschließen. »Der Polizeiagent, der Falschspieler, der Lügner, der Defraudant, der Hochstapler, der Geldschrankknacker, der schwere Junge, der Ordensschwindler, der Abenteurer, der Quacksalber, der Sektierer, der kitschige Gemütsathlet, der [Schmieren-] Schauspieler, der Schwätzer und Folterknecht, der Bauchaufschlitzer – das ist die Personage des Dritten Reiches. «41