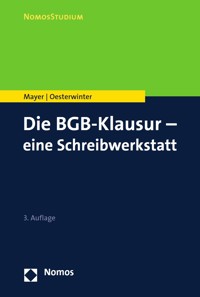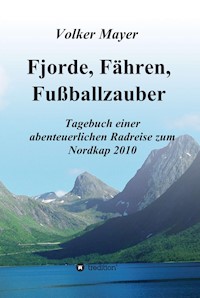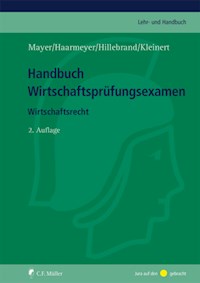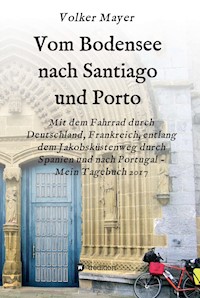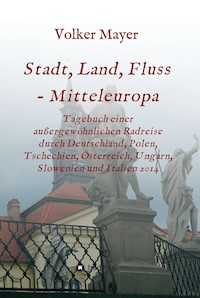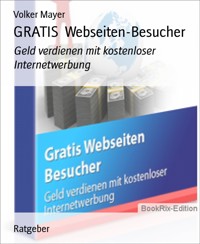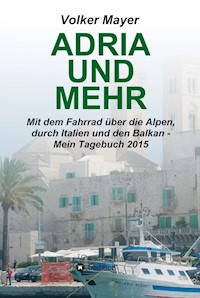
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Stillstand ist nichts für den Autor, der 2003 aus dem Berufsleben ausgeschieden ist und seither in jedem Sommer eine Große Radtour unternimmt, bei der er von der Pfalz aus meist zu einem Ende Europas und zurück radelt. Sie ist für ihn alles, Herausforderung, Selbstbestätigung, Freiheit, Stillen seiner Neugier auf Neues, körperliche Ertüchtigung und Entschleunigung des Alterungsprozesses. 2015 fährt er entlang der Via Claudia Augusta über die Alpen, am Po zur Adria und an der gesamten Küste entlang bis Brindisi an der Südspitze Italiens. Großartige Städte liegen auf seiner Route nach Süden wie Augsburg, Verona, Ravenna und Polignano. Besonders spannend ist die Rückfahrt auf einer zentralen Route durch den Balkan, auf der er die Hauptstädte Podgorica, Sarajevo und Zagreb besucht. Sein Buch ist ein informativer Reisebericht und wirft ein Licht auf den Zustand Europas im Spannungsfeld zwischen Ost und West.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Mayer
Adria und mehr
Mit dem Fahrrad über die Alpen, durchItalien und den Balkan –Mein Tagebuch 2015
© 2016 Volker Mayer
Umschlag: tredition/Volker Mayer
Bilder: Volker Mayer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-6523-6
Hardcover
978-3-7345-6524-3
e-Book
978-3-7345-6525-0
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
In dankbarem Gedenken meines Bruder Dieter, der mich mit seiner Frau Brigitte am dritten Tag meiner Tour so warmherzig empfing, während der Bearbeitung dieses Buches schwer erkrankte und noch vor seiner Fertigstellung von uns ging.
Dieter Mayer 04. 04. 1942 – 07. 09. 2016
Über den Autor:
Der Autor ist Jahrgang 1943, lebt in Landau in der Pfalz sowie in Mühlbach am Hochkönig in Österreich. Nach Ende seiner Berufstätigkeit als Experte der Abwasserwirtschaft und leitenden Tätigkeiten im Beratenden Ingenieurwesen und im Anlagenbau hat er sich vorgenommen, die Welt in individuellen Reisen kennenzulernen. Dabei durchquert er im Sommer mit Touren über 3.500 bis 7.000 km den europäischen Kontinent mit dem Fahrrad, und im Winter besucht er die wärmeren Länder im Süden unserer Erde mit Flugzeug, Zug und Bus. Dazu kommen Einsätze als ehrenamtlicher Experte für den Senioren-Experten-Service, Bonn, in China, Honduras, Bulgarien und Mexiko. Seine Erlebnisse möchte er gerne mit Interessierten teilen, hält sie minutiös in Tagebüchern fest und verfasst jeweils nach seiner Rückkehr Bücher. Über seine Radtour 2015 legt er seine zweite Buchveröffentlichung vor.
Über die Tour:
Bei seinen seit 2003 jährlich unternommenen Großen Radtouren hat sich der Autor das Ziel gesetzt, jeweils ein Ende Europas von der Pfalz aus mit dem Fahrrad zu erreichen. Dafür steht jeweils ein Zeitfenster zwischen Mitte Juni und Ende August zur Verfügung, da im Mai und September die Tage kürzer und die Nächte oft zu kühl für Camping sind. Im Jahr 2015 überwindet er seine Furcht vor den Alpen und konzentriert sich auf den Fernradweg „Via Claudia Augusta“, der am Lech entlang, über den Fern- und Reschenpass nach Italien führt und am Po endet. Getreu seinem Motto radelt er bis Brindisi an der Südspitze Italiens und kehrt auf einer Route durch den zentralen Balkan nach Mitteleuropa zurück, um die ihm bislang unbekannten Hauptstädte Podgorica, Sarajevo und Zagreb zu besuchen. Schließlich fährt er auf dem Donauradweg sowie entlang des Kochers und des Neckars nach Hause in die Pfalz.
Inhalt
I.Vorbemerkungen zum Frühjahr
II.Durch den Süden von Deutschland und über die Alpen
III.Am Po und an der Adria entlang nach Brindisi
IV.Durch den wilden Balkan
V.Auf Flussradwegen zurück in die Pfalz
VI.Nachbetrachtungen zum Herbst
Tourübersicht 2015
Danksagung, Quellenverzeichnis, Bildnachweise
I. Vorbemerkungen zum Frühjahr
Verklärt romantisch sind meine Erinnerungen an die letzten Jahre. Teils abenteuerliche Reisen und Radtouren bestimmten meine Jahresabläufe mit Eindrücken, die schon fast zu vielfältig und kaum noch zu verarbeiten sind. Die schönen Erlebnisse glänzen im Rückblick und verlangen nach einer Fortsetzung. Die Qualen, Pannen und Gefahrenmomente sind verblasst und können meinen Tatendrang kaum mehr dämpfen. Und doch sind sie im Unterbewusstsein gespeichert und bestimmen das, was man Erfahrung nennt. Immerhin bewältigte ich die letzten drei Radtouren über zusammen etwa 13.000 km ohne jede Panne und die letzte zudem ohne Sturz, und noch verfüge ich über die Frische und Disziplin, sie in literarischen Tagebüchern aufzuarbeiten, während meine nicht weniger spannenden Winterreisen im Archiv dämmern und vergeblich darauf warten.
Nach der Silvesternacht zusammen mit langjährigen Freunden im Schwäbischen beginnt das Neue Jahr 2015, das nicht weniger aufregend verlaufen soll als die letzten. Viel mehr als meine Befindlichkeit bedrückt mich die rationale Erkenntnis, dass ich wieder ein Jahr älter geworden und im 73. Lebensjahr bin. Kann ich erneut eine Radtour wagen wie in den letzten zwölf Jahren, die mich meist jeweils von Landau aus an ein Ende Europas geführt hat? Kann ich meinem Körper erneut eine Strecke wie nach Istanbul (2007), nach Estland (2008), zum Nordkap (2010), nach Sagres/Portugal (2011), auf die Halbinsel Krim (2012) oder nach Inverness/Schottland (2013) zumuten? Zum Glück ist diese Frage nicht am Beginn des Jahres zu beantworten, da erst die nunmehr seit Jahren eingespielten Rituale abzuarbeiten sind.
Schon am dritten Tag des Jahres fliege ich zur Verkürzung des Winters über Dubai nach Kuala Lumpur, um Malaysia kennenzulernen. Hier besuche ich nach der Hauptstadt die Insel Penang mit Georgetown, die alte Piratenstadt Melakka mit ihren portugiesischen, holländischen und englischen Wurzeln, die Cameron Highlands mit den zauberhaften Teeplantagen, bereise Ostmalaysia auf der Insel Borneo mit seinen Naturparks und Orang-Utan-Reservaten, das rätselhafte Emirat Brunei, die vor Finanzkraft explodierende Weltmetropole Singapur und verlebe schließlich auf der reichlich unberührten Insel Tioman vor der Ostküste der malayischen Halbinsel sehr entspannte Urlaubstage. Ich nehme ein Schwellenland mit gutem Entwicklungsstand und fortschrittlicher Infrastruktur wahr, mit ordentlichen demokratischen Verhältnissen und einem angenehm gemäßigten Islam, von dem ich überzeugt bin, dass er im Sinne einer globalen Aussöhnung Vorbildcharakter haben kann.
Auch eine Skifreizeit in Mühlbach am Hochkönig gehört zu meinen Ritualen im Frühjahr. Einmal mehr bin ich begeistert von der Qualität der Pisten und der herrlichen Berglandschaft. Auffällig erscheint mir zudem die sprunghaft verbesserte Gastronomie am Berg. Wenn auf der Tiergartenalm die Sonne scheint, Azurblau das Weiß krönt, und ich mich mit einem Weißbier in einen knautschigen Sessel flegeln kann, dann ist die Welt in Ordnung, und ich bedauere, dass all dies endlich ist. Der als Abenteuer unverdächtige Wohlfühlurlaub mit Lebenspartnerin führt mich nach Portugal an die Atlantikküste bei Sao Pedro de Moël. 2012 bin ich an dieser wildromantischen Küste entlang bis zur Südwestspitze von Portugal bei Sagres geradelt. Die Erinnerung an diese fantastische Landschaft, die Besuche historischer Stätten wie Alcobaça, Batalha, Obidos, Coimbra und Nazaré wird meinen Rückblick auf das Jahr sicherlich bereichern.
Nicht nur meine persönlichen Rituale des Frühjahrs sind erwähnenswert. Die Gewissheit, dass wir Zeitzeugen eines fortschreitenden, unaufhaltsamen Wandels sind, veranlasst mich, meinen Reisebericht in das Zeitgeschehen einzubetten. Nachrichten sind meine Wegbegleiter und stehen im Kontext mit meinen Erlebnissen. Die traurigen Meldungen dieses Frühjahrs sind der Tod von Udo Lattek mit 80 und der Selbstmord des beliebten Wettermoderators Ben Wettervogel. Der großartige, visionäre Stuttgarter Architekt Frei Otto stirbt mit 89 Jahren, der unvergessliche Altbundespräsident Richard von Weizsäcker mit 94 Jahren. Helmut Dietl, genialer Regisseur, ist bereits einige Zeit von seiner schweren Krankheit gezeichnet, als er mit 73 stirbt. Seine Krebserkrankung überlebt Percy Sledge (74) nicht. Das „gute Gewissen“ Deutschlands und der leicht durch seine braune Jugend belastete Literaturnobelpreisträger Günter Grass stirbt mit 87 in Lübeck. Kurz bevor ich in meine Große Radtour starte versterben der großartige „Happy-Sound“- Erfinder James Last mit 86 und Pierre Brice („Winnetou“) mit 87.
Das Neue Jahr ist kaum eine Woche alt, als Europa durch das Attentat auf die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris aufgerüttelt wird. Später erschüttert ein Terroranschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit 21 Toten die hoffnungsvolle, junge Demokratie von Tunesien. Ein Anschlag der somalischen Al Shabab-Miliz auf ein Studentenheim in Nairobi und gezielt auf Christen fordert 147 Tote.
In der Luftfahrt geschieht tatsächlich, was man bislang nicht für möglich gehalten hatte: Ein unter Depressionen leidender Copilot bringt eine Maschine der „Germanwings“ in voller Absicht zum Absturz und tötet sich sowie 149 Menschen an Bord. Ein verheerendes Erdbeben zerstört weite Bereiche Nepals. Die Zahl der Toten steigt auf über 8.000.
In der Ostukraine schwelt der Konflikt weiter, Waffenstillstandsvereinbarungen werden zunächst ignoriert, erst im Februar blinkt Hoffnung auf, als die schweren Waffen auf beiden Seiten abgezogen werden. Alle Bemühungen um die Rettung Griechenlands scheinen vergebens, als die Linke dort die Parlamentswahlen gewinnt und der neue Ministerpräsident Tsipras unvermittelt seinen Konfrontationskurs startet.
Der Bürgerkrieg in Syrien geht ungebremst weiter. Der selbsternannte „Islamische Staat“ (IS) breitet sich in Syrien und im Irak aus und gewinnt weiter an Einfluss. Die Flüchtlingskatastrophe mit Hunderten ertrunkener Menschen spielt sich weit weg von Deutschland im Mittelmeer ab. Noch sind wir alle der Meinung, dass hier das Dublin-Abkommen gilt und die Länder Italien und Griechenland als Ankunftsländer damit fast allein fertig werden müssen. Wir helfen nicht oder nur halbherzig und finden das alle in Ordnung.
Obwohl am Vortag sechs Funktionäre der FIFA wegen Korruptionsverdachts verhaftet werden, lässt sich Sepp Blatter als Präsident wiederwählen, um wenige Tage später als Unschuldslamm zurückzutreten. Wer Deutscher Fußballmeister wird, muss dem Fan kaum erklärt werden. Zu mächtig ist inzwischen das Budget der Bayern aus München. Gleichwohl sind sie im Halbfinale der Championsleague gegen den FC Barcelona chancenlos. Der Fan des VfB-Stuttgart durchleidet im Frühjahr 2015 Höllenqualen nach einer völlig missratenden Saison. Mit viel Mühe und Dusel vermeidet er den Abstieg durch Siege in den letzten drei Spielen. Ein Tor weniger am Ende hätte das Undenkbare zur Folge gehabt, den Abstieg in die zweite Liga. Man will eine neue Zukunft beim Verein gestalten, und ein neuer Name taucht als Hoffnungsträger auf: Zorniger.
Nach der Rückkehr aus Portugal und dem Ende der Bundesligasaison wird es Zeit, meine Große Radtour ins Visier zu nehmen. Allein, mein körperlicher Zustand ist desolat. Auf fast 90 kg hat sich mein Körpergewicht unter anderem durch meine unverminderte Lust auf Süßes erhöht. Meine Trainingsfahrten sind ernüchternd. So schlecht vorbereitet war ich seit sechs Jahren nicht mehr. Gleichwohl, die Große Radtour ist für mich alles, Herausforderung, Selbstbestätigung, Stillen meiner Neugier auf Neues, Freiheit, körperliche Ertüchtigung und Entschleunigung des Alterungsprozesses. Zudem muss ich unbedingt einige Kilogramm abnehmen.
Trotz des Ehrgeizes: Nachdem ich in den letzten Jahren Europa von Landau aus in allen Himmelsrichtungen erforscht habe, fällt es mir schwer, neue Ziele zu definieren. Dabei fallen mir die wundersamen Augenblicke ein, als ich im letzten Jahr aus Slowenien kommend in Italien eingetroffen bin. Es war wie die Heimkehr in eine vertraute Kultur im ziemlich zuverlässig warmen Wetter mit einem Defilee durch wunderbare historische Städte voller verspielter Architektur. Wegen der hohen Lebenshaltungskosten, aber auch wegen der Alpenquerung habe ich bislang Italien gemieden. Jetzt nehme ich allen Mut zusammen, recherchiere unter anderem bei Speidel/Maccallini, denke, wenn es die Schauspieler geschafft haben, werde ich das auch schaffen, und fixiere mich auf den Fernradweg „Via Claudia Augusta“, der am Lech entlang, über den Fern- und Reschenpass nach Italien führt und am Po endet. Da mein Ehrgeiz damit noch nicht gestillt ist, nehme ich mir einige historische Städte in Norditalien vor und dann die Fahrt an der gesamten italienischen Adria entlang von Ravenna bis Brindisi, wo ich meine, dass die Berge nicht so hoch sind wie auf der anderen Seite. Weil sie vergleichsweise unbekannt sind, beziehe ich gerne osteuropäische Städte in meine Touren ein und beschließe, zentral durch den Balkan zurück zu radeln, um die mir bislang fremden Landeshauptstädte Podgorica, Sarajevo und Zagreb zu besuchen. Auf eine genaue Rückfahrtroute will ich mich vor der Tour wegen der sehr anspruchsvollen Topografie auf der Balkanhalbinsel nicht festlegen. Mut macht mir, dass ich von Sarajevo nach Zagreb und weiter nach Ljubljana ohne Berge durch die Täler der Bosna und Sava radeln kann.
Ein weiteres Problem ist die Route durch Süddeutschland wegen der dortigen Mittelgebirge, die ich bislang stets gemieden habe. Aber auch hier finde ich eine Lösung, die mich ganz und gar begeistern wird, die Täler des Neckars, der Murr, des Kochers, der Brenz bis zur Donau, und von dort ist es zum Lech und zur „Via Claudia Augusta“ ein Katzensprung.
Die zuletzt völlig pannenfreien Touren ermutigen mich, in mein Fahrrad zu investieren, und ich lasse ein neues Licht, Pedale, Ritzelkassette, Kette, Tretlager, Ständer und Kettenradscheibe montieren. Dabei verzichte ich auf einen neuen Hinterreifen und hoffe, dass der alte die Tour überstehen wird. Ich kaufe keine Karten und vertraue auf mein Smartphone zur Navigation und mein (unbefriedigendes) Garmin-Navi wegen der geladenen Adressen. Wie in jedem Jahr versuche ich, meine Ausrüstung sinnvoll zu ergänzen und kaufe ein Powerpack zum Nachladen meines Smartphones und des Navis auf der Strecke sowie eine winzige Actionkamera, mit der ich aber nicht glücklich werde. Über mein Zelt ärgere ich mich schon seit mindestens zwei Jahren. Jetzt investiere ich etwas mehr als bisher in ein neues und fühle mich in dieser Hinsicht nunmehr bestens ausgerüstet.
Als ich in meine Große Radtour starte, leben wir Deutschen in einer Oase der Glückseligkeit. Die Wirtschaft brummt, der Finanzminister vermeldet Rekordeinnahmen, der Bundeshaushalt ist ausgeglichen, wir exportieren wie die Weltmeister und sind Nutznießer der Einbahnstraße Globalisierung. Währenddessen ist vor allem die arabische Welt aus dem Gleichgewicht geraten und auf dem afrikanischen Kontinent schlittern viele Länder in existentielle Krisen. Wir hingegen können nach Jahrzehnten des Wohlstandes nicht mehr würdigen, wie gut es uns tatsächlich geht. Nur wenige Visionäre reflektieren, dass die Aufteilung der Welt in arm und reich so nicht bleiben kann.
****
II. Durch den Süden von Deutschland und über die Alpen
1. Mittwoch, 17. 06.: Von Landau über Heidelberg nach Neckargemünd –Sonniger Anfang in der Kurpfalz. 87,5 km
Das Stadtgebiet von Landau liegt hinter mir, über mir ein äußerst freundlicher, blauer Himmel. Ich habe mir für den Start meiner Großen Fahrradtour einen Tag ausgewählt, der kaum schöner sein könnte. Im Hintergrund vor mir ragt der Kirchturm von Zeiskam steil in den Himmel. Davor liegt ein ausgedehntes Maisfeld, genau dort, wo im letzten Jahr noch grell grüne Zwiebelfelder prangten. Hinter mir werden die Hügel des Pfälzer Waldes mit jedem Kilometer weiter im Horizont versinken. Die Ähren der Gerstenfelder wiegen sanft im leichten Wind. Wenige Klatschmohnpflanzen stehen am Wegesrand in voller Blüte. Ich bin guter Dinge, habe mir allerdings vorgenommen, wegen meiner schlechten Form und meines undiskutablen Übergewichts, sehr behutsam zu starten.
Zu Beginn meiner Tour habe ich mir Zeit gelassen am Morgen, ein ausgiebiges Frühstück bei letzter Zweisamkeit genossen und mich entschlossen, noch einmal umzupacken. Spürbar zu hoch lag der Schwerpunkt meines Gepäcks, da ich auf den kleinen Stopfsack verzichten wollte, der sich geschickt unter den Sattel stecken lässt. Dann war das Gewicht besser verteilt, und der Abfahrt stand nichts mehr im Weg. Es ist ein mühsamer Weg durch Landau, der mich durch bewegten Verkehr hinaus auf die Radwege bringt, die auf direkter Strecke zu den Ufern des Rheins führen, und die ich von vielen Ausfahrten wie meine Hosentasche kenne.
Bald ist auch Zeiskam passiert, und ich radle entlang der stillgelegten Bahnstrecke, auf der sich nunmehr Draisinen mit metallischen Rollgeräuschen und fröhlichen Ausflüglern vorwärtsbewegen. Westheim, Lingenfeld, Germersheim. Ich überquere den großen Strom auf der Straßenbrücke der B 35. Schöne Radwege entlang der Straßen geleiten mich in einen berühmten Ort, Philippsburg. Lange radelte ich nicht mehr durch Baden-Württemberg und empfinde die Radwegausschilderung nunmehr ziemlich perfekt. Über dem Grün der Wälder tauchen die unsäglichen Betonmonster auf, die bei Wanderungen vom Hardtrand aus großer Entfernung zu sehen sind. Es sind die Riesenkühltürme des Kernkraftwerks Philippsburg, die von einer im Untergang begriffenen Epoche zeugen. Ein Block (Siedewasserreaktor) ist bereits stillgelegt, den anderen (Druckwasserreaktor) wird man vermutlich bis 2019 noch dampfen sehen.
Kann es sein, dass ich jetzt schon Hunger habe? Jedenfalls macht mir die Vorstellung von einem warmen Essen in einer Metzgerei Appetit, und ich kehre ein. Entschleunigung ist die Devise des Tages. Dabei kann ich nach dem Weg nach Waghäusel fragen, einem wenig bekannten Ort in Baden, wo im Stadtteil Wiesental der legendäre Fußballtrainer Sepp Herberger (1919 – 2002) geboren ist, und wo ich schon lange einmal die Eremitage besuchen wollte. Ich folge der Ausschilderung, begebe mich auf die „Tour de Spargel“ und nähere mich dem barocken Bauwerk vorbei an einem muslimischen Friedhof, auf dem bei einer Beerdigung die männlichen Trauergäste kräftig schaufeln. Die Silhouette des Schlösschens wird unschön überragt von riesigen Speichern der ehemaligen Fabrik der Südzucker AG (größter Zuckerhersteller der Welt), die 1837 gegründet und 1995 geschlossen wurde.
Neugierig umrunde ich den achteckigen Schlossbau mit vier Flügeln, der vom Speyerer Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn 1724 als Jagdschloss erbaut und von Balthasar Neumann 1737 erweitert wurde. Ich wundere mich, dass hier keine Besucher unterwegs sind, und verweile an einer Gedenkstätte für die badischen Revolutionäre von 1848 – 1849, die hier zum 150. Jahrestag 1999 errichtet wurde.
Die Weiterfahrt nach Norden irritiert mich ungemein, da ich mich der quirligen Metropolregion Rhein-Neckar nähere. Vor zehn Jahren bin ich diese Strecke schon einmal gefahren, aber jetzt ist alles anders. Durch Autobahnen, Schnellbahntrasse und viele andere Verkehrswege vollzieht der Radweg unübersichtliche Wendungen und gefühlte Umwege, und Überführungsrampen stören meine Fahrt im Flachland. Mit meiner völlig veralteten Radtourenkarte kann ich ohnehin nichts anfangen. Sie gibt mir nur noch Hinweise auf Richtungen und Ortsnamen. Entlang der Ausschilderung radle ich Richtung Neulußheim und an Hockenheim vorbei. Unvermittelt stehe ich vor einem Hinweis auf die „Berta Benz Memorial Route“, die von Mannheim nach Pforzheim führt, 1888 Trasse der ersten automobilen Fernfahrt war und danach dem Automobil zum Durchbruch verhalf.
Auf meinem Weg nach Heidelberg habe ich mir vorgenommen, auch Schwetzingen einen kurzen Besuch abzustatten. Schon radle ich entlang des unendlich langen Schlossparks, biege an dessen Ende nach links ab, um zum Eingang zu kommen. Rechts öffnet sich weit der Schlossplatz, der von barocken Gebäuden gesäumt wird. Links hinter den Pfortenhäuschen der mehrstöckige Hauptbau des Schwetzinger Schlosses, der leider auf der Parkseite für Renovierungsarbeiten eingerüstet ist. Die Entscheidung, ob ich einen Spaziergang durch den berühmten Park machen soll, wird mir dadurch erleichtert, dass mir die freundliche Kassiererin mit französischem Akzent eine liegengebliebene Eintrittskarte schenkt.
Zum ersten Mal in meinem Leben betrete ich die französische Gartenanlage, die an ihren Rändern in den englischen Gartenbaustil übergeht. Rechts und links erstrecken sich die kreisrund angelegten Zirkelbauten als Flügel des Hauptbaus, in denen sich ein sehenswertes Rokokotheater und Konzerträume für die Schwetzinger Festspiele befinden. Vorbei an Springbrunnen, vielen weißen oder goldenen, verspielten Figuren schlendere ich zwischen Rasenflächen und Blumenrabatten hindurch. In der Tiefe des Parks befinden sich eine Moschee, römische Tempelchen und rechts, etwas im Hintergrund, die Orangerie.
Was ich vermeiden wollte, tritt schon am ersten Tourtag ein, Hektik, zumal ich heute noch etwas Zeit für Heidelberg eingeplant habe und dann noch einige Kilometer am Neckar entlang fahren will. Ich fühle mich zu schlapp, um zur Moschee zu gehen, habe auch schon genug von dem feudalen Prunk und gehe zurück zum Eingang, wo ich mein Fahrrad unbeaufsichtigt stehen lassen musste. Das Schwetzinger Schloss wurde ab 1697 in mehreren Bauabschnitten am Standort eines mittelalterlichen Wasserschlosses erbaut und diente Kurfürst Karl Theodor von Mannheim als Sommerresidenz.
Ohne Umschweife verlasse ich die Stadt, die auch für den Spargel- und Tabakanbau berühmt ist, nach Nordosten Richtung Plankstadt, passiere das eindrucksvolle Landhotel Birkenhof, komme durch Pfaffengrund, sehe in der Ferne wie sich das Neckartal zur Rheinebene hin öffnet und wie sich Gebäude an den Hängen des Odenwalds hinaufziehen. Ich freue mich, bald in einer der Sehnsuchtsstädte Deutschlands anzukommen, und erreiche schon den Rand von Heidelberg. In der Nähe des Hauptbahnhofs überquere ich die Bahnlinie und arbeite mich weiter nach Osten durch starken städtischen Verkehr zur Altstadt vor.
Erst radle ich zum Neckarufer, wo ich glaube, mich besser orientieren zu können. Unbedingt möchte ich die alte Steinbogenbrücke überqueren, um vom Nordufer des Neckars das Königsmotiv der Stadt zu fotografieren, die Brücke mit den Tortürmen und der Schlossruine am Hang im Hintergrund. Die altehrwürdige Stadthalle mit der Säulenreihe am Eingang und die wehrhaften alten Mauern des Marstallhofs mit den runden Ecktürmen liegen an der Uferstraße, die gleichzeitig die B 37 ist. Bald habe ich meinen diesbezüglichen Fotohunger gestillt und will für wenigstens zwei Stunden die Atmosphäre und Stimmung einer meiner Lieblingsstädte aufsaugen. Durch ganze Horden von Besuchern hindurch schiebe ich mein Fahrrad immer tiefer in die Altstadt hinein und lasse mich auf dem Universitätsplatz auf einem Biergartenstuhl nieder. Ich schmunzle. Ein auf dem Tisch aufgeklebter Zettel verrät: „Wir machen kein Fingerfood. Bei uns brauchst du beide Hände“. So gefällt mir meine Radtour mit einem kühlen Bier auf einem zentralen Platz einer der beliebtesten Städte Deutschlands.
Vor dem Universitätsmuseum begehren Besucher in einer langen Schlange Einlass. Für mich ist das keine Option, vielmehr benötige ich eine Verschnaufpause, da ich anschließend noch am Neckar entlang weiterradeln möchte. Mir kommt in den Sinn, dass ich viel zu selten hier bin, zumal es höchstens eine Stunde von Landau mit dem Auto braucht, um hierher zu kommen. Dabei hat die Stadt eine überaus interessante Geschichte und beherbergt die älteste Universität auf dem heutigen Boden Deutschlands. Schon die Kelten gründeten hier eine Siedlung. Die Römer unterhielten ein Militärlager, bevor dieses erst von den Alamannen und dann von den Merowingern erobert wurde, was die Stadt ins Frankenreich beförderte. Die Gründung der heutigen Stadt Heidelberg fällt ins 12. Jahrhundert, die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1196 zurück. Friedrich Barbarossa ernannte 1156 seinen Bruder Konrad zum Pfalzgrafen bei Rhein, und als die damals übliche Reiseregentschaft aufgegeben wurde, setzte sich Heidelberg als Sitz der Pfalzgrafen gegen Neustadt an der Haardt durch. 1225 erhielt der Pfalzgraf die bislang zum Bistum Worms gehörige Stadt als Lehen. Das Herrschaftsgebiet des Pfalzgrafen nahm nach der Verleihung der Kurwürde an den Pfalzgrafen 1356 als Kurpfalz eine positive territoriale Entwicklung innerhalb des Heiligen Römischen Reiches.
Ruprecht I. gründete im Jahr 1386 die Universität, und Heidelberg wurde ein Zentrum des frühen Humanismus. Offen für die Ideen Luthers wurde Heidelberg calvinistisch und zog zahlreiche Wissenschaftler an. Im Dreißigjährigen Krieg besetzte die Katholische Liga unter Tilly 1622 die Stadt, und sie blieb bis zum Westfälischen Frieden 1648 katholisch und bayerisch. Im Zuge des von Ludwig XIV. von Frankreich entfesselten Pfälzischen Erbfolgekriegs 1689 – 1697 wurde Heidelberg zwei Mal eingenommen und völlig verwüstet, wobei die am Ende des 16. Jahrhunderts entstandenen, prächtigen Renaissancebauten allesamt zerstört wurden (außer dem Hotel Ritter), und das Schloss war unbewohnbar. Aus diesem Grund und nach einem Streit mit den Protestanten verlegte der katholische Karl III. Philipp den Sitz ins prunkvolle, barocke Mannheim, und Heidelberg verlor an Bedeutung. Gleichwohl entstand die Altstadt neu im barocken Glanz.
Im Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde die Kurpfalz zerschlagen und das rechtsrheinische Gebiet mit Heidelberg dem Großherzogtum Baden zugeschlagen. Dank seiner landschaftlichen Lage entwickelte sich Heidelberg als Sehnsuchtsort der Romantik und beherbergte Dichter wie Achim von Arnim, Friedrich Hölderlin, Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff. Auch im Vorfeld der badischen Märzrevolution 1848 spielte die Stadt durch die Heidelberger Versammlung demokratischer und liberaler Politiker eine wichtige Rolle. Zu Ende des 19. Jahrhunderts erfuhr Heidelberg eine rasante Expansion und blieb im Zweiten Weltkrieg als eine der wenigen deutschen Großstädte nahezu unversehrt. Dadurch zog es zahlreiche Flüchtlinge an, wurde Standort hoher Kommandostellen der Amerikaner und so zum Sehnsuchtsort amerikanischer Soldaten. Bis zu 10.000 Amerikaner wohnten hier, die nach der Verlegung der Dienststellen nach Wiesbaden 2009 – 2013 nach und nach die Stadt verließen.
Dank der bedeutenden Rolle der Ruprecht-Karls-Universität wirkte eine Vielzahl von Nobelpreisträgern, Philosophen und Schriftstellern in der Stadt. Ihre bedeutendsten Söhne und Töchter sind der erste Reichspräsident Friedrich Ebert (1871 – 1931), der Philosoph Ernst Jünger (1895 – 1998), der thailändische König Ananda Mahidol (1925 – 1946), die schwedische Königin Silvia Sommerlath, Lieselotte von der Pfalz (1652 – 1722), der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (1930 – 2014) und die Unternehmer Götz Werner, Hubert Burda und Dietmar Hopp sowie die Sängerin Pe Werner und der aktuelle VfB-Fußballspieler Lukas Rupp.
Mit der Universität und weiteren Hochschulen sowie dem Krebsforschungszentrum, vier Max-Planck-Instituten, dem Zentrum für Astronomie und der Landessternwarte ist Heidelberg einer der bedeutendsten Standorte für Bildung und Forschung in Deutschland. Es hat heute etwa 155.000 Einwohner und entwickelte sich mit der Ansiedlung von Heidelberger Druckmaschinen, HeidelbergCement, ABB und SAP auch zu einem beachtlichen Wirtschaftsstandort.
Bereits am ersten Tag meiner Großen Radtour 2015 freue ich mich also über ein derartiges Highlight geschichtlicher und touristischer Relevanz. Es fällt mir schwer, meine Fahrt fortzusetzen, und ich muss auch auf die Besichtigung des Schlosses verzichten, das als Burg 1225 zum ersten Mal erwähnt wird, aber dessen Baugeschichte bis heute wissenschaftlich umstritten ist. Fest steht, dass der Ottheinrichsbau zu den bedeutendsten Renaissancebauten nördlich der Alpen gehört. Da es nach seiner Zerstörung nur teilweise wieder aufgebaut wurde, ist es heute eine der berühmtesten Ruinen Deutschlands.
Durch die Besuchermassen bahne ich mir den Weg durch eine der längsten und interessantesten Fußgängerzonen Europas nach Osten, werfe einen Blick auf prächtige Bauten wie das Hotel Ritter, die Heiliggeistkirche und halte am Kornmarkt noch einmal inne, wo sich die Säule mit der Madonna befindet und ein schöner Blick auf die Schlossruine frei wird. Viel würde ich gerne noch sehen, aber ich muss weiter. Das Karlstor markiert das Ende der Altstadt und für mich beginnt der romantische Radweg am Neckar entlang. Mir bleibt nur noch ein verklärter Blick zurück auf die schöne Silhouette der Universitätsstadt, und ich denke, dass sie fast so schön ist wie die von Dresden neben der Elbe.
Das Wetter hat heute gehalten, was es versprochen hat. Die Steilhänge auf beiden Seiten des Flusses sind zusammengerückt, das enge Tal hat Potential für bildschöne Ansichten im warmen Abendlicht. Ich entscheide mich, am Südufer zu bleiben, da dort die nächsten Zeltplätze liegen. Die Fahrt ist allerdings nicht sehr angenehm, da es hier wegen der Enge des Tals kaum separate Radwege gibt. Vielmehr radle ich eng an der verkehrsreichen B 37 entlang, bleibe meiner Linie treu, nur mit halber Kraft zu fahren, und erreiche bald den Zeltplatz „Bei der Neckarbrücke“ kurz vor Neckargemünd. Er liegt unten am Ufer und bietet alles, was ich für die abendliche Ruhephase brauche. Kurz bevor der Kiosk schließt bekomme ich noch mein Bier. Die Gewöhnungsphase an das Camperleben hat begonnen. Ich schlafe schlecht aber erhole mich recht ordentlich.
2. Donnerstag, 18. 06.: Von Neckargemünd über Bad Wimpfen nach Neckargartach – Regen auf dem Neckarradweg. 84,2 km
Der neue Tourtag graut für mich am Neckarufer. Es ist trocken, als ich meine Nase in die frische Luft stecke. Noch fühlt sich mein neues Zelt bei der Demontage etwas ungewohnt an. Kaum habe ich die Plane im Sack verstaut, fängt es an zu regnen. Mir schwant, dass der heutige Tag ein Gegenentwurf zum gestrigen werden könnte. In der schönsten annehmbaren Landschaft zeigt sich meine Tour von der schlechtesten annehmbaren Seite. In der Hoffnung, dass der Regen nachlassen wird, rette ich mich ins Dorfzentrum von Neckargemünd, wo ich zum Glück eine offene Bäckerei für mein Frühstück finde. Missmutig kaue ich mein Salamibrötchen im Stehen und grüble, was zu tun ist. Gleichwohl tut mir das Wetter nicht den erhofften Gefallen. Es regnet, regnet, regnet.
Es hilft alles nichts, ich mache mich auf die Socken, ziehe meine Kapuze über, trotze dem Regen so gut es geht, und wofür habe ich mir eigentlich vor zwei Jahren diese funktionale, knallrote Wolfskin-Regenjacke gekauft? Durch das verkehrsreiche Dorf hindurch lasse ich es hinunter zum Neckarufer rollen und setze meinen Weg am Südufer an den Neckarmäandern entlang nach Osten fort. Der Asphalt geht bald in eine feste Schotterauflage über, auf der es sich allerdings gut fahren lässt. Eine Brücke lädt mich ein, kurz im Trockenen zu verschnaufen. Durch ein Grau in Grau blicke ich in eine traumhaft schöne Landschaft, wo ich noch nie mit dem Fahrrad war, und auf die ich mich so sehr gefreut habe. Ich bin schon klatschnass, das Regenwasser trieft an mir herunter. Ich schaue auf die gekräuselte Wasserfläche des Flusses, auf die Uferbüsche am Nordufer und die dicht bewaldeten Hänge im Hintergrund, die den Rand des Odenwaldes markieren.
Als ich meine Fahrt fortsetze, falle ich auf ein neutrales Fahrradschild herein, das den Hang hinauf weist. Mühsam schiebe ich meinen Drahtesel einen Waldweg hinauf, bis ich zum Schluss komme, dass das Unsinn ist. Ich vermute, dass unten der Weg möglicherweise wegen eines Kraftwerks oder Hafens unterbrochen sein könnte. Blödes Schild, denke ich, und schiebe wieder hinunter, und es geht alles gut.
Die ersten Burgruinen, deren dunkelgraue Mauern sich kaum vom nassen Grün des Hintergrunds abheben, sind drüben zu sehen. Erst sind es die Hinterburg und die Mittelburg bei Neckarsteinach, die mir trotz der schlechten Sicht ein Foto wert sind. Weiter führt der Radweg über Schotter etwas abseits des Ufers zwischen Getreidefeldern hindurch. Etwa ab Neckarsteinach, von dem ich vom Radweg aus nur wenig sehe, ist das Nordufer hessisch, und bald sehe ich drüben die Gebäude des malerischen Hirschhorns am Hang auftauchen. Fasziniert bleibe ich stehen und blicke hinüber auf die alten Mauern am Fluss, die Häuser, die katholische Pfarrkirche, die ehemalige Karmeliterklosterkirche am Hang und die Burg Hirschhorn oben, die der Skyline die Form gibt. Auch hier geht die territoriale Neuordnung und das Vorrücken Hessens bis zum Neckarufer auf die napoleonischen Eroberungen und den Reichsdeputationshauptschluss 1803 zurück, der Hirschhorn der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt zuschlug, die 1806 im Herzogtum Hessen aufging.
Der Neckar windet sich durch eine enge Schlinge, in der das badische Ersheim mit seiner hübschen Kapelle hinter der Friedhofsmauer liegt. Als kurze Zeit später drüben die Häuser von Eberbach am Hang erscheinen, ist das Nordufer abermals badisch-württembergisch. Es fällt mir schwer, an Ebersbach vorbei zu fahren, beherbergt die kleine Stadt doch eine Reihe historischer Gebäude, aber vielleicht komme ich ja bei der Rückfahrt noch einmal hier vorbei. Ich bleibe auf dem südlichen Neckarufer und folge den Schildern Richtung Mosbach. Trotz des schlechten Wetters begegnen mir viele Radler, ein Hinweis darauf, dass der Neckarradweg recht beliebt ist. Das Naturfreudehaus Zwingenberger Hof liegt am Wegesrand und macht einen vorzüglichen Eindruck. Kaum habe ich auf der anderen Seite das stattliche Schloss Zwingenberg gesichtet, wechselt der Radweg auf die andere Flussseite. Auf einer modernen Schrägseilbrücke für Fußgänger und Radler überquere ich den Neckar und setze drüben meine Fahrt entlang der B 37 fort, die hier mit der Burgenstraße von Mannheim nach Prag identisch ist.
Schon auf der nächsten Brücke bei Neckargerach führen mich die Radwegschilder zurück auf die Südseite des Flusses. Kurz nach der Brücke entdecke ich einen überdachten Picknickplatz. Hier könnte ich mich vielleicht etwas unterstellen. Spontan kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Ein älterer Herr spricht mich an, und ich errege wohl sein Mitleid, als er meine triefenden Kleider sieht. Ich solle doch mit ihm hinein kommen und meine Sachen trocknen. Nein, ich will doch nicht die Nässe in sein Haus schleppen. Aber ja doch, nötigt er mich geradezu und führt mich durch die Garage in seinen Heizungskeller, wo er eine unsägliche Hitze entfacht. Ich packe mein Essen aus und wärme mich so intensiv, wie ich es noch nie erlebt habe. Schuhe und Jacke sind aufgehängt und trocknen blitzschnell. Er erzählt von seinen Söhnen, von denen einer beim „Daimler“ Karriere macht, beim Formel 1-Team war und zuletzt an der Actros-Entwicklung beteiligt war. Herr Martin ist ein gläubiger Mann, und dass er mir beim Trocknen hilft, ist seine heutige gute Tat.
Wir reden über seinen Namenspatron, den Heiligen Martin, dem Bischof von Tour, wo ich 2009 mit dem Fahrrad war, und der in Szombathely (Stein am Anger) im heutigen Ungarn geboren ist, wo ich 2014 ebenfalls mit dem Fahrrad war. Herr Martin trägt den Titel „Kavalier der Straße“, weil er uneigennützig bei Unfällen geholfen hat. Zudem hat er schon öfters Fernradler unterstützt. Ich notiere mir seine Adresse, da es mir ein Anliegen ist, mich auf meine Art zu bedanken. Inzwischen ist es im Heizungskeller so heiß geworden, dass ich unbedingt raus muss. Mein Mittagessen habe ich vorgezogen, und der Regen hat ein wenig nachgelassen. Auf wundersame Weise äußerlich getrocknet radle ich guten Mutes weiter am bildschönen Neckarstrand entlang.
Nach einem weiteren engen Flussbogen mit der Gemeinde Binau nähere ich mich Obrigheim, wo auch bald das ehemalige Kernkraftwerk mit seinem kugelkalottenförmigen Reaktor ins Blickfeld rückt. Der Druckwasserreaktor war von 1969 bis 2005 in Betrieb, und wurde durch die erste, von der rot-grünen Koalition ausgelösten Stilllegungswelle vom Netz genommen. Ausgelegt für zunächst 150 MW baute man ihn im Lauf seiner Betriebszeit für bis zu 357 MW aus. Noch befindet sich die Anlage im Rückbau, der erst im Jahr 2020 abgeschlossen sein soll und mit 500 Mio. € veranschlagt wird. Es ist schon das zweite Atomkraftwerk, an dem ich in Baden-Württemberg vorbeikomme, und morgen könnte bei Neckarwestheim ein drittes folgen. Währenddessen habe ich auch die Stadt Mosbach passiert, die etwas versetzt gegenüber von Obrigheim liegt, ohne viel von ihr zu sehen.
Der Weg entfernt sich jetzt etwas vom Ufer und geht steil bergan. Von oben bieten sich tolle Aussichten auf die Neckarlandschaft. Über gelbe Getreidefelder blicke ich auf die Weinberge und die Ruine der Burg Hornberg bei Neckarzimmern am Waldrand am Hang. Wunderschön, würde es nicht ununterbrochen regnen. Zurück am Neckarufer wird Haßmersheim passiert, wo sich beim Gewerbegebiet ein toller Blick auf die ganze Breite der Burg Hornberg öffnet. Weitere Burgen tauchen auf und machen der Burgenstraße alle Ehren. Es sind Horneck, Guttenberg und Ehrenberg. Inzwischen bin ich abermals völlig durchnässt, selbst der Geldbeutel in meiner Jackentasche ist schon total aufgeweicht. Zum Glück komme ich dennoch gut voran, lasse auf der anderen Seite Gundelsheim liegen und nehme das nächste, wichtige Ziel ins Visier. Unbedingt möchte ich die historische Altstadt von Bad Wimpfen sehen, müsste ihr schon ziemlich nahe sein, aber noch ist die Silhouette nicht zu sehen.
Aus einer Flussbiegung heraus öffnet sich endlich rechts oben der Blick auf die berühmte Oberstadt. Über einer steil ins Neckartal abfallenden Felswand erheben sich die Türme der alten Reichsstadt. Etwas missmutig schiebe ich mein Fahrrad über das grobe Kopfsteinpflaster der Hauptstraße den steilen Berg hinauf, die ins Zentrum führt. Es sollte der Höhepunkt des heutigen Tages werden, aber in diesem Regen macht das alles keinen Spaß. Ich passiere das uralte Stadttor und lande unmittelbar auf dem schönen Neumarkt mit herrlichen Fachwerkhäusern und dem Löwenbrunnen. Geranien schmücken die Mauerkronen, überhaupt ziert erstaunlich viel Grün die alte Stadt. Rechts oben blinken die Türme der evangelischen Stadtkirche durch den Marktrain. Aber dieser ist mir viel zu steil. Ich gehe geradeaus weiter durch die Hauptstraße und lande mit diesem Umweg auf dem Marktplatz mit der evangelischen Stadtkirche und dem Rathaus.
Bad Wimpfen erlangte seine historische Bedeutung durch den Bau der größten Kaiserpfalz nördlich der Alpen durch die Staufer um das Jahr 1200, nachdem hier bereits eine keltische Siedlung und ein bedeutendes Kastell der Römer existiert hatten. Das Marktrecht war bereits 965 erteilt worden. In der Kaiserpfalz residierten die Herrscher und sprachen Recht, sodass sich die Bergstadt stärker entwickelte als die viel ältere Talstadt. Nach dem Niedergang der Staufer wurde Wimpfen Reichsstadt, was zum Erblühen des Handwerks und des Bürgertums führte. Sie war im 16. Jahrhundert ein Brennpunkt der Reformation, und im Dreißigjährigen Krieg fand hier eine der bedeutendsten und blutigsten Schlachten zwischen dem kaiserlichen Heer unter Tilly und dem Markgrafen von Baden statt. Da durch den Reichsdeputationshauptschluss die Stadt Wimpfen zu Baden, das in der Unterstadt bereits im 7. Jahrhundert gegründete Stift aber zu Hessen-Darmstadt kam, entbrannte ein Streit über die Zugehörigkeit der Stadt zwischen Hessen und Baden-Württemberg, bei dem mehrfach Gerichte bemüht wurden und Volksabstimmungen stattfanden. Aus der heutigen Sicht fast europaweit offener Grenzen mutet dies fast unglaublich an. Selbst die Zugehörigkeit zum Landkreis Sinsheim oder Heilbronn war bis 1960 nicht endgültig geklärt. Die seit 1817 erfolgreiche Soleförderung auf dem Stadtgebiet führte zu deren therapeutischen Nutzung und zur Verleihung des offiziellen Bädertitels 1930. Heute hat Bad Wimpfen knapp 7.000 Einwohner und ist wegen seines mittelalterlichen Stadtkerns und der Reste der Kaiserpfalz ein beliebtes Touristenziel.
Auf dem glitschigen Kopfsteinpflaster steht mir eine unangenehme Fahrt abwärts durch die Altstadt bevor. Ich wähle einen anderen Rückweg und komme am Wahrzeichen der Stadt, dem freistehenden „Blauen Turm“, vorbei, der durch eiserne Spannbänder gesichert wird. Auch das Steinhaus und die Pfalzkapelle liegen an meinem Weg, allesamt Bestandteile der historischen Burganlage, von der vor allem noch die Mauern über dem Hang zum Neckartal erhalten sind. Mit Vorsicht lasse ich es steil abwärts über das glitschige Pflaster rollen, fahre durch den Schwibbogen und staune trotz des anhaltenden Regens über das stattliche Ensemble von Fachwerkhäusern, die oft mit Rosen oder Schlingpflanzen verziert sind. In der Talstadt werden Zelte für ein Volksfest aufgebaut, eine Chance, mich kurz ins Trockene zu stellen. Unbedingt möchte ich einen Eindruck von der Stiftskirche St. Peter mitnehmen, deren Gründung auf das 7. Jahrhundert zurückgeht, und die in der heutigen Form im 13. bis 14. Jahrhundert errichtet wurde.
Schön asphaltierte Radwege führen mich meist eng am Ufer des Neckars entlang weiter Richtung Heilbronn. Ich habe mich daran gewöhnt, pudelnass zu sein. Was ist denn das? Fast endlos ziehen sich unzählige Werkshallen und Produktionsstätten am gegenüberliegenden Ufer entlang. Zwar sehe ich kein einziges Firmenlogo, aber das kann nur AUDI in Neckarsulm sein. Ich kann mich an die ferne Vergangenheit erinnern, als das noch NSU war. 1969 fusionierte die aus der Horch AG hervorgegangene Audi AG mit der NSU AG, verlegte ihren Sitz nach Ingolstadt und wurde 2002 von VW übernommen. Kurz vor dem Feierabend, erleide ich einen Hungeranfall. Dringend muss ich Pause machen und etwas essen. Zum Glück finde ich einen überdachten Picknickplatz. Wo werde ich heute Nacht schlafen? Zelten ist unmöglich, meine Sachen müssen unbedingt trocknen. In die so stark industrialisierte Großstadt Heilbronn will ich nicht, also biege ich ins nächste Dorf ab, und das ist Neckargartach. Durch einen Park gelange ich ins Zentrum, fahre auf der Frankenbacher Straße nach rechts, finde nichts, was mich zur Übernachtung einladen würde, gehe in eine Kneipe und frage. Männer an der Bar und das Personal reden wild durcheinander, alle wollen gleichzeitig helfen. Ich verstehe zunächst gar nichts, dann aber, dass ich links hätte abbiegen sollen, wo ich den Hotelgasthof Anker schnell gefunden hätte.
Der Anker ist eine bescheidene Unterkunft, aber preislich für mich erschwinglich. Der Rest des Abends ist Routine und dient fast ausschließlich der Erholung. Nach der Dusche schlafe ich sofort ein und übertrage erst in der Nacht Bilder und Videoclips auf mein Notebook.
3. Freitag, 19. 06.: Von Neckargartach nach Kirchberg/Murr – Durch die Heimat meiner Jugendjahre. ~ 50 km
Ich möchte heute bei meinem Bruder in meinem Geburtsort übernachten. Auf meinem Weg in Richtung engere Heimat stellt sich mir ein Hindernis in den Weg. Es ist die Großstadt Heilbronn mit ihren Kraftwerken, Hafenanlagen, Stauwehren und Gewerbegebieten. Gut kann ich mich an die Schilderungen meiner Eltern erinnern, wie sie Ende 1944 von zu Hause aus die Stadt hatten brennen sehen. Tatsächlich wurde damals das Zentrum nach Bombenangriffen vollkommen zerstört, sodass hier keine intakte Altstadt zu sehen ist. Leichten Herzens verzichte ich auf einen Besuch in Heilbronn und nehme mir vor, sie möglichst Zeit sparend zu umradeln. Indessen kündigt sich ein weit schönerer Tag an als gestern. Der Himmel ist blau, mich blenden sogar Sonnenstrahlen. Wieder einmal ist das Frühstück für mich das Beste an der Übernachtung im Hotel, und ich genieße es. Schnell zurück zum Neckarufer, vorbei am Kohlekraftwerk Heilbronn und am Hafen weiter nach Süden.
Als ich das Neckarufer verlassen muss, wird die Ausschilderung uneindeutig, an wichtigen Stellen fehlen Hinweise, ich durchquere ein Industriegebiet, weiß nicht mehr, wo ich bin, nur, dass ich an einem Kanal stehe. Ich bin ratlos, auch das Kartenstudium hilft mir nicht weiter, als ein rettender Engel auftaucht. Auch er meint, dass die Innenstadt von Heilbronn nicht so wahnsinnig interessant ist, und fährt mir voraus. Das ist äußerst bequem, aber dabei verliert man leicht die Orientierung darüber, wo genau man fährt. Jedenfalls möchte ich bei Sontheim den Neckar verlassen und der Trasse des Radwegs „Neckar ‒ Alb“ folgen, die ins malerische Bottwartal führt. Diese Strecke ist zwar kürzer als die am Neckar entlang, aber weist eine kleine Wasserscheide zwischen Neckar und Murr auf.
Mein Führer scheint Zeit zu haben, bringt mich über Brücken und mit vielen Richtungswechseln in den Vorort Sontheim und verabschiedet sich an der Gemeindegrenze von Talheim, wo er glaubt, dass ich selbst zurecht kommen werde. Allein hätte ich das nicht so leicht gefunden. Er erzählt mir, dass er aus einer bekannten Heilbronner Familie stammt. Sein Großonkel war Eigentümer der Silberwarenfabrik Bruckmann und hat als Industrieller offensichtlich viel im nördlichen Württemberg bewegt. Unter anderem soll er den Bau des Neckarkanals und der wegen seiner Bauhaus-Architektur historischen Weißenhofsiedlung in Stuttgart initiiert haben. Es handelt sich wohl um den Heilbronner Ehrenbürger Peter Bruckmann (1865 – 1937), der den „Deutschen Werkbund“ mitgegründet hat und im Landtag von Württemberg saß. Das ist hochinteressant, denke ich, und er erzählt mir zudem, dass er ein begeisterter Radler sei und schon an der „Tour de Ländle“ teilgenommen habe, einer jährlich zu Beginn der Sommerferien vom Radiosender SWR veranstalteten Freizeittour mit wechselnden Streckenführungen.
Freundlich verabschiedet sich mein Helfer und schickt mich auf eine Route, die bei mir nostalgische Erinnerungen weckt. Der Radweg verläuft von hier an auf der Trasse der ehemaligen schmalspurigen Bottwartalbahn, die der Volksmund wegen seiner langsamen Fahrt „Entenmörder“ getauft hatte. Sie führte von Marbach am Neckar nach Heilbronn. Oft bin ich mit meiner Mutter nach Auenstein gefahren, wo meine Oma mütterlicherseits herstammte. Meine Schulkameraden aus dem Bottwartal kamen allesamt mit ihr zur Schule nach Marbach am Neckar. Das erste Teilstück ging bereits 1894 in Betrieb. Die Bahn war wichtiges Transportmittel für die Zuckerfabrik Heilbronn und das Kohlekraftwerk Marbach und wurde 1966 beziehungsweise 1968 zunächst für den Personen- ,und dann auch für den Güterverkehr still gelegt.
Die Kindheitserinnerungen beflügeln mich. Die Trasse führt zunächst an der Schozach entlang, durch Waldgebiete und steigt stetig leicht an. Meist besteht der Belag aus Schotter, auf dem aber gut zu radeln ist. Auf ehemaligen Eisenbahntrassen fühle ich mich stets in meinem Element und komme gut voran. Nur wenige Kilometer westlich liegt Neckarwestheim mit einem weiteren Kernkraftwerk, das aber von hier nicht zu sehen ist. Die Öttingermühle taucht am Wegesrand auf. Ich lasse es mir nicht nehmen, das Mühlenlädchen auf Spezialitäten zu untersuchen. Meine Wahl fällt auf einen riesigen, hausgemachten Rhabarberkuchen. So gestärkt rolle ich weiter an der Schozach entlang nach Ilsfeld, wo ich im Gewerbegebiet endlich einkaufen kann. Auenstein, wo ein Viertel meiner Wurzeln liegt, ist nur wenige Kilometer östlich von hier zu finden.
Nachdem ich Ilsfeld hinter mir gelassen habe, führt der Radweg unter der A 81 hindurch über intensiv genutztes Agrarland, die Schozach biegt nach Norden ab, die ehemalige Eisenbahntrasse steigt stetig an. Der Radweg verläuft unmittelbar neben der L 110. Die gefürchtete kleine Wasserscheide liegt vor mir, aber sie ist moderat und weist nur einen Höhenunterschied von etwa 70 m auf. Als das Willkommensschild für die Tourismusregion Marbach-Bottwartal erscheint, bin ich schon oben, und hinter dem Berg tauchen die glatt planierten, ausgedehnten Weinberge des Bottwartals auf. Der erste Blickfang ist die Burg Hohenbeilstein aus dem 11. Jahrhundert, auf der ein Burgrestaurant und eine Falknerei betrieben werden. Das Städtchen Beilstein liegt am Hang, und der Radweg führt abwärts durch neuere Wohngebiete. Obwohl ich zügig durch das Zentrum radle, fällt mir auf, wie authentisch der Ortskern mit dem Fachwerkrathaus und anderen historischen Gebäuden hergerichtet ist. Ebenmäßige Weinberge begleiten mich auf meinem Weg, und bald taucht auf der Spitze eines Bergkegels Burg Lichtenberg über der Gemeinde Oberstenfeld auf. Hier haben wir uns als Halbwüchsige oft aufgehalten, und das Heimatgefühl wärmt mein Sonnengeflecht. Auch Oberstenfeld ist im Zentrum wunderschön renoviert.
Es folgt Großbottwar, das ich auf einem neuen, leicht abwärts geneigten Radweg an der Bottwar entlang erreiche. Einen Abstecher ins Zentrum lasse ich mir auch hier nicht nehmen, um das schönste Rathaus zu bewundern, das ich bisher in Württemberg gesehen habe. Weiterhin begleiten saftig grüne Getreidefelder und Weinberghänge meinen Weg durch das Bottwartal. Mit den Baumgruppen am Flüsschen entlang und kleineren Wäldern erlebe ich eine bildschöne Landschaft. Als ich diesen visuellen Genuss vollends auskosten will, ist er auch schon zu Ende. Die ersten Häuser von Steinheim tauchen auf, wo die Bottwar in die Murr mündet. Hier sind wir als Kinder in die Bahn eingestiegen, wenn es nach Auenstein ging. Im ehemaligen Bahnhof befindet sich eine Gastronomie, und davor sind eine Schmalspurdampflok und die Skulptur eines Steppenelefants zur Schau gestellt.
Steinheim ist ein Städtchen mit etwa 12.000 Einwohner und bekannt als Fundstelle des „Homo Steinheimensis“ (1933), dem drittältesten Fund dieser Art in Europa, und dem heute das Urmenschmuseum gewidmet ist. Die Urmenschfrau wird als Zwischenstufe des „Homo Heidelbergensis“ und Neandertalers eingestuft und soll vor etwa 250.000 bis 300.000 Jahren gelebt haben. Das Gebiet war schon in der Römerzeit besiedelt, der Markgraf von Baden errichtete auf dem ehemaligen Römerbad ein Herrenhaus und die einflussreichen Dominikanerinnen ein Kloster, das 1643 vollständig abbrannte. Die Stadt kam 1564 zu Württemberg, Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte es sich zu einem bedeutenden Standort der Möbelindustrie, die heute allerdings keine Rolle mehr spielt. Steinheim gehörte zum Oberamt Marbach und kam 1938 zum Landkreis Ludwigsburg. Nur kurz verlasse ich die Hauptstraße, um mir das schöne Rathaus mit der tollen Außentreppe anzusehen, dann kehre ich auf den Radweg zurück der an der Kreisstraße 112 und der Murr entlang nach Osten führt. An der sogenannten Schweißbrücke (volkst.) endet leider der schöne Radweg, und ich radle im motorisierten Verkehr meinem Geburtsort Kirchberg an der Murr entgegen.
Mit gemischten Gefühlen passiere ich das Ortsschild. Zu lange bin ich schon weg und kenne die Menschen nicht mehr. Zudem kommt ein kräftiger Anstieg vom Murrtal ins Zentrum von etwa 210 auf über 300 m Meereshöhe. Noch verfüge ich nicht über die Kondition für einen solchen Berg, und ich muss mich sehr plagen. Warmherzig werde ich empfangen, das Fahrrad kommt in den Keller, zum Abendessen gibt es feine Küche im vorzüglichen Restaurant des TB Rielingshausen, mein Sohn und meine Nichte stoßen dazu. So kommt es kurz nach unserem traditionellen Familiengrillfest an Fronleichnam zu einem spontanen kleinen Familientreffen. Mein Bruder Dieter ist ein gutes Jahr älter als ich, sodass wir fast wie Zwillinge aufgewachsen sind. Jetzt sind wir jenseits der 70, und es ist alles anders: Dieter trinkt keinen Alkohol mehr. Es wird ein schönes Wiedersehen mit schwelgen in Erinnerungen bis Mitternacht und ich werde ungemein verwöhnt mit einem trockenen und warmen Bett.
4. Samstag, 20. 06.: Von Kirchberg/Murr über Backnang und Murrhardt nach Untergröningen – Verregneter, heimatlicher Schwäbischer Wald. 67,1 km
Dank meinem Bruder und meiner fürsorglichen Schwägerin habe ich eine weitere erholsame Nacht im warmen Bett hinter mir. Nicht nur, dass ich ein wunderbares Frühstück serviert bekomme, auch meine Wäsche ist gewaschen, als ich anfange zu packen. Klar, dass es später wird, als mir lieb ist. Es bleibt mir für den Augenblick nur das herzliche, verbale Dankeschön und ich reiße mich mühsam los, um zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Wenn ich schaffe, was ich vorhabe, wird es ein weiter Weg durch ein äußerst vielfältiges Europa. Noch ist es trocken aber sehr kühl, und ich habe warme Sachen angezogen. Erst muss ich unbedingt noch ein paar Fotos im Ortskern des Dorfes schießen, das auf 3.700 Einwohner angewachsen ist. Nicht ganz ohne Wehmut radle ich die Hauptstraße hinunter, sehe mein Geburtshaus rechts gegenüber dem Gasthaus „Hirsch“, komme zum Zentrum mit der Kirche, dem schicken Rathaus und dem Pfarrhaus mit ihren malerischen Fachwerkfassaden. Auf dem Rathausplatz wird gerade ein Dorffest vorbereitet. Ich will nicht noch mehr Zeit verlieren und radle Dorf auswärts Richtung Burgstall.
Den offiziellen Radweg habe ich gestern verloren, sodass ich dankbar einen Radweghinweis aufnehme, der zum Sportplatz führt. Es wird eine anstrengende Fahrt durch das sehr bewegte Gelände meines Geburtsorts. Die Radroute führt nach Zwingelhausen und dort am Geburtshaus meiner Mutter vorbei. Noch immer reißt der riesige Steinbruch der Firma Gläser dort die Landschaft auf, wo es hinunter geht und wieder steil aufwärts zum Fürstenhof. Ein Schwächeanfall lässt mich innehalten. Ich schnappe nach Luft, und mir wird speiübel. Jetzt muss ich unbedingt Kräfte schonen, aber vielleicht hilft ein Schokoriegel. Es rächt sich mein Übergewicht und meine schlechte Form, und ich kann nur hoffen, dass es mir schnell besser geht. Verhalten bin ich zwar die ersten drei Tage angegangen aber vielleicht gestern am Berg doch zu heftig. Langsam schiebe ich hinauf und radle dann mit halber Kraft. Aber auch hinter Großaspach, Heimat eines Fußballdrittligisten, will das nervige auf und ab kein Ende nehmen. Die Fahrt bleibt überaus anstrengend. Hoffentlich geht das gut.
Auch die schöne Altstadt der ehemaligen Kreisstadt Backnang liegt am Hang. Hier schiebe ich mein Fahrrad durch einen sehr belebten Wochenmarkt und nehme die altehrwürdigen Fachwerkhäuser in Augenschein, die vom Stadtturm überragt werden. Nachdem der Kreis Backnang 1973 im Landkreis Waiblingen aufgegangen war, ist die Stadt mit etwa 35.000 Einwohnern ein Mittelzentrum. Kurz bin ich hier sogar zur Schule gegangen, und ich erinnere mich an die einstmals hier ansässige Schwermaschinen-, Textil- und Lederindustrie. Zudem befand sich ein bedeutender Standort von Telefunken, dem Erfinder des PAL-Farbfernsehens, in Backnang.
Schon in der Jungsteinzeit besiedelt gehörte die Stadt zu einer römischen Provinz und liegt nicht weit vom Limes entfernt. Die heutige Siedlung geht auf die Alamannen zurück, die die Römer 260 von hier vertrieben. Die Badener gründeten 1116 ein Augustiner-Chorherrenstift, bevor die Stadt um 1300 durch Heirat württembergisch wurde. Sie litt sehr unter den Bauernkriegen, im Dreißigjährigen Krieg und durch eine Belagerung der Franzosen 1693. Mehrere prominente Zeitgenossen wurden hier geboren, wie der „Fußballprofessor“ Ralf Rangnick, die beiden ehemaligen Spieler des VfB Stuttgart Andreas Hinkel und Julian Schieber und der SPD-Politiker Volker Hauff. Der Bundesbankpräsident Jens Weidmann baute hier sein Abitur und der Dialektsänger Wolle Kriwanek lebte und starb (1949 ‒ 2003) in Backnang.