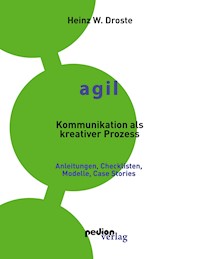
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nach der Lektüre von "AGIL" verfügen die Leser über ein Komplett-Paket mit Werkzeugen erfolgreicher Kommunikationsprofis. Sie profitieren bei zukünftigen Aufgabenstellungen im Bereich Social Media-Marketing, Presse- und Medienarbeit sowie Public Relations, indem sie - Problem-Konstellationen schneller erfassen und treffender reagieren - sich zügig in neue Aufgabenstellungen einarbeiten - ihre Kommunikations-Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln - in Krisensituationen wirkungsvollere Lösungsansätze ermitteln - kreativere und komplexere Kommunikations-Ideen entwickeln - ihre Arbeit übersichtlicher und überzeugender präsentieren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Eltern –
Rosa B. und Heinz W. Droste
Inhaltsübersicht
»Alle Fachleute sind sich einig:
Die Qualität von Public Relations
hängt ab von der Qualität
der Konzeption.
Anders gesagt:
Professionelles Konzipieren ist
Voraussetzung für
gute Public Relations.«(1)
Klaus Dörrbecker
Vorwort:
In sieben Schritten zum kreativenNetzwerk–Strategen
Qualifikations–Ziel dieses Buchs:
Die bisher üblichen PR–Patentrezepte und –Checklisten helfen nicht mehr weiter. Funktionierende Lösungen erfordern einen Rückgriff auf die aktuellen Ergebnisse angewandter Kommunikations– und Netzwerk–Forschung. Aktuelle Erkenntnisse und Daten sind mit Hilfe eines kreativen Verfahrens konsequent in praktische und teamfähige Vorgehensweisen umzuwandeln.
Hierfür liefert dieses Buch eine umfassende, innovative Kommunikations–Technologie – im Einzelnen: geprüftes Know–how, direkt einsatzfähige Analyse– und Konzeptions–Werkzeuge, Anleitungen, Checklisten und Case Stories.
Was Sie durch dieses Buch mitnehmen:
Leserinnen und Leser erhalten eine wirkungsvolle, unmittelbar einsetzbare »agile Formel« an die Hand.
Dieses AGIL-Konzept umfasst neben einem praxisbewährten Paket von Kommunikations–Tools eine gründliche, in sieben Schritte übersichtlich strukturierte Einweisung in die Nutzung dieser Werkzeuge.
Herausforderungen zeitgemäßer Public Relations bewältigen:
Die Kreativität von PR–Beraterinnen und PR–Beratern wird täglich durch komplexer werdende Herausforderungen und Fragen auf die Probe gestellt:
Wie können wir im dynamischen digitalen Zeitalter angesichts unüberschaubarer Interaktionsnetze unsere Kommunikations–Ziele sicher erreichen?
Wie setzen wir die Briefings von Unternehmen und Institutionen verantwortungsvoll, risikovermeidend und besonders wirksam im Meinungsmarkt um?
Wie können wir vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung der Öffentlichkeit als Kommunikations–Profis gleichermaßen produktiv, effektiv und kostenbewusst arbeiten?
Kommunikations–Profis haben vielfältige Netzwerke zu managen, die sich durch ein kommunikatives Eigenleben und eine Eigendynamik auszeichnen, die sich nicht durch klassische PR–Maßnahmen wie beispielsweise Presse– und Medienarbeit oder die gängige Social Media–Nutzung kontrollieren lassen.
Erfolgreiche Profis bewältigen ihre Aufgaben, indem sie stattdessen mit ständig neu entwickelten Lösungen wirkungsvoll am dynamisch–systemischen Prozess moderner Netzwerk–Kommunikation teilnehmen.
Eine neue Ära beginnt, und die stellt sich folgendermaßen dar:
In Zukunft heißen Public Relations,
»kompetent und verantwortlich die Kommunikationskanäle zu Dialoggruppen kreativ bestimmen und betreiben, mit dem Ziel, die legitimen Interessen des PR–Auftraggebers auf direktem Weg zu verwirklichen«.
Mit dem AGIL-Konzept haben Leserinnen und Leser ein Werkzeug bei der Hand, sich für diese neue Ära der Kommunikation zu qualifizieren.
Quellenhinweise
1.Dörrbecker, Klaus; Renée Fissenewert; Wie Profis PR–Konzeptionen entwickeln. Das Buch zur Konzeptionstechnik; Frankfurt/Main 2003 (4); S. 9
»No intuition should be
left untested, and one›s
most deep seated intuitions
should be revised
from time to time. «(1)
Mario Bunge
Einleitung
Kommunikation: Kreative Prozesse steuern
Leserinnen und Lesern ...
... wird in diesem Buch Schritt für Schritt ein Verfahren zur Entwicklung kreativer Kommunikations–Lösungen vermittelt. Mit diesem Verfahren werden sie zukünftig in der Lage sein, zügig relevante Fakten der Ausgangssituation zu ermitteln und darauf zugeschnitten wirkungsvolle Kommunikations–Mechanismen zum Einsatz zu bringen.
Es ist vor allem praktisches Interesse an PR–Konzeption und Maßnahmen–Planung, das die Leserinnen und Leser zu »AGIL« greifen lässt. Der Autor wird deshalb für die anschließende Vorstellung des AGIL-Ansatzes nicht unmittelbar notwendige Hintergrundinformationen zu Theorien, Forschung und Philosophien aussparen. Wer solche Details sucht, kann auf andere Veröffentlichungen des Autors zurückgreifen.(2)
Bevor es in die »Vollen« geht ...
Im nächsten Kapitel wird der Autor thematisch sofort »in die Vollen« gehen. Außerdem wird er diesen Einleitungsabschnitt möglichst kurz halten. Dieser soll lediglich dazu dienen, ein paar Hintergrundinformationen zu geben, für die in den folgenden Kapiteln keine Zeit und kein Raum verschwendet werden soll:
Vorgänger–Buch: Public Relations – Analyse–Schema
Ja, diesem Buch ist eine, wenn auch »schmale« Veröffentlichung vorausgegangen, die Dr. Heinz Flieger, der PR–Pionier und engagierte Förderer der deutschen PR–Forschung, in seinem Verlag vor Jahren herausgegeben hat.
Hintergrund: Als der Autor seine PR–Karriere begann, nahm ihn Heinz Flieger »unter seine Fittiche«. Flieger sorgte dafür, dass jener nicht nur die Ehre hatte, die damals noch aktiven »PR–Altmeister« Prof. Albert Oeckl, Prof. Franz Ronneberger und Georg–Volkmar Graf Zedtwitz–Arnim persönlich kennen zu lernen. Sondern der Autor wurde eingeladen, zusammen mit ihnen Mitgründer der PR–Akademie Wiesbaden zu werden, die Flieger an seine Gesellschaft zur Förderung der PR–Forschung anschloss.
Weiterhin regte Flieger den Autor dazu an, sich Gedanken über die Professionalisierung von PR–Konzeptionen zu machen. Die Ideenskizze, die daraufhin entstand, ist eben diese kleine Veröffentlichung »Public Relations – Analyse–Schema für die Praxis des PR–Beraters«.(3) Was Flieger und Droste im Jahr der Veröffentlichung (1989) nicht voraussehen konnten, ist die Tatsache, dass dieses Bändchen in die Liste der Basisliteratur von Kommunikations–Studiengängen an deutschen Universitäten aufgenommen werden sollte und sich heute in zahlreichen PR–Bibliographien findet. Mit solchen »Vorschuss–Lorbeeren« hatten Herausgeber und Autor nicht gerechnet.
Das Vorgänger-Buch ist »Geschichte«.
Doch nun liegt das Endprodukt vor, dessen Konturen in dem kurzen Vorgänger –Manuskript noch recht schemenhaft skizziert waren. Das »Analyse–Schema« ist damit Geschichte, »AGIL« ist das Endergebnis der Mission, die Heinz Flieger dem Autor mit auf den Weg gegeben hatte.
AGIL-Werkzeuge: »Auf den Schultern von Giganten«
Basis des Verfahrens, das in diesem Buch vermittelt wird, sind bewährte Analyse– und Konzeptions–Werkzeuge, die Wissenschaftler und Kommunikations–Experten entwickelt haben. Der Autor hat diese kreativen »Tools« für die Anwendung in der PR–Praxis weiterentwickelt. Neu erfinden brauchte er diese nicht. Lediglich die verschiedenen, in der Folge vorgestellten Anwendungs–Modelle, Case Stories und grafischen Umsetzungen sind von ihm selbst aufgrund langjähriger Beratungstätigkeit und aufgrund eigener Studien erstellt worden.
Die wichtigsten Werkzeuge, die Leserinnen und Leser hier bald kennen lernen werden, wurden von renommierten Sozialwissenschaftlern und Psychologen im »Department of Social Relations« an der Harvard University entwickelt. Dieses berühmte »Department« hieß eigentlich »The Department of Social Relations for Interdisciplinary Social Science Studies« und wurde im Jahr 1946 gegründet. Hintergrund war, dass begabten Wissenschaftlern – unter anderem aus den Bereichen Soziologie, Anthropologie und Psychologie – Gelegenheit gegeben werden sollte, über ihre Wissenschaftsbereiche hinweg interdisziplinär zu forschen. Ergebnis war, dass viele richtungweisende Forschungsprojekte z.B. in den Bereichen Persönlichkeits– und Motivationsforschung, in der kognitiven Psychologie, der Sozialpsychologie, der Psycholinguistik, der Wertorientierungs–Forschung, der Sozialpsychologie, der Wirtschafts–Soziologie und der Politologie angestoßen werden konnten. Viele der beteiligten Wissenschaftler und manche Harvard–Absolventen aus den Zeiten des Departments wurden zu international bedeutenden »Köpfen« der modernen Sozialwissenschaften.
AGIL nutzt interdisziplinäre »Tools«.
Hier ein »Vorgeschmack« auf die Werkzeuge, die Leserinnen und Leser bereits in den folgenden ersten Kapiteln kennen lernen werden: Eines der wichtigsten im AGIL-Ansatz verwendeten »Tools« gehört zu den »Produkten« der interdisziplinären Zusammenarbeit von Soziologen, Psychologen und Ökonomen im »Department«. Es dient zur Anleitung von kreativen »Sessions« und von Brainstormings, die sich durch einen qualitativ besonders hochwertigen Ideenfluss auszeichnen.(4)
Dieses Tool funktioniert gleichermaßen motivierend als Orientierungsinstrument und Wegweiser als auch als innovativer Ideengenerator. Mit diesem Instrument lassen sich diejenigen Kommunikations–Prozesse und –Strukturen übersichtlich aufzeichnen – »mappen« –, die im Anschluss eine Basis dafür bieten, zügig Mechanismen zur Lösung von Problemstellungen offen zu legen. – Die Details zum Einsatz dieses Werkzeugs werden wie gesagt in der Folge Schritt für Schritt vorgestellt.
Nun fragen wahrscheinlich manche Leserinnen und Leser, ob es sich tatsächlich lohnt, dieses und die weiteren Werkzeuge näher in Augenschein zu nehmen: Wird sich die zeitliche Investition in diese Instrumentarien tatsächlich auszahlen? Lohnt es sich, hier »Gehirn–Schmalz« zu investieren? Sind diese Tools überhaupt praxisrelevant?
Handfeste Vorteile in der Übersicht
Als motivierende Antwort mag der Hinweis dienen, dass der Autor und seine Team–Kollegen dieses besondere Werkzeug jahrzehntelang in der Kommunikations–Beratung, der Entwicklung und Umsetzung von PR–Konzeptionen einsetzten und dabei ständig verfeinerten. Dabei zeigte sich, dass Teams, die mit dem Instrument arbeiten, gegenüber »klassisch« arbeitender Konkurrenz eine ganze Reihe handfester Vorteile genießen, von denen hier einige aufgelistet sein sollen:
Schnelles Erfassen der Problem–Konstellation in einer komplexen Kommunikations–Situation
Schnelles Einarbeiten in neue Aufgabenfelder aufgrund einer steilen Lernkurve
zügige Entwicklung neuer Kommunikations–Kompetenzen in bisher »unbeackerten« Branchenfelder
Schnelles Entwickeln von erfolgsträchtigen Lösungen in Krisensituationen
Das Instrument ermöglicht detaillierte, aber dennoch pointierte und übersichtliche Präsentationen von Konzeptionen und Projektplänen etwa gegenüber den PR–Auftraggebern.
Das Instrument begünstigt innovative und kreative Lösungen, wenn es im Kommunikations–Research und als Orientierungsinstrument bei Studien eingesetzt wird.
(
5
)
Problemlösungs-Methoden der »Creative Education Foundation«
An dieser Stelle sei auch vorweggenommen, dass in »AGIL« nicht nur Werkzeuge zum Einsatz kommen, die an der Harvard University entwickelt wurden. Eine weitere wichtige Quelle ist die »Creative Education Foundation«, die im Jahr 1954 von Alex Faickney Osborn an der Universität von Buffalo im amerikanischen Bundesstaat New York gegründet wurde.
Gemeinsam mit einem Partner hatte Osborn ein Verfahren zur Entwicklung von kreativen Kommunikations–Lösungen entwickelt: den »Creative Problem Solving Process«. Die dabei gefundenen, bewährten Prinzipien kreativer Problembearbeitungen spielen in »AGIL« eine große Rolle, wenn es darum geht, ein teamfähiges Verfahren der Konzeptions–Entwicklung zu schaffen. Leserinnen und Leser wird es an dieser Stelle interessieren zu erfahren, dass Alex Faickney Osborn zu seiner Zeit nicht nur Bestsellerautor war,(6) sondern als Mitgründer und langjähriger Chairman der Werbeagentur BBDO fungierte – heute noch repräsentiert durch das »O« im Agenturnamen.
Kreativität: Kurs halten im Land der wilden Fantasien
In der Folge werden Leserinnen und Leser eins ums andere Mal in das »Land« der kreativen Imagination geführt. Wir werden es dort mit Evidenzen, Ahnungen, spontanen Eingebungen, unserem Gespür, plötzlichen »erhellenden« Einsichten, Gedankenblitzen, Assoziationen und insbesondere mit Intuitionen zu tun bekommen.
Intuition: Erkenntnisquelle mit zweifelhaftem Ruf
Zugegeben:Intuition und Imagination sind die Domänen von Scharlatanen und »Aufschneidern«, die sich auf diese »Erkenntnis–Zugänge« berufen, um mangelnde Kompetenz zu überspielen. Doch wir sind angewiesen auf kreative Imagination, wenn wir an der Einführung neuer Konzepte, dem Aufstellen neuer Hypothesen oder der Erfindung neuer Prozeduren oder Techniken arbeiten – kurz gesagt, wenn wir eine neue Idee haben.
Intuitionen und Imagination sind »unzuverlässige Embryos«, die offenbar einer besonders umsichtigen Behandlung bedürfen.(7) Wie kreative Ideen im Einzelnen zu behandeln sind, die als Ergebnis der Arbeit mit Kreativ–Werkzeugen entstehen, um daraus nützliche theoretische und technologische Anwendungen zu machen, hat der argentinisch–kanadische Wissenschaftsphilosoph und Physiker Mario Bunge in seinem umfassenden wissenschaftstheoretischen Werk ausgiebig beschrieben. Es ist also bekannt, auf welche Weise das »wilde Wesen« Intuition gebändigt werden kann.
Der Autor orientiert sich in diesem Problembereich bei der Entwicklung von AGIL konsequent an Bunges Überlegungen, allerdings ohne Leserinnen und Leser in diesem Buch mit Ausführungen zu den philosophischen Hintergründen der spannungsreichen Beziehung zwischen »Intuition und Wissenschaft« zu behelligen. Hier soll aber stellvertretend für solch eine philosophische Tiefen analyse die »Grundthese« festgehalten sein, an denen die Entwicklung des AGIL-Ansatzes orientiert ist:(8)
Als PR Professionals müssen wir unsere Intuitionen und Eingebungen deutlich von Annahmen unterscheiden, die objektiv erklärbar sind und für die es empirisch begründete Belege gibt. Dinge, die uns lediglich als evident, einleuchtend usw. erscheinen, erweisen sich im Laufe der Zeit allzu oft als Irrwege – auch wenn sie uns im ersten Augenblick spontan als überaus klar und wahr aufdrängten.
Wissenschaftler und Technologie–Anwender wissen, dass die Entwicklung tragfähiger Problemlösungen zweierlei voraussetzt:
»ungeduldiges« Erfinden und Assoziieren auf der einen Seite
und »geduldiges Überprüfen« dieser Vorschläge auf der anderen Seite
Um es noch einmal ein wenig anders zu formulieren:
Fruchtbare kreative Ideen erfordern beides:
kontrollierte Imagination – Fantasie, Vorstellungskraft, Gedankenexperimente –, die zu neuen Gedanken führt
eine geplante Vorgehensweise zur Hinführung auf diese Gedanken und zur empirischen Überprüfung und Kontrolle dieser neuen Ideen
Solide Lösungen ohne »heiße Luft«
Diese Einsichten seien direkt an den Anfang von AGIL gestellt. Damit sollen Leserinnen und Leser beruhigt werden, die möglicherweise befürchten, im Laufe dieses Buchs mit Fantastereien und obskuren Assoziations–Techniken konfrontiert zu werden, mit denen allerlei bizarre Gedankenketten gebildet, aber keine einsatzfähigen Kommunikations–Lösungen entwickelt werden können.
Der Feminisierung Tribut gezollt: Abschließender Hinweis an Leserinnen und Leser
Nach einführenden Worten geben Autoren von Fach– und Sachbüchern häufig Hinweise zu sprachlichen Besonderheiten der folgenden Kapitel. Nicht selten pflegen sich männliche Autoren bei Leserinnen wegen diskriminierend wirkender Redeweisen zu entschuldigen. Angesichts unseres besonderen Themenbereichs halten wir uns an dieses Ritual, »kehren« es allerdings gewissermaßen »um«. Denn das Berufsfeld der Public Relations hat sich in den letzten Jahrzehnten stark feminisiert – PR sind zur weiblichen Domäne geworden.
Public Relations sind weiblich.
Das Manuskript von »AGIL« war beinahe fertig geschrieben. Da wurde dem Autoren bewusst, dass die sich immer wieder »einschleichende« Terminologie »der PR–Berater« oder »der Konzeptioner« angesichts dieses Tatbestands unpassend ist und mit der Berufsrealität zu kollidieren droht.
Der Autor ist bestrebt, mit »AGIL« diejenigen Personen möglichst direkt anzusprechen, die mit den darin diskutierten Aufgaben hautnah konfrontiert sind. Wo es möglich war, kommen deshalb im Folgenden »Anreden« wie »PR–Beraterin« und »Konzeptionerin« zum Einsatz.
In der Hoffnung, dass auch der schrumpfende Anteil in der PR–Tagesarbeit verbliebener männlicher Berater sich für den AGIL-Ansatz interessiert, bittet der Autor nun abschließend seine Kollegen um Verständnis für die möglicherweise als diskriminierend empfundene feminisierte Ansprache des vorliegenden Buchs.
Quellenhinweise und Anmerkungen
1. Bunge, Mario; Intuition and Science; Englewood Cliffs/New Jersey 1962; S. 120
2. Siehe:
Droste, Heinz W. ;
Kommunikation. Planung und Gestaltung öffentlicher Meinung. Band 1: Grundlagen
/
Band 2: Mechanismen;
Neuss 2011
3. Droste, Heinz W. ; Public Relations – Analyse-Schema für die Praxis des PR-Beraters ; Wiesbaden 1989
4. Die Soziologin Renée C. Fox hat in einem biografischen Artikel festgehalten, wie eine beispielhafte »Kreativ-Session« von Harvard–Wissenschaftlern ablief – Teilnehmer waren im Jahr 1976 die Soziologen Robert Bellah, Harold Bershady, Victor Lidz und der langjährige Vorsitzende des »Departments« Talcott Parsons. (Renée C. Fox, »Talcott Parsons – Mein Lehrer«; in: Staubmann, Helmut; Harald Wenzel (Hg.); Talcott Parsons – Zur Aktualität eines Theorieprogramms; Österreichische Zeitung für Soziologie, Sonderband 6, Wiesbaden 2000; S. 15–30.).
5. Der Autor hat mit Hilfe des Harvard-Instrumentariums z. B. zusammen mit Soziologen an der Universität Düsseldorf und der Universität Bamberg zwei Studien (»Innovationen in mittelständischen Unternehmen«; »Börsengänge und Investor Relations mittelständischer Unternehmen«) durchgeführt und dokumentiert:
Droste, Heinz W. ;
Innovations–Monitor 2000 Mittelstand;
Grevenbroich 2000
Droste, Heinz W.;
Investor Relations Monitor Neuer Markt 1997–2000;
Grevenbroich 2000
Droste, Heinz W.;
Praktikerhandbuch Investor Relations. Mit IPO–Kommunikationskalender für die erfolgreiche Börsenpräsenz;
Stuttgart 2001
6. Osborn, Alex F.; Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Problem–Solving; New York 1963
7. Vergleiche:Bunge, Mario; Intuition and Science; Englewood Cliffs/New Jersey 1962; S. 104–11
8. Vergleiche: ebenda: S. 67–120
»In der ersten Phase der PR–Planung
wird der systematische und
zugleich kreative Charakter
der PR–Arbeit deutlich.«(1)
Fritz Neske
Ausgangspunkt:
Das Strategiemodell der Public Relations
1. Ausgangspunkt der Öffentlichkeitsarbeit
Der konkrete Anlass für die Tätigkeit der PR–Beraterin liegt im Auftrag, der von einer Organisation ausgeht.
Begriff der Organisation
Organisation soll im Folgenden ganz allgemein als Begriff für eine Ordnung von arbeitsteilig und zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und Gruppen dienen. Der Begriff der Organisation bezeichnet also nicht nur Verbände und Vereinigungen, sondern alle Institutionen, Gruppen und sozialen Gebilde, deren Angehörige geplant auf ein Ziel hinarbeiten, arbeitsteilig gegliedert sind und ihre Aktivität auf Dauer eingerichtet haben. Wenn eine Organisation als Auftraggeber für Öffentlichkeitsarbeit auftritt, so kann es sich hierbei beispielsweise um ein Wirtschaftsunternehmen aber auch um einen politischen Verband handeln.
Die PR–Beraterin ist entweder Mitarbeiterin der PR–Abteilung der betreffenden Organisation oder sie kann als externe Beraterin mit der Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit betraut sein.
Bei besonderen Problemen oder bei besonderen Aufgabenstellungen übernehmen externe PR–Beraterinnen über begrenzte Zeiträume Öffentlichkeitsarbeit, die ein Verband oder ein Unternehmen in dieser konkreten Situation aus eigener Kraft nicht bewältigen kann. Möglicherweise möchte sich der Auftraggeber den organisatorischen Aufwand einer eigenen PR–Abteilung sparen und greift deshalb auf externe Hilfe zurück.
Die konkrete Öffentlichkeitsarbeit hat sich an den institutionalisierten Zielen der Organisation zu orientieren. Darüber hinaus liegen meist eine Reihe von Entscheidungen über die Grundprinzipien und Maßstäbe der Öffentlichkeitsarbeit vor, die in der Philosophie oder den Maximen des Handelns der Organisation verankert und als verbindlich festgelegt sind.
Aufgabe der PR–Beraterin ist es ganz allgemein, ein Verhältnis von gegenseitigem Verstehen und Vertrauen zwischen dem Auftraggeber und der Öffentlichkeit zu erreichen und zu erhalten.
Aufgrund von Offenheit und gezielter Information soll gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz aufgebaut werden.
Adressaten der Öffentlichkeitsarbeit
Adressat der Öffentlichkeitsarbeit kann ein eng umgrenzter Personenkreis sein, mit dem es die Organisation – der politische Verband oder das Wirtschaftsunternehmen – zu tun hat. Die Arbeit der PR–Beraterin kann aber auch auf die gesellschaftliche Gemeinschaft insgesamt bezogen oder gar über nationale Grenzen hinweg international orientiert sein.
2. Das Strategiemodell der Öffentlichkeitsarbeit
Vierstufiges Strategiemodell
Diesen Bemühungen um das gegenseitige Verständnis zwischen Organisation und Öffentlichkeit liegt üblicherweise ein vierstufiges Strategiemodell(2) zugrunde, anhand dessen PR–Aktionen von der PR–Beraterin planvoll und zielführend konzipiert und durchgeführt werden (siehe Abb. 1).
PHASEN DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
SITUATIONSANALYSE:Untersuchung der Ausgangslage
PLANUNG:Entwicklung von Kampagnenmotiven
DURCHFÜHRUNG:Realisierung der einzelnen PR–Aktionen
ERFOLGSKONTROLLE:Untersuchung der Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit
Abb. 1: Phasen der Öffentlichkeitsarbeit
Situationsanalyse
Die PR–Tätigkeit beginnt mit einer Situationsanalyse; die Ausgangslage vor dem Beginn der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit wird untersucht.
Planung
Der nächste Schritt ist die Planung; hier werden die Adressaten der Öffentlichkeitsarbeit festgelegt, Zielgruppen definiert, Leitmotive für die Öffentlichkeitsarbeit entwickelt, Medien zum Transport dieser Motive ausgewählt. Zeitplanung sowie Kostenplanung gehören ebenfalls zu dieser Arbeitsphase.
Durchführungsphase
Im dritten Schritt, in der Durchführungsphase, wird die PR–Kampagne mit ihren einzelnen PR–Aktionen realisiert.
Erfolgskontrolle
Eine mit Mitteln der empirischen Sozialforschung durchgeführte Untersuchung ermittelt idealerweise im letzten Schritt, welchen Fortschritt die Kommunikation der betreffenden Organisation aufgrund der PR–Kampagne gemacht hat. Durch diese Erfolgskontrolle soll der Grad der Informiertheit der Öffentlichkeit über die Organisation und das Ausmaß des Verständnisses für ihre Belange dokumentiert werden.
3. Sammlung und Analyse der Informationen als erster Schritt der Öffentlichkeitsarbeit
Die Tätigkeit der PR–Beraterin beginnt mit der Bestandsaufnahme und der Analyse der Ausgangssituation des Auftraggebers.
Am Anfang der Öffentlichkeitsarbeit steht damit die Aufgabe, ein zutreffendes Bild von der Situation und von der Kommunikation einer Organisation – etwa einer Institution oder eines Unternehmens – zu zeichnen (siehe Abb. 2).
SITUATIONSANALYSE
Sammlung aller relevanten Informationenintern: Eigenbild der Organisationextern: Image der Organisation in der ÖffentlichkeitAnalyse des Faktenmaterialsintern und extern: realistisches Bild der KommunikationssituationFeststellung der Probleme und Chancen in der Beziehung zwischen Organisation und ÖffentlichkeitAbb. 2: Situationsanalyse
Faktensammlung
Zunächst werden Fakten und Daten gesammelt und zusammengestellt. Im Blickpunkt liegt das Faktenmaterial, das beim Auftraggeber selbst recherchiert werden kann und somit in der Struktur der Organisation zu ermitteln ist.
1. Schritt: Blick nach Innen
In einem ersten Schritt werden alle erreichbaren Informationen, seien es Selbstdarstellungen eines Unternehmens, Protokolle von Vorstandssitzungen, frühere Presseerklärungen usw., zusammengestellt und vorsortiert.
Es kommt darauf an, die Organisation aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu erfassen und dazu eine umfassende geordnete Sammlung von Fakten und Daten vorzulegen.
Aus diesem Material herauszuarbeiten ist zunächst, wie sich das Unternehmen selbst sieht, welches Eigenbild es im Einzelnen hat. Es ist festzuhalten, wie es die eigenen Leistungen und seine Beziehung zur Öffentlichkeit einschätzt.
Katalog mit Grundinformationen
Mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Informationen wird ein Katalog mit Grundinformationen aufgestellt, der folgende Themenkreise abdeckt:
allgemeine Ziele der Organisation
Philosophie
verbindliche Wertvorstellungen
geschichtliche Entwicklung der Organisation
Prinzipien der Organisationspolitik
Dienstleistungen oder Produkte, welche die Organisation anbietet
rechtliche Voraussetzungen des Wirkens der Organisation
innerer Aufbau und Abläufe der Organisation
wirtschaftliche Lage
Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit bisher
Adressaten der Öffentlichkeitsarbeit der Organisation
Im Fall eines Wirtschaftsunternehmens gilt es beispielsweise, zunächst genau festzuhalten, an welchen Wertvorstellungen sich die Geschäftspolitik des Unternehmens orientiert.
Neben diesen Grundprinzipien der Unternehmensführung ist von Interesse, welche Produkte hergestellt werden bzw. welche Dienstleistungen angeboten werden, welche wirtschaftlichen Ergebnisse damit jeweils erzielt werden (Wirtschaftsdaten) und wie der äußere Auftritt des Unternehmens gestaltet ist.
Entwicklungs-Perspektiven
Von Interesse ist auch die geschichtliche Entwicklung, die das Unternehmen seit seiner Gründung genommen hat und eine Einschätzung dazu, welche Entwicklungen für die Zukunft zu erwarten sind.
Besondere Beachtung verdient das »Betriebsklima« in einem Unternehmen, also ein Überblick darüber, welche Meinungen und Urteile es intern in Bezug auf den Arbeitgeber gibt.
Für die Planung von PR–Aktivitäten ganz entscheidend ist die Feststellung der spezifischen Zielgruppen des Unternehmens, insbesondere die Feststellung der Adressaten der im Folgenden zu planenden PR–Aktivitäten.
2. Schritt: Blick nach Außen
In einem zweiten Schritt werden Informationen ermittelt, die von außerhalb der Organisation kommen. Hier geht es insbesondere um die Erforschung der öffentlich vertretenen Meinungen und Urteile gegenüber dem PR–Auftraggeber.
Die dazu notwendigen Informationen erhält die PR–Beraterin durch Auswertung vorliegender demoskopischer Untersuchungen und von Studien, die speziell für die Erkundungsphase der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden.
Darüber hinaus wird die Berichterstattung der Medien über die Organisation betrachtet sowie der Meinungsaustausch mit Journalisten gesucht, die mit der Berichterstattung über den betreffenden Auftraggeber betraut sind.
Nützlich sind an diesem Punkt der Informationssammlung Verbands– und Branchenberichte, Urteile von Fachleuten und sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse.
Hat die PR–Beraterin diesen Schritt der Informationssammlung bewältigt, den aktuellen Bestand an Meinungen und Urteilen in den wichtigen Zielgruppen über die Organisation zusammengestellt, zeichnet sich das Image ab, welches das Unternehmen oder die Institution im Rahmen der bisherigen PR–Politik in der Öffentlichkeit bewirken konnte.
4. Die Analyse von Image und Eigenbild
Es ist wie gesehen in der PR–Branche verbreitet, die Aufgabe der PR–Beraterin zu definieren als Versuch, »gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen ihrem Auftraggeber und der Öffentlichkeit zu erreichen und zu erhalten«.
Indem sie die gerade beschriebene Informationssammlung durchgeführt hat, verfügt die PR–Beraterin über die erste Analyse des Verhältnisses von Auftraggeber und Öffentlichkeit, welche ihr als Grundlage für ihre nächsten Arbeitsschritte dient.
Relation zwischen Eigen- und Fremdbild
Diese Analyse besteht aus der genauen Untersuchung der Relation, in der das Eigenbild der auftraggebenden Organisation – also die Selbsteinschätzung ihrer Mitglieder – zu dem Bild steht, das sich die Öffentlichkeit von ihr macht – in der mit anderen Worten Eigenbild und Image des Auftraggebers stehen.
Als erstes Ergebnis dieser Untersuchung ergibt sich ein realistisches Bild von der Kommunikationssituation, die beide Aspekte – Eigenbild und Image – erfasst. Beide werden von der PR–Beraterin gegenübergestellt und anhand des objektiven Faktenmaterials gegeneinander abgewogen.
Als eine aus Prinzip »außenstehende« Betrachterin ermittelt die PR–Beraterin, wo die auftraggebende Organisation Konfliktstoff in die Kommunikationssituation hineinbringt. Sie stellt fest, wo die Notwendigkeit der Anpassung an begründete Anliegen der Öffentlichkeit besteht, wo die Öffentlichkeit berechtigte Anliegen hat, die eine Veränderung des Handelns und der Kommunikation der Organisation erfordern.
Konflikte in der Kommunikationssituation von Organisation und Öffentlichkeit sind nicht allein in der Struktur der Organisation des Auftraggebers begründet. So hat die PR–Beraterin festzustellen, wo die Öffentlichkeit Informationsdefizite hat und der Organisation Verständnis und Zustimmung schuldet, die sie ihr derzeit noch vorenthält.
Mithilfe dieser ersten Analysen werden die Probleme, Schwachstellen und Gefahren im Verhältnis der Organisation zur Öffentlichkeit ermittelt.
In einem nächsten Schritt gilt es, Anknüpfungspunkte für die zu konzipierenden PR–Aktivitäten herauszuarbeiten. Die PR–Beraterin untersucht, wo der Auftraggeber Stärken hat, die zur Verbesserung der Beziehung zur Öffentlichkeit beitragen können. Entsprechend stellt sie fest, wo in der Öffentlichkeit Chancen liegen, die Kommunikation zu verbessern.
Öffentlichkeitsarbeit bewirkt auf diese Weise einen planbaren Anpassungsprozess zwischen der Organisation und der Öffentlichkeit, bei dem die Situationsanalyse als Faktenbasis eine entscheidende Rolle spielt.
Mit der Situationsanalyse erarbeitet die PR–Beraterin ein umfassendes Bild von den Problemen in einer Kommunikationssituation auf der einen Seite und erfasst auf der anderen die Chancen zur Verbesserung der Situation.
5. Situationsanalyse, Planung, Durchführung
Der wie gesehen erste Schritt im Rahmen der PR–Tätigkeit für einen Auftraggeber – die Situationsanalyse der Ausgangslage – steht in engem Zusammenhang mit den anschließenden Planungs– und Durchführungsschritten.
Überwindung von Defiziten ist Basis-Kriterium.
Es sind die aufgrund der Situationsanalyse festgestellten Diskrepanzen in der Kommunikation zwischen Auftraggeber und der Öffentlichkeit, an denen die Planung der PR–Aktionen ansetzt und an deren Behebung letztendlich der Erfolg der später durchzuführenden PR–Aktionen gemessen wird.
Es sind die Ergebnisse dieser Situationsanalyse, aufgrund derer die PR–Beraterin die für die Planungen notwendigen Lösungsalternativen ersinnt und deren Erfolgschancen abschätzt.
Eine gewissenhafte – präzise und umfassende – Situationsanalyse gewährleistet, dass Risiken, die in der Entscheidung für eine konkrete PR–Aktion liegen, von vornherein sichtbar werden.
Darüber hinaus können die Ergebnisse dieses ersten Schritts der Öffentlichkeitsarbeit Implikationen für den gesamten institutionellen Rahmen der Organisation haben, in dem die PR–Beraterin mit der Übernahme ihrer Aufgabe betraut worden ist:
Es kann im Einzelfall das dringende Erfordernis ermittelt werden, die vom Auftraggeber vorgegebenen grundlegenden Prinzipien und Zielvorstellungen für die Öffentlichkeitsarbeit zu überdenken und im Detail zu revidieren.
6. Kriterien für eine adäquate Situationsanalyse
Aus dem Bisherigen lassen sich eine Reihe von Anforderungen an die PR–Beraterin und ihre erste Aufgabe ableiten, die grundlegenden Informationen zu sammeln, aufzubereiten und in ein analytisches Bild von der zu bearbeitenden Problemsituation zu bringen (siehe Abb. 3):
Die relevanten Informationen zur Kommunikationssituation von Organisation und Öffentlichkeit sind umfassend zu berücksichtigen.
Frei von persönlichen Wünschen und Vorurteilen soll die vorliegende Situation objektiv bewertet und gedeutet werden.
Zutreffendes und stimmiges Bild der Ausgangslage
Unter Anknüpfung an ihre bisher in der Praxis gemachte Erfahrung soll die Beraterin alle relevanten Informationen zu einem zutreffenden und stimmigen Bild der Ausgangslage zusammenstellen. Nur so kann der Gesamtzusammenhang der Probleme und Chancen ihrer Öffentlichkeitsarbeit für den Auftraggeber nachvollziehbar aufbereitet werden.
Im nachfolgenden Kapitel werden die formalen Kriterien der Situationsanalyse im Einzelnen diskutiert. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob die in diesem Kapitel ermittelten drei Kriterien ausreichen oder ob sie eventuell noch zu ergänzen sind.
KRITERIEN FÜR EINE ADÄQUATE SITUATIONSANALYSE:
Vollständigkeit der InformationserfassungObjektivität der Darstellung der AusgangssituationNachvollziehbarkeit der Ergebnisse der AnalyseAbb. 3: Kriterien für eine adäquate Situationsanalyse
7. Hilfsmittel der Öffentlichkeitsarbeit
Für die Planung und Durchführung von PR–Aktionen kann auf zahlreiche ausgereifte Hilfsmittel zurückgegriffen werden – wie beispielsweise auf Netzpläne oder Muster–Projektlisten. In der PR–Praxis fehlen solche Planungshilfen bisher allerdings, wenn es um die Durchführung von Situationsanalysen geht.
Dennoch ist für diese komplexe Aufgabe am Anfang jeder Öffentlichkeitsarbeit ein standardisiertes Verfahren notwendig:
Standard für adäquate Situationsanalyse
Die PR–Beraterin benötigt einen Leitfaden für die planvolle, detaillierte Recherche, die nicht lediglich das allseits Bekannte aufgreift. Es ist ein analytisches Modell erforderlich, das neue Einsichten und einen tiefen Einblick in die Problematik der realen Kommunikationssituation ermitteln hilft.
Nichts ist peinlicher, als eine Konzept–Präsentation, an deren Ende ein Auftraggeber der PR–Beraterin nach vorgetragener Situationsanalyse erklärt, das wisse er als Laie alles selber und er vermisse die fachlichen, weiterführenden Erkenntnisse.
Das Design eines solchen Analyse–Schemas für die Ausgangssituation von PR–Aktivitäten ist an den im letzten Abschnitt ermittelten formalen Kriterien Vollständigkeit, Objektivität und Nachvollziehbarkeit auszurichten.
Wie die bisherigen Überlegungen dieses ersten Kapitels zeigen, hat dieser Begriffsrahmen eine ganze Reihe von Leistungen zu erbringen, die wir hier in vier Punkten zusammenfassen:
Punkt 1: Interaktive Prozesse erfassen
Erster Punkt (1): Der zu entwickelnde Begriffsrahmen muss tauglich sein, interaktive Prozesse und Kommunikation zu erfassen.
Es gilt, komplexe Kommunikationsvorgänge, vielfältige Meinungsbilder zu dokumentieren und zu analysieren. Wie gesehen muss ein »räumliches«, mehrere Ebenen umfassendes Bild von der Situation erstellt werden.
Zunächst hat die PR–Beraterin das Eigenbild der auftraggebenden Organisation zu registrieren. Entsprechend hat sie das Meinungsbild in der Öffentlichkeit zu ermitteln und festzustellen, welches Image die Organisation hier hat. Anschließend ist beiden – Eigen– und Fremdbild – eine umfassende Meinungsanalyse gegenüberzustellen, die beide Blickrichtungen erfasst und mit der objektiven Tatsachenlage konfrontiert.
Dabei muss die PR–Beraterin auf drei verschiedenen Kommunikationsebenen arbeiten:
Sie hat sich die Ordnung der Kommunikation innerhalb der auftraggebenden Organisation zu erarbeiten (a).
Sie muss die mit einem grundlegend anderen »Sprachstil und –verständnis« operierenden Meinungsäußerungen im Bereich der Öffentlichkeit erfassen (b) und darüber hinaus auf einer analytischen Betrachterebene arbeiten (c).
Am Ende ihrer Arbeit muss die PR–Beraterin schließlich ihr Arbeitsergebnis von dieser analytischen Ebene aus auf die Ebene des Auftraggebers rückübersetzen.
Punkt 2: Erklärungsrelevante Fakten
Der zweite wesentliche Punkt (2) in der Leistungsbeschreibung eines solchen Begriffsrahmens ist das Erfordernis, mit der vorgelegten Analyse die erklärungsrelevanten Fakten ablesbar zu machen. Der Begriffsrahmen muss die Untersuchung der kausalen Bedingungen der Kommunikationssituation anleiten. Es muss ablesbar werden, welche Umstände für die besondere Funktionsweise der Kommunikation des Auftraggebers und seiner Zielgruppen verantwortlich sind.
Erst mithilfe eines solchen analytischen Instruments zeichnet sich ab, in welchen Bereichen der Kommunikation Schwierigkeiten zu erwarten sind, aber auch, wo Vorteile und Stärken liegen, die dazu dienen können, Diskrepanzen auszugleichen.
Punkt 3: Grundprinzipien der PR-Arbeit
Das dritte Erfordernis (3) betrifft den Gesamtrahmen, in dem die Öffentlichkeitsarbeit stattfindet.
Bei allen Arbeitsschritten – auch bei der Situationsanalyse – müssen die Grundprinzipien und Maßstäbe der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt bleiben, die der Auftraggeber für die Öffentlichkeitsarbeit vorgegeben hat.
Außerdem hat sich die Recherche der Informationen eng an den konkreten PR–Auftrag zu halten und die Informationsbeschaffung zielgerichtet an den sich abzeichnenden Problemen auszurichten.
Entscheidend ist darüber hinaus, dass in diesem ersten Schritt der Öffentlichkeitsarbeit die Erfordernisse der folgenden Planungs– und Durchführungsschritte zu ihrem Recht kommen. So müssen Ansatzpunkte für Lösungsstrategien verfügbar und Ideen für konkrete PR–Aktionen herleitbar werden. Schließlich gilt es, die Bezugspunkte zu ermitteln, anhand derer bei der Erfolgskontrolle die Messung des PR–Erfolgs vorgenommen werden kann.
Punkt 4: Geschlossenes Gesamtbild
Das vierte Erfordernis (4) hat mit dem Kriterium der Nachvollziehbarkeit zu tun, das im vorhergehenden Abschnitt besprochen wurde:
Gerade wegen der Komplexität der Zusammenhänge, mit denen es die PR–Beraterin bei der Ausgangssituation zu tun bekommt, sollte die Situationsanalyse übersichtlich gestaltet sein und die Informationsfülle in ein geschlossenes Gesamtbild verpacken. Da komplizierte Zusammenhänge durch grafische Darstellungen und Modelle sichtbar und handhabbar werden, sollte dieses Begriffsschema Ansätze bieten, die Situationsanalyse und alle gefundenen Zusammenhänge angemessen zu visualisieren.
Damit ergibt sich zusammengefasst als Ergebnis dieses Kapitels für das Instrument zur Anleitung und Durchführung der Situationsanalyse:
Der gesuchte Begriffsrahmen ermöglicht die Beschreibung und Analyse von interaktiven Prozessen. Diese Prozesse sind die wichtigen erklärungsrelevanten Fakten des Gesamtbildes einer Kommunikationssituation. Sie sind bei der Definition der Aufgabenstellung in den Mittelpunkt zu stellen.
Quellenhinweise und Anmerkungen
1.Neske, Fritz; PR–Management; Gernsbach 1977; S. 9
2. Das hier vorgestellte Phasenmodell ist über die Jahre ein Stück »PR–Folklore« geworden. Es findet sich als »Evergreen« in beinahe jedem Buch zu PR–Konzeption und PR–Strategie. Auch wenn mancher Autor Formulierungsvariationen erfindet, so konzentriert sich die Diskussion stets auf die selben vier strategischen »Grundbausteine« unseres ersten Kapitels:
Dörrbecker, Klaus; Renée Fissenewert;
Wie Profis PR–Konzeptionen entwickeln
(2003)
Fissenewert, Renée; Stephanie Schmidt;
Konzeptionspraxis
; Frankfurt/ Main 2004 (2)
Hendrix, Jerry;
Public Relations Cases
; Belmont/Kalifornien 2003 (6)
Kendall, Robert;
Public Relations Campaign Strategies. Planing for Implementation
; New York 1997 (2)
Knödler–Bunte, Eberhard; Klaus Schmidbauer;
Das Kommunikationskonzept. Konzepte entwickeln und präsentieren
; Potsdam 2004
Leipziger, Jürg W.; Konzepte entwickeln.
Handfeste Anleitungen für bessere Kommunikation
; Frankfurt/Main 2007 (2)
Marston, John E.;
The Nature of Public Relations;
New York 1963
Neske, Fritz;
PR–Management
; Gernsbach 1977
Oeckl, Albert; PR–Praxis.
Der Schlüssel zur Öffentlichkeitsarbeit;
Düsseldorf, Wien 1967
Schulze–Fürstenow, Günther (Hg.);
Handbuch für Öffentlichkeitsarbeit (PR)
– (Loseblattsammlung); Neuwied
Smith, Ronald D.;
Strategic Planning for Public Relations;
Mahwah/New Jersey 2005 (2)
Szyszka, Peter; Uta–Micaela Düring (Hg.);
Strategische Kommunikations– Planung (Praxis PR);
Konstanz 2008
Weintraub Austin, Erica; Bruce E. Pinkleton;
Strategic Public Relations Management. Planing and Managing Effective Communication Programs
; Mahwah/New Jersey 2006 (2)
»Scientific research starts
with the realization
that the available fund of
knowledge is insufficient
to handle certain problems.«(1)
Mario Bunge
Schritt 1:
Die zuverlässige Situationsanalyse
1. Der allgemeine Handlungsbegriff
Unsere Aufgabe ist es, ein alternatives Planungs–Verfahren zu entwickeln, welches das in der PR–Profession übliche Abarbeiten der schlichten PR–Konzeptions–Standard–Checkliste ablöst.
Das »Grundrezept« der Public Relations hat – wie das erste Kapitel zeigte – eine typische viergliedrige Grundstruktur. In einer ersten Phase – der Situationsanalyse





























