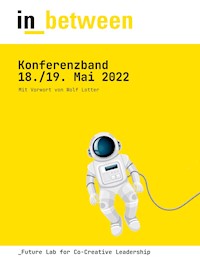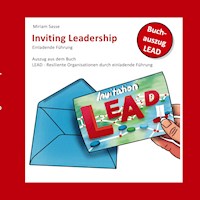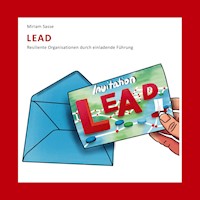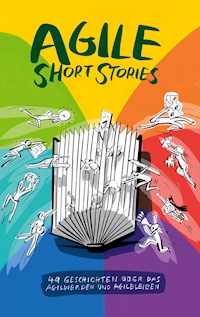
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten transportieren mehr als nur Wissen. Sie berühren, inspirieren, schaffen Nähe und ein Gespür für andere Menschen. Geschichten zeigen etwas von uns selbst und werden so zur Hilfe, wenn wir uns in ähnlichen Situationen befinden. In diesem Buch teilen 45 Autorinnen und Autoren ihre Erlebnisse aus der Welt der Agilität. Es sind erfahrene Product Owner, Scrum Master, Führungskräfte, Agile Coaches, Berater und Organisationsentwickler. Sie erzählen wahre Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag und ihrem persönlichen Leben: über die ersten Schritte und Spannungen in Teams, förderliche und hinderliche Führung, Verluste und Ängste, erstaunliche Entwicklungen, klare Werte und Haltungen. Diese Geschichten machen das Angebot, als Menschen voneinander zu lernen. Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie Flying Hope e.V. Erweiterte Auflage mit Glossar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judith Andresen, Petra Berleb, Kathinka Best, Hendrik Bornholdt, Thomas van der Burg, Susanne Bretfeld, Conny Dethloff, Jean Michel Diaz, Philipp Diebold, Sabrina Dittrich, Alexander Dobry, Julia Dorenkamp, Jutta Eckstein, Frank Edelkraut, Claudia Eisinger, Heinz Erretkamps, Masud Fazal-Baqaie, Peter Gfader, Monika Grosser, Philipp Hammerer, Christian Heidemeyer, Chereen Heinrich-Cibis, Philipp Hohl, Marion Janotta, Siegfried Kaltenecker, Jan Köster, Dina Kohler, Veronika Kotrba, Sabina Lammert, Cosima Laube, Alexa Lorenz, Dominik Maximini, Daniel Mezick, Ralph Miarka, Joachim Pfeffer, Janna Philipp, Juliane Pilster, Carolin Salz, Miriam Sasse, Frank Sazama, Alisa Stolze, Veronika Unterrainer, Gerhard Wohland und Klaus Wybranietz
Inhalt
Vorgeschichte
Agiler Anfang
Durch die Liebe zur Agilität
Agiler Erstkontakt mit Schreibfehler
Lesson – learned
Lastenheft_V3.6_final_07
Must I evolve?
Vom Chaos zur Kooperation
Das Zauberwesen in mir: Die Visualisierungsfee
Plan B oder: fürs Leben lernen
Wie man Scrum ohne Scrum macht
Die erste große Liebe
Agile Menschen
Inspektor Coach
Brücken bauen in Bangalore
Cost of Delay
New Work: Lösung oder Problem?
Wie Gegenwind auch ohne Flugzeug nützt
Eine Fahrt über die Alpen
Wie aus Neugier und Lernen Freude entsteht
Mammutjäger
Warum ich Hackathons liebe
Product Owner gesucht – Superheld gefunden
Agile Leadership
Wie MS Project mein Leben veränderte
Raus aus dem Engpass, rein ins Vertrauen!
Wie Machtstreben Teams zerstört
Von einer die auszog, das Agile zu lernen
Unter Wasser
Echte Führung im Change-Prozess
Der Tunnel
Agile Transformation
Es ist Zeit, agil zu werden!
Was kann dein Kunde für dich tun?
Einfach mal loslassen
Wie man Agilität möglichst unagil einkauft
Ein Rettungsplan kämpft gegen den Rollout-Plan
Geschichten schreiben Geschichte
Entwicklungszeit halbe!
Hürdenlauf zur agilen Hardwareentwicklung
Über agile Transformation und das Bergsteigen
Agile Mythen, Scrum und andere Märchen
Agile Werte
Und aus der Struktur wächst Flexibilität
Die Scrum-Verschwörung
Sportlich zur Agilität
Agile Living
Abraham hat recht
Ein Fuck-up kommt selten allein
Terror. Überleben. Neuordnung
Das Experiment
Day 1 – Ctrl Alt Delete
Learning to love them
Agiles Ende
Epilog - Nachgeschichte
Glossar
Danke
Vorgeschichte
Schön, dass du dieses Buch gekauft oder geschenkt bekommen hast! Wir haben für dich 49 Geschichten gesammelt: über Veränderungen in der Arbeitswelt, agile Teams und persönliche Wege. Alle Geschichten sind in sich abgeschlossen – du kannst also an jeder beliebigen Stelle zu lesen beginnen, Geschichten überspringen oder ganz klassisch eine nach der anderen genießen.
Natürlich hätten wir einfach ein Vorwort schreiben können. Doch dieses Geschichtenbuch hat selbstverständlich eine Vor-Geschichte. Wenn du hier weiterliest, erfährst du, wie wir – Joachim und Miriam – überhaupt auf die Idee gekommen sind, gemeinsam mit 45 anderen Autorinnen und Autoren ein Buch herauszubringen, und wie aus einer Idee Schritt für Schritt – mit allen Höhen und Tiefen – Realität geworden ist.
Wir wünschen dir viel Freude mit 49 persönlichen Erkenntnissen und Erlebnissen aus der agilen Arbeitswelt!
Miriam & Joachim
PS: Weitere Informationen zum Buch und ein Glossar findest du unter agile-short-stories.de
2017, Juni – Miriam
»Magst du deine Geschichten nicht mal aufschreiben, Joachim?«
Mit 60 km/h rollt mein Wagen hinter dem LKW her. Der Feierabendverkehr ist kaum auszuhalten. Daher nutzen Joachim und ich diese tägliche Stunde im Auto meistens, um uns über unsere Erlebnisse des Tages auszutauschen.
»Aufschreiben? Was soll das denn bringen? Meinst du, das will irgendjemand lesen?«
Diese rhetorische Frage muss ich eigentlich nicht beantworten.
Vor zwei Monaten hat uns der Zufall zum zweiten Mal unabhängig voneinander an den gleichen Arbeitsplatz geführt. Reiner Zufall, dass unsere Schreibtische sogar im gleichen Raum einander gegenüberstanden. Wieder ging es um die Einführung von Agile – nur bei einem anderen Arbeitgeber, 43 Kilometer entfernt vom vorherigen. Seit zwei Monaten tauschen wir uns regelmäßig über unsere Erlebnisse im Rahmen agiler Transformationen aus. Joachim erzählt mir viele Geschichten, die er in unterschiedlichen Branchen als Berater erlebt hat.
»Ich höre deine Geschichten immer gerne. Dadurch lerne ich mehr über agile Transformationen als durch irgendwelche Theorien. Deine Geschichten vermitteln mir ein besseres Gefühl dafür, was wirklich wichtig ist.«
Joachim geht nicht weiter darauf ein und erzählt stattdessen die nächste Geschichte.
2018, Juni – Joachim
Da sitzen wir, am Check-in-Counter des Scrum Days in Stuttgart, und verschenken unsere Bücher. Jeder, der es haben möchte, bekommt »Open Space Agility kompakt«. »Warum? Was ist das? Wie führt man damit agile Transformationen durch?«, fragen uns die Teilnehmer. Wir erzählen unsere Geschichte: Wie ich durch Zufall auf Daniel Mezick aufmerksam wurde. Warum OpenSpace Agility die Antwort auf unsere damaligen Probleme war. Was ich damit in meiner eigenen Beratung erlebt habe.
»Finde ich die Geschichten in diesem kleinen Büchlein?«, fragt eine der Scrum-Day-Teilnehmerinnen.
»Nein, hier haben wir das Konzept beschrieben. Die Geschichten aus unserem Arbeitsleben haben wir nicht aufgeschrieben.« Sie sieht mich sichtlich enttäuscht an.
»Und wo höre ich mehr von deinen Geschichten?«
»In unseren Vorträgen und Trainings. Oder wir treffen uns nach der Pause und ich erzähle dir mehr.«
2018, September – Miriam
Wie kann ich mich verbessern, über meine eigene Erfahrung hinaus? Kann ich von den Erfahrungen anderer lernen? Oder muss ich erst alles selbst erlebt haben, um es zu können? Wie kann ich trotz der Widrigkeiten im Unternehmen etwas völlig Neues und Anderes erschaffen? Wenn Agile hier im Unternehmen unmöglich ist, wie kann ich das Unmögliche in das einzig Mögliche verwandeln? Mit den Zahlen, Daten und Fakten zu Agile komme ich nicht weiter. Immer wieder stoße ich an die Grenzen: Wir haben keine Zeit, kein Geld oder keine Leute. Es ist unmöglich – es sei denn, wir verzerren die Realität zu unseren Gunsten.
»Miriam, wir werden in den nächsten Monaten kaum agile Projekte haben und auch die neue Geschäftsführung wird ihren Schwerpunkt auf etwas anderes legen. Am besten suchst du dir externe Projekte, in denen du Scrum und Kanban anwenden kannst«, sagt ein Kollege zu mir. Wie sehr wünsche ich mir eine gute Fee oder einen überraschenden Kundenauftrag, der alles möglich macht. In Märchen passiert so etwas, im wahren Leben nicht unbedingt. Wenn ich jetzt eine mitreißende Geschichte erzählen könnte, könnte ich vielleicht mehr Kollegen vom agilen Arbeiten begeistern.
Immer wieder heißt es: »Erzählt die Geschichte dahinter.« Aber für mich fühlt sich das falsch an. Schließlich bin ich im Herzen Wissenschaftlerin, habe lange an der Uni gelernt und gelehrt. Da wird jeder Text auf das Wesentliche reduziert: Zahlen, Daten und Fakten.
2018, Dezember – Joachim
Unter uns stapfen die Weihnachtseinkäufer mit ihren riesigen Tüten durch den matschigen Schnee. Die Züricher Straßenbahnen biegen gemütlich um die Ecke, in einer lustigen Choreografie. Wir sitzen im ersten Stock eines Kaffeehauses. Mein Laptop steht auf einem kleinen runden Tisch aus dunklem Holz, daneben haben wir unsere zwei riesigen, weißen Kaffeetassen abgestellt. Der Kaffee ist mittlerweile kalt, weil wir uns so sehr auf das Lesen und Schreiben konzentrieren. Es ist das zweite Buch, das Miriam und ich gemeinsam schreiben, und es wird nicht mein letztes sein. Mein Buch »Produktentwicklung: Lean & Agile« schreibe ich parallel dazu. Darin und im »OpenSpace Agility Handbuch« haben wir eine Menge Praxisbeispiele ergänzt. Sachlich und fachlich präzise.
Hinter jeder Erkenntnis aus den Praxisbeispielen steckt eigentlich eine Geschichte:
Die Geschichte des Chefs, der kein Motto für den Open Space findet. Die Geschichte vom Open Space, bei dem niemand am vorgegebenen Motto arbeitet. Die Geschichte vom Open Space, bei dem wir nicht genügend Stühle hatten. Die Geschichte eines Experiments mit Scrum in einem Geschäftsführungsteam. Die Geschichte von OpenSpace Agility in einem Unternehmen mit 120.000 Mitarbeitern.
Statt die Geschichten zu erzählen, schreiben wir:
»Sie müssen genug Zeit einplanen, um ein Motto für den Open Space auszuarbeiten. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn die Mitarbeiter im Open Space nicht direkt am Motto arbeiten, sondern Randthemen wählen. Auch Führungskräfte können teilnehmen und Experimente planen. Sie können selbst in großen Konzernen einen Open Space ausrichten, denn es werden nicht alle Mitarbeiter erscheinen, sondern nur die, die es interessiert. Und falls doch mehr Personen kommen, können Sie den Open Space-Stuhlkreis zu einem Stehkreis umfunktionieren. Es passiert das Einzige, was passieren kann. (Prinzip 1 von Open Space Technology)«
Als wir in unserer Konzentration wieder einmal abschweifen, erzähle ich Miri lustige Erlebnisse von meinen Beratungseinsätzen. Naja, sagen wir: Erlebnisse, die ich lustig finde. Manchmal wirft sich Miri weg vor Lachen, manchmal schaut sie mich nur groß an. Ich weiß, dass meine Späße mitunter blöd sind. Aber genau dieser hier, der war echt gut. Glaube ich.
»Hast du das mal aufgeschrieben?« Diese Frage stellt Miri mir immer wieder. Da ich wie jedes Mal mit »Nein« antworte, bietet Miri wieder an, meine Geschichten aufzuschreiben. Das übt auf mich aber keinen Reiz aus. Ich kenne ja meine Geschichten und vergesse sie nicht. Ich weiß ungefähr, welche Geschichte bei welchem Publikum gut ankommt. Meine Geschichten und die (anonymisierten) Protagonisten werden bei meinen Kunden teilweise in den Organisationswortschatz übernommen: »Wir haben hier einen Rolf-Effekt, kannst du mal vorbeikommen?« Aber weshalb soll ich die aufschreiben? Ich will nicht mal darüber nachdenken, über das Aufschreiben nachzudenken.
»Vielleicht sollten wir lieber Geschichten aufschreiben, statt 130 Seiten FAQs zu formulieren?«, bringt Miri den Fokus zurück.
»Vielleicht …«
Wir stecken wieder die Köpfe zusammen und schreiben an den FAQ.
2019, März – Miriam
Ich weiß nicht, was ich tun könnte. Gibt es irgendeine Methode in irgendeinem Fachbuch oder einen Prozess, an dem ich mich orientieren kann? Ich rufe Joachim an und frage ihn um Rat.
»Das agile Team, das ich coache, wird scheitern, Joachim. Das Management kümmert sich nicht genug. Niemand im Team hat Erfahrung mit agilen Ansätzen. In keinem Sprint haben sie bisher irgendetwas Nützliches fertiggestellt. Was mach ich denn nur? Kennst du eine passende Methode?«
»Ich kenne das Problem, aber eine Methode habe ich nicht parat.«
Enttäuschung breitet sich aus. Ich suche eine Methode, Fachtexte, Fakten, die mich zu einer Lösung inspirieren. Vielleicht sollten wir es mit Kanban versuchen? Vielleicht eine andere agile Methode, die besser zum Team passt? Ich suche das Allheilmittel. Doch alles, was ich finde, wird dem Team wahrscheinlich mehr schaden als helfen.
»Miri, du wirst keine Methode finden, die das Team erfolgreich macht. Teams machen Methoden erfolgreich. Nicht umgekehrt.«
»Aber du benutzt eine Methode nach der anderen. Und es ist immer grandios!«
Joachim lacht. »Weil ich schon seit zehn Jahren mit agilen Teams arbeite. Das hat nichts mit der Methode zu tun. Menschliche Abgründe finden keinen Platz in Methoden.«
»Dann zeigt es nur die Qualität des Profis, was?«
»Na, ich erzähle dir mal von meinem letzten Team, das mit Scrum nicht zurechtkam. Trotz Coaching von deinem sogenannten Profi.«
Eine bewegende Geschichte. Ich höre gespannt zu und versuche die Geschichte auf meine Situation zu übertragen. Wahnsinn, welches Wissen Joachim hat und was für ein Gefühl für die Einsetzbarkeit von Scrum. In einem konservativen Unternehmen mit autoritärem Führungsstil, vielen Kontrollinstanzen und sehr introvertierten Mitarbeitern sollen selbstorganisierte Teams eingeführt werden. Ich bin gespannt darauf, wie er die Situation löst, die meiner recht ähnlich zu sein scheint. Ich erwarte ein Wunder. Aber es kommt keins.
»Was hast du denn nun gemacht, Joachim?«
»Nichts, Miri. Das kann nicht funktionieren.«
»Aber ich kann doch jetzt nicht aufgeben! Es muss doch irgendeinen Weg geben! Irgendeine Methode!«
»Erinnerst du dich noch an die Mail, die ich an die Ansprechpartner der Projektmanagement-Konferenz gesendet habe? Sie wollten von mir eine Methode oder einen 5-Schritte-Plan, den ich nicht liefern wollte.« Ja, ich erinnere mich an die Mail:
»[…] In meinem Job geht es um Umdenken, Zusammenhänge, nicht um Methoden. In meiner täglichen Welt gibt es keine Best Practice und keine Good Practice, jede Lösung ist anders, in jedem Umfeld führen andere Ansätze zum Ziel. Kochrezepte gelten als maximales Risiko.
Habe lange darüber nachgedacht, warum ich immer so ein Bauchzwicken habe mit den Kochrezepten. Mein Ergebnis: Eure Kundschaft ist im klassischen Projektmanagement unterwegs, die Welt der Analysen, Pläne und Good Practices, PMOs usw.
Ich bin in der agilen Welt zuhause, wo es keine Good oder Best Practices gibt, keine Projektleiter, keine PMOs und wo man eh denkt, dass Projekte ein maximal ungünstiges Konstrukt sind, um im Markt zu bestehen (hoffe, ihr könnt jetzt noch gut schlafen). […]«
Das ist ganz schön konfrontativ. Auch ich komme aus dem klassischen Projekt- und Qualitätsmanagement und mir fiel das Umdenken schwer. Und dann hatte ich in meinem Kopf die klassischen Methoden gegen die agilen ausgetauscht. Voller Stolz, etwas Neues verstanden zu haben, berichtete ich einem befreundeten Professor der Softwareentwicklung davon. In einer Eisdiele im Hochsommer 2018, bei einem großen Eisbecher. Ich schwärmte damals davon, wie toll das Arbeiten in agilen Teams sei, wieviel Freude es mir bereitete, während er mir zuhörte und sein Eis genoss. Dann legte er seinen Löffel zur Seite und riss mich aus meiner Schwärmerei:
»Meiner Meinung nach können Methoden wie Scrum, Kanban oder auch klassische Projektmanagement-Methoden nicht die Lösung für Hindernisse im Projekt sein. Die Planungsart hat keinen direkten Einfluss auf die erfolgreiche Durchführung von Projekten. Erst wenn das Mindset hinter Ansätzen wie dem agilen Management betrachtet wird, kommen wir zu förderlichen Strukturen und selbstorganisierten Teams. Wichtig ist, dass das Team eine gewisse Experimentierfreudigkeit behält und diese auch vom Management unterstützt und gefördert wird. Standards in Prozessen, Methoden und Templates können helfen, wenn sie klar verständlich und leicht zugänglich sind. In den meisten Fällen jedoch bremsen sie das Team aus und sorgen dafür, dass das Team seine Selbstorganisation aufgibt. Es will dann seine Arbeitsweise in eine Form bringen, die vom Management gefordert wird. Egal, ob hilfreich oder nicht. Extrawünsche und Sonderlösungen nicht ausgeschlossen. Eins ist klar: Methoden fördern das Schubladendenken. Schublade auf, Methode raus – das gilt auch für Scrum.«
Jetzt habe ich es! Joachims Geschichte, seine Mail und das Gespräch mit dem Prof – alles hatte für mich eine Kernaussage: Ich suche nach einer Methode als Absicherung, um alles richtig zu machen. Sicherheit kann mir aber niemand geben. Sicherheit wird es nie geben. Ich muss mit Neuem experimentieren. Ob ich wirklich ein Talent dafür habe, solche Situationen zu lösen, wird sich zeigen. Die Geschichten haben mir Kraft gegeben, auf meine Intuition zu vertrauen. Vielleicht kann auch ich den Teammitgliedern eine Geschichte mit auf den Weg geben, die ihnen Kraft und Wertschätzung vermittelt? Methoden weg, Geschichten her? Ich muss vielleicht doch mehr Geschichten erzählen.
»Joachim, ich möchte ein Buch über unsere Geschichten aus dem agilen Arbeitsalltag schreiben.«
2019, Mai – Joachim
»That’s a really great idea! I love that! Yeah, it’s all about storytelling!« Daniel ist begeistert. Unser erster Autor, den wir ansprechen, ist begeistert. Was für eine Erleichterung!
Miriams Schnapsidee ist mittlerweile gereift und um die halbe Welt geflogen. Die Situation hat etwas Episches: Ein Restaurant in New York, in der Nähe der Central Station in Manhattan. Wir sitzen zu dritt an einem kleinen quadratischen Tisch in der Mitte des Raumes. Unsere Weißweingläser stehen neben einer kleinen Blechdose mit Karamell-Toffees, die wir Daniel Mezick mitgebracht haben.
»Thanks for telling me your idea first! I would love to join. I have a story that I could write down for your book. Would you like to hear it?«
Selbstverständlich wollen wir sie hören. Daniel beginnt zu erzählen und wir tauchen in seine Erzählung ein.
Daniel ist dabei – das Abenteuer kann beginnen. (Seine Geschichte ist in diesem Buch der krönende Abschluss.)
Die Zeit in New York vergeht rasend schnell. Wir besuchen den Scrum Day und erkunden die Stadt, sind gedanklich aber immer wieder bei dem Buchprojekt. Mittlerweile hat es einen Namen: Agile Short Stories.
Kern der Idee ist, nicht nur unsere eigenen Geschichten aufzuschreiben – das würde lediglich eine einzige Sichtweise widerspiegeln. Wir wollen Vielfalt im Buch: Geschichten von Autorinnen und Autoren, die unterschiedlich viel Erfahrung mit Agile haben, aus unterschiedlichen Branchen kommen und verschiedene Ansichten einbringen. Und es sind ganz tolle, herzliche Menschen, die wir kennen und schätzen gelernt haben.
Noch von New York aus kontaktieren wir Dolores, unsere Lieblingslektorin, die bereits unsere letzten Bücher bearbeitet hat. Fachbücher. Wir sind unsicher, ob sie überhaupt ein Geschichtenbuch lektorieren würde und erwarten gespannt ihre Antwort.
»Hallo ihr zwei, na da habt ihr ja eine schöne Idee gehabt. Das ist aber eine ganz schöne Mammutaufgabe! Und zeitlich viel zu knapp. Die Autoren werden alle keine Experten im Geschichtenschreiben sein. Wollt ihr nicht stärker selektieren und mehr Zeit einplanen?«
Es folgt ein kurzer Austausch per E-Mail, in dessen Rahmen Dolores aus einem einzelnen großen Bedenken einen Blumenstrauß vieler großer Bedenken macht. Die Bedenken zu ignorieren, fällt uns leicht, haben wir doch in diesem Moment keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Wir versuchen lediglich abzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, dass Dolores das Handtuch wirft. Miriam schreibt ihr eine Mail zurück: »Ach, wir schaffen das schon. Lass uns mal machen – das wird ein ganz tolles Buch!«
2019, Juni – Miriam
Vor einem Jahr noch haben wir hier auf dem Scrum Day in Stuttgart die Büchlein zu OpenSpace Agility verteilt. Heute verteilen wir Flyer zu den Agile Short Stories. Selektiv sprechen wir Bekannte und Freunde aus der agilen Community an und erzählen die Geschichte und Idee hinter Agile Short Stories.
»Das Buch soll Menschen Mut machen, die sich mit agilen Themen beschäftigen, obwohl oder gerade weil es ein wichtiges, aber auch schweres Thema ist. Mit unseren Geschichten sollen sie das Gefühl bekommen, dass sie auf ihrem Weg nicht alleine sind und es viele Gleichgesinnte gibt. Gleichzeitig gibt es viele, die Agile nicht für wichtig halten oder noch keinen Zugang zum Thema gefunden haben. Ihnen wollen wir zeigen, warum wir Autoren dem Ganzen so viel Zeit widmen oder sogar einen Lebenssinn darin gefunden haben.«
Bei den ersten Gesprächen ist mir noch ganz mulmig zumute. Was werden die Kollegen antworten? Aber die ersten sagen völlig begeistert: »Was für eine schöne Idee! Der Hammer! Ja, da muss ich einfach mitmachen! Ich bin natürlich dabei!« Also fassen wir Mut. Wir könnten wohl wirklich mehrere Autorinnen und Autoren zusammenbekommen.
Gleich in den nächsten Tagen versenden Joachim und ich Einladungsmails an Freunde und Bekannte aus der agilen Szene.
2019, Juli – Joachim
Damit wir beide über eine zentrale Adresse erreichbar sind, habe ich in irgendeiner Mittagspause die Domain agile-short-stories.de reserviert. Auf dem Flyer und der Homepage haben wir den Autoren einen ersten Rahmen für die Sprint-Ziele vorgegeben:
1.7.: Einige wenige Sätze zu deiner Agile Short Story, damit wir einen Eindruck gewinnen können.
20.7.: Kurzgeschichte als Rohtext
1.8.: Erstes Feedback von Miriam und mir
Danach überarbeiten die Autorinnen und Autoren ihre Geschichten und ab Oktober starten wir mit dem professionellen Lektorat. Anfang November müssen wir das Buch setzen, damit wir es im Dezember veröffentlichen können. So der Plan.
Am 1.7. trudeln 15 ausgefeilte Geschichten ein. Zehn Personen haben nur wenige Stichworte gesendet. 24 Personen hatten angekündigt, mitmachen zu wollen, haben sich aber nicht gemeldet. Einige Experten und »Prominente« sagen ab – manche aus Zeitmangel, andere weil ihr persönlicher Fokus aus ihrer Sicht nicht ins Buch passt. Verständlich. Ein Autor schreibt zurück:
»Habt ihr euch in der Adresse vertan? Ich halte das für ungeeignete Ansätze.«
Wir schreiben eine Mail des Bedauerns und erklären, dass uns die unterschiedlichen Perspektiven wichtig sind. Manche, die zunächst abgesagt haben, sagen jetzt wieder zu.
Wir müssen abwarten und senden eine Erinnerungsmail an alle, in der wir auf den 20. Juli verweisen. Aber wird das helfen? Viele haben sich gar nicht zurückgemeldet.
2019, Juli – Miriam
Wieder steht ein Laptop vor uns, Joachim und ich kleben mit den Köpfen vor dem Bildschirm. Wir haben einen neuen Arbeitsmodus gefunden: Einer liest die Geschichte vor, der andere hört zu und verfolgt die Wörter auf dem Bildschirm.
Nach jeder Geschichte schreiben wir ein umfangreiches Feedback für jeden einzelnen Autor und jede einzelne Autorin. Seite um Seite entstehen Anregungen für Verbesserungen. Eine Autorin antwortet uns: »Was für eine Mail! Das ist die längste Mail, die ich je bekommen habe! So viele Tipps und Anregungen. Die muss ich erstmal in Ruhe durcharbeiten.« Unsere Lektorin freut sich, dass wir ihr auf diese Weise die Arbeit erleichtern.
»Da habt ihr euch aber sehr viel Arbeit gemacht! Wollt ihr zukünftig unter die Lektoren gehen? Ich habe die Bedenken, dass einige Autoren nicht gewusst haben, dass noch viel Arbeit auf sie zukommt, als sie euch die Geschichte gesendet haben. Wahrscheinlich werden einige ihre Geschichte nicht überarbeiten.«
Das ist hart, aber da hat sie wahrscheinlich recht. Wir klappen den Laptop zu und fahren an den Strand. Wie gut, dass Joachim und ich uns für eine Woche an die Nordsee in unser »flexible Office« zurückgezogen haben, um fokussiert die Geschichten lesen zu können. Der frische Meereswind hilft, die Bedenken zu verdauen. Wir sammeln neue Kraft und setzen uns wieder an die Geschichten.
Als wir gerade wieder mittendrin sind, meldet sich ein Kollege von mir. Er möchte ebenfalls eine Geschichte beitragen und bittet mich, ihm eine Beispielgeschichte zu schicken. Ich zögere lange, fasse dann aber doch den Mut und sende ihm meine unlektorierte eigene Geschichte. Nach kurzer Zeit ruft er mich an und ich verlasse den Raum, um zu telefonieren.
Als ich nach dem Telefonat zurückkehre, schaut Joachim mich an und fragt, ob alles in Ordnung ist. Ich berichte ihm von der Auseinandersetzung mit meinem Kollegen. Er hält die Form der Kurzgeschichte für zu emotional und selbstoffenbarend für den Business-Kontext und ist so irritiert, dass er doch nicht mitmachen möchte. Das ist nicht das erste Mal, dass wir energiegeladene Diskussionen zu dem Thema »Was ist eine Geschichte und was ist ein Bericht?« führen. Der Geschichtenerzähler hat Mut, vertritt einen Standpunkt, bezieht Stellung, zeigt sich kühn oder verletzlich. Eine Geschichte ist eine individuelle Wahrnehmung der Realität – also eine subjektive Wahrheit. In Geschichten wird man persönlich und geht eine authentische Verbindung mit dem Leser ein. Diese Verbindung war schon mehreren, mit denen wir bisher gesprochen haben, zu persönlich.
Wir nehmen uns die Zeit, um ausgiebig über den Stil der Geschichten zu diskutieren. Auch Joachim und ich sind beim Durcharbeiten der Geschichten immer wieder betroffen, manchmal sogar irritiert. Aber Geschichtenerzählen ist eine Kunst. Nicht jedes Bild, nicht jede Skulptur gefällt jedem Betrachter. Wichtig ist, dass es in dir etwas bewegt.
Genauso wie meine Geschichte den Kollegen bewegt, vielleicht sogar wie ein Schlag mit der Faust ins Gesicht. Aber mit meiner Geschichte will ich dem Leser keinen Honig um den Mund schmieren. Faust oder Honig ist hier die Frage.
Eine Geschichte, die Annahmen herausfordert, Paradigmen wechselt, ist wie eine Faust.
Geschichten, die sich gut anfühlen und ein Zustimmen erzeugen, sind wie Honig. In unserem Buch soll man beides finden.
Wenn wir unsere Gedanken zur Agilität verbreiten möchten, wollen wir, dass sich andere intensiv mit dem Thema befassen. Das bedeutet auch, dass sie den Status quo in Frage stellen und aufzeigen, wo es den Menschen schlecht geht und wo die Dinge falsch laufen. Mit unseren Geschichten wollen wir nicht belehren. Wir wollen, dass der Leser sich eine eigene Meinung bildet.
Joachim und ich sind uns einig: Wir wollen Facetten im Buch haben.
Und so lesen wir weiter und versuchen, mit unseren Anmerkungen jeden einzelnen Autor zu noch mehr Tiefe und Aussagekraft in der eigenen Geschichte zu inspirieren.
2019, August – Joachim
Wir orchestrieren 50 Autoren und Autorinnen. Damals im März hätten wir nie gedacht, dass so viele Menschen mitmachen würden. Eine Community ist erwacht. Miriam und ich sitzen gerade in Düsseldorf am Flughafen zusammen und schreiben den nächsten Newsletter an alle. Einige Autoren haben uns schon angeschrieben, weil sie auf ihre Mails nicht schnell genug eine Rückmeldung erhalten haben. Alles ist viel mehr Arbeit als gedacht. Fast alle Autorinnen und Autoren haben Rückfragen zu ihrer Geschichte, wollen mit uns chatten, telefonieren oder sich mit uns treffen. Im nächsten Newsletter wollen wir den rechtlichen und finanziellen Rahmen beschreiben. Tatsächlich sind die ersten Geschichten bereit fürs Lektorat und wir benötigen noch die Freigabe, um diese weiterleiten zu können. Seit einer Stunde sitzen wir zusammen und schreiben an dem Text für den Newsletter.
»Joachim?« Miriam spricht mich mit Namen an? Von einer Sekunde auf die andere ist sie plötzlich ganz aufgeregt. Sie will etwas Wichtiges. »Ja?«
»Ich fühle mich nicht wohl mit unserem Text. Die Art und Weise, in der wir rechtliche und finanzielle Dinge beschreiben, klingt so steril und distanziert. Das passt doch eigentlich gar nicht zu uns.«
»Wie meinst du das?«
»Die Autoren sind Freunde und gute Bekannte mit dem Herz am richtigen Fleck. Wir wissen, dass sie nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln werden, und genauso tun wir es auch. Wir möchten, dass sie alle ihre Rechte am Text behalten. Wir möchten uns nicht dadurch bereichern. Die Nachricht, die wir mit dem Buch verbreiten möchten, ist uns wichtig, nicht die Verpackung.«
»Du möchtest es umschreiben?«
»Ja. Ich möchte es so schreiben, wie ich diese Dinge zum Beispiel mit dir klären würde. Offen und vertrauensvoll. Die Werte, die wir mit den Geschichten laut und deutlich mitteilen möchten, sollten sich in unserer Zusammenarbeit mit den Autoren wiederfinden.«
Ich stimme ihr zu und wir schreiben den gesamten Text noch einmal um, bis …
»Joachim?« Ah, da ist es wieder.
»Ja?«
»Was machen wir, wenn dieses Buch irgendwann Gewinn erzielt? Wenn wir die Kosten für das Lektorat gedeckt haben? Wollen wir dann jeden Erlös mit 50 Autoren und Autorinnen teilen?«
Ich muss lachen und kann es mir schon bildhaft vorstellen.
»Dann schreiben wir monatliche Newsletter: Liebe Autorin, hier kommt deine Abrechnung über 43 Cent.« Wir lachen beide.
»Nee, Miri. Wir sollten den Erlös spenden.«
»Ja. Vielleicht an eine kleinere Organisation, die wir gut kennen und die keinen großen Verwaltungs-Wasserkopf hat. Flying Hope zum Beispiel. Mit denen fliegst du doch häufiger schwerkranke Kinder durch die Welt?«
»Das ist eine schöne Idee. Unser Autor Klaus ist auch als Pilot für Flying Hope geflogen.«
»Dann machen wir das so.«
Wir schreiben direkt in unseren Newsletter, was wir soeben beschlossen haben. Die Mail ist nicht perfekt, aber sie kommt von Herzen. Rechtlich nicht einwandfrei formuliert, aber für jeden verständlich.
Vertrauen und eine gute Beziehung zu unseren Autorinnen und Autoren sind uns wichtiger.
Dieses große Vakuum im Business wollen wir durch unser Buch mit Emotionen füllen.
Wir haben genügend Geschichten für ein Buch gesammelt. Nun fängt die Arbeit erst an. Jeder Autor sitzt an einem anderen Standort in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und Daniel in New York. Das Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen ist schwer, und wir vereinbaren, regelmäßig Newsletter zu schreiben. Wir wollen auch bald den ersten Video-Call machen. Miriam schreibt in die Mail noch rein:
»PS: Wir haben eine WhatsApp-Gruppe eröffnet. Unter diesem Link könnt ihr beitreten …«
Es dauert keine Stunde, dann sind 23 Autorinnen und Autoren in der Gruppe, begrüßen sich und stellen sich gegenseitig vor. Eine Community erwacht.
2019, September – Miriam
Draußen stürmt es. Der Regen peitscht gegen die großen Fensterscheiben des Konferenzhauses. Nur schemenhaft erkenne ich den Hamburger Hafen neben der großen Leinwand, vor der eben noch die Vortragenden standen. Eigentlich wäre jetzt »Walk & Talk« angesagt – mit anderen spazieren gehen und ins Gespräch kommen. Eine wundervolle Idee für eine Konferenz, nur bei diesem Wetter bleiben wir lieber alle im Gebäude.
Eine unserer bekannteren Autorinnen von Agile Short Stories erzählt mir gerade von ihrer Idee für eine Geschichte, und dass sie uns ihre abschließende Version bald zusenden wird.
»Ich war total begeistert von eurer Idee. Ich erzähle selber auch gerne Geschichten, deshalb habe ich direkt zugesagt. Danach ist mir erst eingefallen, dass eine Kurzgeschichte ja ein literarisches Format ist. Damit muss ich mich erst einmal beschäftigen.«
Ich muss grinsen. Da ging es nicht nur ihr so. Viele wussten am Anfang nicht, worauf sie sich einlassen und haben den Aufwand unterschätzt. Ein paar wenige sind aus dem Projekt ausgestiegen. Auch ich habe den Aufwand unterschätzt. Zwei Autoren und eine Autorin haben mich sogar gefragt, ob ich an ihrer Geschichte mitschreiben könnte. Da wollte ich natürlich mein Allerbestes geben und fühlte mich nicht gut genug, anderen Ratschläge zu erteilen.
In den vergangenen Monaten habe ich mir immer wieder Kurzgeschichten gekauft: eine Sammlung von Kurzgeschichten von Alice Munro, der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin 2013, und die »49 stories« von Ernest Hemingway. Er hat in den 1930er-Jahren, unmittelbar nach dem Krieg, mit seinen »49 stories« die »Lost Generation« und die junge deutsche Dichtergeneration nachhaltig geprägt. Nicht dass unsere oder gar meine Kurzgeschichten damit irgendwie vergleichbar wären. Es hat mich demütig werden lassen, aber mein Gefühl für das Format ist auf jeden Fall gewachsen. Aber das erzähle ich der Autorin besser nicht, sonst denkt sie noch, wir hätten überhöhte Erwartungen. Stattdessen antworte ich:
»Da bist du nicht allein. Uns geht es allen so. Wir nehmen nicht nur Kurzgeschichten, sondern auch kurze Geschichten unterschiedlicher Art ins Buch auf. Bist du schon in unserer WhatsApp-Gruppe und auf dem Austausch-Ordner in der Cloud unterwegs?«
»Noch nicht. Schickst du mir bitte die Links?«
»Ich möchte mir gerne die Option offenhalten mitzumachen«, sagt der Teilnehmer neben uns. Wir hatten ihn im Juni angeschrieben, wie 150 andere auch, er hatte sich aber nicht zurückgemeldet.
Ich muss ihm schweren Herzens absagen. Unsere Deadline für Ersteinreichungen war vor zwei Monaten. Die Hälfte der Geschichten ist bereits lektoriert und neue Geschichten würden es nicht mehr rechtzeitig bis zum Setzen des Buchs schaffen. Er ist nicht der Einzige. Noch vier andere Interessenten haben sich im September, zwei weitere im Oktober gemeldet – leider zu spät. Wenn wir unsere Deadline halten wollen, dürfen wir keine weiteren Geschichten aufnehmen. Da viele das Buch zu Weihnachten verschenken wollen, steht das Datum der Veröffentlichung fest.
Die Konsequenz, die wir in diesen Tagen walten lassen müssen, verursacht bei Joachim und vor allem bei mir viel Stress. Immer wieder quält mich die Angst, das Buch könnte nicht gut genug werden oder die Autoren könnten sich nicht gut genug begleitet fühlen. Joachim und ich führen hitzige Diskussionen über verlorene Dokumente, ungleiche Ansprüche an die Qualität der Geschichten, den fehlenden Überblick und zu früh bestellte Probedrucke.
Aber all dies wird belohnt durch atemberaubende überarbeitete Geschichten, wundervolle Ideen zu Illustrationen, Cover und Buchsatz. Joachim und ich sind immer wieder begeistert von Dingen, die wir »einfach mal so machen«.
Am nächsten Tag fliege ich von Hamburg nach Zürich, um unsere Schweizer Autorinnen und Autoren zu treffen. Ihre Begeisterung für unser Buchprojekt steckt an und gibt viel Kraft für die weitere Arbeit. Joachim kommt nach, wir arbeiten uns zu zweit durch die überarbeiteten Geschichten und beantworten Mails von Autorinnen und Autoren. Wir sitzen wieder im Café mit Blick auf die Straßenbahnen. Sprachlos genießen wir unseren Kuchen und schauen wie in Trance auf den Rechner, der eine Übersicht der Geschichten anzeigt. In diesem Augenblick der Ruhe nehmen wir wahr, wie groß unsere Idee mittlerweile geworden ist, wie viele Menschen mitmachen. Es ist Ende September und einige Autorinnen und Autoren warten bereits auf das Lektorat.
2019, Oktober – Joachim
In einem gigantischen Kraftakt lektoriert Dolores die Geschichten. Jede Geschichte ist inhaltlich und sprachlich ein Unikat, ebenso wie die jeweiligen Autoren. Mit jeder und jedem der Autorinnen und Autoren nimmt Dolores individuell Kontakt auf, um die Geschichten rund zu bekommen – um sie gut zu machen und dennoch den Geist des Autors oder der Autorin beizubehalten. Das geschieht für Miri und mich im Verborgenen, wir bekommen nur die freigegebenen Geschichten von Dolores überreicht. Wie viel Kraft das von Lektorin und Autoren verlangt, können wir nur erahnen. Und dabei hat Dolores andere Projekte und muss sich die Zeit für unsere Schnapsidee aus den Rippen schneiden. Am Ende werden es knapp 100 Stunden sein, die sie für die agilen Kurzgeschichten aufgewendet hat.
Wir arbeiten im Lektorat nach dem Pull-Prinzip: Dolores sagt Bescheid, wenn wir ihr den nächsten Fünferpack an Geschichten zusenden können. Anfang Oktober ist bereits die Hälfte der Geschichten lektoriert und ich bringe sie mit Adobe InDesign ins Buchlayout. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Seiten füllen. In unseren Video-Calls berichten die Autorinnen und Autoren, wie zufrieden sie mit dem Ergebnis sind und wie toll sie sich begleitet gefühlt haben – durch unsere Lektorin und durch uns. Wir freuen uns sehr.
Miri und ich treffen uns auf dem Oktoberfest in München mit einer Autorin, deren Geschichte schon komplett fertig ist. Gemeinsam schwärmen wir vom Buch und überlegen, welche Marketing-Aktivitäten wir planen sollten. Kurz vor Ende des Abends haben wir noch eine Idee: Wir lassen ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift »Agile Short Stories« anfertigen.
Am nächsten Tag sitzen wir an meinem Esstisch und versuchen, die nun 49 Geschichten in eine Struktur zu bringen. Es entstehen fünf Kapitel: »Agiler Anfang«, »Agile Menschen«, »Agile Leadership«, »Agile Transformation« und »Agile Werte«.
Die eigentliche Buchproduktion, an der ich arbeite, gerät immer mehr zu einer Nebensache. Die Betreuung der Autorinnen und Autoren und aller damit zusammenhängenden Aspekte, wie das Informieren aller Beteiligten, die Organisation von Treffen, die Gestaltung des Covers und nicht zuletzt das Erstellen von über hundert Illustrationen macht den Großteil des – für die anderen unsichtbaren – Aufwands aus. Das alles wird überwiegend von Miri gestemmt.
Ich wollte ursprünglich drei Geschichten einbringen. Eine davon, meine Herzensgeschichte, handelt von der Auflösung eines Teams durch Management-Intrigen und Machtspiele. Da die Zeit für mich im Schreibprozess knapp wird, beschließe ich, diese und eine andere Geschichte wegzulassen. Die Herzensgeschichte wäre zu umfangreich und zu komplex, um sie in das Format einer Kurzgeschichte zu packen, das ist mir inzwischen klar geworden. Im Gegensatz zu mir liefert Miri eine Geschichte nach der anderen – aus meiner Sicht in maximaler Qualität. Doch mir ist im Laufe des Sommers klar geworden, dass es mir keine Freude bereitet, Geschichten zu schreiben und Details akribisch auszuschmücken. Es ist eine harte, aber wichtige Erkenntnis für mich. Denn ich habe Jahrzehnte von einer Zweitkarriere als Kinderbuchautor geträumt.
2019, November – Miriam
Mit dem zweiten Probedruck, den ersten Flyern, dem Lebkuchenherz und unseren Rechnern machen wir uns auf den Weg ins Hotelrestaurant. Die Musik der Konferenz »Manage Agile«, die im gleichen Hotel stattfindet, schallt bis hierher. Wir sind früh dran und nutzen die Zeit, um die letzten fünf Geschichten an unsere Lektorin zu versenden.
Sechs Autorinnen und Autoren kommen zum gemeinsamen Abendessen. Nach der Begrüßung wollen wir uns alle kurz vorstellen und von unseren Geschichten erzählen. Joachim beginnt die Runde und bringt direkt die Schlagwörter ein, zu denen noch Fragen offen sind oder Ideen im Raum stehen. Alle sind sofort in Gespräche über ihre Geschichten vertieft, den anstehenden Buchverkauf und die Frage, wie wir den Gewinn schnellstmöglich erhöhen können, damit wir bald größere Summen an Flying Hope spenden können. Da das Gespräch so schnell Geschwindigkeit aufnimmt, müssen wir uns gegenseitig daran erinnern, die Vorstellungsrunde fortzusetzen. Es geht weiter:
»Hallo, mein Name ist Susanne und ich habe eine Geschichte geschrieben.«
»Hallo Susanne!«, klingt es im Chor. Man könnte glauben, wir wären die Selbsthilfegruppe »Anonyme Autoren«.
Zwischen chorischen Begrüßungen jedes Einzelnen verfallen wir immer wieder in Gespräche, und so dauert die Vorstellungsrunde zwei Stunden – bei acht Personen. Irgendwann beginnt die eine oder andere zu drängen, weil die Klimaanlage den Raum zum Eiskasten herunterkühlt. Wir beenden die Restaurantrunde und gehen zum Tanzen und Aufwärmen hinüber zur Konferenz.
Wir sind alle gespannt, ob das Buch den gewünschten Erfolg haben wird, ob es unsere Leser genauso bewegen wird wie uns. Es ist schön zu beobachten, wie sehr unser Buchprojekt die Autorinnen und Autoren anregt, ihre Geschichten nun häufiger zu erzählen. Viele haben die Geschichten zusätzlich in ihren Blog gestellt. Einige präsentieren ihre Geschichte sogar hier auf der Manage Agile als Vortrag. Zwei Autorinnen haben den Mut geschöpft, sich zukünftig stärker auf das auszurichten, was ihre Geschichten ihnen seit Jahren zuflüstern.
Der Abend endet mit herzlichen Verabschiedungen und einer Aussage, die ein großes Fragezeichen im Raum zurücklässt:
»Wenn ihr einen Band 2 macht, bin ich auf jeden Fall wieder dabei!«
2019, Dezember – Joachim
»Push the button« – im Dezember ist es so weit. Alle sitzen gespannt vor ihren Rechnern. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren wollen live dabei sein, wenn wir das Buch veröffentlichen. Wir alle haben den großen Wunsch, andere zu inspirieren und gleichzeitig haben wir Bedenken, welche Fragen und Rückmeldungen wir wohl zu unseren Geschichten bekommen werden.
Geschichten zu erzählen bedeutet, seine eigene Wahrnehmung der Realität in Worte und Buchstaben zu bringen und so etwas sehr Persönliches von sich preiszugeben. Die Geschichten sind nicht »die Wahrheit im engeren Sinne«: Sie sind stilisiert, komprimiert und literarisch frei erzählt. Personen und Orte sind bildhaft dargestellt, Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen und Orten sind rein zufällig.
Es ist wie in Hollywood: Das Leben basiert auf einer wahren Geschichte.
Agiler Anfang
Durch die Liebe zur Agilität
Mit der Teilnehmerliste in der Hand stehe ich mutterseelenalleine in einem gut vorbereiteten Seminarraum. Der Stuhlkreis ist perfekt. Die Flipcharts sind mit blütenweißem Papier bestückt und auch frisches Obst, Wassergläser und kleine Knabbereien stehen für die Ankommenden bereit. Mein Coaching-Idol aus der Schweiz soll die nächsten beiden Tage die Seminargruppe in einer »Coaching Masterclass« begeistern. Ich kenne dieses Training schon. Dreimal habe ich es bisher mitgemacht. Trotzdem melde ich mich immer wieder als Erste, wenn die Frage auftaucht, wer aus unserem Team das nächste Seminar zum Lösungsfokussierten Coaching mit Peter Szabo begleiten möchte.
Ach ja, ich heiße Veronika und arbeite zu diesem Zeitpunkt seit sechs Jahren erfolgreich als Lösungsfokussierte Coach in Wien. Als Kooperationspartnerin übernehme ich gerne Aufträge meines Mentors und Lehrers Günter, der das Solution Management Center in meiner schönen Heimatstadt betreibt. Ich bin gerade frisch geschieden, und außer meinen beiden kleinen Töchtern hält mich derzeit nur meine Begeisterung für Lösungsfokussiertes Arbeiten aufrecht. Und das tue ich dann eben auch. Ich arbeite, ich lerne, ich kümmere mich um meine Kinder. Bloß nicht zurückblicken. Alles wird gut. Dass mein Leben in Kürze zwei alles verändernde Wendungen nehmen wird, ahne ich in diesem Moment noch nicht.
Da öffnet sich die Tür und die ersten Teilnehmenden treten ein. Ich begrüße sie herzlich und helfe ihnen, sich zurechtzufinden. In der Gruppe bemerke ich ein bekanntes Gesicht. Leider kann ich mich nicht erinnern, woher ich diesen Mann kenne. Doch seine lachenden Augen sind mir sehr vertraut.
Der Seminartag verläuft – erwartungsgemäß – großartig. Peter Szabo ist ein Meister darin, andere von Lösungsfokus zu begeistern. Die Stimmung im Raum ist ausgelassen und wir experimentieren nach den Vorgaben des Trainers. Nach 17 Uhr ziehen die Leute von dannen. Nur ich bleibe als Gastgeberin zurück, um die leeren Kaffeetassen, Wassergläser und Teller in der Spülmaschine zu verstauen und den Raum für den nächsten Tag vorzubereiten. Okay – ich bleibe nicht ganz alleine. Ralph, der Mann mit den lachenden Augen, ist auch noch da. Und nachdem wir gemeinsam alle Überreste des Seminartages beseitigt haben, bittet er mich, ihn auf einen Drink in ein benachbartes Bierlokal zu begleiten.
Aus einem Drink werden drei, und nachdem wir unsere Lebensgeschichten ausgetauscht haben und er herausgefunden hat, dass mein Mädchenname »Jungwirth« ist, wissen wir es wieder: Ralph und ich haben 15 Jahre zuvor gemeinsam im Kino gejobbt. Ich an der Kassa und er als Billetteur – das ist der Typ am Eingang, der die Tickets kontrolliert. Irgendwie war er mir wohl schon damals sympathisch, denn ich hatte ihm – so behauptet er jedenfalls – meine Pager-Nummer gegeben.
Kurz nach unserer ersten Begegnung ist er nach England gegangen, um dort zu studieren. Später, zurück in Österreich, hat er seinen Weg und seine Liebe zur Agilität gefunden – das ist jedoch seine Geschichte. Du findest sie hier in diesem Buch. Jedenfalls arbeitet Ralph zum Zeitpunkt des Peter-Szabo-Seminars schon seit zwei Jahren selbstständig als Agile Coach. Was genau das ist, verstehe ich zunächst nicht. Mit Coaching, so wie ich das mache, hat es scheinbar nicht viel gemeinsam. Zumindest so viel finde ich heraus: Es hat wohl irgendwie mit Softwareentwicklung zu tun. Ich beschließe, das Thema für mich ad acta zu legen. Vorerst wenigstens.
Ein paar Wochen später – wir sind inzwischen ein unzertrennliches, sehr verliebtes Paar und benehmen uns wie Teenager – lädt Ralph mich ein, ihn übers Wochenende nach Rückersbach zu begleiten. Dort findet das alljährliche Agile Coach Camp Deutschland statt. Drei Tage soll ich mit begeisterten Software-Entwicklerinnen und Software-Entwicklern im Grünen verbringen. Angeblich macht das richtig viel Spaß. Kann ich mir vorstellen. Klar.
Ich sage natürlich – trotz meines flauen Bauchgefühls – zu. Der Liebe wegen. Dummerweise habe ich am Anreisetag noch ein Seminar in Wien zu halten und muss spätabends alleine nachreisen. Bei meiner Ankunft, gleich an der Rezeption, werde ich von einem wildfremden Mann stürmisch umarmt und begrüßt. Er trägt einen Bart, eine Brille und ein T-Shirt, dessen Aufschrift ich nicht verstehe. Ähnliche Szenarien wiederholen sich, bis ich Ralph finde, noch ungefähr vier Mal und ich ertappe mich bei einem verzweifelten Gedanken: »Ob das Taxi wohl noch vor der Tür steht, um mich zurück zum Flughafen zu bringen?«
Am Abend erlebe ich meine erste Open-Space-Eröffnung. Knapp 80 Menschen – vorwiegend Männer – sitzen in einem dreifachen Stuhlkreis. Zwei Moderatoren erklären mit ruhiger und fast schon feierlicher Stimme, worum es hier geht. Sie erzählen irgendwas von Hummeln und Schmetterlingen, und ich frage mich, ob mich Ralph zu einem Sektentreffen geschleppt hat. Noch bevor ich diese Befürchtung zu Ende denken kann, springen mindestens zwanzig Menschen auf, holen sich große Klebezettel und Stifte und schreiben Themen auf, über die sie im Laufe der nächsten Tage gerne sprechen möchten. Eine an der Wand vorbereitete Riesentabelle, in die Räume und Uhrzeiten eingetragen sind, füllt sich langsam mit diesen Klebezetteln, während die Themen vorgestellt werden. Die Begeisterung der Menge steckt mich an. Ich verstehe inhaltlich kaum ein Wort – vielleicht auch, weil alle Teilnehmenden Englisch sprechen. Doch irgendwie scheint es toll zu sein.
Am nächsten Morgen geht es los. Nach einer kurzen Begrüßung im Stuhlkreis strömen die Leute auseinander, um sich in den verschiedenen Räumen zu treffen. Ralph geht zu einer technischen Session und empfiehlt mir eine andere, in der es um Coaching geht.
So sitze ich also passenderweise im Raum »Österreich« und frage mich, was ich hier soll. Die etwa fünfzehn Personen, die mit mir in einem – du ahnst es schon – Stuhlkreis sitzen, sprechen über Coaching und ich höre zu. Und dann passiert es: Einer von ihnen trifft eine Aussage, die ich so unmöglich stehen lassen kann. Ich sammle meinen ganzen Mut, öffne meinen Mund und höre mich selbst – auf Englisch – über Lösungsfokus sprechen. Alle sehen mich gebannt an. Nach einer kurzen Stille strömen Fragen auf mich ein. Hier sitze ich, inmitten von begeisterten Software-Coaches, und kann mit meinem Wissen etwas beitragen, das die scheinbar interessiert.
Ich bin angekommen. Von diesem Moment an bin ich kaum mehr zu bremsen. Ich wage mich in immer fremdere Themen vor, lerne, was Retrospektiven sind, was ein Scrum Master tut, worum es sich bei einem Minimum Viable Product handelt, und vieles mehr. Im Laufe dieser Tage wird mir immer klarer: Diese Menschen haben das gleiche Ziel wie ich. Sie wollen diese (Arbeits-)Welt zu einem besseren Ort machen. Sie möchten dabei helfen, dass Teams gemeinsam Erfolge feiern können, dass Kunden und Organisationen zufrieden und langfristig Hand in Hand arbeiten. Dazu braucht es viel Kooperation. Diese Leute hier in Rückersbach wissen, wie gute Zusammenarbeit gefördert werden kann. Und ich weiß, wie gute Kommunikation auf Augenhöhe besser klappt. Gemeinsam haben wir die Antwort. Topf trifft Deckel. Das muss es sein!
Ralph strahlt, als er meinen begeisterten Ausführungen geduldig zuhört. Er wusste schon vor unserer Begegnung, dass Lösungsfokus und agiles Vorgehen zusammenpassen. Schließlich ist er als ausgebildeter systemischer Coach Experte auf beiden Gebieten. Ich will jedoch nicht schon wieder in seine Geschichte eingreifen – falls er das überhaupt erzählt.
Zurück in Wien krame ich eine neue Rolle Flipchart-Papier aus dem Schrank und wir stellen die wichtigsten Aussagen aus der agilen Welt und jene aus der lösungsfokussierten Welt einander gegenüber. Was wir herausfinden, ist phänomenal: Die agilen Werte und die lösungsfokussierten unterstützen einander. Die Prinzipien der beiden Welten passen wie Puzzlesteine zusammen. Das, was hier auf dem Papier entsteht, ist wie eine Symphonie des sinnvollen Agierens in modernen Organisationen und in Zeiten der Digitalisierung! Aufregung, Hitzewallungen, Begeisterung!
Diese Geschichte ist nun ziemlich genau sieben Jahre her. Vielleicht bald acht, je nachdem, wann dieses Buch erscheint. Heute diskutiere ich auf Augenhöhe mit gestandenen Agile Coaches über den Kern des agilen Vorgehens. Ich habe noch immer keine Zeile Code geschrieben. Ich kann es nicht und ich werde es wohl auch nicht mehr so richtig erlernen. Was mich hingegen enorm interessiert, ist, wie Menschen in verschiedensten Situationen möglichst gut miteinander harmonieren können.
Und da unterscheidet sich für mich agiles Arbeiten kaum von einer Liebesbeziehung: Die Beteiligten haben mit äußeren Widerständen und Anforderungen zu kämpfen, und das schaffen sie nur, wenn sie bedingungslos zusammenhalten. Wenn es in einer Paarbeziehung etwa kleine Kinder gibt, die Aufmerksamkeit brauchen, oder Eltern, die es gar nicht lustig finden, wenn ihr katholisch erzogenes Wiener Mädel sich scheiden lässt und plötzlich mit einem deutschen Staatsbürger an ihrer Seite auftaucht. Bedingungsloses Zusammenhalten ist notwendig, wenn ein agiles Team mit ständig wechselnden Kundenanforderungen, mit Starallüren einzelner Teammitglieder oder mit diktatorischen Führungsstilen kämpfen muss. Und es hilft in beiden Welten, viel miteinander zu kommunizieren, zu experimentieren und Fehler als Lernchancen zu verstehen.
Ich bin froh und dankbar für jeden Schritt, den ich auf dieser Reise bisher gehen durfte und freue mich auf jeden einzelnen, der noch kommt. Ich lerne jeden Tag dazu, gehe über meine Grenzen und mache dabei Fehler. Ich darf kreativ sein, andere begeistern und von ihnen lernen. Und manchmal, da bin ich einfach nur müde. Dann möchte ich mich am liebsten irgendwo verkriechen. Auch das ist okay – in der agilen Welt, wie in der privaten. Weil es immer um Liebesgeschichten geht, um Begeisterung, um Leidenschaft, um Sinn – mit allen Höhen und Tiefen. Das ist nicht einfach nur ein Job. Es ist das Leben.
Veronika Kotrba
ist lösungsfokussierte Coach, Beraterin und Trainerin in Wien. Seit 2012 unterstützt sie – gemeinsam mit Ralph Miarka – Führungspersonen im agilen Unternehmensumfeld. 2015 haben sie gemeinsam die sinnvollFÜHREN GmbH in Wien gegründet und ihr Buch »Agile Teams lösungsfokussiert coachen« veröffentlicht. Seit 2018 bildet Veronika im hauseigenen Lehrgang – gemeinsam mit 11 internationalen TrainerInnen – lösungsfokussierte Coaches aus und findet unermüdlich neue Ansätze für mehr Kooperation auf Augenhöhe. Nähere Infos zu Veronika und zu den Angeboten von sinnvoll-FÜHREN findest du unter www.sinnvoll-fuehren.com
Agiler Erstkontakt mit Schreibfehler
Mit agiler Entwicklung kam ich zum ersten Mal 2011 in Berührung, als ich an einem Projekt für ein neues Bremssystem arbeitete. Zu dieser Zeit war ich bereits drei Jahre in dieser Abteilung. Ich hatte also schon einiges gesehen, aber als supererfahren hätte ich mich damals nicht bezeichnet.
Wie immer bei einer Neuentwicklung, oder zumindest kenne ich es nicht anders, waren wir spät dran. Der angespannte Zeitplan ließ die Projektleitung nach neuen Ideen suchen, mit denen sie die Arbeit beschleunigen konnte.
Also bekam ich vom Softwareprojektleiter eines Tages eine Einladung zum SCRUMP. Was heißt eine Einladung … eine ganze Serie! Ab sofort sollte ich jeden Tag um 8:30 Uhr zum Daily SCRUMP erscheinen. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Jeden Tag so früh bei der Arbeit auftauchen, dann auch noch in einem anderen Gebäude auf der Task-Force-Fläche – oje, gar nicht meins. Und was sollte SCRUMP überhaupt sein? Was sollte ich da? Was würde dort passieren?
Das Googeln des Wortes SCRUMP lieferte kein vernünftiges Ergebnis, außer dem Tierchen aus dem Film »Lilo & Stitch«. Am Abend rief ich meinen Vater an und fragte ihn, ob er dieses Wort schon einmal gehört hatte. Er meinte, das beschreibe einen schweren Atomkraftwerksunfall. Das ergab für mich jetzt auch keinen Sinn. War also vermutlich wieder so eine neue doofe Idee, die zu nichts führte. »Eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird«, wie die älteren Kollegen zu sagen pflegten. Was blieb mir also anderes übrig, als dort aufzutauchen und mir anzuschauen, was passieren würde. Schließlich wollte ich ja offen für Neues sein und wer weiß, vielleicht bestand ja eine geringe Chance, dass es doch was helfen würde.
Also kam ich Montagmorgen halbwegs pünktlich um 8:30 Uhr in einem Gebäude, in dem ich nicht arbeitete, zum ersten SCRUMP meines Lebens an. Überrascht stellte ich fest, dass der Gesamtprojektleiter anwesend war. Sehr gut, so sieht der also aus. Er erklärte uns, was mit diesem Meeting jeden Morgen bezweckt werden sollte. Wir sollten enger zusammenarbeiten, schneller Informationen austauschen und somit besser im Projekt vorankommen. Das ganze Projektteam war eingeladen.
Ich muss sagen: So nervig es auch war, jeden Morgen so früh vor Ort sein zu müssen, erwies sich das Daily SCRUMP als äußerst hilfreich. Es verbesserte tatsächlich unsere Zusammenarbeit, da wir jeden Morgen ein Update zu wichtigen Themen bekamen, Antworten auf Fragen erhielten und manchmal schon auf dem Weg zum Gebäude mit den Kollegen Themen klären konnten – zum Beispiel wann ich welches funktionierende Auto zum Testen bekommen würde.
Am Ende fand ich die Idee sogar so gut, dass ich versuchte, den Leiter unseres bereichsweiten Project Management Offices davon zu überzeugen, diesen Ansatz in unser Handbuch aufzunehmen. Nach einer zweistündigen Diskussion gab ich deprimiert auf. Die Gegenargumente habe ich nicht verstanden, bis heute nicht. Es sei jedem Projektleiter selbst überlassen, so etwas zu organisieren, sagte er. Ja, schon, aber die meisten taten es halt einfach nicht.
Erst zwei Jahre später habe ich durch Zufall erfahren, dass das nicht SCRUMP, sondern SCRUM heißen sollte und dass es eine agile Methode ist. Ein Kollege hatte mir ein Training dazu empfohlen und ich beschloss, es zu besuchen. Ich lernte mehr über SCRUM und ich verstand auch, dass das, was wir gemacht hatten, dem Daily Standup ziemlich nahegekommen war. Aber eben nicht ganz, da wir den Ablauf nicht befolgten und statt eines Entwicklungsteams immer das ganze Projektteam dabei war. 2015 wechselte ich in ein Projekt zur Einführung agiler Methoden in unserem Bereich. Ich lernte andere Kollegen kennen, die bereits Erfahrung mit agilen Methoden gesammelt hatten, und ich lernte viel von ihnen. Heute, acht Jahre später, sind agile Methoden fester Bestandteil unseres Projekt-Management-Handbuchs. Ich war meiner Zeit wohl einfach voraus.
Sabrina Dittrich
arbeitet seit über zehn Jahren als Entwicklerin für sicherheitsrelevante Systeme und ist agiler Methoden-Coach sowie Führungskraft in der Automobilbranche. Sie ist ASpice Provisional Assessor und versucht somit, immer die Balance zwischen Prozess und Produktivität zu finden. Sabrina arbeitet selbst agil, sie unterstützt die Einführung agiler Methoden und entwickelt unternehmensweite agile Konzepte. Sie hat den agilen Ansatz in internationalen Projekten kommen und manchmal auch wieder gehen sehen.
Lesson – learned
Heute trifft sich um 11 Uhr eine Auswahl der Projektteilnehmer am Standort der über 200 Kilometer entfernten Firmenzentrale. Früh morgens, es ist noch kalt und der Himmel grau, steige ich in meinen schwarzen Mietwagen und fahre los. Auf der Autobahn in Richtung Süden setzt der Regen ein. Er prasselt auf die Frontscheibe und der Wind wirbelt das Laub durch die Luft. »Na hoffentlich komme ich pünktlich an bei diesem Schietwetter1«, schimpfe ich leise vor mich hin. Die Scheibenwischer schieben hektisch das Wasser zur Seite. Auf der Fahrt habe ich viel Zeit, um über das Projekt und den heutigen Termin nachzudenken.
Lessons Learned – was haben wir im Projekt gelernt? Es ist so einiges schiefgelaufen. Nur mit Mehrarbeit, Stress und zusätzlichen Mitarbeitern konnten wir die nicht enden wollenden Anforderungen mit einigen Abstrichen halbwegs termingerecht umsetzen. Das hatte sich wie ein Leben unter Dauerstrom angefühlt. Die Dokumentation blieb dabei auf der Strecke, und auch die Qualität war nicht perfekt. Für mich hatte das Problem ganz klar beim Start des Projekts begonnen, als die Anforderungen aufgeschrieben wurden. Es war nie so richtig klar, was dem Kunden versprochen worden war. Fix waren nur zwei Sachen: das Budget und der Termin. Ich bin gespannt, ob der heutige Termin irgendetwas bringt. Das Projekt ist vorbei und aus den Projekten davor haben wir selten etwas gelernt. Jetzt darf ich so weit fahren, obwohl es sicher wieder nur um Schuldzuweisungen geht. Das wird bestimmt eine dieser PowerPoint-Schlachten, in denen die Teilnehmer nacheinander erklären, warum sie keine Schuld am chaotischen Verlauf des Projekts hatten und warum die Schuld eindeutig bei den anderen liegt. So wie es in den anderen Lessons Learned vergangener Projekte war, wenn sie überhaupt stattgefunden haben. Soll ich doch noch spontan absagen? Ach, vielleicht wird es ja ganz nett. Einige Kollegen habe ich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten nicht mehr gesehen.
Nach über drei Stunden Autofahrt im Dauerregen und zahlreichen Baustellen, die mich wertvolle Zeit gekostet haben, erreiche ich das Ziel. Nun muss ich mich beeilen, noch sieben Minuten bis zum Beginn der Veranstaltung. Mein Puls steigt. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Vor mir erstreckt sich der nicht enden wollende Parkplatz der Firmenzentrale. Zum Glück finde ich nahe am Haupteingang eine Parklücke, ich schnappe meine Laptoptasche aus dem Kofferraum und eile zur Tür. Schnell das Drehkreuz beim Werkschutz passieren und ab in das mehrstöckige Nebengebäude, wo das Treffen stattfindet. Die ersten Schweißperlen glitzern auf meiner Stirn, unter meiner dunklen Softshelljacke wird es immer wärmer. Der gläserne Fahrstuhl bringt mich direkt in die dritte Etage. Während der Fahrt werfe ich einen kurzen Blick durch die bodentiefen Panoramafenster auf das riesige Firmengelände. Die Fahrstuhltür öffnet sich und nur einige Meter entfernt erreiche ich den Meetingraum. Ich tupfe die Schweißperlen schnell mit meinem Ärmel ab, ein letzter Blick auf meine Armbanduhr. Es ist 10:59 Uhr. »Puh, geschafft.« Abgehetzt und einen tiefen Atemzug holend durchschreite ich die Tür.
Im Hintergrund ertönt aus einem Bluetooth-Lautsprecher leise klassische Musik. Vor mir erblicke ich zuerst Matthias, den Hauptprojektleiter, Organisator und Moderator des Meetings. Matthias ist Mitte 40 und hat sein dünnes, graumeliertes Haar zu einem Seitenscheitel gekämmt. Er ist sportlich gekleidet: blau-weiß-kariertes Hemd, dunkelblaue Jeans mit einem weißen Ledergürtel und dazu perfekt passende weiße Sneakers. Die Ärmel sind bis zum Oberarm lässig hochgekrempelt. Gemächlich kommt Matthias auf mich zu, breitet seine Arme aus, begrüßt mich herzlich mit einer Umarmung und sagt: »Schön, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Ich hatte schon Angst wegen des Wetters. Nimm Platz und ruh dich kurz aus, wir fangen in zehn Minuten an. Nina und Jochen kommen etwas später.« »Na toll«, denke ich, »Nina und Jochen kommen zu spät, obwohl beide hier arbeiten. Wozu hetze ich mich so ab? Das ist mal wieder typisch für die beiden.« Im Raum warten bereits die anderen Teilnehmer. Nacheinander begrüße ich alle, setze mich auf einen freien Konferenzstuhl am Kopfende des grauen Tisches und schaue mich um. Bis auf Nina und Jochen sind alle Abteilungen vertreten, die am Projekt mitgewirkt haben. »Moment, der Vertrieb fehlt. Komisch, dass von denen noch keiner da ist. Die waren mit ihren Versprechungen gegenüber dem Kunden nicht gerade unbeteiligt am Chaos. Anforderungen vier Wochen vor dem Go-Live in die Entwicklung einkippen – nun ja«, erinnere ich mich. Zwischen der klassischen Hintergrundmusik nehme ich in unregelmäßigen Abständen das Klackern von Laptop-Tastaturen wahr. Manche Teilnehmer nutzen die Zeit, um schnell noch E-Mails zu beantworten, andere schauen aufs Smartphone, schreiben ebenfalls E-Mails oder surfen im Internet. Am anderen Ende des Raumes fällt mir ein Flipchart auf. Darauf ist eine mit schwarzen Strichen gezeichnete Figur erkennbar, die durch eine geöffnete Tür schaut und winkt. Darüber steht in großen Buchstaben geschrieben: HERZLICH WILLKOMMEN.
Wow, nicht schlecht. Eher ungewöhnlich, dass ein Flipchart eingesetzt wird. Normalerweise läuft in Meetings der Beamer auf Hochtouren und zeigt das Deckblatt einer PowerPoint-Präsentation mit Titel und Untertitel. Und heute? Der Beamer ist nicht einmal eingeschaltet. Hat Matthias das vergessen?
15 Minuten später schlendern Nina und Jochen entspannt durch die Tür. Mir fällt auf, dass sie einigen Teilnehmern zur Begrüßung die Hand reichen und sich mit Vornamen vorstellen. »Komisch, nun haben die so lange in einem Projekt gearbeitet und haben sich noch nicht persönlich kennengelernt? Wie soll man eine Verbindung zu einer Person aufbauen, die man noch nie getroffen hat? Nur durch E-Mails und Telefonate geht das wohl kaum«, sind meine ersten Gedanken.
Matthias stoppt die Musik über sein Smartphone und positioniert sich mir gegenüber auf der anderen Seite des Tisches. Einige Teilnehmer reagieren sofort und klappen die Laptops zu, andere tippen munter weiter oder starren auf das Smartphone. Mit seiner kräftigen, tiefen Raucherstimme sagt Matthias: »Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Lessons Learned und freue mich, dass ihr alle den Weg in die Zentrale gefunden habt. Bis auf den Vertrieb ist aus jeder Abteilung ein Mitarbeiter anwesend. Bevor ich starte, stelle ich euch die Regeln für die heutige Veranstaltung vor.« Er geht zum Flipchart und blättert das erste Blatt um, auf dem die Spielregeln geschrieben stehen. Matthias liest vor: »Keine Handys! Keine E-Mails! Lasst andere ausreden. Geht respektvoll miteinander um und gebt konstruktive Kritik. Gibt es irgendwelche Einwände?« Sein prüfender Blick wandert durch den Raum. Keine Reaktion. »Das werte ich als Zustimmung und bitte euch, die Laptops und die Mobiltelefone nun wegzupacken.« Die Teilnehmer stecken ihre Geräte in die Taschen und lagern diese hinter sich an den Wänden. »Ein guter Start, nun können wir fokussiert über das abgeschlossene Projekt diskutieren«, flüstere ich meinem Sitznachbarn zu.