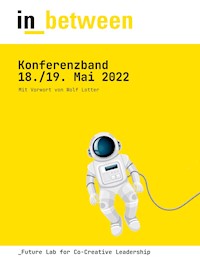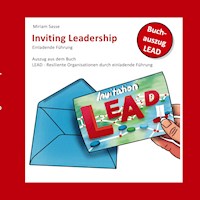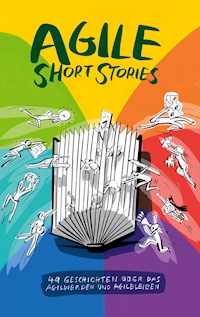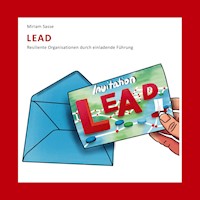
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ob wir es "Agilität" nennen oder anders: Unternehmen müssen die Fähigkeit entwickeln,sich wendig an die Kapriolen unberechenbarer Märkte anpassen zu können. Glücklich ist in dieser Situation, wer die Überlegungen hinter Buzzwords wie New Work, Scrum, Kanban verstanden hat, statt die zuhauf verfügbaren Blaupausen des Agile Industrial Complex blindlings anzuwenden. Den Versprechen der neuen Arbeitswelt nach wirkungs-, werte- und sinnvollerer Arbeit sollten Sie nicht uneingeschränkt vertrauen: In der Umsetzung schafft ein gelöstes Problem viele neue Probleme, wenn bestehende Organisationsstrukturen und Verhaltensmuster nicht hinterfragt werden. Am wenigsten können sich Führungskräfte dem Wandel entziehen. Ihre Aufgabe ist, klug abzuwägen: Was müssen wir bewahren, was muss sich verändern und wie gehe ich in dieser Veränderung voran? Führung wird so zum aktiven Gestalten zwischen Stabilität und Dynamik, durch das die einzelnen Menschen und schließlich die Organisation resilienter gegenüber dem Unvorhergesehenen werden. Die Fähigkeit von Führungskräften, das Potenzial von Menschen zu erkennen und sichtbar zu machen - das Fördern von "Talenten" -, spielt dabei eine zentrale Rolle. Dr. Miriam Sasse betrachtet in diesem Buch agile Konzepte sowie gängige Führungsansätze aus psychologischer und systemtheoretischer Sicht. Durch diesen klaren, unverzerrten Blick zeigt sie auf, wie wirkungsvolle Führung hin zur Resilienz gelingt. Sie entwickelt ein "Inviting Leadership", das die Kraft von Einladungen und Experimenten für die Veränderung nutzt. Das stärkt nicht nur Teams und macht sie handlungsfähig, sondern lässt Führungskräfte selbst resilienter werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1.
Vorwort
2.
Managen oder führen?
2.1 Vorsicht mit Worthülsen und Alltagsdietrichen
2.2 Anleitung für dieses Buch
3.
New World – New Work
3.1 Junge Generationen im Zwiespalt
3.2 Welt der Überraschungen
3.3 Das Agile Manifest
3.4 New Work und der Wandel der Gesellschaft
3.5 Der agile Industriekomplex
4.
Wie agile Teams arbeiten
4.1 Scrum
4.2 Kanban
4.3 Crossfunktionale DevOps-Teams
4.4 Selbstorganisation – das Ergebnis zielorientierter Führung
4.5 Führung als konstruktive Störung der Selbstorganisation
5.
Geschäftsagilität
5.1 Prämissen der Geschäftsagilität
5.2 Wie der agile Wandel Geschäftsagilität fördert
5.3 Prozesse dual gestalten
5.4 Ambidextrie und Dualität
5.5 Skalierungsansätze
5.6 Netzwerk- und Zellstrukturdesign
5.7 Flight Levels
5.8 Agile Transformation
6.
Führung früher vs. heute
6.1 Traditionelle Führungsmodelle
6.2 Was führt: Macht oder Ansehen?
6.3 Freigabe von Autorität: Alles oder nichts?
6.4 Agile Leadership
7.
Inviting Leadership
7.1 Prinzipien des Führens mit Einladungen
7.2 Kommunikation über und innerhalb von Grenzen
7.3 Einladend führen statt streng befehlen
8.
Transformation durch Experimente
8.1 Ab heute machen wir alles anders
8.2 Kein „Jugend forscht“ – oder doch?
8.3 Bedingungen für erfolgreiches Experimentieren
8.4 Der Sponsor setzt den geschützten Rahmen und das „Was & Wofür“
8.5 Gute und relevante Bewertungen in Organisationen
8.6 Die Schritte des guten Experimentierens
8.7 Erfahrungen aus der Experimentierküche
8.8 Der Business Case für Experimente
9.
Resilienz: robust und agil
9.1 Agilität & Resilienz
9.2 Glauben Sie an den Menschen
9.3 Positive Leadership
9.4 Vertrauen
9.5 Nicht-entschiedene Entscheidungsprämissen
9.6 Objectives and Key Results
10.
Sich als Führungskraft neu erfinden
10.1 Führen wie die Vorbilder
10.2 Was die agile Führungskraft können soll
10.3 Schema-Coaching mit SWITCH
LEAD
1 Vorwort
Der IT-Unternehmer Mik Kersten behauptet, dass Organisationen heute folgendes Problem haben (Kersten 2018): Die verantwortlichen Manager und Führungskräfte wissen durchaus, dass sie auf schnelllebige Märkte mit Veränderung reagieren müssen. Allerdings wird in vielen Organisationen versucht, dieses Problem mit Management-Modellen und Infrastrukturen der letzten industriellen Revolution zu lösen. Für die Revolution von heute werden aber neue Modelle und neuen Denkweisen benötigt
Dabei geht es nicht darum, das Alte gänzlich zu entsorgen, sondern darum, dem bekannten System ein zweites zur Seite zu stellen. John P. Kotter (2012) und viele andere sprechen von einem dualen System, das sie bei vielen Höchstleistern beobachten: Es gibt eine Handlungsweise für stabile, undynamische Umfelder, in denen bekannte Standards und Best Practices verlässlich wirken – gleichzeitig wird aber eine Handlungsweise kultiviert, die schnelle Reaktionen in instabilen, dynamischen Umfeldern zulässt. Talente in der Organisation bekommen den Freiraum, um Neues auszuprobieren und damit zu experimentieren. Die Höchstleister unter den Organisationen reagieren auf diese Weise leidenschaftlich auf Überraschungen aus dem Markt und überraschen wiederum selbst ihre Konkurrenten. Jede Organisation existiert in diesem Spannungsfeld von gleichzeitiger Stabilität und Instabilität und es ist wichtig, das Hin und Her und die Kräfte zwischen beiden Systemen bewusst zu gestalten.
Dieses Buch hat daher einen anderen Fokus als die 40.000 anderen Management-Bücher, die ich bei Amazon unter dem Schlagwort „Führung“ finde. Mir geht es nicht darum, Wege zum wirtschaftlichen Arbeiten aufzuzeigen oder Ihnen zu erklären, wie höchste Qualität erzeugt wird. Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie ein Manager sein sollte, um möglichst schnell befördert zu werden. In diesem Buch geht es um die Frage: Was kann Führung dazu beitragen, um widerstandsfähige Teams entstehen zu lassen, die sich in ihrer Arbeit gestärkt und handlungsfähig fühlen?
Ich will Ihnen zeigen, wie Sie sich selbst gut führen können, denn aus dieser Balance heraus werden Sie Ihre Teams und letztendlich die Organisationen in jeder Situation gut führen. Die Fähigkeit, sich selbst zu führen, brauchen Sie in turbulenten, dynamischen und unsicheren Zeiten. Wie tasten wir uns also an dieses Thema heran?
In Teil 1 betrachten wir die Hintergründe der neuen Führungs- und Arbeitswelt, zum Beispiel die „New Work“-Bewegung, die als Reaktion auf eine unberechenbarere Arbeitswelt und die Ansprüche einer unkonventionellen Generation von Arbeitskräften entstanden ist. Wir finden als Antwort darauf eine Gemeinschaft, die ein einträgliches Geschäft mit allem entwickelt, was sich als „agil“ verkaufen lässt (der sogenannte Agile Industrial Complex). Auf der anderen Seite betrachten die Thesen der neuen Wirtschaft Agilität als natürliche und unvermeidbare Entwicklung unserer Gesellschaft. In vielen Organisationen gibt es bereits agile Teams, die sich mit Themen wie Scrum, DevOps und der angestrebten Selbstorganisation beschäftigen. Ziel des Ganzen ist die Geschäftsagilität: eine Organisation, die in allen Belangen schnell auf den Markt reagieren kann und widerstandsfähig gegenüber unvorhersehbaren Ereignissen ist. Diese Veränderungen unterliegen einigen Prämissen, und so manche Skalierungsansätze und Transformationsmethoden bewirken keine wirkliche Veränderung. Manche wirken in Organisationen sogar destruktiv.
In Teil 2 werden alte Management- und aktuelle Führungsansätze einander gegenübergestellt. Viele der älteren Ansätze bauen auf einem Machtverständnis auf, das für die neue Arbeitswelt und die kommenden Generationen nicht haltbar ist. Wir werden uns einen ungewöhnlichen Weg ansehen: Das Führen mit Einladungen bewirkt hohe Motivation bei den Mitarbeitern und weckt deren Talentpotenziale, die für die Führung des Unternehmens in einer komplexen Marktsituation gebraucht werden. Autonomie und Selbstorganisation brauchen aber klare Absichten und Leitplanken, um sich entfalten zu können. Mit Experimenten und Schutzräumen in der Organisation schaffen Sie für Mitarbeiter die kreative Weite, um innovativ auf den Markt reagieren zu können.
In Teil 3 sehen wir uns an, wie Sie Ihren eigenen Führungsstil nach und nach verändern können. Wer agil und reaktionsfähig sein will, braucht eine große innere Stärke – eine hohe Resilienz. Wir fokussieren uns daher auf Ihre persönlichen Stärken als Führungskraft und auf die Stärken Ihrer Mitarbeiter. Um sich als Führungskraft neu zu erfinden, sollten Sie die Muster in Ihrer Führung und der Reaktion Ihrer Mitarbeiter erkennen. Wenn Sie diesen Blick trainieren, können sich nach und nach neue Handlungs- und Denkmuster bei Ihnen selbst und Ihrem Team entwickeln.
Dieses Buch ist als Begleitlektüre zu meinem Training für Führungskräfte entstanden, das ich seit einigen Jahren anbiete. Das Training ist sehr auf die Praxis, die gemeinsame Diskussion und die Anwendung der Inhalte ausgerichtet, daher beinhaltet dieses Buch vor allem die theoretischen Hintergründe und Grundlagen.
Im Text werden Sie immer wieder die Anmerkung „(//Karte xxx)“ finden. Diese bezieht sich auf Flipcharts und Lernkarten, die ich im Training verwende und die jenen Personen zugänglich sind, die das Training absolviert haben. Unabhängig vom Training können Sie diese Karten aber auch unter www.miriamsasse.de bestellen. Eine Übersicht darüber, wo welche Karte im Buch beschrieben wird, finden Sie auf Seite →.
Ich wollte dieses Buch bewusst kompakt halten, damit Sie es überall hin mitnehmen und in freien Minuten lesen können. Es soll helfen, unter den Führungskräften eines – Ihres – Unternehmens ein einheitliches Verständnis von Führung im agilen Kontext zu entwickeln. Wie ein Brühwürfel bietet es in komprimierter Form Inspirationen zur Frage, wie Sie Führung zukünftig gestalten können. Sie können es jederzeit an jeder beliebigen Stelle öffnen, einen Absatz lesen und aus diesem Krümelchen Würze etwas Größeres entstehen lassen.
Möge Ihnen dieses Buch als Orientierung auf Ihrem persönlichen Weg als Führungskraft dienen.
Miriam Sasse
Juli 2021, Paderborn
2 Managen oder führen?
Führung ist immer da. Selbst wenn Sie keine Führung wollen und Sie keine formelle Führungsperson bestimmen, wird sich Führung informell ausbilden. Diejenigen, die die Führung übernehmen, machen von ihrer gegebenen Macht sehr unterschiedlich Gebrauch. Jede Führungskraft baut anders geartete Beziehungen zu ihren Mitarbeitern auf und nutzt die Macht auf ihre Weise: um den eigenen Status zu erhöhen, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln oder ein ideales Arbeitsumfeld zu gestalten. Im Alltag erleben wir ständig Führungssituationen, die dafür sorgen, dass jeder Mensch eine Meinung dazu hat, was gute und was schlechte Führung ist. Sicherlich hatten auch Sie gute und schlechte Vorgesetzte oder gute und schlechte Mannschaftskapitäne?
Wir maßen uns dieses Urteil an, obwohl Führung eine sehr komplexe Aufgabe ist. Menschen sind unberechenbar und niemand kennt die Ursache eines bestimmten Verhaltens wirklich. Trotzdem meinen wir, sofort erkennen zu können, was schlechte Führung ist. Über Leiter, Chefs, Bosse, Direktoren, Anführer und Manager wird kontinuierlich gemeckert. Unter den Mitarbeitern können sich nur wenige Personen mit der Rolle des Chefs identifizieren, während sich auf der anderen Seite der Organisation viele auf ihre Führungsposition schlecht vorbereitet fühlen. Denn Führung ist nicht immer Spaß und Ehre. Oft muss man den Kopf hinhalten für Dinge, die man selbst nicht beeinflussen konnte und die Erwartungen an Führungskräfte sind manchmal so hoch, dass nur ein Superheld sie erfüllen könnte.
Als Manager bekommen Sie früh eingebläut, alles zu planen, detailreich zu delegieren und anzuleiten, alle Ergebnisse abzuzeichnen, Ziele zu setzen und zu verfolgen, alle Entscheidungen allein zu treffen und über ein ganzes Jahr hinweg die notwendigen Kapazitäten und Kosten zu planen. Problematisch nur, wenn Sie aus dem Planen und Steuern nicht mehr herauskommen und für Ihre Mitarbeiter zum Engpass werden, weil sich auf Ihrem Schreibtisch die Unterlagen stapeln und alle auf Ihre Anweisungen, Entscheidungen und Planungen warten.
Viele Führungskräfte denken dann: „Ich muss das, was ich mache, noch besser machen und überhaupt muss ich mehr machen.“ – Mehr vom Gleichen. Also machen Führungskräfte Überstunden ohne Ende und entwerfen meterlange Masterpläne.
Irgendwann merken sie, dass sie eigentlich 24/7 arbeiten könnten, weil immer überraschend irgendetwas anfällt und der Plan doch nie funktioniert.
Klingt das vertraut?
Rückt auch bei Ihnen die inhaltliche Arbeit in den Hintergrund? Kümmern Sie sich gar nicht mehr um die eigentlichen Probleme, sondern nur noch darum, die Auswirkungen der Probleme in die Termin- und Kostenplanung zu integrieren? Denn das Wichtigste ist schließlich, Pläne zu erfüllen und schöne Kennzahlen zu liefern, nicht wahr?
Vielleicht gehören auch Sie zu jenen Führungskräften, die Prozessvorgaben zu erfüllen versuchen und dabei merken, dass diese Prozesse, Konzeptvorgaben und Regelungen viel zu detail-liert und schwerfällig sind. Über Jahrzehnte gewachsen und noch viel stärker „verwachsen“ sind sie schon lange nicht mehr einhaltbar. Vollgestopft mit Sonderregelungen und ständigen Ergänzungen platzen die Prozesse aus allen Nähten.
Veränderung beginnt mit dem Erkennen
Möglicherweise haben sie die folgenden Situationen in ähnlicher Form schon selbst erlebt:
Sie hätten gerne bzw. fordern, dass Ihre Mitarbeiter im Projekt mehr Verantwortung für einzelne Produktkomponenten übernehmen. Wenn nun aber ein Fehler passiert, müssen Sie den Verursacher suchen und die Bearbeitungszeit für den Fehler auf dessen Kostenstelle buchen. Natürlich will unter diesen Umständen niemand als Verantwortlicher für eine Produktkomponente eingetragen werden. Die Folge: Die Arbeit bleibt liegen wie eine heiße Kartoffel.
Was in der Praxis ebenfalls oft zu sehen ist: Die Führungskraft fordert eine intensivere team- und abteilungsübergreifende Kooperation. Selbstverständlich würden auch die Teams gerne besser und öfter zusammenarbeiten, aber für jede Aufgabe müssen die Kostenstellen gegenseitig belastet und über Auftragsnummern verrechnet werden. Allein das Freischalten der Auftragsnummern dauert ewig und außerdem hat jeder ein festgelegtes Kostenstellen-Budget. Da ist Kooperation – insbesondere zum Quartalsende – einfach nicht mehr möglich.
Diese zwei Beispiele zeigen, dass sich Unternehmen meistens selbst im Weg stehen. Führungskräfte und Mitarbeiter haben keine Schuld daran, dass manches nicht so läuft, wie es soll. Sie handeln nur nach den ihnen auferlegten Spielregeln. Allerdings vergessen die Entscheidungsbefugten häufig, dass diese Spielregeln nicht gottgegeben sind, sondern verändert werden können.
Im krassen Gegensatz zu den alten Management-Ansätzen wird Ihnen in Führungskräfte-Trainings von heute klar gemacht, dass Sie Kulturen verändern, Mitarbeiter motivieren und coachen, gemeinsame Werte und Prinzipien festlegen, Teams gestalten oder ohne Ausüben von Macht führen müssen.
Auch diesen Ansätzen möchte ich eine neue Perspektive hinzufügen. Eines ist nämlich sicher: Menschen wollen sich nicht verändern, weil andere es von ihnen verlangen. Schon gar nicht wollen sie sich Werte vorgeben lassen. Sie können die besten Theorien der Teamgestaltung berücksichtigen: die Teamrollen von Belbin, Maccobys Charaktertypen und die Theorien zur Gruppendynamik von Homan, Wheelan oder Tuckman. Zuguterletzt tut Ihr Team doch, was es will.
Aber denken Sie nun bitte nicht, dass Sie als Führungskraft sowieso nichts bewegen könnten. Sobald Sie die Prozesse und Strukturen der Organisation so gestalten, dass sie den Mitarbeitern und der Wertschöpfung dienen, wird sich die Haltung der Mitarbeiter und die Organisationskultur von ganz allein verändern. Da sind dann keine verzweifelten Appelle notwendig, wie etwa: „Übernehmt mehr Verantwortung!“
Jede Führungskraft gibt nämlich die Muster der Unternehmenskultur vor: durch die Art und Weise, wie sie Regeln setzt und einhält und welche Strukturen sie schafft. Als Führungskraft haben Sie die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich diese alten Prozesse und Strukturen verändern dürfen. Sie geben die Sicherheit, dass die Teams ihre Arbeit transparent machen können und für Fehler nicht getadelt, sondern für neu Hinzugelerntes gelobt werden. Sie schaffen einen Schutzschirm für Ihre Teams.
Es gibt einige Persönlichkeiten, die immer wieder als Vorbilder in puncto Führung genannt werden. Da liegt die Vermutung nahe, dass es in ihren Führungsstilen oder genutzten Methoden Gemeinsamkeiten geben könnte. Seit Jahrhunderten beschäftigen sich Wissenschaftler und Philosophen mit der Frage, was gute Führung ausmacht und es wird immer wieder versucht, aus dem Leben der Führungsvorbilder neue Führungsansätze zu destillieren: Agile Leadership, Lean Leadership, Inviting Leadership, Intention-based Leadership, New Work Leadership, systemtheoretisches Future Leadership, Mindful Leadership, Positive Leadership und viele mehr. Die Beurteilung, ob es unterm Strich alles ein und dasselbe ist, überlasse ich Ihnen selbst.
Daraus ergibt sich die Frage, ob sich Führung erlernen lässt, oder ob man mit einem Talent für Führung geboren werden muss. Die typischen Vorbilder für gute oder beeindruckende Führung hatten immer auch ihre Schwächen, nur haben sie ihre Stärken gut ausgespielt. Wie auch immer: Wenn Sie bereits viel zum Thema Führung gelesen haben, könnten Sie mittlerweile den Eindruck gewonnen haben, dass eine Führungskraft mindestens ein Avenger sein muss, um all dieses Wissen in der Praxis anwenden zu können. Kann das eine einzige Führungskraft überhaupt allein leisten? Oder brauchen wir in Zukunft mindestens ein Dreigestirn aus Führungskräften, in dem jeweils eine für Produkt, Prozess und personelle Themen zuständig ist? Oder werden Führungskräfte kommen und gehen wie Influencer in den sozialen Medien?
Wenn Unternehmen anpassungsfähig sein wollen, dann muss mehr passieren, als neue Etiketten auf alte Strukturen zu kleben. Wir müssen mit dem Change-Theater aufhören und uns den neuen Denkweisen ernsthaft zuwenden. Dieses „anders denken“ hat viele Höchstleistungs-Unternehmen, wie sie Gerhard Wohland nennt, erfolgreich gemacht. Anders denken beginnt immer damit, den Unterschied zwischen „dem einen“ und „dem anderen“ zu kennen und in der Praxis wahrnehmen zu können. Nur dann ist die Aufmerksamkeit geschult, um bestehende Wahrnehmungsfilter auslüften und die Arbeitswelt aus anderen Perspektiven betrachten zu können. Einen Unterschied wahrzunehmen, ist der erste Schritt zur Erkenntnis. Es ist der richtige Weg, um Probleme zu lösen, die man mit dem bisherigen Denken nicht lösen konnte.
Den alten Führungstheorien stehen heute viele neue Führungsansätze gegenüber. Begriffe wie „Management“ und „Steuerung“ werden als veraltet und unangemessen deklariert, im Gegensatz dazu erleben „Führung“ und „Leadership“ eine Renaissance. Ich unterscheide deshalb zwischen Führung und Steuerung von Mitarbeitern, zwischen dem Führen in Netzwerken und der Ressourcensteuerung in Hierarchien. Ich wäge die Differenz zwischen internen, fixen Abteilungszielen und externen, relativen Marktzielen ab. Wissensmanagement unterscheidet sich grundlegend von Stärken- und Talentförderung. Sich gut auf alle möglichen Situationen vorzubereiten, ist etwas anderes, als einen festen Plan zu erstellen. Die Kraft von Communities im Unternehmen zu entfachen, unterscheidet sich von der Arbeit in Gremien und Lenkungskreisen. Mitarbeiter hoch auszulasten, heißt noch lange nicht, dass das Unternehmen erfolgreich ist.
Beginnen wir also damit, Begriffe zu unterscheiden und unserem Denken auf die Schliche zu kommen. (//Karte 500 und 501)
2.1 Vorsicht mit Worthülsen und Alltagsdietrichen
Den Unterschied zwischen zwei Begriffen zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Viele Begriffe haben nämlich gar keine klare Bedeutung, denn sie sind gedankliche Hilfskonstruktionen für etwas, das man nicht direkt wahrnehmen kann, nicht sehen, riechen, hören, schmecken oder fühlen kann. Ein Begriff wie „Agilität“ vereint viele Bedeutungen in sich, so wie der Begriff „Möbel“ sowohl Stühle als auch Tische umfasst. Weil die Begriffe „Agil“ und „Agilität“ mittlerweile so inflationär gebraucht werden, verwischt die Kommunikation. Um präzise kommunizieren zu können, müsste unweigerlich die Frage folgen: „Was meinst du mit Agilität?“ Niemand würde sagen: „Bring mir bitte das Möbel!“ Damit die Interpretationen nicht vollständig auseinanderlaufen, würde man intuitiv so präzise wie möglich kommunizieren und stattdessen sagen: „Bring mir bitte den Stuhl.“ Warum machen wir das nicht auch in unserem Management-Jargon?
Bei der Arbeit hören wir einige Worte so oft, dass wir sie schon gar nicht mehr hören können. Es sind undefinierbare und bedeutungsleere Begriffe, sie sind wie Plastikwörter (Pörksen 1988) oder Worthülsen: Sie entstammen meist der Umgangssprache, sehen nach außen schön aus, klingen wissenschaftlich und versprühen Autorität – nur haben sie meistens wenig Inhalt und wenig Wert. Sie transportieren mit der Zeit mehr Vorurteile als wirkliche Aussagekraft.
Begriffe, die zu Beginn noch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, weil sie neu im Gebrauch waren, nutzen sich irgendwann so sehr ab, dass die Welt nach neuen Ausdrücken fragt. Agile, Führung 4.0, New Work und viele andere Begriffe gelten als sogenannte Alltagsdietriche: Mit ihnen lässt sich jede Tür im Unternehmen, jedes Gespräch mit einer Führungskraft und jede Ausschreibung eines Auftrags eröffnen.
Erst kürzlich rief mich ein Kollege an: Er wollte in ein Angebot noch „irgendetwas mit Agile“ reinschreiben, damit es hip und modern klang. Doch das, was hinter dem Wort „Agile“ steht, ist viel zu wichtig, als dass es zu einem hippen Modebegriff verkommen sollte.
Doch nicht nur der eher außergewöhnliche Begriff der Agilität wird immer öfter seiner Bedeutung beraubt, es betrifft auch Wörter wie „Planung“ oder „Strategie“. Wenn ein Vorgesetzter eine „Planung“ verlangt, ist nicht immer sofort klar, was genau gewünscht ist: Soll etwas terminiert, analysiert, priorisiert, sortiert, programmiert oder eine Reihenfolge vorgeben werden?
Sich gut auf alle möglichen Situationen vorzubereiten, ist etwas anderes, als einen festen Plan zu erstellen. Wenn eine Fußballmannschaft einen Ablaufplan für das nächste Spiel so wie einen Produktionsplan gestalten würde, wären die Spieler nicht mehr flexibel genug, um auf die überraschenden Spielzüge des Gegners angemessen zu reagieren. Ohne angemessene Vorbereitung, ohne Training und ohne Analyse des Gegners würden die Spieler aber niemals auf den Platz gehen.
Wenn Sie in Ihrer Organisation hören „Die Agilen planen nicht“, dann fragen Sie bitte nach, was mit „planen“ gemeint ist. „Die Agilen“ bereiten sich nämlich sehr wohl vor, trainieren und analysieren ihr Arbeitsumfeld, ähnlich einer Fußballmannschaft.
Als 17 Experten 2001 in Utah zusammenkamen, um ihr Manifest für die zukünftige Zusammenarbeit in der Softwareentwicklung zu formulieren, dachten sie darüber nach, wie sie ihr Kind nennen wollten. Sie haben es nicht „lightweight“, sondern „agile“ genannt. Damals war der Begriff „agile“ noch bedeutungsoffen und sie konnten ihn mit der Bedeutung füllen, die sie brauchten. Es ist gut, wenn etwas eine Überschrift, einen Namen bekommt, weil man dann mit der Beschreibung eines Sachverhaltes nicht immer wieder von vorne beginnen muss. Man fasst etwas unter diesem Begriff zusammen. Wenn der Begriff vorher noch nicht belegt war, kann gerade diese Unbeschwertheit ein Katalysator für den dahinterliegenden Inhalt sein.
Oft sehen wir Dinge nämlich erst, wenn wir einen Begriff dafür haben. Für den einen ist Schnee nur Schnee. Für den anderen, der gerade einen Berg hinaufsteigt, ist die Unterscheidung zwischen Neuschnee, Altschnee, Pulverschnee, Nassschnee, Faulschnee, Bruchharsch und Firn überlebenswichtig.
Ludwig Wittgenstein schreibt in seinen Philosophischen Untersuchungen in § 43: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ Das gilt besonders für Worte wie Agile, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Führung 4.0, New Work, Innovation und andere. (// Karte 504) Unter „Agile“ verstehen wir sehr viel mehr als nur „beweglich“ und „flexibel“, wie es uns die Übersetzung aus dem Wörterbuch vorschlägt.
Wenn Begriffe wie Agile als Katalysator dienen, dann können sie für Teams und Abteilungen, die ihre Inhalte umsetzen wollen, einen Schutzraum schaffen. Positiv besetzte Begriffe wie Innovation oder Agilität werden vorerst nicht diskreditiert und bekommen wenig Widerstand, weil grundsätzlich jeder innovativ und agil sein möchte. Durch die Wortbedeutung können sich Teams abgrenzen, so dass sie geschützt vom Rest der Organisation etwas Neues ausprobieren dürfen. Der Rest der Organisation duldet diese Irritation, weil alte Strukturen und Regeln dadurch nicht in Frage gestellt werden. Der Alltagsdietrich Agilität ermöglicht neue Arbeitsweisen.
Aber seien Sie gewarnt: Wenn Ihre Mitarbeiter erleben, dass dem Begriff keine Taten folgen und sich im Grunde nichts an den hierarchischen und bürokratischen Strukturen verändert, verlieren sie ihre Motivation und werden letztendlich zynisch. So können die besten Absichten destruktiv im Unternehmen wirken.
2.2 Anleitung für dieses Buch
Die Warnung vor Worthülsen und Alltagsdietrichen haben Sie erhalten. Moderne Führung und Agilität sind längst nicht mehr die Ausnahme, in manchen Branchen gehören sie mittlerweile zum Standard. Sie sollten dennoch nicht unüberlegt moderne Führungsansätze und Agilität in Ihrer Organisation einsetzen.
Allem voran steht natürlich die große Frage: „Wofür?“ Wofür machen Sie das? Wofür lesen Sie dieses Buch? Wofür soll es gut sein, wenn Sie Ihren Führungsstil verändern? Welche Probleme wollen Sie damit lösen? Wofür soll es gut sein?
Wenn Sie vor hatten, mal eben schnell zwei oder drei kleine Dinge aus diesem Buch in Ihre bestehenden Strukturen einzubinden und dafür mit einem großen Erfolg belohnt zu werden, muss ich Sie schon jetzt enttäuschen: Die einzelnen Elemente, die ich Ihnen vorstellen werde, sind Teil eines großen Ganzen. In der falschen Kombination mit Ihren bestehenden Strukturen im Unternehmen können sie lächerlich, provokativ oder gar destruktiv wirken.
Vergleichen wir es wieder mit einem Beispiel aus dem Sport:
Nehmen wir an, ein Squash-Verein hat zu wenige Mitglieder, Zuschauer und Sponsoren und entscheidet deshalb, einen Handball-Verein zu gründen – Handball ist im Stadtkreis nämlich sehr gefragt. Je zwei Spieler mit ihren Squash-Schlägern und ohne spezielles Training auf ein Handballfeld zu stellen, wäre zwar amüsant, aber nicht erfolgreich. Die ehemaligen Squash-Spieler sind es gewohnt, im Einzel gegen sich selbst oder im Doppel zu spielen und müssen sich an den Mannschaftssport erst gewöhnen. Sie müssen über ihre Rollenverteilung sprechen, Torwarte gab es beim Squash nämlich nicht. Die Trainer und Fachexperten für Squash können ihnen beim Handball nicht weiterhelfen. Mit dem Squash-Schläger, dem Ball und ihren alten Sprint- und Bremstechniken können die Spieler ebenfalls nicht mehr effektiv arbeiten.
Die Elemente müssen zusammenpassen, damit es funktioniert. Sie müssen auf Plausibilität überprüft werden und dürfen im Gegensatz zu den Grundüberzeugungen des Unternehmens stehen. Wenn die Überzeugung „Ich spiele Bälle grundsätzlich immer so, dass sie niemand erreichen kann“ besteht, spielt man besser Squash als Handball.
Wenn Sie nicht in diese Fettnäpfchen treten oder ins Leere laufen möchten, sollten Sie sich vorher drei Fragen stellen:
Was möchten Sie verändern?
Welche Hindernisse oder Probleme möchten Sie damit lösen?
Stehen Grundüberzeugungen in Ihrem Unternehmen den Maßnahmen entgegen?
Wenn Sie das Verhalten Ihrer Mitarbeiter oder Führungskräfte direkt verändern wollen, sie „dressieren“ wollen, wird es höchstwahrscheinlich scheitern. Erinnern wir uns an die Beispiele zum Übernehmen von Verantwortung und zur teamübergreifenden Zusammenarbeit.
Wenn Sie Poster mit den neuen Leitlinien für die Unternehmenskultur und zu den neuen Werten aufhängen – zum Beispiel „One Company“ mit offener Fehler- und Vertrauenskultur – wird dadurch niemand seine Werte verändern. So etwas Persönliches wie die eigenen Werte kann man nur schwer ändern – man kann lediglich andere Werte schauspielern oder sogar vorgaukeln. Dadurch entsteht jedoch eher eine Misstrauenskultur, sogar Zynismus.
Sobald Sie aber an den Strukturelementen der Organisation anpacken wollen, an der Hierarchie, der Infrastruktur, den Regeln und Prozessen, wird die Veränderung erfolgversprechend.
Wenn Sie nicht wirklich etwas verändern wollen, sondern nur ein paar Sandkasten-Übungen im sicheren Umfeld ohne Auswirkung auf das Jahresergebnis der Organisation absolvieren möchten, werden Sie ebenfalls nicht viel erreichen. Natürlich können Sie im Kleinen beginnen. Aber irgendwann reicht es einfach nicht mehr, die Selbstorganisation beim Aufräumen der Kaffeeküche als „New Leadership“ zu bezeichnen. Die neuen Ansätze müssen die Wertschöpfung betreffen, sie müssen genutzt werden, um wirklich wichtige und dringende Probleme des Unternehmens zu lösen. Nur dann wirken sie nachhaltig.
Und dann wären da noch die bestehenden Grundüberzeugungen im Unternehmen. Beim Squash ist das Ziel, die Bälle so zu spielen, dass sie niemand erreichen kann. Beim Handball sollten Sie die Bälle Ihren Mitspieler so zuspielen, dass sie diese sicher erreichen.
Wenn in Ihrer Organisation bisher jede Person an den persönlichen Jahreszielen gemessen wurde, werden Sie mit dem Wechsel zu Team- und Abteilungszielen noch nicht erreichen, dass echte Teamarbeit entsteht. Hier handelt es sich um einen tiefgreifenden Wechsel vom Einzelzum Mannschaftssport. Wenn die Experten die Grundüberzeugung mitbringen, dass man sich auf andere nicht verlassen kann und die anderen sowieso nichts können, wird kein Teamspiel entstehen.
Wenn Sie Veränderungen bewirken wollen, die den bisherigen Grundüberzeugungen in Ihrer Organisation entgegenstehen, müssen Sie einen Schutzraum gestalten, in dem diese Veränderung möglich wird, weil die Grundüberzeugung außer Kraft gesetzt wird.
Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie vielleicht mit einigen älteren Management-Theorien aufräumen. Machen Sie einen kleinen Schritt nach dem anderen, priorisieren Sie Ihre Ideen. Manche Veränderungen werden von den anderen vielleicht gar nicht bemerkt, andere werden große Wellen schlagen. Durch viele kleine Schritte entsteht eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Arbeitsweise.
Wo steht die Welt heute? Wo dreht sie sich hin?
3 New World – New Work
3.1 Junge Generationen im Zwiespalt
Neue Technologien beeinflussen nicht nur den Markt für Produkte und Dienstleistungen, sondern auch unsere eigene Wahrnehmung und Erwartungshaltung. Durch die neuen Technologien lernen wir, dass fast alles jederzeit zugänglich ist und uns alle Möglichkeiten offenstehen. Viele Mitarbeiter wechseln deshalb heute schneller ihren Job, als das in früheren Generationen der Fall war. Nicht nur das Umfeld von Unternehmen ändert sich schneller als jemals zuvor, auch die Mitarbeitenden möchten ihre Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten stets vor Augen haben – sonst ziehen sie in das nächste Unternehmen weiter.
Die neue Generation von Mitarbeitern – die sogenannten Generationen Y und Z – möchten eigenverantwortlich arbeiten, Entscheidungen hinterfragen und Zusammenhänge erklärt bekommen. Die Benefits, die von Bewerbern gefordert werden, verändern sich und Unternehmen müssen einiges bieten, um mit dem Rest des Marktes Schritt halten zu können.
Doch so leicht sind die Ys und Zs gar nicht zu verstehen oder gar in Schubladen zu packen. Peter Kruse fand in einer Studie heraus, dass die Eigenschaften in diesen jungen Generationen stark gestreut und polarisiert sind. Die Generation Y zerfällt in zwei voneinander unabhängige Kohorten, deren Werte inkompatibel sind: Während die eine Kohorte eine sichere, klassische Karriere in einem Unternehmen anstrebt, wünscht sich die andere Kohorte die kreative Autonomie in der Selbstständigkeit (Kruse 2004). Eine zusätzliche Streuung ergibt sich durch das Milieu, in dem die einzelnen Personen aufgewachsen sind.
Wir haben es also mit Mitarbeitenden zu tun, die sowohl nach großer Autonomie als auch nach hoher Sicherheit suchen. Die einen fordern einen (notwendigen) Paradigmenwechsel, während den anderen eine leichte Optimierung genügt. Das sind die Symptome der Suche nach Orientierung, die von jeder Generation gewünscht wird. Ein wichtiger Orientierungspunkt war schon immer die Technik, die das jeweilige Zeitalter bestimmt. Für die Generation X war es der Personal Computer und die Erfindung der E-Mail. Die Generation Y wächst mit dem Smartphone auf und nutzt Instant Messaging sowie Social Media als alltägliche Kommunikationsmittel. Die kommende Generation Z wächst mit Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) und der Cloud auf. (//Karte 521)
Die Generation Z beschäftigt sich mit dem Klimawandel und Pandemien, mit Terror und Diversity. Bei all den riesigen Problemen, vor denen unsere Gesellschaft steht, wird ein Angestelltenverhältnis lediglich als Auslaufmodell wahrgenommen. Vertreter und Vertreterinnen der Generation Z denken darüber nach, ob durch die zunehmende Automatisierung zukünftig noch für jeden Menschen genug Arbeit da sein wird und sie gehen davon aus, dass sie von überall arbeiten können. Im Büro müssen nur wenige zwingend sitzen – das hat COVID-19 eindrucksvoll gezeigt.
Genauso steckt das Führungsverständnis in einem fundamentalen Wandel: In 2020 zeigte eine Studie der Bertelsmann Stiftung mit 1000 teilnehmenden Führungskräften, dass unter den Führungskräften der Generation Y (Jg. 19802001) rund 44 Prozent, der Generation X (Jg. 1965-1979) rund 34 Prozent und der Generation Baby-Boomer (Jg. 1946-1964) rund 21 Prozent große Zweifel an sich selbst haben. Der Zweifel an der eigenen Führungskompetenz fällt bei den Jüngeren also sehr viel stärker aus. Sicherlich haben sie weniger Führungserfahrung als die Älteren, aber Führung ist für sie auch weniger attraktiv, weil sie anders sozialisiert wurden. Die junge Generation fühlt sich in ihrer Führungsrolle wie in einem bürokratischen Korsett, das einerseits schwer auszufüllen ist und sie gleichzeitig erdrückt.
Stärker als je zuvor hat aber die Kommunikation einen entscheidenden Einfluss auf die jungen Generationen. Nach Kruse (in Burda 2010) verändert die Architektur unserer technischen Systeme auch die Art der zwischenmenschlichen Vernetzung. Eine geänderte Architektur erzeugt immer eine geänderte Wirklichkeit. Die Vernetzung der Menschen auf dieser Welt ist durch das Internet, Smartphones und Social Media so stark verändert wie nie zuvor und diese Veränderungen werden uns langfristig beschäftigen. Die jungen Menschen von heute wachsen in einer ganz anders vernetzten Welt als ihre Vorgänger auf. Weichselbaum (2020) nennt diese vierte große gesellschaftliche Revolution eine „Vernetzungsrevolution“, die Menschen mit ihrer Kommunikation und Begegnung wieder in den Fokus setzt.
Für die Jugend von heute tun sich damit völlig neue Arbeitsfelder auf – vor allem solche, in denen sie „ihr Ding“ machen können. Social Media haben das Berufsbild des Influencers geschaffen. (//Karte 520) Warum folgen so viele Jugendliche den Influencern auf YouTube, Tik Tok, Instagram oder Twitch? Die Influencer von heute – die Lochis, ConCrafter, LeFloids, Paluten oder Babys Beauty Palaces – sind morgen schon wieder uninteressant, weil es neue Influencer gibt. Dennoch berichten die Berufsberater der Agentur für Arbeit, dass Jugendliche als Berufswunsch „Influencer“ angeben – und das recht häufig.
Die Art und Weise, wie sich Influencer darstellen und wofür sie stehen, kann von Unternehmen nicht ganz unberücksichtigt bleiben. Denn so wie Jugendliche und junge Erwachsene über die Performance von Influencern urteilen, so tun sie es auch über potenzielle Arbeitgeber: Ein Unternehmen, das nicht die richtigen Werte vertritt und moralisch handelt, wird immer weniger Mitarbeiter für sich gewinnen. Nicht nur über einen Influencer, sondern vor allem über ein Unternehmen kann in den Sozialen Medien ein so hartes Urteil gefällt werden, dass es vom Markt verdrängt wird.
Ob sie nun ihre Freiheit oder eher Sicherheit oder beides suchen – eines sind die Generationen Y und Z auf jeden Fall: selbstbewusst. Mitarbeiterbeteiligung, Selbstorganisation, kollegiale Führung, Selbstentfaltung und Work-Life-Balance gehören für viele Führungskräfte und Personalabteilungen inzwischen zum Pflichtprogramm. Schließlich fragen junge Mitarbeitende und High Potentials heute bereits beim Einstellungsgespräch nach Sabbaticals und flexiblen Arbeitszeiten, damit sie die erträumte Australienrundreise und das Fußballtraining dreimal wöchentlich wahrmachen können.
Die Generationen Y und Z wollen ein Unternehmen mitgestalten können und mehr Befugnisse haben als die Generationen vor ihnen. Dies lenkt die Organisationskultur maßgeblich in die entsprechende Richtung und lässt diese attraktiv oder unattraktiv für die Mitgestaltenden im Unternehmen erscheinen.
Die ADPRI-Studie (19 Länder mit je 1000 Befragten pro Land) zeigt, wie wichtig die Möglichkeit zur Mitgestaltung und die Autonomie am Arbeitsplatz sind – und das generationenübergreifend: Vieraugengespräche, um den Mitarbeitern die entsprechende Anerkennung für ihre Leistungen zu zeigen sowie die Freiheit, im Mobile Office zu arbeiten, sind essenziell. Hier zeigte sich: Wer an vier von fünf Tagen der Woche auswärts arbeitete, war fast doppelt so engagiert als jemand, der jeden Tag im Büro saß. Die Studie bestätigte die Ergebnisse der Gallup-Befragungen, die jedes Jahr mit dem gleichen Ergebnis veröffentlicht werden: Nur 16 Prozent aller Mitarbeiter engagieren sich stark für ihre Arbeit, 84 Prozent machen nur noch Dienst nach Vorschrift, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. Wer nur noch bis ins Detail ausführt, was von der Organisation vorgeschrieben wird, macht die Arbeit schwerfällig und bringt sie irgendwann zum Erliegen. Dienst nach Vorschrift ist die effektivste Streikform.
Wer sich in der einen Organisation nicht wertgeschätzt fühlt, erfährt Wertschätzung in einer anderen – die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern ist groß. Das ist das Ass im Ärmel aller Generationen.
3.2 Welt der Überraschungen
Wahrscheinlich haben Sie auch schon von der VUCA-Welt gehört. Unsere Welt ist heute sprunghafter (volatility), unsicherer (uncertainty), komplexer (complexity) und mehrdeutiger (ambiguity) als sie es jemals war und es sieht derzeit nicht so aus, als würde sich das in der nahen Zukunft ändern. Wie können Organisationen diesem Umstand begegnen? (//Karte 3)
Wenn die Welt sprunghaft ist, dann ist es nützlich, sich in der Organisation auf eine attraktive, kraftvolle Vision zu einigen, die Rückhalt genießt. Es gibt genügend Beispiele von Unternehmen und Branchen, die der Meinung waren, dass alles so bleiben wird, wie es war: Kodak glaubte nicht an die Digitalkamera, Taxi-Unternehmen wurden von Uber überholt und der Brockhaus wurde durch Wikipedia abgelöst.
Die Vision sollte aber nicht aus bedeutungsleeren Marketingfloskeln bestehen, sondern einen klaren Handlungsraum aufzeigen. Sie gibt den Mitarbeitenden Orientierung, indem sie dabei unterstützt, Entscheidungs- und Handlungsoptionen auszusortieren. Es werden jene Optionen ausgewählt, die am besten zur Vision passen. Gute Visionen helfen uns, durch turbulente Zeiten zu navigieren und nie aus den Augen zu verlieren, wofür wir etwas machen.
Wenn die Welt unsicher ist, helfen keine Fünfjahrespläne. Wir wissen doch alle, dass der eben erstellte Plan schon morgen veraltet ist. Wie viele Projektpläne haben Sie bereits gesehen, die genauso umgesetzt wurden? Hier hilft nur der Versuch, jene Dinge zu verstehen, die Unsicherheit ausmachen und damit offen umzugehen.
Wenn die Welt komplex ist und Technologien nicht von einer einzelnen Person beherrscht werden können, werden Teams gebraucht. Es muss klar sein, was für den Kunden und das Team wertschöpfend ist. Dafür ist Transparenz nötig und Aufgaben müssen nach ihrem Wert priorisiert werden. Das Ziel sollte sein, die Welt nicht durch zusätzliche Regeln, Rollen und Prozesse noch komplexer zu machen, als sie schon ist.
Wenn die Welt mehrdeutig ist, gibt es kein Schwarz-weiß mehr, sondern viele Farben und Schattierungen. Wo viele Interpretationen und Deutungen möglich sind, gibt es nicht den einen richtigen Weg. In diesem Fall müssen wir uns in kleinen Schritten an Lösungen herantasten und immer wieder überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Agilität bedeutet, sich auf dem Weg zum Ziel durch ständige Lernschleifen immer wieder an die Realität anzupassen und ergebnissoffen zu bleiben.
Den Luxus, über Jahre hinweg etwas Neues für ihre Kunden zu entwickeln, haben heute nur mehr weniger Unternehmen. Der Kunde will sofort etwas, das seinem Bedürfnis entspricht. Gleichzeitig brauchen die Personen in der Produktentwicklung so schnell wie möglich Feedback, ob ihr Angebot den gewünschten Nutzen für den Kunden bringt. Da sich dessen Bedarf über die Jahre ohnehin verändern wird, wird es umso wichtiger, die Lösungen in kleinen Schritten kontinuierlich an diesen Bedarf anzupassen.
(Bildidee von Henrik Kniberg) Manchmal reicht als erster Schritt ein Button, der zum noch nicht verfügbaren Produkt führt, um zu beobachten, wer sich wie oft und warum nach dem neuen Produkt erkundigt. (//Karte 18)
Einfache Situationen treten häufig auf und es gibt bewährte Lösungsmuster für diese Aufgaben und Problemstellungen – sogenannte „Best Practices“. Es gibt klar eine erkennbare Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Um Best Practices anwenden zu können, müssen Sie nur das Problem richtig kategorisieren und dann einen passenden Standard oder eine Routine auswählen. Beispiele dafür wären die Reisekostenabrechnungen nach der Vorgabe des Unternehmens, eine selbstsichernde Mutter an einer Schraubverbindung oder wiederkehrende Testfälle einer Software. Diese Problemlösungen können manchmal automatisiert oder digitalisiert werden und dadurch das Leben erleichtern.
Mitarbeiter freuen sich in einfachen Situationen über klare Ansagen, Prozesse und Checklisten, die ohne Aufwand ausgeführt werden können. Führungskräfte führen in diesem Umfeld eher autoritär, dirigierend, anleitend oder kontrollierend.
In einer komplizierten Situation wird es schwieriger, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen, aber für Experten ist es dennoch möglich. Es bedarf jedoch einer genauen Analyse des Problems und jeder Experte wird unterschiedliche Handlungsschritte und Szenarien daraus ableiten.
Das Vorgehen entspricht dem traditionellen Projektmanagement: Die Problemstellung wird analysiert, ein entsprechender Plan zur Problemlösung wird erstellt und anschließend von Experten abgearbeitet. Da Sie in einer komplizierten Umgebung das System verstehen können, wird der Plan recht passend zur Problemstellung sein und Sie müssen unterwegs lediglich darauf achten, dass der Plan korrekt abgearbeitet wird.
Führungsstile sind in dieser Situation eher informierend, beratend, kooperativ und orientieren sich individuell an den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Experten brauchen weniger Anleitung.
Jede Tätigkeit, die auf Basis von Algorithmen und Regeln beschreibbar ist, kann kurz- oder langfristig automatisiert werden. Analysen können mittlerweile durch künstliche Intelligenz, Big Data und Expertenwissen-Modellierungen technisch stark unterstützt werden. Teilintelligente Maschinen mit integrierten Bildverarbeitungssystemen, Spektralanalysen, Feinstmechanik und 3D-Druckern können heute bereits so manchen komplizierten Expertenauftrag abwickeln.
In komplexen Situationen ist der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erst im Nachhinein erkennbar. Wenn eine Situation nicht verstanden werden kann, schlägt eine initial durchgeführte Analyse fehl. Ebenso würde ein eventuell aufgestellter Plan vermutlich nicht das gesteckte Ziel erreichen. Der Plan entsteht erst während der Arbeit, so wie beim Jazz oder während des Fußballspiels erst im Spiel die nächsten Sequenzen gewählt werden. Echte Höchstleister probieren in diesen sehr dynamischen Situationen etwas aus, beurteilen die Reaktionen und handeln entsprechend. Diese Lernschleife durchlaufen sie kontinuierlich bis zum Ziel, wobei die Leitplanken entsprechende Experimente ermöglichen müssen.
Führungskräfte gestalten in einem komplexen Umfeld den Kontext, damit die Mitarbeiter die voll delegierten Aufgaben eigenständig bearbeiten und selbst entscheiden können. Talente entdecken auf diese Weise Möglichkeiten, wie bestehende Werkzeuge umfunktioniert werden können, um das Problem zu lösen.
Chaotische Situationen weisen überhaupt keine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung auf und sind vollkommen unvorhersehbar. Durch die Turbulenzen gerät ein Organisationssystem schnell in eine Krise, in der es vorrangig ist, Wichtiges zu schützen, Stabilität und Ruhe zu schaffen und zu warten, bis die Dynamik abgeflacht ist. Feuerwehr und Rettungsdienst machen vor, wie sie mit ihren Handlungsschemata schnell ins Handeln kommen, um solche Situationen abzusichern. Führungskräfte benötigen deshalb eine klare Vision, großes Selbstvertrauen und gute kommunikative Kompetenz, um den Mitarbeitern im Chaos das nötige Maß an Orientierung zu geben. Für die psychologische Sicherheit ist es wichtig, symbolische Handlungen sowie Emotionen zu schätzen und anzusprechen. Im Rettungs- und Feuerwehrdienst sind deshalb die Routinen zentral: Die Einsätze werden gemeinsam nachbesprochen, die Einsatzfahrzeuge werden nach einem bestimmten Muster abgestellt, es gibt ein gemeinsames Frühstück usw.
Das Cynefin-Modell von Dave Snowden wird oft im Kontext von Digitalisierungsinitiativen genutzt, da einfache und komplizierte Aufgaben leichter durch Maschinen und Automatisierungssysteme ausgeführt werden können. Während diese Seite der Landschaft im Rahmen der Digitalisierung immer weniger menschliches Zutun braucht und die Arbeitsplätze in diesen Tätigkeitsfeldern immer weniger werden, nimmt die Menge der Aufgaben im komplexen und chaotischen Bereich deutlich zu. Aufgrund der Instabilität und Unberechenbarkeit in diesen Landschaften können diese Aufgaben auch in Zukunft nur durch Menschen ausgeführt werden.
Die einzelnen Situationen sind meistens nicht in Reinform, sondern als Mischformen anzutreffen. Wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben, gibt es einfache Aufgaben wie das Tippen und Speichern, die komplizierten Aufgaben wie das Setzen des Textes und die Gestaltung des Verlagsvertrags, die komplexen Aufgaben wie das Entwickeln einer Buchidee und die Leserführung, und schließlich die chaotischen Aufgaben wie den Umgang mit den Selbstzweifeln der Autorin.
Es ist sinnvoll, die Bereiche – so gut es geht – voneinander zu trennen und unterschiedlich zu behandeln. Agilität und Selbstorganisation eignen sich beispielsweise weniger für einfache und komplizierte Aufgaben. Wird ein solcher Bereich dennoch „auf agil umgestellt“, erhalten die Mitarbeiter den Freiraum, selbst über ihre Arbeitsweise zu bestimmen. Dieser Freiraum wird von Teams, die komplizierte Themen bearbeiten, aber meistens nicht benötigt. Sich zusätzlich über die eigene Arbeitsweise Gedanken machen zu müssen, ist für sie vielleicht beim ersten Mal interessant, weil sie zwei oder drei Verbesserungsideen einbringen können, aber danach etablieren sie diese Good Practices wieder als Anhaltspunkt für alle. Genauso kann ein einfaches Problem zum Chaos werden, wenn zu rigide Gesetze und Bedingungen eingeführt werden. Beispiel: Die Straßenverkehrsordnung sagt „Fahre rechts“. Das sollte ich aber nicht zu streng sehen, wenn ein Kind auf die Straße läuft.
Ebenso können Planungs- und Steuerungstools bei echter Komplexität nicht helfen. Alle Versuche, Komplexität zu steuern, führen zu mehr Aufwand und haben eine schlechtere Prognose. Genauso hilft ein hoher Automatisierungsgrad bei komplexen Problemen nicht. Deshalb greifen wir bei der Moderation von Workshops und Retrospektiven am liebsten auf Flipcharts und Haftnotizen zurück. Die Digitalisierung macht uns in diesen Fällen nicht intelligenter, sondern steht dem Gedankenfluss eher im Wege.
3.3 Das Agile Manifest
Das Agile Manifest wurde 2001 von 17 Softwareentwicklern in Utah (USA) verfasst. Es umfasst vier Leitsätze und 12 Prinzipien. (//Karte 5)
„Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt:
Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software meht als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite höher ein.“
(www.agilemanifesto.org)
Die 17 Unterzeichner des Agilen Manifests waren sich einig, dass Softwareentwickler angesichts der wachsenden Dynamik in Zukunft Werkzeuge und Methoden brauchen würden, die flexibel einsetzbar und leichtgewichtig sind. Jene Unternehmen, deren Mitarbeiter Sklaven der eigenen Methoden, Prozesse und Systeme sind, würden aufgrund ihrer selbst geschaffenen Bürokratie langfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sein.
Erst als das Unternehmen Wikispeed für seine Leistungen bekannt wurde, eroberten das Agile Manifest und Agilität als solche zusehends Branchen und Professionen außerhalb der IT. In seinem TED Talk bei TEDxRainier 2011 berichtete Gründer Joe Justice, wie Wikispeed, unterstützt durch die agile Praktik „Scrum“, Autos baut: Das erste Auto wurde innerhalb von drei Monaten entwickelt, Feature-Änderungen dauern sieben Tage, es ist modular aufgebaut, der Motor lässt sich innerhalb von zehn Minuten wechseln und das Team – 120 Mitglieder – ist auf zehn Länder verteilt. Die Mitarbeiter arbeiten freiwillig mit, fast alle ehrenamtlich. Sie nutzen Open-Source-Programme und beteiligen sich an sozialen Projekten.
Spätestens seit einem viel beachteten Artikel des Agile-Beraters Cliff Berg (Berg 2019) wissen wir, dass sogar „Rocket Science“ agil betrieben werden kann. SpaceX verwendet 3D-Druck und setzt auf Wiederverwendbarkeit: Es ist der erste Hersteller wiederverwendbarer Raketen der Orbitalklasse und auch das Marsfahrzeug wird wiederverwendbar sein. Das Design der Raketen und Fahrzeuge kann sich aber von einem Monat zum nächsten verändern, da es ebenfalls iterativ und inkrementell entwickelt wird.
Scrum, entwickelt von Jeff Sutherland und Ken Schwaber, erfüllt – so wie alle anderen agilen Praktiken wie Kanban oder agile Führungstechniken – die agilen Prinzipien:
(//Karte 6)
Die Kundenzufriedenheit steht im Fokus. Der Kunde soll regelmäßig den aktuellen Stand des Produkts oder der Dienstleistung beurteilen und bekommt deshalb regelmäßige Lieferungen, die funktionieren. Er soll Feedback geben und mitteilen, was für ihn den höchsten Wert hat. Vom Team werden die Änderungen willkommen geheißen.
Das Team ist ein echtes Team. Die Mitglieder vertrauen einander, sie haben gemeinsame Ziele und helfen sich gegenseitig. Durch sinnvolle Ziele sowie problem- und zeitorientiertes Arbeiten, in dessen Rahmen sich jeder persönlich und fachlich weiterentwickeln kann, ist das Team motiviert. Die Teammitglieder kommunizieren direkt und auf Augenhöhe miteinander.
Der Fortschritt im Team wird am funktionierenden Produkt gemessen. Die Teammitglieder versuchen, eine nachhaltige, konstante Geschwindigkeit zu erlangen statt vor Deadlines in Hektik zu geraten. Das Team legt Wert auf technische Exzellenz, gutes Design und auf Einfachheit bei der Herstellung.
Regelmäßig reflektieren und adaptieren die Teammitglieder ihre Arbeitsweise sowie die Ergebnisse und werden dadurch immer besser – es entsteht ein selbstorganisiertes Team.
Die Prinzipien sind einfach und logisch, aber die Schwierigkeit liegt in ihrer Umsetzung und den emotionalen Barrieren. Agile Methoden und Tools liefern erste Ideen und Kniffe, wie ein Wandel gelingen kann – Scrum ist dabei nur einer der vielen Ansätze, um agile Arbeitsweisen in Teams zu etablieren.
3.4 New Work und der Wandel der Gesellschaft
Der ursprüngliche Gedanke
Frithjof Bergmann gilt als Initiator der New-Work-Bewegung. Den Kern von New Work sieht er in der Selbstbestimmung bei der Arbeit und in der Befreiung aus der Knechtschaft der Lohnarbeit. Menschen sollen in ihrer Arbeit Erfüllung finden und sich in deren Rahmen weiterentwickeln können. Sie sollen sich einbringen können, denn schließlich verbringen wir einen Großteil unseres Lebens mit unserer Arbeit. „Nur die meisten Leute gehen nicht zur Arbeit, weil sie dort etwas tun können, was sie wirklich wirklich wollen.“ (Bergmann 2017) Gab es eine Zeit in Ihrem Leben, in dem Sie Ihre Arbeit richtig geliebt haben und es gar nicht abwarten konnten, zur Arbeit zu gehen? Was wäre, wenn jeder Arbeitstag genau so wäre?
Mittlerweile ist New Work ebenso ein Alltagsdietrich, ein Plastikwort geworden wie Agilität. Unter diesem Buzzword wird einfach alles subsumiert, was mit tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun hat. Unternehmen stellen sich die Frage, ob sie New Work „einführen“ sollten oder nicht. Doch in ihrer Organisation und in den Köpfen ihrer Mitarbeiter findet New Work und der Gedanke „Wie könnte die Arbeitswelt besser werden?“ tagtäglich statt. Jeden Tag denken Mitarbeitende darüber nach, was sie wirklich wirklich wollen. Jeden Tag denken sie Arbeit neu und nutzen die aktuellen Technologien, um Arbeit so aufzubauen, dass sie den Menschen stärkt. – Genau das hat Frithjof Bergmann gemeint. Sobald man sich intensiv mit diesen Grundzügen beschäftigt, ist man mittendrin im „New Work“. New Work hat kein konkretes Ziel. Der Weg ist wichtig – die Ergebnisse sehen daher für jeden Einzelnen und für jedes Unternehmen anders aus. Immer wenn etwas populär wird, machen sich die Rezepteverkäufer auf den Weg und wollen ihre Kochbücher auf den Markt bringen. Nur gibt es dafür keine Rezepte – es ist ein lebendiges, komplexes Thema.
Warum zwingen wir uns, eine Arbeit zu machen, die wir nicht wirklich machen wollen? Warum bleiben wir an einem Arbeitsplatz, der uns nicht wirklich gefällt? Dieses Verhalten hat meistens einen einfachen Grund: Angst. Angst, den Job zu verlieren. Angst vor Sanktionen. Angst, keinen besseren Job zu finden. Durch ein Arbeitsverhältnis begeben wir uns in eine Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit zwingt uns, zur Arbeit zu gehen, weil wir hingehen müssen und nicht, weil wir wollen. Wir brauchen das Geld, um unsere Familien zu ernähren und um das Auto oder das Haus abzubezahlen. Deshalb schleifen wir unsere Körper morgens aus dem Bett und zur Arbeit, während die Seele in weite Ferne schweift.