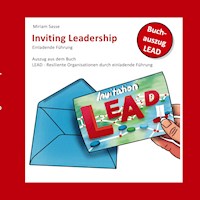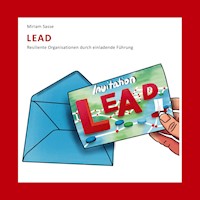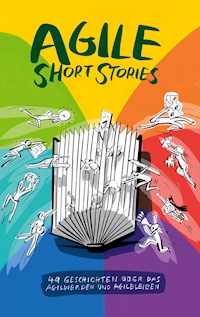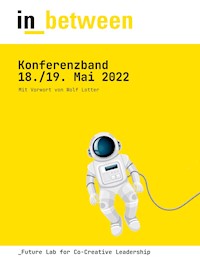
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: in_between Konferenzband
- Sprache: Deutsch
in_between ist eine Plattform für den Austausch über Führung und Zusammenarbeit von morgen. Die zweite gleichnamige Konferenz fand am 18./19. Mai 2022 statt. Mehr als 30 Speaker:innen und 150 Teilnehmer:innen nahmen an dem hybriden Event teil, das beim HDI in Hannover, andrena objects in Stuttgart und online, im sogenannten Weltraum, stattfand. Der Konferenzband zur in_between 2022 richtet sich an alle, die sich für zukünftige Führung und Zusammenarbeit interessieren. Mit einer Auswahl von Beiträgen zum Nachlesen bietet er Impulse und Inspiration zu den Handlungsfeldern Dazwischen, Zusammenhänge und Balance.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Führung findet nicht mehr nur durch klassische Führungskräfte statt, sondern überall dort, wo Verantwortung übernommen wird.“
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Vorworte
Bewegliche Ziele
Wir sind immer auf dem Weg, nie am Ziel
Blick hinter die Kulissen
Betwixt & Between – Nicht mehr alt und noch nicht neu
Innovation in selbstorganisierten Produktionsteams
Wenn Inkremente zu Exkrementen werden: Vom Scheitern agiler Transformationen
Die Rückseite der Medaille – Psychologische Stolperfallen „agiler“ Organisationsentwicklung
Remote und Asynchrone Zusammenarbeit & Führung: Die besten Tipps & Tricks
Spielerisch zum Erfolg im Business
Co-kreativ in die Zukunft – LEGO® SERIOUS PLAY® als Instrument partizipativer Führung und Zusammenarbeit
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Liminalität
Abbildung 2: Die drei Säulen agiler Führung im neuen Rollen- und Zusammenarbeitsmodell als Rahmen, in dem Selbstorganisation zur Entfaltung kommen soll
Abbildung 3: Ein Architekturmodell als Leitgedanke für Produktentwicklung und Aufbauorganisation
Abbildung 4: Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung von Faktoren, die zur kognitiven (Über-)Last beitragen.
Abbildung 6: Brain2Business™ Tool
Abbildung 7: Würfel: Blau 3, Rot 4
Abbildung 8: Die LEGO® SERIOUS PLAY® Baustufen
Abbildung 9: Der LEGO® SERIOUS PLAY® Kernprozess
Abbildung 10: Teilnehmer eines Workshops, die voller Konzentration die Antwort auf eine komplexe Fragestellung bauen.
VORWORTE
Wolf Lotter
Bewegliche Ziele
Echte Diversität ist mehr als nur eine weitere Schublade,
in die Menschen gepackt werden können.
Wer die Transformation ernst nimmt, sieht nicht alle gleich,
sondern sucht nach guten Unterschieden.
Wolf Lotter
Transformation, das sagt sich leicht. Auch Nachhaltigkeit sagt sich leicht, Klimaschutz, Menschenrechte und Gerechtigkeit. Von all dem wird viel geredet, aber es wird dabei wenig gesagt. Und weil Wörter so geduldig sind wie die Menschen, die sie benutzen, kommt wenig dabei raus. Das dürfen wir nicht zulassen, weil wir Begriffe, deren Sinn wir nicht ernst nehmen, gestatten, uns und andere Menschen nicht ernst zu nehmen.
Transformation heißt Verwandlung, vor allem andere der alten Weltbilder und Kulturen in neue Sichtweisen. Es geht also ums Ganze, ums Menschenbild. Aber was ist das eigentlich, ein Menschenbild? Bisher dachten wir, dass man für ein scharfes Menschenbild irgendeine Form von Einordnung bräuchte, eine politische, kulturelle Erklärung für das, was Menschen ausmacht und wie wir sie sehen sollten. Kaum jemand in der Geschichte hat behauptet, er könne Menschen an sich nicht leiden und wolle sie ausbeuten, sehe sie nur als Verbraucher und Konsumenten oder gar als Kanonenfutter für Kriege, die für alles Mögliche geführt werden, nur nicht für den Menschen an sich. Nun aber ist die Sache mit dem Menschenbild seit der Aufklärung gar nicht so schwer zu verstehen: Es geht darum, dass die und der Einzelne nach ihrer Fasson, nach ihrem eigenen Gutdünken, glücklich werden sollen. Glücklich ist natürlich nicht jenes uns so hartnäckig von Werbung, Kultur und Ideologien nahegelegenes himmelhoch Jauchzende, sondern schlicht die Zufriedenheit mit dem eigenen Ich. Diese Selbstzufriedenheit ist keine Überheblichkeit, sondern ein Menschenrecht. Oder kürzer: Nur Einzelgerechtigkeit, auch sich selbst gegenüber, ist wirklich gerecht. Der Mensch soll sich entfalten dürfen, nicht nach dem Willen einer Partei, einer Regierung, eines Chefs oder einer Unternehmenskultur, in der wortreich festgeschrieben wird, was gut ist und was nicht, und dass sich daran jeder und jede gefälligst halten soll. Das eben nicht. Ein Menschenbild, wie es ins 21 Jahrhundert passt, geht weit über das hinaus, was im Abendland die letzten 3000 Jahre – seit den Zeiten der ersten Athenischen Denker, die unsere Kultur so beeinflusst haben, für “normal” gehalten wird: Dass einige wenige den anderen, den Vielen, sagen, was gut und richtig ist für sie. Gleichheit ist nicht gerecht.
Gleichheit ist wichtig, vor Gericht etwa, oder bei der Entlohnung für eine wirklich gleiche Tätigkeit, oder bei der Frage, wie wir uns auf Straßen verhalten sollen. Aber das wirkliche Leben kennt keine Straßenverkehrsordnung. Unsere Kultur hat das immer behauptet, und die letzten 250 Jahre, die Industriegesellschaft und ihre Kultur, haben das in Stein gemeißelt. Originelles, Einzigartiges, Unterschiedliches, das in der Vielfalt erkennbar ist, also im wahrsten Sinne divers, das ist in dieser Gesellschaft nicht gefragt gewesen. Die Industriegesellschaft war und ist eine Massengesellschaft, in der Ungleiches gleich gemacht wird, unpassend passend. So sind unsere Kindergärten, Schulen, Unternehmen immer noch, auch wenn sie die Aufklärung schon zaghaft erreicht, die unablässig sagt: Jeder Mensch ist anders, und es geht darum, daraus was zu machen.
Diversität, die nur als M/W/D besteht, greift einfach zu kurz. Aus einer Welt der gleichförmigen Männer wird eine gleichförmige Welt von Mann, Frau, Transgender. Das reicht lange nicht. Was gebraucht wird, ist der persönliche Unterschied. Das Prinzip der Massengesellschaft ist das Kollektiv, die Gleichförmigkeit, die Norm, der Standard, die Einheit. Einige dieser Worte stehen in Deutschland unter besonderem Schutz. Trotz massiv gegenteiliger historischer Erfahrung beschwören wie selbstverständlich die Vorzüge des Schwarms und der “Gemeinschaft” gegenüber dem persönlichen Unterschied. Das Ich gilt als verdächtig, dass wir gut. Ist das so? Es ist dann nicht so, wenn das Ich nichts weiter ist als das ungeliebte Anhängsel des Großen und Ganzen, dass es nur sein darf, wenn es sich wie ein Zahnrad in Unternehmen, Gesellschaft und Arbeitswelt einfügt. Das Einzelne gilt als “egoistisch”, der Unterschied zur Norm als negativ verstandene Abweichung. Das Problem ist eigentlich klar zu sehen: Wer nicht abweicht, anders denkt, alternativ, zweifelnd, kritisch, sich selbst dabei ernst nehmend, der kommt nie auf Problemlösungen, die es bisher nicht gab. Deshalb ist unsere Gesellschaft so innovativ, so schlecht in Transformation. Wir haben eine Kultur, in der nur die Unbeweglichen, die Unsichtbaren wirklich geschätzt werden. Die sich kenntlich machen, ganz gleich, ob als Frau, Unternehmer, Innovatoren und Zweifelnde, die stören in einer solchen Kultur massiv. Transformation ist das Programm dagegen. Dass wir uns verändern müssen, hat ja genau mit dieser Ursache, dieser Wurzel unserer Bewegungsunfähigkeit zu tun. Die Welt ist nur gerecht, wenn sie einen Unterschied macht, wer gerade in welchem Kontext was braucht. Wir beklagen beispielsweise die Gießkannen Politik bei der Ausschüttung staatlicher Hilfen, eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir positive Unterschiede noch nicht ganz verlernt haben. Aber wir empfinden es als ungerecht, wenn man uns “vergisst”, wie wir vorschnell sagen, auch wenn wir uns ganz prima selbst helfen können. Gebt nicht dem Gesetz die Schuld, der Verfassung. Die kennt, in Europa wie im deutschen Grundgesetz, selbstverständlich die Regel der Subsidiarität, also dass, wer sich helfen kann, das auch tun möchte und erst dort, wo es nicht mehr geht, auf die dann viel zielgenaue Hilfe anderer hoffen darf. So ist es richtig. Warum sollte es dann im Unternehmen falsch sein, mehr zu differenzieren? Die Antwort ist so einfach, dass es wehtut. Klassisches Management kann mit Differenz nicht umgehen. Das Management, wie wir es kennen, ist ein Kinder der Normen Liebe der Industriegesellschaft. Es geht darum, möglichst viel zu vereinheitlichen, das ist der Beruf. Es geht darum, “die Dinge richtig zu machen”, und das bedeutet in dieser Regel bedeutet, dass sie nach einem Muster getan werden. Nichts gegen Routinen, sie haben ihren Zweck und ihren Nutzen. Wo wir aber nicht mehr unterscheiden, ob es um Menschen oder Maschinen geht, nivellieren wir wirtschaftliches und innovatives Potenzial auf einer Flatline, mit der sich nicht mal erhalten lässt, was wir schon haben. Oder, um es mit der Kulturwissenschaftlerin Margaret Mead zu sagen: “Diversity is a resource, not a handicap". Das wiederum verstanden zu haben führt zu Transformations- und Innovationsfähigkeit, also zur real existierenden Veränderung. Auch die Marktwirtschaft baut, wie aller menschlicher Fortschritt, nicht auf Gleichmacherei, sondern Differenz, auf guten Wettbewerb - und nicht etwa monopolistische Gewalt, mit der die Konkurrenz in die Knie gezwungen wird. Industrialistisches Denken, dass der vielfältigen Wissensökonomie des digitalen Zeitalters und seiner Netzwerke vollständig widerspricht, dass besteht aber aus diesem Streben nach Einheit, Monopol, Vormacht und Alleinherrschaft. Es geht immer darum, der “Marktführer” zu sein, nicht darum, die besten Produkte und Ideen für die Menschen bereitzustellen, die wiederum von Menschen gedacht werden, die auf die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen auch eingehen wollen.
In gesättigten Märkten ist das eine Frage des Überlebens. Masse können alle. Wenn Europa jemals etwas gut konnte, war es Unterscheidung, Grenzen ziehen, auch im Positiven, Originale herstellen. Das gilt nicht nur für die Kunst, sondern für die glücklicheren Stunden der Geschichte, die Aufklärung, Menschenrechte und die Wertschätzung für Vielfalt hervorbrachten statt dummen Kollektivismus, der immer einfache Antworten gibt, populistisch, brutal, raumgreifend und menschenverachtend. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wer das nur als Phrase sieht, verspielt Gegenwart und Zukunft. Es ist die wichtigste Formel der Diversität. Der Mensch mit all seinen Unterschieden braucht neue Organisationen, die Menschen nicht formen, sondern ihre Talente und Potenziale freisetzen. Die Gemeinschaft braucht jene Ambiguitätstoleranz, die eigene Sicht nicht aufzugeben und dennoch andere die ihre haben zu lassen. Die Unternehmen brauchen weniger Einheitsdenken und mehr Liebe zum Detail, zum Unterschied, zum Original und damit auch zu jener Vielzahl an Varianten, die die menschlichen Bedürfnisse am besten abbilden. Nein, wir sind nicht alle gleich, und das ist gut so. Wir sind verschieden, und das ist deutlich besser.
Es geht nicht allein um den Wohlstand und das Glück der Menschen, es geht hier schon um ihre Existenz. Die Feinde des Unterschieds, der als politisches System Demokratie bezeichnet wird, sind so stark wie schon lange nicht mehr. Es gibt viele, die sich aus einer falschen, alten Kultur mit ihnen geistig längst verbündet haben, all jene, die die überholte Einheitskultur der alten industriellen Massengesellschaft nicht lassen wollen.
Wir müssen wachsam sein, mehr als je zuvor. Wir müssen den richtigen, den positiven Unterschied, der gleichbedeutend ist mit Freiheit und Recht auf Andersartigkeit, als Kernwert der Demokratie und Zivilgesellschaft verteidigen, mit jener Bedingungs-losigkeit, mit der sich die Feinde des Unterschieds an ihm zu schaffen machen. Das gilt ganz besonders im Zeitalter der Digitalisierung und der Netzwerke, in denen die Chancen groß sind wie nie, dem Unterschied die Rolle zu geben, die er braucht, damit der Mensch sein kann, was er ist, und wie es die brillante Margaret Mead so unsterblich formulierte: “Wir sind alle verschieden – so wie alle andern auch.” Gerecht ist, wer das sieht und lebt.
Wolf Lotter ist Transformations-Experte und Publizist. Er war Gründungsmitglied und viele Jahre Leit Essayist von brand eins und hat zahlreiche Bücher zur Transformation veröffentlicht. Als dritter Teil seiner Transformations-Trilogie hat er nach “Innovation” (2018) und “Zusammenhänge” (2020) “Unterschiede. Wie aus Vielfalt Gerechtigkeit wird” bei der Edition Körber veröffentlicht.
wolflotter.de
Sarah Lay
Wir sind immer auf dem Weg, nie am Ziel
in_between, das heißt „Dazwischen“. Zwischen alt und neu. Zwischen hybrid, remote und onsite. Zwischen Gefühlen. Zwischen Orten und Ländern. Zwischen Zuständen.
Die Konferenzserie in_between – Future Lab for Co-Creative Leadership wurde 2021 von Juliane Pilster, Kai Bauer und Christian Brosig ins Leben gerufen. Dort werden Menschen zusammengebracht, die Impulse setzen, die dabei helfen, das Dazwischen zu meistern in dem sie es ermöglichen Zusammenhänge zu erschließen und Balance herzustellen.
Eine Message zog sich wie ein Roter Faden durch alle Vorträge: Wir müssen Altes loslassen und Neues wagen. Es gilt, Ambiguität auszuhalten und zu lernen, Unsicherheiten mitzunehmen. Transformation wird zum Alltag. Wir sind und werden immer Dazwischen sein und wir müssen zwischen all den Veränderungen, Unsicherheiten und Widersprüchen lernen, unsere neue Stabilität zu finden.
In seiner Keynote betonte Arie von Bennekum, Co-Autor des Agilen Manifests: „Agile is not a state. It’s an ambition.“ Wir sind immer auf dem Weg, nie am Ziel.
Doch zwischen Worten, Verstehen und daraus resultierenden Taten liegt ein weiter Weg. Das menschliche Gehirn mag keine Veränderung. Es mag die bekannten neuronalen Autobahnen. Es will sich im Außen sicher fühlen. Nur – das wird nicht mehr möglich sein. Diese Zeiten sind vorbei. Wir müssen daher lernen, Ruhe und Stabilität in uns selbst zu finden, um die Ambiguität im Außen nicht nur auszuhalten sondern auch mitgestalten zu können. Dieser Prozess, neue neuronale Autobahnen anzulegen und eine neue Stabilität im Innen zu finden, kostet Willenskraft, Geduld und Zeit. Wir brauchen Geduld mit uns selbst sowie mit Anderen. Denn – und das ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit: Wir werden niemals alle auf demselben Stand sein. In Organisationen treffen Individuen aufeinander von denen jede:r andere Erfahrungen und Voraussetzungen mitbringt. Niemals werden alle Mitarbeitenden einer Organisation sich alle am selben Entwicklungspunkt hinsichtlich des sich-einlassens auf die VUCA-Welt stehen. Es gilt also für Organisationen, Leitplanken zu schaffen, innerhalb derer die Individuen produktiv sein können. Leitplanken, die Unterschiede zulassen und gleichzeitig gemeinsame Basis und Regeln schaffen.
Darüber hinaus muss jeder Einzelne, unabhängig von der eigenen Aufgabe und dem Grad an Verantwortung, verstehen, dass jede:r anders ist und das genau dieses Anders-Sein, dieses aufeinandertreffen verschiedener Erfahrungen, Blickwinkel und Interpretationen, uns stark macht. Es macht uns jedoch nur dann stark, wenn wir zulassen, dass unsere Kolleg:innen sehen, wer wir sind, was wir denken und was wir fühlen. In Konsequenz heißt dies: Wir dürfen, nein wir müssen zeigen wer wir sind. Nahbar und authentisch. Und ja, auch verletzbar. Im Unterschied zu unserer Arbeitswelt noch vor zehn Jahren, wo man sein „Freizeit-Ich“ am Empfang abgegeben hat, um sein „Arbeits-Ich“ überzustreifen, wo Emotionen und Erlebtes ausgeklammert und als unprofessionell abgestempelt wurden, ist heute und in der Zukunft das Gegenteil der Fall. Allerdings gilt auch für diese Veränderung: Wir werden niemals den Endzustand, die finale Transformation erreichen. Wir werden uns immer „dazwischen“ befinden. Um mehr und mehr Individuen auf diesen Weg zu bringen bzw. auf ihrem Weg weiter zu bringen braucht es Fascilitator:innen, Vorreiter:innen und Mut-Macher:innen. Auf den Bühnen der in_between-Konferenzen dürfen wir jedes Jahr wieder einige dieser Vorreiter:innen und Mut-Macher:innen kennenlernen.
Sarah Lay ist Kommunikationsexpertin im Kontext der agilen Transformation bei der HDI Global SE, einem der Location-Partner der diesjährigen Veranstaltung.
Juliane Pilster, Kai Bauer und Christian Brosig
Blick hinter die Kulissen
Die zweite in_between Konferenz fand am 18./19. Mai 2022, ziemlich genau ein Jahr nach unserem Debüt statt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen scheint die Notwendigkeit zum gemeinsamen Lernen und zur Anpassung jetzt noch dringlicher als zuvor.
Die Pandemie hat zu vielfältigen Veränderungen in unserer Arbeitswelt geführt. Sie hat der Digitalisierung einen enormen Schub verpasst. Schlagworte wie Hybride Settings, Remote Work usw. kommen ganz selbstverständlich über unsere Lippen und versuchen den Wandel sprachlich zu greifen. Der von Russland initiierte Krieg in der Ukraine hat eine Vielzahl weiterer Irritationen in unsere Welt geworfen. Die Dynamik und die unabsehbaren Folgen dieser Geschehnisse bedeuten ein hohes Maß zusätzlicher Unsicherheit für uns.
Wir Menschen und die Unternehmen, in denen wir agieren, stehen also einer ganzen Reihe großer Herausforderungen gegenüber: Kostensteigerungen, Fachkräftemangel und Lieferengpässe sind nur einige Beispiele in diesem Zusammenhang. Mehr denn je stellt sich die Frage, wie wir mit dem Wandel mithalten und uns anpassen, wie wir dies gemeinsam mit unseren Teams gestalten und wie Führung verstanden werden muss, um den Gegebenheiten gerecht zu werden und eine hilfreiche Funktion einzunehmen.
Bei in_between wollen wir lernen, wie die Zukunft der Zusammenarbeit und Führung bestmöglich gestaltet werden kann. Wir gehen davon aus, dass dieses Lernen eine kontinuierliche Entwicklung und einen ständigen Prozess des Wandels bedeutet. Und damit sind wir dauerhaft im Dazwischen, in den Zwischenräumen der Veränderung gefordert. Und genau auf diese Zwischenräume legen wir unser Augenmerk und stellen die Frage, wie wir damit möglichst gut umgehen.
Zu Beginn von in_between haben wir mit unserem Namen maßgeblich zwei Perspektiven in Verbindung gebracht. Einerseits sehen wir ein zeitliches Dazwischen. Wir wollen die Führung und Zusammenarbeit der Zukunft gestalten. Es gibt also ein Dazwischen zwischen dem heute und dem morgen. Damit fokussieren wir auf den herausfordernden Aspekt einer jeden Transformation, dass wir uns von dem Gewohnten verabschieden, das Neue erfinden und uns mit der damit unausweichlich verbundenen Unsicherheit auseinandersetzen müssen.