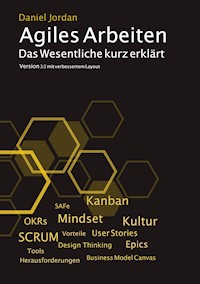
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Agiles Arbeiten wird in immer mehr Firmen eingeführt und gerne als Wunderheilmittel propagiert, da ein Großteil der erfolgreichen Technologiekonzerne und Startups genau auf diese Arbeitspraxis setzt. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was kann agiles Arbeiten wirklich leisten? Wo sind die Grenzen? Auf was ist in der Praxis zu beachten? Und wie fängt man eigentlich am besten damit an? Jede Menge Fragen und das Angebot auf eine kurze Reise zur Beantwortung dieser mitzukommen. Ziel des Buches ist, einen möglichst vollumfänglichen Überblick zu den wesentlichen Aspekten des agilen Arbeitens zu geben, ohne aber zu tief in die Details zu gehen. Am Ende sollst du in der Lage sein, beurteilen zu können, ob agiles Arbeiten für dich in Frage kommt oder eher nicht. Du sollst die Grundkonzepte verstanden haben, um zumindest grundsätzlich mitreden und dir eine eigene Meinung bilden zu können. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Praxiserfahrungen und Fallstricke in der Umsetzung gelegt werden, da dies einerseits von großer Bedeutung ist und andererseits in der Fachliteratur häufig zu kurz kommt. Der Ratgeber richtet sich dabei primär an Neulinge und möchte den schnellen Einstieg in die Thematik erleichtern und beschränkt sich daher bewusst auf das Wesentliche. Durch eine einfach gehaltene Sprache, zahlreiche Illustrationen, viele Beispiele und weiterführende Literaturhinweise wird das schnelle Verstehen und Eintauchen in die Thematik unterstützt. In diesem Sachbuch findest du dabei nicht nur einzelne Kapitel zu den am weitesten verbreiteten Methoden des Agilen Arbeitens wie SCRUM, Kanban, OKRs, Design Thinking, Business Model Canvas nund weitere wie SAFe, CFRs, Value Proposition Canvas, sondern auch zu grundlegenden Aspekten der Thematik wie Vorteile des Agilen Arbeitens, Agiles Mindest und Unternehmenskultur, Agilen Organisationsstrukturen. Natürlich dürfen dann auch nicht einzelne Kapitel zu Praxiserfahrungen fehlen wie u.a. Fallstricke in der Praxis und Lösungsansätze, Ansätze für den Start in das Agile Arbeiten, Tools zur Umsetzung der Methoden. So musst du für den Start in die Thematik nicht 10 oder mehr Bücher lesen, sondern kannst dir erst einmal einen guten Überblick verschaffen und dann bei Bedarf basierend auf den Literaturempfehlungen bewusst tiefer einsteigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agiles Arbeiten wird in immer mehr Firmen eingeführt und gerne als Wunderheilmittel propagiert, da ein Großteil der erfolgreichen Technologiekonzerne und Startups aus dem Silicon Valley genau auf diese Arbeitspraxis setzen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Was kann agiles Arbeiten wirklich leisten? Wo sind die Grenzen? Auf was ist in der Praxis zu achten? Und wie fängt man eigentlich am besten damit an? Jede Menge Fragen und das Angebot auf eine kurze Reise zur Beantwortung dieser mitzukommen.
Ziel des Buches ist es daher, einen möglichst vollumfänglichen Überblick zu den wesentlichen Aspekten und Methoden des agilen Arbeitens zu geben, ohne zu tief in die Details zu gehen. Am Ende sollst du in der Lage sein, beurteilen zu können, ob agiles Arbeiten für dich in Frage kommt oder eher nicht. Du sollst die Grundkonzepte verstanden haben, um zumindest grundsätzlich mitreden und dir eine eigene Meinung bilden zu können. Ein besonderer Fokus soll dabei auf Praxiserfahrungen und Fallstricken in der Umsetzung gelegt werden, da dies einerseits von großer Bedeutung ist und andererseits in der meist theorielastigen Literatur häufig zu kurz kommt. Daher richtet sich der Ratgeber primär an Neulinge der Thematik. Da ich mich bewusst kurzhalte, gebe ich dir in jedem Kapitel Literaturhinweise zur Vertiefung der einzelnen Themen. Verschiedene Kreativitätstechniken oder Methoden zur kreativen Durchführung von Workshops wirst du daher hier nicht finden, da dies meiner Meinung nach auch nicht der Kern agilen Arbeitens ist und es bereits viele großartige Bücher dafür gibt. Dieses Buch kann aber dein Startpunkt in die neue agile Arbeitswelt sein, dir das Wesentliche vermitteln und hoffentlich auch Lust machen, diese noch recht neue Arbeitsweise zumindest einmal auszuprobieren.
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, möchte ich zu Beginn mit den Vorteilen des agilen Arbeitens starten. Schließlich ist es essenziell wichtig zu wissen, was die Arbeitsweise bringt bzw. bringen soll, bevor man sich näher damit beschäftigt. Mache also gleich den Check, ob es sich für dich lohnt, das Thema weiter zu verfolgen. Agiles Arbeiten ist viel mehr als eine Ansammlung von “neuen“ Arbeitsmethoden. Es ist eher eine innere Einstellung, eine Haltung, wie man gut zusammenarbeiten kann und wie Motivation und innerer Antrieb entstehen. Dazu erfährst du mehr im Kapitel zum agilen Mindset. Methoden stellen dabei nur ein Mittel zum Zweck dar, um das agile Mindset in konkreten Arbeitsweisen oder Vorgehensweisen zu operationalisieren. Hier möchte ich mich auf eine Auswahl der am weitesten verbreiteten Methoden beschränken und das jeweilige Grundprinzip erklären. In Kapitel 4 werden dann Tools vorgestellt, mit denen sich die genannten Methoden leicht umsetzen lassen. Agiles Arbeiten wird meistens im Projektumfeld umgesetzt, wobei nun immer mehr Firmen diese Arbeitsweise auch für ihre Linienorganisation adaptieren. Wie man die klassische Hierarchie auflösen kann und so auch die gesamte Linienorganisation agil transformieren kann, erfährst du in Kapitel 5. In der Theorie läuft dabei natürlich immer alles wie am Schnürchen. In der Praxis sieht das zumeist dann aber doch anders aus. Auf welche Fallstricke du achten solltest und wie du mit verschiedenen Problemen umgehen kannst, erfährst du in Kapitel 6. Wenn du den Umgang mit den Herausforderungen gelernt hast, brennst du vielleicht schon darauf, die neuen Arbeitsweisen bei euch auszuprobieren. Was es beim Start zu beachten gilt, kannst du in Kapitel 7 nachlesen. Aus meiner Sicht gibt es aber durchaus auch Grenzen des agilen Arbeitens, also wann agiles Arbeiten sinnvoll ist und wann eben nicht. Dazu erfährst du mehr in Kapitel 8. Abschließend habe ich im letzten Kapitel noch einmal weiterführende Literatur und Links zusammengestellt, die dir bei der Vertiefung der hier behandelten Themen helfen können.
Inhaltsverzeichnis
Vorteile des agilen Arbeitens
Das agile Mindset und Unternehmenskultur
Überblick zu den Methoden
OKRs
Continuous Performance Management mit CFRs
Epics, Capabilities, Features, User Stories
Kanban
SCRUM
SAFe oder Scaled Agile Framework for Lean Enterprises
Design Thinking
Business Model Canvas
Value Proposition Canvas
Tools zur Umsetzung der Methoden
Agile Organisationsstrukturen
Fallstricke in der Praxis und Lösungsansätze
Ansätze für den Start in das agile Arbeiten
Grenzen der Agilität
Quellen und Literaturhinweise
1 Vorteile des agilen Arbeitens
Bevor man sich die Mühe macht die komplette Art und Weise, wie man arbeitet, umzustellen, sollte man sich das Warum klar machen. Die Umstellung auf eine agile Arbeitsweise ist zweifelsohne mit großem Aufwand verbunden. Daher gilt erst zu prüfen, ob die damit verbundenen Vorteile für das eigene Umfeld denn überhaupt von Bedeutung sind. Nur weil gerade gefühlt alle auf agiles Arbeiten umstellen, ebendies auch zu tun, ist ein denkbar schlechter Grund. Die Vorteile sind jedoch trotzdem zahlreich. Aus meiner Erfahrung heraus, schätze ich die folgenden dabei am meisten:
Erstens ist agiles Vorgehen ein probates Mittel für den Umgang mit komplexen Fragestellungen, die in unserer VUCA Welt immer häufiger auftreten. VUCA steht dabei für volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig (Englisch ambigious). Hierbei ist es auch wichtig, sich den Unterschied zwischen kompliziert und komplex zu verdeutlichen. Während bei komplizierten Sachverhalten eine fundierte tiefer gehende Analyse helfen kann, Wirkungszusammenhänge aufzudecken und damit als Basis für die Ableitung eines Vorgehens (Plan) dienen kann, wird dies bei einem komplexen Problem nicht mehr weiterhelfen. Da sich bei einem solchen Thema u.a. die verschiedenen Einflussfaktoren gegenseitig bedingen und die Rahmenbedingungen sich sehr schnell ändern können, führt eine noch so gründliche Analyse nicht zu hinreichender Klarheit, um einen langfristig stabilen Plan ableiten zu können. In der Praxis wird aber leider trotzdem sehr gerne versucht, mit dem Mittel der Wahl für komplizierte Fragestellungen komplexe Fragestellungen lösen zu wollen. Damit hat man dann das sprichwörtliche „sich zu Tode analysieren“. Beim agilen Vorgehen überlegt man sich im Prinzip das Ziel und was der erste Schritt dorthin sein könnte, um dann nach diesem die Lage neu zu bewerten und sich den nächsten Schritt zu überlegen. So hat man die Möglichkeit, aus dem ersten Schritt zu lernen und diese Erfahrungen zu berücksichtigen, ohne im Vorfeld den ganzen
Weg bis zum Ziel analysieren und planen zu müssen. Wie man dazu in verschiedenen Bereichen und Situationen vorgeht, erfährst du in dem Kapitel zu den Methoden. An dieser Stelle ist erst einmal nur wichtig festzuhalten, dass man mit agilen Methoden komplexe Probleme besser lösen kann als mit einem herkömmlichen Vorgehen.
Ein weiterer Vorteil liegt darin begründet, dass man schneller erste Werte schafft. Nehmen wir mal ein klassisches IT-Projekt als Beispiel, um sich das zu verdeutlichen. Dort überlegt man sich sein Ziel, vergleicht den gewünschten Zustand mit dem heutigen und leitet dann daraus Anforderungen ab, die notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Dann schreibt man in der Regel ein Grobkonzept oder eine Vorstudie und im Anschluss ein Fachfeinkonzept, das auch noch das letzte technische Detail festlegt. Dann erst wird mit dem Programmieren begonnen. Das dauert in der Regel sehr lange. Beim agilen Arbeiten versucht man einerseits die Anforderungen vertikal zu schneiden und andererseits dies möglichst kleinschrittig zu tun. So entstehen im besten Fall sehr kleine Pakete, die leicht und schnell umsetzbar sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass z.B. ein neues Computerprogramm oder -system erst einmal mit minimalem Funktionsumfang startet und dann schrittweise neue Funktionen hinzukommen. Als Beispiel könnte man sich einen neuen Onlineshop nur mit den allernotwendigsten Funktionen vorstellen, also z.B. Auflistung der Produkte und der Abwicklung des Bestellprozesses. Das sogenannte MVP (Minimum Viable Product), ein Produkt, das so rudimentär ist, dass es gerade noch Sinn macht und Nutzen stiftet. Schrittweise kann man dann zum Beispiel weitere Zahlungsmethoden, weitere Produktkategorien, zusätzliche Versandmöglichkeiten oder ein Kundenkonto hinzufügen. Anstatt also den finalen Ausbauzustand von Anfang an anzupeilen, startet man erst einmal mit dem kleinstmöglichen Produkt und entwickelt dieses fertig. Das hat den Vorteil, dass dieses deutlich weniger komplex ist als das finale Produkt und sich somit weniger Fehler einschleichen, welche dann auch schneller zu entdecken sind. Vor allem startet man aber viel früher und hat schon einen nutzbaren Wert geschaffen. Wenn man ein klassisches IT-Projekt in der Phase der Fachfeinkonzeption einstampft, hat man bis dahin nur Papier produziert, das keinerlei Nutzen stiftet. Ein weiterer positiver Nebeneffekt eines solchen frühen Starts ist, dass man aus dem Nutzerfeedback lernen und das beim weiteren Ausbau berücksichtigen kann.
Drittens möchte ich einen Punkt anführen, der vielleicht erst gar nicht so offensichtlich erscheint, aber sich in der Praxis aus meiner Sicht als einer der wichtigsten herausgestellt hat. Der Einfluss auf die Mitarbeitermotivation. Menschen haben in der Regel das Bedürfnis, mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles zu kreieren und möchten geistig herausgefordert werden. Was hat das nun mit dem agilen Arbeiten zu tun bzw. warum ergeben sich aus dieser Arbeitsweise Vorteile? Das klassische Arbeiten geht mit langen Analyse- und Konzeptionsphasen einher. Das liegt nur den Wenigstens, macht nur bedingt Spaß und setzt ein langes Durchhaltevermögen voraus. Beim agilen Arbeiten wechseln sich kurze Analysephasen mit Umsetzungsphasen ab und man merkt unmittelbar wie das eigene Thema wächst. Das motiviert ungemein. Ein weiterer wesentlicher Punkt beim agilen Arbeiten ist, dass man den einzelnen involvierten Personen viel mehr Freiheiten und Freiräume gewährt, im Rahmen der definierten Anforderungen Lösungen zu entwickeln und somit selbst kreativ zu werden. Und genau das motiviert eben. Man arbeitet nicht stumpfsinnige Befehle ab, sondern ist aktiv in der Lösungsentwicklung in seinem Bereich eingebunden.
Als letzten größeren Vorteil möchte ich noch die Flexibilität herausstellen, welche auch schon in den vorherigen Absätzen angeklungen ist. Während man klassisch schon weit in die Zukunft geplant und damit das Vorgehen festgezurrt hat, ermöglicht ein Vorgehen in kleinen Schritten, sich schnell, falls nötig, an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen. Stellt sich bei unserem Beispiel des Online Shops heraus, dass auf einmal viele Kunden zum Beispiel nach Apple Pay verlangen, kann man diese neue Anforderung schnell priorisieren und umsetzen. Man muss nicht warten, bis ein kompletter klassischer Projektzyklus durchlaufen ist, um diesen Aspekt dann in einem neuen Projekt einzusteuern. Umgekehrt kann sich mit der Zeit herausstellen, dass die eigenen Kunden kaum mehr „per Nachnahme“ als Versandart verlangen, und man kann das Thema so nach hinten priorisieren oder sogar ganz weglassen.
Abschließend lässt sich also festhalten, dass agiles Arbeiten richtig umgesetzt besser mit Komplexität umgehen kann, schneller echte Werte schafft, die Mitarbeiter motiviert und eine größere Flexibilität bietet. Jetzt ist es an dir zu entscheiden, ob dir diese Vorteile ausreichen, um den Weg in die neue Arbeitswelt weiterzugehen. Wie dieser Weg aussehen kann, erfährst du in den folgenden Kapiteln.
2 Das agile Mindset und Unternehmenskultur
Da es letztlich keine Instanz gibt, die final eine Definition festlegen kann, was das agile Mindset ist, gibt es auch nicht die eine Definition. Aus meiner Sicht ist das agile Mindset eine andere Haltung und andere Glaubenssätze, was Menschen antreibt und zu Höchstleistungen motiviert und wie Innovationen durch die Art der Zusammenarbeit gefördert werden können. Während früher und auch heute noch viel zu oft Druck als probates Mittel angesehen wurde bzw. wird, verfängt das bei den heutigen Wissensarbeitern nicht mehr oder führt sogar zum genauen Gegenteil. Unter großem Druck können nur die Wenigstens kreativ sein, was man aber wiederum braucht, wenn es darum geht, komplexe Probleme zu lösen. Was beispielsweise in der Produktion von Gütern vielleicht noch funktionieren mag, also Druck auszuüben, damit schneller gearbeitet wird, führt bei Wissensarbeitern meistens nur zu einer geistigen Blockade. Hinzu kommt auch noch das Problem, dass die einzelne Leistung des Mitarbeiters aufgrund immer komplexerer Aufgaben immer schwerer zu beurteilen ist, und so eine Kontrolle und eventuelle Sanktionierung immer weniger Sinn machen (wenn so etwas überhaupt jemals Sinn gemacht hat). Stattdessen setzt das agile Mindset aus meiner Sicht auf Vertrauen, dass jeder Einzelne einen positiven Beitrag im Rahmen seiner Fähigkeiten leisten möchte, dass geistig anregende Arbeit den Mitarbeitern Spaß macht und sie so aus freien Stücken das Beste geben. Zudem wird davon ausgegangen, dass Menschen gerne Verantwortung übernehmen, wenn sie entsprechende Rahmenbedingungen vorfinden und die notwendige Freiheit für eigene Entscheidungen besitzen. An die Stelle von Druck und Kontrolle treten damit Entscheidungsfreiheit, eigenverantwortliches Arbeiten und eine weitestgehende Selbstführung. Somit ist der Kern von agiler Arbeit viel mehr als eine Ansammlung von Arbeitsmethoden, sondern eher eine komplett andere Wertehaltung. Diese fließt daher auch als Basis in alle Methoden ein und ist quasi das Fundament, auf welchem diese aufbauen.
Dieses offene und positive Mindset der einzelnen Kolleginnen und Kollegen formt in Summe in einem wirklich agilen Umfeld eine ganz besondere partnerschaftliche Unternehmenskultur. Wie in Wikipedia zur Unternehmenskultur treffend formuliert „bildet jede Organisation eine Kultur heraus, die das kollektive organisatorische Verhalten und Verhalten von Individuen in Organisationen bestimmt. Sie ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Werten, Normen, Denkhaltungen und Paradigmen, welche die Mitarbeiter kollektiv teilen. Durch die Kultur wird das Zusammenleben in der Organisation sowie das Auftreten nach außen hin geprägt.“ Anders formuliert kann man eine Unternehmenskultur als die ungeschriebenen Gesetze und Werthaltungen einer Firma verstehen, welche die Art und Weise der Zusammenarbeit festlegen.
Eine gute Unternehmenskultur sollte sich meiner Meinung nach durch gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung seines Gegenübers, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Respekt und Offenheit gegenüber Veränderung oder neuen Ideen auszeichnen. Schlussendlich gibt es aber nicht die eine richtige Unternehmenskultur. Vielmehr spielen in diesem Zusammenhang natürlich auch die eigenen Werte und die Rahmenbedingungen der Branche des jeweiligen Unternehmens eine starke Rolle, welcher Wertekanon als positiv oder geeignet empfunden wird. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass ein wertschätzender und fairer Umgang in allen Unternehmen möglich und förderlich ist. Das gibt den einzelnen Mitarbeitern z.B. die notwendige Sicherheit, auch mal etwas ausprobieren zu können, Fehler zu machen und daraus zu lernen. So entstehen Innovationen. Anstatt von Druck und Kontrolle sollten der Sinn der Arbeit, die gemeinsamen Ziele und der Beitrag jedes Einzelnen in den Vordergrund gestellt werden. Wenn allen die Werte der Firma bekannt sind und diese mitgetragen werden, braucht es auch weniger Regeln, da automatisch das Richtige getan wird. Das erhöht einerseits in starkem Umfang die Flexibilität, vermeidet aber auch den Frust mit bestimmten Regeln, die eben nicht in jeder Situation immer sinnvoll sind. Vereinfachend kann man sagen, dass sich Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig auf jeden Fall auszahlt.
Vertiefende Literatur
Dich interessiert, welche unterschiedliche Typen von Organisationsformen es gibt, wie sich diese historisch entwickelt haben, wie man diese klassifizieren könnte, durch welche Charakteristika sie sich auszeichnen und welche jeweiligen Stärken diese mitbringen? Die von Frederic Laloux in „Reinventing Organizations“ beschriebenen „Teal Organizations“ entsprechen dabei dem langläufigen Verständnis agiler Organisationen. Laloux geht in seinem Werk dabei detailliert auf die in dieser Organisationsform dominierenden Werte und deren Kultur ein und stellt dies anschaulich an real existierenden Firmen als Beispiele dar.
■ Reinventing Organizations – A guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness, von Frederic Laloux, erschienen bei Nelson Parker (2014)
Dich interessiert, wie man den Entwicklungsstatus der eigenen Organisation evaluieren und wie man durch gezielte Personalentwicklung ein agiles Mindset fördern kann? Svenja Hofert setzt in ihrem Buch „Das agile Mindset“ genau darauf den Fokus, in dem sie detailliert die einzelnen Aspekte des agilen Mindsets definiert und charakterisiert und Methoden an die Hand gibt, um im eigenen Unternehmen in Gänze aber auch bei den einzelnen Mitarbeitenden deren Mindset zu analysieren. Darauf aufbauend gibt sie Hinweise, wie eine agile Transformation von Mitarbeitenden und Führungskräften sowie der gesamten Organisation aussehen könnte.
■ Das agile Mindset – Mitarbeiter entwickeln, Zukunft der Arbeit gestalten, von Svenja Hofert, erschienen bei Springer Gabler (2018)





























