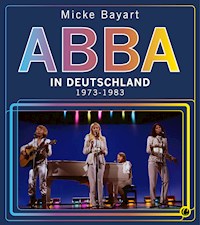14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Charles Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Agnetha Fältskog erlebte mit ABBA eine beispiellose Weltkarriere und ist doch weit mehr als nur „die Blonde“ und Sängerin der legendären schwedischen Popgruppe. Schon vor dem Erfolg mit Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus galt sie als Vorreiterin in der schwedischen Musikszene, schrieb eigene Songs und Texte und produzierte selbst. Nach den Jahren mit ABBA setzte sie ihre Solokarriere fort – ihre klare Stimme und ihr Gesang berühren bis heute. Das einfühlsame und detailreiche Porträt des ABBA-Wegbegleiters Micke Bayart zeichnet das Bild eines musikalischen Wunders und Weltstars, der dennoch bodenständig geblieben ist. Agnetha Fältskog – Sängerin, Musikerin, Songwriterin und Produzentin, Pionierin, Mutter, Legende und Ikone.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Micke Bayart
Agnetha Fältskog. Wie ein Wind
ABBA-Legende. Pionierin. Mensch.
Bayart, Micke: Agnetha Fältskog. Wie ein Wind. ABBA-Legende. Pionierin. Mensch. Hamburg, Charles Verlag 2025
Originalausgabe
ePub-ISBN: 978-3-910408-19-7
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-910408-18-0
Lektorat: Jörg Kulik, Trier
Korrektorat: Angela Rieger, textpalast, Oldenburg
Satz: Sarah Schwerdtfeger, Charles Verlag, Hamburg
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Hamburg
Umschlagmotiv: © Micke Bayart
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Der Charles Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
E-Mail: [email protected]
© Charles Verlag, Hamburg 2025
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.charles-verlag.de
ABBA im Mai 2024 nach der Verleihung des Königlichen Wasaorden im Stockholmer Schloss © Micke Bayart
Vorwort
Mit dem Sommer erwacht Stockholm zu neuem Leben: Die Stadt strahlt in hellem Licht, Menschen baden mitten im Zentrum, erkunden die Schären per Boot und genießen die Natur in den zahlreichen Parks. Nach dem langen Winter wird die warme Jahreszeit mit Lebensfreude und Gemeinschaft gefeiert – stets begleitet von der stillen Melancholie, wohl wissend, dass der Zauber des Sommers nur von kurzer Dauer ist. In Gamla Stan, der Altstadt, laden enge, gepflasterte Gassen zum Schlendern ein, während gemütliche Cafés und kleine Geschäfte zum Verweilen verführen. Der 31. Mai 2024 war ein solcher warmer Sommertag. Die meisten Touristen, die sich dort aufhielten, nahmen vielleicht nur beiläufig Notiz von den vier Wagenkolonnen, die kurz nach 13 Uhr in den abgesperrten Innenhof des Westflügels des Königlichen Schlosses fuhren. In den Fahrzeugen saßen die ABBA-Mitglieder Agnetha Fältskog, Anni-Frid Frida Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, die auf dem Weg zu einer feierlichen Zeremonie waren, in dessen Rahmen ihnen der Königliche Wasaorden für herausragende Verdienste im schwedischen und internationalen Musikleben verliehen wurde. Zuvor hatte der schwedische Monarch Carl XVI. Gustav in einem Interview im Radio die Bedeutung seiner Landsleute für sein Königreich hervorgehoben: „(Sie) haben die Schleusen für schwedische Musik geöffnet. (Sie traten) ja mit Dancing Queen am Abend vor unserer Hochzeit auf, und dieses Lied hat uns all die Jahre begleitet.“1 Zuletzt hatten schwedische Staatsbürger diese Auszeichnung im Jahr 1974 erhalten, als ABBAs Karriere mit Waterloo begann. Dass sie von den insgesamt dreizehn Preisträgern die größte Aufmerksamkeit auf sich zogen, war unbestreitbar, als ich mich in der sommerlichen Wärme vor Ort mit schwedischen und internationalen TV-Teams und Journalisten unterhielt: Würden nur ein paar Mitglieder oder wirklich alle vier anwesend sein? Denn dass sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen, ist eher die Ausnahme als die Regel. Doch an diesem Tag kamen sie im Schloss zusammen, denn sie wurden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, das seinesgleichen sucht und überdies ihr Verhältnis zueinander widerspiegelt: Es ist von Freundschaft, Zusammenhalt, Loyalität und einer tiefen Wertschätzung für das gemeinsam Erreichte geprägt, wie es in I Still Have Faith In You zum Ausdruck kommt. Zunächst schritt Anni-Frid über den blauen Teppich. Kurz darauf folgte Agnetha, die den anwesenden Fotografen freundlich zuwinkte. Sie trug ein elegantes, halbärmliges Kleid in einem zarten Beigeton, das ihr eine sommerliche Leichtigkeit und zugleich eine zeitlose Eleganz verlieh. Danach fuhren Benny und Björn in ihren jeweiligen Wagen vor. Aus der Hand des Königs erhielten sie ihre Orden in einer roten Schatulle, während Königin Silvia ihnen die jeweiligen Urkunden überreichte. Alle Anwesenden spendeten ABBA begeisterten Applaus, der schier kein Ende nehmen wollte. Der Festakt war von einer feierlichen und würdevollen Stimmung geprägt: „Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten, die seit 50 Jahren nicht vergeben wurde – es ist etwas Besonderes, das miterleben zu dürfen. Wir sind alle vier sehr bewegt,“2 fasste Anni-Frid anschließend den Augenblick zusammen. Als ich Agnetha Fältskog im April 2025 frage, welche Gefühle sie heute mit diesem Tag verbindet, ist ihre Antwort schlicht und bewegend: „Stolz und glücklich.“3 In ihren Worten spiegelt sich die bodenständige Haltung eines Weltstars wider: Bescheidenheit, keinerlei Starallüren und Zurückhaltung sind nun mal typisch schwedische Eigenschaften. Sie selbst hatte bereits in einem ihrer ersten Interviews 1967 gesagt: „Und selbst wenn ich erfolgreich bin, werde ich mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und nicht zulassen, dass mir der Erfolg zu Kopf steigt.“4
Mit ihrem langen blonden Haar und ihrer nordischen Schönheit verkörperte Agnetha Fältskog das Idealbild vom schwedischen Mädchen. Doch dabei geht es lediglich um äußerliche Merkmale. Agnetha Fältskog war und ist mehr als nur die Blonde von ABBA. Ihr Ex-Mann Björn Ulvaeus erinnert sich an seine erste Begegnung mit ihr, als er ihre Stimme im Radio gehört hatte: „Sie klang wie keine andere (…) Die Sängerin hatte eine so hohe, klare Stimme, und ihre Worte berührten ihn auf eine seltsam eindringliche Weise. Ihm wurde ganz warm und eigenartig zumute. ‚Kann man sich allein in jemanden verlieben, indem man seine Stimme hört?‘, dachte er. ‚Wenn ja, dann ist es mir gerade passiert.‘“5 Und es war eben diese Stimme, die den ABBA-Sound prägte, da ihr markanter Gesang den Klang der Band entscheidend definierte. Agnetha Fältskog vermittelt eine Authentizität, die berührt. Sie wirkt heilend, weckt Emotionen und spendet zugleich Trost. Ein Wegbegleiter hat ihren Gesang einmal mit einem Laser verglichen: Präzise, klar, kraftvoll und strahlend erreicht sie die ZuhörerInnen. Niemand anderer als sie kann schöner über den monotonen Alltag wie in The Day Before You Came singen, niemand verführerischer als in Take A Chance On Me flüstern (That’s all I ask of you) oder im Hintergrund bei Knowing Me, Knowing You hauchen. Keiner anderen Sängerin gelingt es besser, die höheren Mächte der Liebe wie in Lay All Your Love On Me anzuflehen. Niemand ist in der Lage, in der Stimme die Dramatik einer Alkoholikerin so auszudrücken wie in I Can Be That Woman. Und nur Agnetha Fältskog vermag es in Thank You For The Music, die Magie der Musik mit Hingabe zu würdigen: Es ist ihre Ode an die Musik, vergleichbar mit Edith Piafs Loblied auf die Liebe in Hymne à l’amour. Sie versteht es, in The Heat Is On gleichermaßen ein tropisch-verführerisches Flair zu erzeugen, wie auch in Can’t Shake Loose oder We Got A Way eine beeindruckende Stärke und Entschlossenheit zu vermitteln. Doch vor allem in den Balladen zeigt sie ihr wahres Können und entfaltet ihr außergewöhnliches Talent: Hier kommen ihre stimmliche Verletzlichkeit, Ehrlichkeit und Zerbrechlichkeit vollkommen zum Vorschein, was die Zuhörer direkt anspricht und sie auf eine unwillkürliche Weise emotional berührt. Ingmarie Halling, die Agnetha seit 1975 kennt, mit ABBA auf Welttournee ging und heute Kuratorin und Creative Director des ABBA-Museums in Stockholm ist, fasst ihr musikalisches Können wie folgt zusammen:
„Sie ist eine glaubwürdige Künstlerin. Sie macht nichts, von dem sie nicht selbst überzeugt ist und was sie nicht großartig findet. Ihre Songs sind von einer besonderen Eigenart geprägt und man erkennt fast immer sofort, dass sie von ihr sind. Ihre Lieder sind immer unverkennbar Agnetha. Man spürt auch, dass sie Klavier spielen kann.“6
In den Medien wurde sie oft als „einsam“ und „schwach“ charakterisiert – dabei ist sie in Wahrheit das genaue Gegenteil: unabhängig, willensstark und voller innerer Kraft. Ende der 1960er-Jahre, als sie gerade siebzehn war, begann sie ihre Laufbahn in einer von Männern beherrschten Branche, in der Äußerlichkeiten eine zentrale Rolle spielten und den Sängerinnen oft vorgeschrieben wurde, was sie singen sollten. Aber Agnetha Fältskog war weitaus mehr als ein gutaussehendes junges Mädchen, auf das sie oft reduziert wurde; sie schrieb ihre eigenen Lieder und übernahm eine aktive Rolle bei der Arbeit im Studio. Bereits 1969 hatte sie hierfür deutliche Worte gefunden: „Viele sind wohl überrascht, dass ich die Musik und alle meine Texte selbst schreibe. Als ob ein 18-jähriges Mädchen das nicht könnte. Blond ist nicht immer gleich dumm.“7 In jungen Jahren hat sie ihr Elternhaus, in dem sie sich sicher und geborgen fühlte, verlassen und zog vom behaglichen Jönköping nach Stockholm. Sie verfügte über eine innere Stärke, die sie an ihr Ziel glauben ließ, das sie entschlossen verfolgte: die Musik. Ihr siebzehnjähriges Ich hatte sie einst so beschrieben:
„Ich glaube nicht, dass ich damals viel darüber nachgedacht habe, berühmt zu werden, oder dass ich mich danach gesehnt habe. Das Wichtigste war, in ein Studio zu gehen, um meine eigenen Lieder zu singen. (…) Damals war ich ein junges, unerfahrenes, sehr naives Mädchen, das vor Glück strahlte, weil ich nach Stockholm fuhr, um (…) eine Platte (…) aufzunehmen.“8
Sie wusste genau, wo sie sich als Sängerin am authentischsten fühlte – wo ihre Stimme Raum fand und ihr künstlerisches Schaffen ganz sie selbst war:
„Das Polar Studio war mein Zuhause fernab von zu Hause. Dort habe ich meinen Job am meisten genossen, und es gab Zeiten, in denen ich einfach voller Freude war. Die Aufnahmen der Platten waren der spaßigste Teil davon. Es war spannend, meine eigene Note in die Melodien einzubringen, die ich ursprünglich nur als Klänge auf dem Klavier gehört hatte, Tag für Tag, während sie Form annahmen. Frida und ich haben wirklich daran gearbeitet, die Lieder glaubwürdig zu machen. Selbst die sonnigsten Lieder hatten fast immer einen unterschwelligen dunklen Ton. Es war eine Herausforderung, nicht einfach nur durch den Text zu singen, sondern sie so zu singen, als ob sie von mir handelten.“9
Ruhm und Erfolg hatten allerdings ihren Preis, denn die ständige Aufmerksamkeit, die vielen Reisen über Kontinente hinweg und der permanente Balanceakt, einen Kompromiss zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, hatten deutliche Spuren hinterlassen. Nach den hektischen Jahren mit ABBA und den anschließenden Soloprojekten sehnte sie sich nach Ruhe. Was für Agnetha Fältskog einer natürlichen, persönlichen Entwicklung gleichkam, wurde von der Außenwelt jedoch als Rückzug im besten Greta-Garbo-Stil wahrgenommen. Doch im Leben geschehen Dinge, die Wendepunkte darstellen, Katalysatoren für Veränderungen sind, neue Perspektiven eröffnen und alternative Richtungen vorgeben. Und wenn sie in unregelmäßigen Abständen mit neuer Musik aufwartete, wurde dies eher als ein Comeback eines sich aus dem Scheinwerferlicht zurückgezogenen Weltstars angesehen, statt als Beleg dafür, dass Agnetha Fältskog lediglich das machte, was sie selbst bestimmte: in ihrem eigenen Takt neue Musik veröffentlichen. Auch wenn in ihrem Leben andere Prioritäten im Vordergrund standen, blieb ihre Liebe zur Musik stets bestehen – vielleicht hatte sie zeitweise den Pausenknopf gedrückt, aber die Playtaste war stets in Reichweite. Denn sie hatte die musikalischen Türen nie hinter sich geschlossen. Älter zu werden kann unter anderem bedeuten, dass Dinge, die früher wichtig erschienen, in den Hintergrund treten, während man andere Bereiche des Lebens, wie Familie, Gesundheit oder persönliche Erfüllung, stärker wertschätzt. Oft wächst die Erfahrung, die zu größerer Weisheit und Gelassenheit führen kann, und man lernt, Prioritäten besser zu setzen und mit Herausforderungen gelassener umzugehen. Agnetha Fältskog ist ein down-to-earth Weltstar und weiß genau, was sie will, ungeachtet dessen, was andere darüber denken. Sie zeigt Verletzlichkeit, Gefühle und spricht über ihre Schwächen. Dadurch demonstriert sie zugleich deutliche Stärke. Und was andere von ihr halten, spielt keine Rolle:
„Ich denke, je älter ich werde, desto weniger wichtig wird es, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich möchte einfach nur ich selbst sein. Ich möchte nicht ständig darüber nachdenken, was andere über mich denken.“10
Der Begriff It-Girl beschreibt heute eine modebewusste, selbstsichere Frau, die mit ihrem Stil und ihrer Präsenz als Vorbild gilt. Er hat sich von der Modewelt hin zu digitalen und sozialen Einflussbereichen erweitert. Betrachtet man die Bezeichnung hingegen als Beschreibung einer Frau, die ihren eigenen Weg geht, ihrer inneren Stimme, Überzeugung und ihrem Herzen folgt, sich nicht zu sehr von ihrer Umgebung beeinflussen lässt und einen eigenen Stil entwickelt, kann Agnetha Fältskog durchaus als It-Girl ihrer Zeit tituliert werden. Sie hatte das gewisse Etwas. Sie besitzt immer noch eine besondere Ausstrahlung. Doch darüber hinaus ist und war sie noch mehr: Sängerin. Musikerin. Songwriterin. Produzentin. Pionierin. Mutter. Legende. Ikone. Und sie bestimmt ihre eigene Geschichte! Somit verkörperte sie echten Girl-Power-Spirit, lange bevor die Spice Girls den Begriff überhaupt prägten.
Wie ein Wind kamst du zu mir („Som En Vind Kom Du Till Mig“) ist ein Lied von Agnetha Fältskog, das sie zunächst 1969 auf Deutsch unter dem Titel „Wie der Wind“ aufnahm und später mit einem selbstverfassten schwedischen Text versah. Mit ihrer Musik und Stimme hat sie ihre ZuhörerInnen über Jahrzehnte hinweg empfindsam und liebevoll umhüllt, wie ein zarter Windhauch: beruhigend, tröstend, erfrischend und angenehm, aber auch kraft- und eindrucksvoll. Mitunter gleicht ihr künstlerischer Ausdruck einem sanften Hauch, dann wieder einer belebenden Sommerbrise – beides verleiht den Zuhörenden Auftrieb, schenkt ihnen Kraft, stützt sie und spendet emotionale Geborgenheit. Alles eben Wie ein Wind.
1 https://sverigesradio.se/avsnitt/kungaparetsjalvklart-for-oss-att-hylla-abba
2 https://www.gp.se/nyheter/goteborg/abba-aterforenade-nar-kungen-delade-ut-ordnar.e772ab94-6c33-4f75-8c02-1b54c0156bb2
3 E-Mail-Korrespondenz zwischen Agnetha Fältskog und dem Autor, 15. April 2025.
4 Artikel Jönköpingsflicka nytt stjärnskott, Jönköpings-Posten, 2. November 1967.
5 Björn Ulvaeus, Sagan om ABBA, Verlag Fri Tanke, Stockholm 2914, S. 24.
6 Interview des Autors mit Ingmarie Halling, 18. Dezember 2023.
7 Interview Aftonbladet, S. 18, 03.Januar.1969.
8 https://www.youtube.com/watch?v=pf_5L1qBjo4
9 ABBA, The Official Photo Book, S. 276, Max Ström Verlag, Stockholm 2014.
10 https://www.youtube.com/watch?v=pf_5L1qBjo4
1. Opus mit Zeitgeist
Am 13. November 1981 lagen die Temperaturen in der schwedischen Hauptstadt knapp über dem Gefrierpunkt. An diesem Tag war die Aufnahme des Albumcovers für ABBAs neue Platte The Visitors im Freilichtmuseum Skansen geplant. Dort traf vormittags ein Team, bestehend aus dem Grafikdesigner Rune Söderqvist, dem Fotografen Lars Larsson und ABBAs langjähriger Mitarbeiterin Ingmarie Halling ein, um das Fotoshooting vorzubereiten. Söderqvist, der seit 1975 mit ihnen gearbeitet, viele Alben gestaltet, das ikonische Namenslogo entworfen sowie das visuelle Konzept der Tourneen 1977 und 1979/80 entwickelt hatte, hatte hierfür das Atelier des schwedischen Malers Julius Kronberg ausgewählt, in dem das Thermometer Minusgrade anzeigte.
Julius Kronberg (1850–1921) war ein schwedischer Maler, der vor allem für seine historischen Gemälde und Porträts im romantischen Stil bekannt war. Neben seiner freien Kunst gestaltete er auch zahlreiche öffentliche Gebäude in Stockholm, darunter das königliche Schloss und das Königliche Dramatische Theater. Seine Werke, die unter anderem im Nationalmuseum in Stockholm ausgestellt sind, zeichnen sich durch eine präzise Maltechnik, emotionale Ausdruckskraft und eindrucksvolle Inszenierungen aus. Bereits im Alter von 13 Jahren wurde Kronberg in die Königliche Akademie der freien Künste aufgenommen. Ein Reisestipendium führte ihn in den 1870er-Jahren nach Düsseldorf, Paris und Kopenhagen. Besonders prägend war sein Aufenthalt in München, wo er sich intensiv mit dekorativer Malerei auseinandersetzte und unter dem Einfluss von Hans Makarts farbintensivem Stil stand. Während seiner frühen Schaffensphase in München arbeitete er vorwiegend mit dunklen Farben, doch mit seinem späteren Aufenthalt in Rom entwickelte er eine hellere, leichtere Farbpalette. 1889 ließ sich Kronberg ein Atelier auf Norra Djurgården in Stockholm errichten und war neben seiner Tätigkeit als Maler auch als Architekturdekorateur aktiv. Weitere Studienreisen führten ihn unter anderem nach Würzburg und Madrid. Häufig widmete er sich Figuren aus der Mythologie und ließ sich dabei von literarischen Werken, insbesondere von William Shakespeare und der Bibel, inspirieren. Gleichzeitig nahm er künstlerische Anregungen von Meistern wie Tizian, Rubens und während seines Aufenthalts in Rom auch von Tiepolo auf. Kronberg hinterließ ein bedeutendes künstlerisches Erbe, das sowohl seine beeindruckende Maltechnik als auch seine vielseitigen Einflüsse widerspiegelt. Nach seinem Tod 1921 wurde das Atelier als Geschenk dem Nordischen Museum vermacht, und seit 1922 hat es im Freilichtmuseum Skansen seinen endgültigen Platz gefunden. Bei einem Besuch vor Ort führt mich Osva Olsen durch das Gebäude und erläutert:
„Eine Person, für die Julius Kronberg viel gearbeitet hat, ist die Gräfin von Hallwyl gewesen. Sie war nach seinem Ableben bereit, für den Umzug nach Skansen zu bezahlen. Mehrere Porträts im Atelier zeigen ihre Familie. Sie wollte das kulturelle Leben fördern, war sehr reich und machte ihr eigenes Heim zu einem Museum – Hallwylska Palatset im Stadtzentrum. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass es in Skansen ein Atelier gibt, denn die ersten Häuser hier stammten vor allem aus dem bäuerlichen Milieu. Dann kam eine Kirche hinzu. Doch ein Atelier ist im eigentlichen Sinne kein Zuhause. Damals wurde daher intensiv diskutiert, ob es überhaupt angebracht sei, ein solches Gebäude hier zuzulassen. In dieser Hinsicht ist das Atelier einzigartig, denn es ist ein Ort, an dem Kronbergs Pinsel sowie sein gesamtes Arbeitsmaterial zu sehen sind.“11
Von außen betrachtet ist es ein vertäfelter, gelb gestrichener Holzbau, dessen Fassaden nach Norden, Süden und Westen fensterlos sind. Aber auf der Ostseite dominiert ein enormes Atelierfenster die Architektur, so dass sich das Tageslicht wohlwollend in den Räumlichkeiten ausbreiten kann, das dem Maler in der dunklen Jahreszeit, wenn auch nur für wenige Stunden, Helligkeit spendete. Im Inneren befinden sich Skizzen, die Kronberg in seinem Arbeitsatelier anfertigte, bevor er sich für das endgültige Format seiner Werke entschieden hatte. Hier sind selbstgemachte Figuren und ausgestopfte Tiere zu sehen, mit denen er Vorlagen für seine Bilder anfertigte. Seine Kunden konnten Kronbergs Skizzen im anderen Teil des Ateliers, dem Showroom, begutachten.
Da Söderqvist mit Kronbergs Kunst vertraut gewesen ist und er ABBAs The Visitors als Engel interpretierte, hatte er bewusst diesen Ort ausgewählt. Dort beherrscht nämlich ein Gemälde des Engels Eros den Raum, dessen Übergröße die Gestaltung des Gebäudes insgesamt wesentlich prägt. Zudem schloss ABBAs LP mit dem Song Like An Angel Passing Through My Room ab, was ihn ebenfalls in seinem Konzept beflügelte. Osva Olsen reflektiert über das Gemälde: „Da es nur dieses eine Bild hier gibt, fragt man sich, warum Kronberg es nicht verkauft hat. Warum hat er es aufbewahrt und das Studio drum herum gebaut, damit es hineinpasst? Entweder war er zufrieden damit und wollte es für sich behalten, oder er war es nicht und wollte es daher nicht verkaufen.“12 Auf der Rückseite des Albumcovers sind einige von Kronbergs Skizzen abgebildet. Neben einer solchen von Eros im Miniaturformat hängt ein weiteres Skizzenmotiv, das seinerzeit für einen Skandal sorgte: Jagdnymphen und Faune aus dem Jahr 1875, dessen Original sich im Stockholmer Nationalmuseum befindet. Kronberg hatte zwei Männer fotografiert, als er mit der Gestaltung der Szene begann; der norwegische Künstler Eilif Peterssen und der deutsche Bildhauer Bruno Piglhein posierten 1875 in München als Faune für ihn. Was damals jedoch die Gemüter erregte, war nicht der Umstand, dass auf dem Bild eine Frau zu sehen war, wie die Natur sie geschaffen hatte, sondern dass die beiden Männer versteckt im oberen linken Bildrand diese heimlich beobachteten. Als ABBA im Julius Kronberg Atelier fotografiert wurden, hatte das kreative Team die Genehmigung dafür bekommen, einige Objekte wie Stühle oder Bücher umzustellen. „Es war außergewöhnlich, dass sie das machen durften, denn man bewegte sich ja in einer sensiblen Umgebung, die einen großen kulturhistorischen Wert besitzt,“13 kommentiert Osva Olsen dies.
Ingmarie Halling begann ihre Zusammenarbeit mit ABBA im Jahr 1977, als sie während der ersten Welttournee der Gruppe für Make-up und Bühnenoutfits verantwortlich war. Dabei kam ihr ihre frühere kreative Tätigkeit mit Maske, Perücken und Bühnenkleidern im Theater, Ballett- und Musicalbereich zugute. 1976 probte sie mit dem Cramér-Ballett, das in den 1970er- und 1980er-Jahren für seine Aufführungen bekannt war und mit dem Riksteatern, Schwedens nationalem Tourneetheater, tourte. Als Anni-Frid Lyngstad sie während einer Probe anrief und fragte, ob sie im folgenden Frühjahr mit nach Australien auf Tour gehen wolle, hatte sie ihren Entschluss innerhalb weniger Sekunden gefasst, denn: „Das (…) Cramér-Ballett sollte im Januar zu einer Tournee in die damalige Sowjetunion aufbrechen. (Die Entscheidung, ob) Australien oder Sowjet war nicht so schwer,“14 erinnert sich Ingmarie. So zog sie die Wärme Australiens sowie die Aussicht, auf der Südhalbkugel Windsurfen zu können der eisigen Kälte im Osten vor. Vielleicht erinnerte sie sich an jenem kalten Novembertag 1981 für einen kurzen Moment an jene Balletttournee, die ohne sie stattgefunden hatte. Die niedrigen Außentemperaturen waren nicht nur im Inneren des Ateliers spürbar, sondern schienen auch ein Spiegelbild der Stimmung innerhalb der Gruppe zu sein. „Ja, es war keine lustige Zeit, das muss man auch nicht verschweigen (…)“, erzählt sie während unseres Gesprächs. „Was mir auffiel war, dass die Stimmung an diesem Tag nicht so wie früher war, als man vor den Fotoaufnahmen miteinander geredet und gescherzt hat. Dazu kam die Kälte, sie hatten das an, was sie selbst wollten und das vielleicht nicht so warm gewesen ist. Sie trugen keine aufeinander abgestimmten Outfits, wie sonst üblich, sondern die Kleider, die sie selbst haben wollten. Ich glaube, dass wir vielleicht noch etwas anderes vor Ort für den Fall hatten, dass sie sich umziehen wollten. Es gab kein Styling.“15 Dass die Gruppe keine thematisch abgestimmte Aufmachung, wie in den Jahren zuvor auf den Plattencovern von Super Trouper oder Voulez-Vous, trug, unterstrich die Abkehr vom Glamourlook der 70er-Jahre, der nun endgültig der Vergangenheit angehörte: Benny und Björns monotoner Kleidungsstil mit Jackett, Hemd und Pullunder vermittelt einen Hauch von Alltäglichkeit, so dass Agnetha und Anni-Frid, nur leicht dezent-farblicher als ihre männlichen Kollegen gekleidet, zumindest einen gestylten Eindruck erzeugen. Doch insgesamt lag nicht mehr viel Pop-Star-Aura über der Szenerie. Der Stimmung insgesamt wenig zuträglich war auch die Tatsache, dass Rune Söderqvist ABBA ausgerechnet vor dem Eros-Gemälde des Malers Julius Kronberg positioniert hatte: der Gott der begehrlichen Liebe steht mit einem auf einem Bogen ruhenden Arm auf der Kante eines Steinaltars, wobei die Flügel und dessen nackter Oberkörper links vom Altarfeuer hell erleuchtet sind. Rauchranken fegen über das Gemälde, während sich im Hintergrund eine Landschaft mit roten Wolken abzeichnet. Dennoch vermochten Eros’ goldene Liebespfeile nicht die einstige Verbundenheit zwischen den Individuen davor zu entfachen. Vielmehr traten beim Betrachten des Albumcovers die persönlichen Veränderungen nach den Scheidungen der ehemaligen Paare Lyngstad-Andersson 1981 und Fältskog-Ulvaeus 1979 verstärkt in den Vordergrund, die das glückliche ABBA-Image der 70er-Jahre vollends demontiert hatten. Die frühere persönliche Arbeitsharmonie war nun professioneller Zusammenarbeit gewichen, und man wollte neue (musikalische) Wege erforschen. „Ich war mit Rune und dem Fotografen gegen neun Uhr morgens da, und wir haben alles vorbereitet. ABBA kamen so um zehn oder halb elf und drei Stunden später war alles vorbei,“ erinnert sich Halling weiter. „Es waren vier Personen, die in ihren eigenen Wagen vorfuhren. Sie gingen ihrer Arbeit hundertprozentig professionell nach, denn sie hatten ja dem Ganzen zugestimmt. Wenn sie einmal Ja zu etwas gesagt haben, dann liefern sie auch. Die Vier sind eine sehr demokratische Gruppe.“16 Doch man kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass alle vier Mitglieder das Shooting rasch hinter sich bringen wollten – vermutlich betrachteten sie es lediglich als professionelle Pflicht. Zudem waren die Herren intensiv mit dem Abmischen des neuen Albums im hauseigenen Polar-Studio beschäftigt.
Als am 30. November 1981 ABBAs achtes Studioalbum The Visitors in die Plattenläden kam, deutete das Cover also unmissverständlich an, dass sie ihr farbenfroh-unbekümmertes Image hinter sich gelassen hatten, und es vermittelt das Gefühl, dass man an einem Scheideweg angekommen war. Wie sollte oder konnte der weitere gemeinsame Weg aussehen? Konnte es einen solchen noch geben? Zwar war es Rune Söderqvist gewesen, der die Szenerie ausgewählt und der Gruppe Anweisungen gegeben hatte, wie sie sich positionieren sollte, dennoch glaubten viele darin das symbolische Ende von ABBA erkennen zu können. Die Mitglieder selbst sahen das anders. Im Buch Mamma Mia! How Can I Resist You? kommentierte Benny Andersson dies wie folgt: „Wir vertrauten Runes Geschmack und seinem Urteilsvermögen. Wir waren damit zufrieden, ihn interpretieren zu lassen, was er fühlte, wenn er sich das Album anhörte.“17 Agnetha Fältskog gefiel das Cover, das in ihren Augen Raum für Interpretation bot: „Man kann es auf unterschiedliche Art und Weise betrachten. Wir sind ebenfalls ‚Besucher‘ in diesem Raum und ebenso, wen oder was wir betrachten, (…) dann ist da dieser große Engel hinter uns.“18 Dennoch war deutlich, dass Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid nicht mehr die einstige harmonische Einheit ausstrahlten, denn alle vier standen bzw. saßen voneinander getrennt. Die frühere so vertraute Zusammengehörigkeit war eindeutigem Individualismus gewichen, und obwohl man sich zwar räumlich so nah war, überwog Distanz. Es war nicht zu übersehen, dass eine kleine Eiszeit angebrochen war. So wie im Falle der politischen Spannungen zwischen den beiden Weltmächten USA und der Sowjetunion in jenen Jahren. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten ab 1946/47 gegensätzliche Auffassungen der beiden Siegermächte verstärkt zu Disharmonien geführt, denn es war offensichtlich, dass beide Blöcke gegensätzlich politische, gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Ziele verfolgten: der liberal-kapitalistische Westen traf auf den kommunistischen Osten. Da hierbei mit kalten Waffen gekämpft wurde, definierte sich der Begriff des Kalten Krieges als einer, der mit Drohgebärden, Propaganda und wechselseitiger Aufrüstung geführt wurde. Die Waffenarsenale beider Länder waren aufgefüllt, um gegenseitige Drohungen auszusprechen, was jederzeit dazu hätte führen können, dass sich aus dem kalten Krieg ein heißer, ein echter Krieg entwickeln konnte. Die bis heute geltende Einteilung in ein westliches und östliches Europa ist die Konsequenz von diesem Ost-West-Konflikt, der die Weltpolitik des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt hatte. Damit waren auch global-machtpolitische Gegensätze verbunden, die die Welt wiederholt an den Rand eines atomaren Krieges führten. Durch die Umbrüche in Osteuropa und mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 wurde der damalige Kalte Krieg beendet. Während sich in den Jahren des Kalten Krieges viele Länder deutlich auf die Seite einer der beiden Großmächte positioniert hatten, beantwortete Schweden die Frage nach seiner Bündniszugehörigkeit, indem man eine neutrale Mittellage einnahm und sich somit offiziell nicht zu einer Seite bekannte. Während die Nachbarländer Norwegen und Dänemark deutlich Stellung bezogen hatten, indem sie dem Atlantikpakt NATO beitraten und auf der Seite der USA und des Westens standen, wollte Schweden mit seinem neutralen Status vermeiden, Schauplatz von eventuellen Ost-West Gegensätzen zu sein. Doch problemlos war diese Haltung keineswegs, denn ideologisch betrachtet stand das Land auf der Seite des Westens, schließlich förderte man demokratische Einrichtungen und setzte sich für Menschenrechte und Entwicklungshilfe ein. Zudem kooperierte die schwedische Politik eng mit der NATO, die sich somit einem gewissen Druck beider Großmächte ausgesetzt sah. Für Moskau stellte Schweden ein militärisches Problem dar, das es galt, in jeder Hinsicht handzuhaben, denn während des Kalten Kriegs symbolisierte es in Europa die Frontlinie beider Allianzen. Vor allem wurde in den 1980er-Jahren deutlich, wie sehr das Land im Fokus des großen Nachbarn im Osten stand, als schwedische Streitkräfte am 24. September 1980 ein U-Boot einer fremden Macht östlich der Insel Huvudskär in den Stockholmer Schären entdeckten, welches unerlaubterweise in schwedisches Hoheitsgebiet eingedrungen war. Im darauffolgenden Jahr ereignete sich ein weiterer Vorfall, der weltweit für Schlagzeilen sorgte, als am 27. Oktober 1981 das russische U-Boot U137 südöstlich von Karlskrona auf Grund lief. Es gehörte zum Projekt 613, welches Teil der Modernisierung der sowjetischen U-Boot Flotte nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Diese Zuordnung basierte auf dem Umstand, dass es nicht atomar betrieben wurde, sondern einen dieselelektrischen Antrieb hatte. In der NATO-Terminologie war es auch bekannt als Whiskey-Klasse, die hauptsächlich für küstennahe Operationen eingesetzt wurde. Nach dem Vorfall wurde dieser ferner unter dem Begriff ‚Whiskey on the rocks‘ bekannt; er stand als Symbol für die sowjetische Präsenz in der Ostsee und führte zu einer diplomatischen Krise zwischen Schweden und der Sowjetunion. Untersuchungen der damals zuständigen schwedischen Forschungsanstalt der Verteidigung (FOA) vor Ort offenbarten zudem eine ernüchternde und alarmierende Erkenntnis: In den oberen Torpedorohren von U137 befanden sich eine oder mehrere Nuklearladungen. Der damalige Ministerpräsident Thorbjörn Fälldin bestätigte am 5. November das Vorhandensein von Kernwaffen. Ein kurioses Detail dieses Vorfalls war, dass sich Thorbjörn Fälldin auf einer Hundeausstellung in Oslo befand, als das U-Boot an Schwedens Ostküste nahe dem Öresund, der Meerenge zwischen Schweden und Dänemark, strandete. Seine Entscheidung, nicht sofort nach Schweden zurückzukehren, stieß später auf kritische und ironische Kommentare, die sowohl seine Prioritäten als auch Schwedens Umgang mit der Krise thematisierten. Fairerweise ist anzumerken, dass Fälldin nach seiner Rückkehr von der Hundeausstellung entschlossen gehandelt und gegenüber der Sowjetunion eine klare Position bezogen hatte: Das U-Boot musste entfernt werden, und eine Verletzung der schwedischen Neutralität wurde nicht toleriert. Am 6. November nahm das Unterseeboot aus eigener Kraft Kurs zurück Richtung Osten. Obwohl es sich hier um ein äußerst sensibles politisches Ereignis handelte, von dem zunächst niemand wusste, wie es enden würde, konnten sich die Schweden aber auch ein Lachen nicht verkneifen, als das sowjetische U-Boot in unmittelbarer Nähe der Marinebasis in Karlskrona festsaß. Nachdem sich die Situation gelöst hatte, meinten einige Neugierige, die von einem Berghang aus das Geschehnis beobachteten: „Die Sowjetunion ist eine Supermacht. (…) Wir haben nichts davon, sie herauszufordern.“19
Die politischen Ereignisse, die sich vor der eigenen Haustüre auch auf der politischen Weltbühne abspielten, spiegelten zwei Lieder auf The Visitors wider: Soldiers sowie der Albumtitel selbst. Bei Letzterem handelte es sich um die Geschichte russischer Dissidenten, die regelmäßig zu geheimen Treffen in einer Moskauer Wohnung zusammenkommen, wobei nun eine Person allein zurückgeblieben war und bei jedem Klopfen an der Tür damit rechnete, von der staatlichen Obrigkeit abgeführt zu werden. Soldiers schilderte nicht marschierende Soldaten im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr ideologisch verführte Krieger, die sich durch Propaganda und Fake News zu kämpferischen Handlungen jeglicher Art anstacheln lassen. Hierbei wurde deutlich Bezug auf russische Diktatoren wie Stalin genommen, die rücksichtlos ihre politischen Anschauungen um- und durchsetzten. „Ich sehe den Text sehr ernst und denke, dass jeder Mensch ein bisschen Angst vor dem hat, was auf der Welt passieren kann,“ äußerte sich Agnetha Fältskog nach Veröffentlichung des Albums über Soldiers. „Die (jetzige) Situation fühlt sich nicht besonders gut an.“20 Leider hat dies auch nach mehr als vierzig Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. Somit steht der Song für ein für ABBA bis dato ungewöhnlich deutlich politisches Statement, das sich bereits im Vorjahr auf der Super Trouper-LP mit The Piper angedeutet hatte: eine Rattenfänger-von-Hameln-Figur in Form einer charismatischen Führergestalt, die die Menschen in ihren Bann zieht und diese mit populistischen Botschaften ver- und irreführt. Folglich hätte der Unterschied zur romantisch angehauchten, freiheitskämpferischen Erzähl-Retrospektive von Fernando (1976) nicht deutlicher sein können. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt ein weiterer Song, der inhaltlich wegweisend für die übergeordnete Stimmung auf The Visitors betrachtet werden darf: Happy New Year. Agnetha Fältskog verleiht dem Lied mit ihrer klaren und emotionalen Stimme eine bittersüße Tiefe und fängt die Unsicherheit über das Kommende sowie die Vergänglichkeit des Augenblicks ein. Trotz der Euphorie zum Jahreswechsel bleibt die ernüchternde Wahrheit, dass sich manche Dinge nie ändern. Nachdem ABBA Ende 1980 mit ihrem Album Super Trouper ihre Stellung als die Popgruppe der 70er-Jahre ebenfalls im neu angebrochenen Jahrzehnt manifestieren konnten, hatten Andersson und Ulvaeus Anfang 1981 begonnen, neues Material für eine nächste Platte zu schreiben. Anfangs wollte man mehr in Richtung eines Konzeptalbums gehen, dessen inhaltlich miteinander verknüpfte Lieder eine Einheit bildeten. Bereits im Februar wurde im Studio an zwei neuen Songs gearbeitet. Einer davon war Slipping Through My Fingers, welches im Stockholmer ABBA-Museum optisch umgesetzt ist: durch das Küchenfenster von Agnetha Fältskogs ehemaligem Haus im Stockholmer Vorort Lidingö ist ein kleines Mädchen zu sehen, das sich auf den Weg zur Schule macht. Ihr Vater Björn Ulvaeus hatte diesen visuellen Augenblick textlich eingefangen, nachdem er einsehen musste, dass Tochter Linda älter wurde, ihrer eigenen Zukunft entgegenging und ihm allmählich entglitt. Dieses persönlich-universale Elternerlebnis konnte folglich nur von ihrer Mutter Agnetha gesungen werden. Durch ihre gefühlvolle Interpretation ist dies wohl ABBAs authentischster Song. Wie schon im Jahr zuvor, als Björn Ulvaeus die Scheidung von Agnetha Fältskog inhaltlich mit The Winner Takes It All aufgegriffen hatte, bildete nun die Trennung des zweiten ABBA-Paares Anfang 1981 die Grundlage für einen weiteren Song aus dieser Songwriting-Session: When All Is Said And Done. Doch insgesamt sollte sich die Arbeit am neuen Album im Verlauf des Jahres in die Länge ziehen. Zwar hatte das Team Andersson/Ulvaeus einiges an Material komponiert, jedoch passte es nicht immer in den musikalischen Rahmen von ABBA. Wie zum Beispiel im Falle von I Am The Seeker, das aufgrund seines theatralischen Charakters erst zwei Jahre später in der Londoner Bühnenversion des Musicals Abbacadabra verwendet wurde, das auf mit neuen Texten versehenen ABBA-Songs basierte.
ABBA hatte sich mit der Arbeit am neuen Album beinahe ein ganzes Jahr Zeit gelassen, bevor die LP 1981 kurz vor Jahresende fertiggestellt war. In der Popwelt kommt dies einer Ewigkeit gleich, und zwischenzeitlich hatten sich neue Genres und Acts etabliert. Phil Collins veröffentlichte sein erstes Solo-Album Face Value und lieferte mit der Single In The Air Tonight einen Megahit ab (dessen markanter Drum Fill-Sound durch ein Versehen vom Produzenten Hugh Padgham am Mischpult entstanden ist, als dieser die Reverse Talkback-Funktion aktiviert hatte). Bereits ein Jahr später sollten die beiden Herren ausschlaggebend für den Erfolg von Anni-Frids Soloalbum Something’s Going On sein. Gruppen wie Electric Light Orchestra (Fusion aus Pop und klassischen Arrangements), The Police (eine New Wave/Post Punk Gruppe) und Genesis (Rock) waren hoch in den Charts anzutreffen. Synth-Pop hielt Einzug, der sich vor allem durch die primäre Verwendung von Synthesizern, Sequenzern und Drum Machines auszeichnete, die häufig alle anderen Instrumente ersetzten. In Großbritannien hatte diese Musikgattung 1981/82 ihren kommerziellen Peak, wobei Gruppen wie The Human League und Soft Cell mit Don’t You Want Me und Tainted Love große Erfolge erzielten. Letzterer wurde bereits 1965 von der amerikanischen Sängerin Gloria Jones als B-Seite veröffentlicht, jedoch erst 16 Jahre später zu einem Klassiker. Zudem rettete der Erfolg Soft Cell vor dem Rauswurf durch ihre Plattenfirma Phonogram Records, die dringend von den Bandmitgliedern Marc Almond und Dave Ball einen Hit erwarteten. The Human League ist eine britische Synth-Pop-Band, die in den späten 1970er-Jahren gegründet wurde und als Pionier der elektronischen Musikszene gilt. Ihr Sound vereint futuristische Klänge, markante Melodien und häufig nachdenkliche, gesellschaftskritische Texte. Im Dezember 1981 erreichten sie in England mit Don’t You Want Me erstmals die Spitze der Singlecharts und sicherten sich dort mit Dare gleichzeitig ein Nummer-eins-Album. Damit konnte sich die aus Sheffield stammende Band als einer der prägenden Acts ihrer Zeit etablieren. „Damals herrschte eine große Verwirrung“, erinnert sich Frontman Philip Oakey. „Wir hatten plötzlich Hits und nahmen ein Album voller Popsongs auf. Es wurde allgemein angenommen, dass wir (ironische) ‚Pop‘-Musik machten. Aber so war es überhaupt nicht. Selbst als wir noch als avantgardistische Band wahrgenommen wurden, spielten wir zum Beispiel einen Song von Gary Glitter, einfach weil wir seine Musik mochten. Es war dasselbe, als wir offen sagten, dass wir Pop-Platten im Stil von ABBA machen wollten, die zu dieser Zeit völlig unmodern waren. Wir liebten ABBA-Platten wirklich, und es schien für uns ein ganz natürlicher Schritt zu sein.“21 Es ist daher wenig überraschend, dass Oakey den Anspruch hatte, mit seiner Band das elektronische Pendant zu ABBA in ihrer Zeit zu sein, und dass das Intro von Don’t You Want Me von ABBAs Song Eagle inspiriert war. Als Benny Andersson 2022 in einem Interview mit dem „Record Collector“ darauf angesprochen wurde, bestätigte er, den Song zu kennen, fügte jedoch hinzu: „Nein, so habe ich es nicht gehört. (…) Ich werde es mir (aber) anhören.“22
Einem anderen Synthpop-Act, Blancmange, gelang es 1984 mit ihrer Coverversion von The Day Before You Came in den britischen Charts einen höheren Platz zu erreichen als ABBA seinerzeit 1982. Ein weiterer Vertreter dieser Gattung ist die britische Synthpopgruppe OMD, deren Musik sich durch unkonventionelle Texte und instrumentale Refrains auszeichnet. 1983 veröffentlichten sie das Album Dazzle Ships, welches der Sänger Paul Humphreys als Beispiel für die Verknüpfung von OMDs künstlerischen Seite mit Pop darstellt. In einem Interview 2020 mit „Classic Pop“ sagte er:
„Wir wollten das Gegenteil von New Romantic sein, also dachten wir: ‚Lass uns wie langweilige Bankangestellte aussehen.‘ Aber wenn wir Auftritte hatten, kleideten sich die ersten paar Reihen der Fans genauso langweilig wie wir. Musikalisch haben wir die Grenzen so weit wie möglich verschoben. Bei einem Treffen (mit unserer Plattenfirma Virgin) fragte uns der Leiter von A&R: ‚Kommt schon, Leute, seid ihr Stockhausen oder ABBA?‘ Andy und ich sagten ,Können wir nicht beide sein?‘“
Inhaltlich behandelten die Texte auf Dazzle Ships Themen wie den Kalten Krieg, automatisierte Massenproduktion, technokratisches Denken sowie die Risiken eines unkritischen Vertrauens in die aufkommende Computergesellschaft und Gentechnik. Musikalisch kehrte man der melodischen Popmusik den Rücken und stellte stattdessen experimentelle und elektronische Klänge in den Mittelpunkt. Doch der kommerzielle Erfolg blieb weit hinter dem seines Vorgängers Architecture & Morality, auf dem Joan of Arc enthalten ist, zurück. Paul Humphreys: „Wir bekamen Angst und dachten: ‚Lasst uns Stockhausen aufgeben und für eine Weile ABBA werden.‘“ Das taten sie 1984 mit der Veröffentlichung von Junk Culture, welches sich am Pop orientierte. Zu diesem Zeitpunkt waren eventuelle Pläne, dass sich ABBA, von denen man nach 1982 nichts mehr hörte, mit neuer Musik zurückmelden würden, in weite Ferne gerückt.
Beim Anhören von The Visitors wird deutlich, dass die Unbekümmertheit der 70er-Jahre ernsteren und reiferen Tönen gewichen war. Lediglich Two For The Price Of One und Head Over Heels ließen noch ansatzweise die Leichtigkeit von einst erkennen. „(…) Ich finde, dass es ein happy Song ist,“ kommentierte Agnetha nach Erscheinen des Albums das letztere Lied, auf dem sie Lead sang. „Es hat sich sehr gut angefühlt, dieses Lied zu singen, weil es sich cool angemutet hat. Ich denke, dass man dies heraushören kann, denn es ist eine andere Art zu singen.“23 Thematisch standen tiefgründige Inhalte im Mittelpunkt, wie zum Beispiel emotional-atmosphärische Vergänglichkeit, Like An Angel Passing Through My Room, irreparable Beziehungen, One Of Us, oder die intellektuell-musikalische Dimension der Musik, I Let The Music Speak. Daher drängte sich einem unwillkürlich die Erinnerung an die Sorglosigkeit der 70er-Jahre und die ABBA-eigene Frage aus SOS auf: Wo sind die glücklichen Tage geblieben, die nun so schwer zu finden schienen? „The Visitors (…) ist eines der besten Dinge, die wir gemacht haben“, sagte Anni-Frid rückblickend. „Die Qualität der Lieder (…) Das Niveau ist durch und durch fantastisch. Und alles, was wir damals durchgemacht haben, spiegelt sich auf eine gute Art und Weise in der Musik wider.“24 Agnetha fand, dass die Platte insgesamt wohl ein wenig „tiefgründig ist. Schwerfällig finde ich.“25, dem Benny Andersson zustimmen konnte: „(Die Platte) enthält ein wenig mehr Dramatik. Rückblickend glaube ich, sind wir für eine Popband vielleicht ein wenig zu ernsthaft geworden. Es gab kein Honey, Honey (oder) Thank You For The Music.“26 Björn Ulvaeus pflichtete dem bei, indem er ausführte, dass die LP düsterer als alles Bisherige ausgefallen war, da man es ihren musikalischen Vorbildern The Beatles gleichtun und mit jeder neuen ABBA-Platte textlich sowie musikalisch einen neuen kreativen Weg einschlagen wollte: „Und reifer zu werden, bedeutet manchmal eben auch, düsterer zu werden.“27 Dass die musikalischen Köpfe Andersson/Ulvaeus künstlerisches Neuland betreten wollten, deutete auch ein Treffen der beiden Komponisten kurz nach Erscheinen von The Visitors Ende 1981 mit dem britischen Musical- und Filmmusiktexter Tim Rice an. Mit ihm diskutierten sie eine mögliche Zusammenarbeit, welche 1984 im Musical Chess resultierte, dessen Story auf dem Ost-Westkonflikt der beiden Supermächte USA und UdSSR aufbaut. Benny Andersson brachte nach der Arbeit mit The Visitors seinen künstlerischen Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck: „Ich weiß nicht, was geschah (…) aber was mich betrifft, denke ich, dass es wohl mit einem wachsenden Verlangen zu tun hatte, etwas mehr Substanzielles zu machen – mehr in Richtung Theater (…).“28
Aus der Retrospektive darf konstatiert werden, dass es dem Art Director Söderqvist und Fotografen Larsson mit ihrer Covergestaltung von The Visitors gelungen ist, die Quintessenz von ABBA der 80er-Jahre auf den Punkt zu bringen. Atelierbesucher reagieren immer wieder überrascht, wie klein der Raum in Wirklichkeit ist. Doch dem Team gelang es, dem Bild eine Tiefe zu geben, die aus Licht und Schatten besteht, um es größer wirken zu lassen. Es handelte sich um kein kommerzielles Cover im herkömmlichen Sinne, es vermittelte künstlerische Perfektion. Die Platte war Beweis dafür, dass ABBA ihr Handwerk bis ins kleinste Detail beherrschten, denn sie hatten ein musikalisch-intellektuelles Meisterwerk abgeliefert, welches einen Wendepunkt in ihrer Karriere markierte. Söderqvist hatte diesen nicht nur visuell mittels der dramatisch-anspruchsvollen Aufmachung und gedämpften Farbgestaltung erfasst. Er vermochte in einem kompakten Raum, der im Grunde per se Nähe vermittelt, unübersehbare Distanz zum Ausdruck zu bringen, und dennoch die musikalische Vervollkommnung und Reife der Lieder zu integrieren. Seit Beginn ihrer Karriere unterzog sich die Musik von ABBA stetiger Weiterentwicklung, um so ihrem Anspruch an das eigene Schaffen gerecht werden zu können. Es handelte sich um ABBAs musikalische Identität und Integrität, wobei jede Aufnahme sorgfältig wie ein kleines Meisterwerk behandelt wurde. Das Cover deutet darüber hinaus die individuelle Erneuerung einer Gruppe an, deren Blicke in unterschiedliche (musikalische) Richtungen gehen. Doch aus anfänglicher Passion war irgendwann Routine geworden. Jetzt war man neugierig auf und offen für neue Impulse, fernab vom ABBA-Kosmos.
Mit Erscheinen von The Visitors kurz vor Weihnachten war den Vieren ein weiterer Erfolg beschert. Ohne Weiteres konnten sie sich immer noch gleichberechtigt neben neuen Musiktrends behaupten, denn sie selbst verkörperten ja wie keine andere Band einen Trend an sich. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass The Visitors als Eröffnungsnummer für ABBA Voyage gewählt wurde, das digitale Konzert der Gruppe, das im Mai 2022 in London Premiere feierte: „Zum Teil, weil The Visitors der beste Song ist (und) es ist eine musikalisch-thematische Eröffnungsnummer (…). Sie kommen zu Besuch,“29 sagt Ludvig Andersson, Produzent des Ganzen.
Auch wenn 1982 noch weitere Singles und ein Sammelalbum, das die ersten zehn Jahre von ABBA summierte, folgten, war man dennoch am Ende des gemeinsamen Weges angelangt, und die Gruppe legte eine Pause ein. Die Arbeit an einer weiteren Platte schien in immer weitere Ferne zu rücken. Als erstes Mitglied verwirklichte 1982 Anni-Frid ihren langgehegten Traum von einem internationalen Soloalbum. Und nachdem Agnetha Fältskog 1983 ihre erste englischsprachige Solo-LP Wrap Your Arms AroundMe veröffentlicht hatte, sagte sie:
„Ich empfinde die Pause von ABBA als sehr angenehm (…) Jeder weiß doch, wie es bei uns läuft. Die Jungs schreiben die Songs, tun die ganze Studioarbeit und rufen uns nur an, wenn wir singen sollen. Das ist auf die Dauer nicht befriedigend. Denn ich habe auch viele gute Ideen, die ich aber bei ABBA nie loswerden kann. Deshalb hat mir die Arbeit am Soloalbum so viel Spaß gemacht, weil ich da vom ersten bis zum letzten Ton kreativ dabei war.“30
Der 13. November 1981, an dem die Fotoaufnahmen zu The Visitors stattfanden, mag für manche als Beispiel für einen kulturell geprägten Aberglauben in doppelter Bedeutung gelten – Nomen est omen, nicht nur wegen der berüchtigten Zahl Dreizehn, sondern auch, weil es ein Freitag war …
11
12
13
14 Podcast Hemvändarpodden, Folge 2.2 mit Ing-Marie Halling, 8. Dezember 2023.
15 Interview des Autors mit Ingmarie Halling, 18. Dezember 2023.
16 Interview des Autors mit Ingmarie Halling, 18. Dezember 2023.
17 Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Judy Cramer, Mamma Mia! How Can I Resist You?, S. 120, Krüger Verlag, Frankfurt/Main, 2006.
18 International ABBA Magazine, Nummer 5.
Dagens Nyheter, Whiskey on the rocks, 27. Dezember 2024, S. 6-7.
20 International ABBA Magazine, Nummer 5, S.5.
21 https://toasterking.tripod.com/music_human_league/human_league.html
22 Record Collector, Ausgabe #539, 2020, Seite 104.
23 International ABBA Magazine, Ausgabe 5, S. 5.
24 ABBA, The Official Photo Book, S. 346, Max Ström Verlag, Stockholm 2014.
25 Interview mit Agnetha Fältskog, The Winner Takes It All, Attitude Magazine, Mai 2013.
26 Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Judy Cramer, Mamma Mia! How Can I Resist You?, S. 118, Krüger Verlag, Frankfurt/Main, 2006.
27 Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Judy Cramer, Mamma Mia! How Can I Resist You?, S. 118, Krüger Verlag, Frankfurt/Main, 2006.
28 Booklet The Visitors Deluxe Edition, Polar Music International AB 2012.
29 Podcast Hitfabriken, ABBA Voyage – Ludvig Andersson, Folge 72, 20. Mai 2023.
30 Micke Bayart, ABBA in Deutschland.1973–1983, S. 230, Charles Verlag, Hamburg 2022.
2. Jönköping
Jönköping, malerisch am Südufer des Vättern, dem zweitgrößten See Schwedens, gelegen, ist die zehntgrößte Stadt des Landes und erhielt im Mai 1284 ihre Stadtrechte. In den darauffolgenden Jahrhunderten war sie Sitz mehrerer schwedischer Reichstage, heute ist sie Residenzstadt der Provinz Småland. Mittlerweile ist Jönköping eine moderne Stadt mit florierender Wirtschaft, wachsender Bevölkerung und einer renommierten Hochschule. Durch seine malerische Lage am Vätternsee sowie seine Bedeutung als Messestandort ist es ein zentrales Wirtschaftszentrum Südschwedens. Heute umfasst die Gemeinde Jönköping die drei Städte Gränna, Huskvarna und Jönköping sowie mehrere Dörfer, ländliche Gebiete und die Insel Visingsö. Im 19. Jahrhundert war die alteingesessene Industriestadt international für ihre Zündholzindustrie bekannt, dessen Geschichte im hiesigen Streichholzmuseum erzählt wird. Mit der Industrialisierung wuchs Jönköping weiter und entwickelte sich zu einem bedeutenden Handels- und Industriezentrum. Wie in vielen anderen Städten wurde die Innenstadt in den 1950er- und 1960er-Jahren saniert, wodurch Verwaltung und Geschäfte das Stadtbild zunehmend prägten. Gleichzeitig entstanden am Stadtrand neue Wohngebiete und Stadtteile, darunter Österängen, das 1952 errichtet wurde, und dessen erste Bewohner in elfstöckige Hochhäuser einzogen. Jönköping wird oft als „Smålands Jerusalem“ bezeichnet, da das Christentum, insbesondere die freikirchliche Bewegung, hier tief verwurzelt war. Noch bis 1952 weigerte sich die Zeitung „Jönköpings-Posten“, Anzeigen für Kinofilme zu veröffentlichen! In den frühen 1950er-Jahren dominierten drei politische Parteien das Stadtgeschehen: die Sozialdemokraten, Folkpartiet (Volkspartei) und die Rechte. Berühmte Persönlichkeiten, die von hier stammen, sind unter anderem Viktor Rydberg, Dichter und Schriftsteller, John Bauer, Künstler und Maler, sowie Dag Hammarskjöld, ehemaliger UN-Generalsekretär. Und Agnetha Fältskog.
Als Jönköping im Mai 1984 sein 700-jähriges Stadtjubiläum feierte, hatten sich mehr als 10.000 Menschen auf Västra Torget eingefunden, um den Feierlichkeiten beizuwohnen, die live im schwedischen Fernsehen übertragen wurden. Gemeinsam mit Staffan Lindeborg, der mit ihr einige Jahre in die gleiche Realschulklasse gegangen war, moderierte Agnetha Fältskog die Veranstaltung. Dass sie ihre Heimatstadt feierte, ist nicht verwunderlich, denn hier lagen ihre Wurzeln. Als ihr mit ABBA während der ersten Welttournee in Australien eine Aufmerksamkeit ohnegleichen widerfuhr, die in ihren Augen einer Glorifizierung gleichkam, sagte sie: „Damit war ich noch nie in Berührung gekommen. Ich meine, tief im Inneren war ich immer noch ein ganz normales Kind aus Jönköping (…).“31 Und für ihren Weltstar hatten die Organisatoren auch eine Überraschung bereit: ein Kinderchor präsentierte unter anderem ihren allerersten Hit in Schweden, Jag Var Vå Kär (Ich war so verliebt). Vielleicht erinnerte sich eine sichtbar gerührte Agnetha Fältskog an den Beginn ihrer einzigartigen Karriere, nachdem sie als Siebzehnjährige diesen Song in Stockholm aufgenommen hatte. In ihrer Biografie Som Jag Är