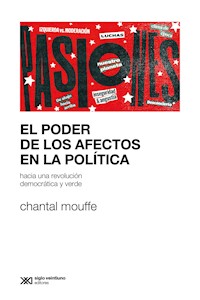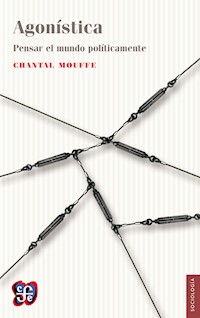15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die SPD wirbt mit »Das Wir entscheidet«, die CDU mit »Gemeinsam erfolgreich« – die Wahlplakate unterstreichen, wie politischer Wettbewerb heute meist aussieht: konsensorientiert und ohne klare Alternativen. Der Ansatz Chantal Mouffes zielt in die entgegengesetzte Richtung: Der agonistische Wettstreit der Ideen ist ein fundamentaler Bestandteil des Politischen. Daher plädiert Mouffe für einen radikalen Pluralismus: Wir müssen sicherstellen, dass unterschiedliche Modelle präsentiert und diskutiert werden können – und zwar auf der nationalen, der europäischen und der globalen Ebene. Was das konkret bedeutet und welche Lehren die Linke daraus ziehen muss, erläutert die Politikwissenschaftlerin im Nachfolgeband zu ihrem vielbeachteten Buch "Über das Politische".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die SPD wirbt mit »Das Wir entscheidet«, die CDU mit »Gemeinsam erfolgreich« – die Wahlplakate unterstreichen, wie politischer Wettbewerb heute meist aussieht: konsensorientiert und ohne klare Alternativen. Der Ansatz Chantal Mouffes zielt in die entgegengesetzte Richtung: Der agonistische Wettstreit der Ideen ist ein fundamentaler Bestandteil des Politischen. Daher plädiert Mouffe für einen radikalen Pluralismus: Wir müssen sicherstellen, dass unterschiedliche Modelle präsentiert und diskutiert werden können – und zwar auf der nationalen, der europäischen und der globalen Ebene. Was das konkret bedeutet und welche Lehren die Linke daraus ziehen muss, erläutert die Politikwissenschaftlerin im Nachfolgeband zu ihrem vielbeachteten Buch Über das Politische (es 2483).
Chantal Mouffe, geboren 1943 in Charleroi, lehrt Politische Theorie an der University of Westminster. Ihr gemeinsam mit dem argentinischen Politikwissenschaftler Ernesto Laclau verfasstes Buch Hegemonie und radikale Demokratie gilt als ein Grundlagentext des Postmarxismus.
Chantal Mouffe
Agonistik
Die Welt politisch denken
Aus dem Englischen von Richard Barth
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2677.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73607-4
www.suhrkamp.de
6Inhalt
Vorwort
Einführung
1. Was bedeutet »agonistische Politik«?
2. Welche Demokratie für eine multipolare, agonistische Welt?
3. Ein agonistischer Ansatz für die Zukunft Europas
4. Radikale Politik heute
5. Agonistische Politik und künstlerische Praktiken
6. Schlussfolgerungen
Anhang: Und jetzt, Frau Mouffe?Chantal Mouffe im Gespräch mit Elke Wagner
7»Opposition is true friendship.«
William Blake, The Marriage of Heaven and Hell (1793)
»Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt.«
Theodor Däubler, Hymne an Italien (1916)
9Vorwort
Die in diesem Buch dargelegten Gedanken habe ich im Lauf der vergangenen Jahre an unterschiedlichen Orten diskutiert, und manches habe ich, wenn auch in anderer Form, bereits veröffentlicht. Da der Zweck dieser Interventionen darin bestand, meinen agonistischen Ansatz in unterschiedlichen Kontexten vorzustellen und seine Relevanz für neue Gebiete zu untersuchen, musste ich zu Beginn stets die Grundprinzipien der Agonistik darlegen, so dass ein gewisses Maß an Wiederholung unvermeidlich war. Bei der Überarbeitung der einzelnen Texte für diese Publikation habe ich diese Wiederholungen, sofern sie mir nicht für die Stringenz der Argumentation notwendig erschienen, so weit als möglich zu streichen versucht. Das bedeutet, dass die meisten Kapitel zwar auf die eine oder andere Weise aus öffentlichen Vorträgen oder Konferenzbeiträgen hervorgegangen, hier jedoch nicht in der ursprünglichen Form enthalten sind. Das letzte Kapitel habe ich eigens für dieses Buch geschrieben.
Zur leichteren Einordnung der in diesem Buch diskutierten Fragen in den größeren Kontext meiner Arbeit habe ich für alle, die mit meinem Ansatz noch nicht vertraut sind, am Ende des Buches ein Interview angefügt, das ich vor einigen Jahren gegeben habe und das ursprünglich in der 2007 von Suhrkamp veröffentlichten Anthologie Und jetzt? erschienen ist.[1] Indem es eine kurze Einführung in mehrere Themen gibt, mit denen ich mich im Lauf der Jahre auseinandergesetzt habe, wird dieses Interview, wie ich hoffe, zum leichteren Verständnis meiner derzeitigen Position beitragen.
10Ich danke dem Literaturverein Het beschrijf in Passa Porta, auf dessen Einladung ich im Mai 2012 einen Monat als Writer in Residence in Brüssel verbringen durfte, um in einer sehr angenehmen Umgebung die Endfassung dieses Manuskripts zu erstellen – was mir nebenbei die Gelegenheit gab, das Kunstenfestivaldesarts zu besuchen, das sich für meine Reflexionen über künstlerische Praktiken als außerordentlich anregend erwies.
Anmerkung
1 Heinrich Geiselberger (Hg.), Und jetzt? Politik, Protest und Propaganda, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007, S. 105-127.
11Einführung
Die in diesem Band versammelten Essays untersuchen die Relevanz des von mir in meinen bisherigen Büchern ausgearbeiteten agonistischen Ansatzes für eine Reihe von Fragen, die ich für das linke Projekt als bedeutsam erachte. Jedes Kapitel widmet sich einem anderen Thema, doch mein Ziel ist dabei stets, mich dem Problem aus politischer Sicht zu nähern. Politisch zu denken erfordert, wie Ernesto Laclau und ich in Hegemonie und radikale Demokratie argumentiert haben, sich die ontologische Dimension der radikalen Negativität bewusst zu machen.[1] Aufgrund der Existenz einer Form von Negativität, die dialektisch nicht auflösbar ist, kann einhundertprozentige Objektivität niemals erreicht werden, und der Antagonismus ist eine stets präsente Gefahr. Die Gesellschaft ist von Kontingenz durchdrungen, und jede Ordnung ist hegemonialer Natur, das heißt, sie ist Ausdruck von Machtverhältnissen. Für den Bereich der Politik bedeutet das, dass wir die Suche nach einem Konsens ohne jede Exklusion einstellen und die Hoffnung auf eine ganz mit sich versöhnte und harmonische Gesellschaft fahrenlassen müssen. Folglich kann das emanzipatorische Ideal nicht im Sinne einer Verwirklichung irgendeiner Form von »Kommunismus« formuliert werden.
Die hier dargelegten Überlegungen orientieren sich an der Kritik des Rationalismus und des Universalismus, die ich entwickelt habe, seit ich in The Return of the Political ein Demokratiemodell auszuarbeiten begann, das ich als »agonistischen Pluralismus« bezeichne. Um die Dimension der radikalen Negativität in die Sphäre des Politischen einzubeziehen, habe ich in jenem Buch zwischen dem »Politischen« und der »Politik« unterschieden. Während ich »das Politische« auf die ontologische Dimension des Antagonismus beziehe, bezeichne ich mit »Politik« das Ensemble von Praktiken und Institutionen, deren Ziel die Organisation der menschlichen Koexistenz ist. Diese Praktiken operieren jedoch stets auf einem konflikthaften Terrain, das vom »Politischen« geprägt ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!