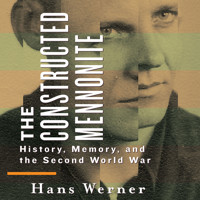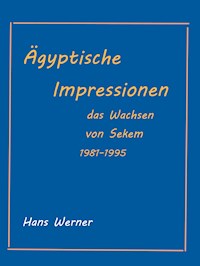
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Titel umfasst Tagebuchaufzeichnungen, die Dr. Hans Werner auf einer Reihe von Ägyptenreisen in den Jahren 1981 und 1995 gemacht hat. Sie geben ein persönliches Bild der Entwicklung des SEKEM-Projektes in Ägypten, das auf der Grundlage der Urbarmachung eines großen Wüstengeländes Heilkräuter und Nahrungsmittel anbaut und aus den Erträgen soziale und kulturelle Einrichtungen finanziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Warum wir in Sekem sind
Tagebucheintrag am 27. Januar 1981,
Ibrahim Abouleish – der Initiator
28. Januar 1981: Ein Sekem-Schicksalstag
Ägyptenreise: 14. 6. bis 4. 7. 1982
Martins Brief an einen Freund
Ägyptenreise: vom 4. bis 18.2. 1984
Ägyptenreise: vom 2. bis 16.12. 1984
Ägyptenreise: vom 29.9. bis 20.10. 1985
Ägyptenreise: Vom 24. 9. bis 18. 10. 1986
Ägyptenreise: vom 1. bis 15. Mai 1987
Ägyptenreise: vom 30.3. bis 9.4. 1988
Ägyptenreise: vom 2.9. bis 1.10. 1988
Ägyptenreise: vom 2.9. bis 1.10. 1989
Ägyptenreise: vom 11.9. bis 9.10. 1990
Ägyptenreise: vom 24.2. bis 10.3. 1991
Ägyptenreise: vom 9. bis 29.9. 1991
Ägyptenreise: vom 14.1. bis 25.1. 1992
Ägyptenreise: vom 4. bis 22.4. 1992
Ägyptenreise: vom 3. bis 17.9. 1992
Ägyptenreise: vom 23.1. bis 13.2. 1993
Ägyptenreise: vom 14. bis 27.3. 1995
Abbildungen
Übersicht
Warum wir in Sekem sind
Tagebucheintrag am 27. Januar 1981
Ibrahim Abouleish - der Initiator
26. Januar 1981 - ein Sekem-Schicksalstag
Ägyptenreise vom 14.6. bis 4.7.1982
Martins Brief an einen Freund
Ägyptenreise vom 4. bis 18.2.1984
Ägyptenreise vom 2. bis 16.12.1984
Ägyptenreise vom 29.9. bis 20.10.1985
Ägyptenreise vom 24.9. bis 18.10.1986
Ägyptenreise vom 1. bis 15.5.1987
Die Rose
Ägyptenreise vom 30.3. bis 9.4.1988
Ägyptenreise vom 2.9. bis 1.10.1988 Ägyptenreise vom 2.9. bis 1.10.1989
Ägyptenreise vom 11.9. bis 9.10.1990
Ägyptenreise vom 24.2. bis 10.3.1991
Ägyptenreise vom 9. bis 29.9.1991
Ägyptenreise vom 14.1. bis 25.1.1992
Ägyptenreise vom 4. bis 22.4.1992
Ägyptenreise vom 3. bis 17.9.1992
Ägyptenreise vom 23.1. bis 13.2.1993
Ägyptenreise vom 14. bis 27.3.1995
Abbildungsverzeichnis und -Nachweis
Warum wir in Sekem sind
Leitbild, Grundsätze und Ziele der Sekem-Initiative
Die Sekem-Initiative will den Herausforderungen der Zeit gerecht werden und zu einer umfassenden Entwicklung von Mensch, Gesellschaft und Erde beitragen. Durch das Streben nach einer Wissenschaft des Geistes, dem Quell alles Religiösen, erhalten wir unsere Dynamik und unsere Entwicklungsimpulse.
Wie wir uns verhalten wollen
Wir wollen unsere wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitäten so gestalten, dass sie sich gegenseitig befruchten.
Wir streben danach, mit unseren Partnern eine langfristige, zuverlässige und faire Zusammenarbeit aufzubauen.
Wir fördern die Entwicklung aller Mitarbeiter, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, in der Arbeit zu lernen, sich mit den gestellten Aufgaben zu verbinden und ein friedliches Miteinander zu üben.
Wir möchten die Gesundung der Erde unterstützen, indem wir die Methode der biologisch-dynamischen Landwirtschaft anwenden und weiterentwickeln.
Was wir anbieten wollen
Wir möchten alle Arten von Produkten und Dienstleistungen erstellen, die den Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen.
Wir bilden Kinder und Jugendliche nach einer zeitgemäßen Menschenkunde aus.
Wir unterstützen die Gesundheitsvorsorge und stellen Therapien auf einem ganzheitlichen Menschenbild zur Verfügung.
Wir forschen an wesentlichen Fragen der Zeit auf allen Lebensgebieten.
Tagebucheintrag am 27. Januar 1981,
am Tag nach der ersten Begegnung
50 km von Kairo entfernt gibt es eine junge Farm. 70 ha Wüste wurden vier Jahre lang bearbeitet. Der Anbau ist biologisch, das Ziel ist der biologisch-dynamische Anbau, modifiziert nach den Gegebenheiten Ägyptens. Nach einiger Mühsal finden wir dorthin, werden herzlich aufgenommen und erleben, was der Wille einiger Menschen vermag: Wüste in Kulturlandschaft verwandeln; Häuser und Werkstätten, Ställe und eine Käserei, sowie ein pharmazeutisches Labor bauen; Menschen Freude an der Arbeit vermitteln, Verantwortlichkeit bei ihnen fördern, Behördenhindernisse überwinden.
All dies entspringt dem Entschluss von Dr. Ibrahim Abouleish und seiner Frau, die Existenz in Europa aufzugeben und gegen ihren eigentlichen Wunsch wieder nach Ägypten zurückzukehren. Dieses Erlebnis und die intensive menschliche Begegnung dort führen bei uns zum Vorsatz, unsere Kraft dafür einzusetzen, dass dieses Werk gelingen möge. Wie eigenartig berührt uns, dass hier mitteleuropäischer Geist den ägyptischen Menschen etwas bringen will, was sie fördern kann.
Bäume wachsen, Flächen sind für die Bewässerung vorbereitet, noch geht der Blick frei über das Farmgelände
Ibrahim Abouleish –
der Initiator
Am 23. März 1937 wurde Ibrahim Abouleish im Sternzeichen des Widders in einer kleinen Stadt des Nildeltas als Sohn und erstes Kind in eine ägyptischen Großfamilie hineingeboren. Der Vater hatte eine Seifenfabrik in Kairo, und so spannte sich die Kindheit zwischen dem dörflichen Mastul und dem ägyptischstädtischen Kairo aus. Durch Geschäftsbeziehungen des Vaters drang auch schon europäische Luft in die Seele des aufwachsenden Knaben. So beeindruckte ihn ein Sortiment Essbesteck, Geschenk eines Stuttgarter Geschäftsfreundes, so tief, dass er spontan den Wunsch äußerte, später einmal nach Deutschland zu kommen.
Die Schulzeit verbrachte Ibrahim in Kairo. Dort gab es drei Onkel, Brüder seines Vaters, die durch ihre beruflichen Tätigkeiten eine denkwürdige Konstellation für den jungen Menschen darstellten. Der eine Onkel hatte eine große Speditionsfirma. Ibrahim durfte anfangs kleinere Strecken, später dann auch Transporte in andere Landesteile mitmachen. Er erlebte auf diesen Reisen sein Heimatland, und in seine Seele senkten sich die besonderen Verhältnisse Ägypens: die großen Gegensätze zwischen der lebensfeindlichen Wüste, den unzugänglichen Gebirgen und der fruchtbaren Lebendigkeit des Niltals. Dass zwischen diesen Extremen das Wasser das Leben vermittelnde Element ist, hat sich dieser jugendlichen Seele tief eingeprägt.
Der zweite Onkel war Künstler. Er machte den Jüngling mit dem Künstlerleben in Kairo bekannt und hat so dem sein seelisches Leben entfaltenden Ibrahim keimhaft die Liebe und die Sehnsucht zur Kunst eingepflanzt. Dem dritten, einem Philosophieprofessor an der Universität Kairo mit großer Bibliothek, war Ibrahim Lieblingsneffe, und Ibrahim durfte freizügig seinen Wissensdurst in dieser Bibliothek stillen. So kam es, dass der Vierzehnjährige ein Buch von Goethe fand, es nur so verschlang und tief beeindruckt war. Dorthin, wo dieser große Dichter gelebt hatte, wollte er auf jeden Fall gehen. So hat das Schicksal den jungen Menschen durch die drei Onkel in wichtigen Bereichen des Lebens vorbereitet für seine zukünftigen Aufgaben.
Der Vorsatz war so stark, dass Ibrahim von dieser Zeit an Geld sammelte, um, wenn er das Abitur hinter sich hätte, heimlich nach Mitteleuropa zu gehen – denn er wusste, dass die Eltern einem solchen Weg nicht zustimmen würden.
Ständig dieses Ziel vor Augen, machte der vielseitig begabte junge Mensch das Abitur. Nicht die geliebte Mutter, nicht die Geschwister und Freunde und auch nicht die Verwurzelung in seinem Heimatland Ägypten konnten verhindern, dass Ibrahim in der Dämmerung noch einen unhörbaren Gruß in das Schlafzimmer der Eltern schickte und bald danach von der Reling eines Schiffes aus das Entschwinden der Küste Ägyptens, damit aber auch das Näherkommen des so lange ersehnten Zieles erlebte. Die Universität Graz war zunächst das Ziel. Dort gab es eine ägyptische Studentengruppe. Aber weiter hätte auch das Geld nicht gereicht. Die Wette, die ein ägyptischer Student ihm im Spott aufgezwungen hatte, dass er bald wieder in Ägypten landen würde, weil er ja keine finanzielle Unterstützung bekäme, hätte Ibrahim gewonnen – hätte er sie nicht vergessen.
Wie ein Verdurstender sog Ibrahim Abouleish jetzt die mitteleuropäische Kultur in sich auf. Diese war ihm nicht fremd. Es war wie ein Wiedererkennen und Wiederaufnehmen. Eine besondere Bedeutung nahm dabei die Musik ein und so konnte man den Studenten oft aus Oper und Konzertsälen beseligt nach Hause gehen sehen, manchmal ins Gespräch vertieft zusammen mit einem älteren Hornbläser-Professor. Daraus ergab sich Familienanschluss, der nach nicht vielen Jahren zur Ehe mit der jungen, blonden, lebhaften Gudrun führte.
Das Studium der Chemie, daneben Philosophie und später auch Medizin ließen Ibrahim Abouleish zu einem jungen Pharmakologen mit philosophischer Grundstimmung werden, der bald erfolgreich Patente anmelden konnte. Er sprach natürlich in der Zwischenzeit fließend die deutsch/österreichische Sprache. Und er fühlte sich als Mitteleuropäer und dachte nicht daran, wieder nach Ägypten zurückzugehen. Nach einer Tätigkeit als Assistent an der Universität, dann bei einem pharmazeutischen Unternehmen, später bei Beiersdorf in Harnburg und bei einer Firma in Amerika bekam der 33jährige das Angebot einer pharmazeutischen Firmengruppe, in St.Johann/Österreich ein Forschungsinstitut aufzubauen. Das weckte die Fähigkeiten, die er späterbeim Aufbau der SekemInitiative brauchte: Ideen zu haben und diese zu verwirklichen.
Zwei Kinder, Helmy und Mona, waren in der Zwischenzeit geboren, ein eigenes Haus in St. Johann war Familienmittelpunkt geworden.
Ein Schicksalsjahr Ägyptens, der zweite ägyptisch-israelische Krieg, wurde auch zu einem Schicksalseinschlag von Ibrahim Abouleish. Der 36jährige Ägypter wurde gebeten, einen Vortrag über Ägypten zu halten. Schon während des Vortrages ergab sich ein Blickkontakt zu einer älteren Dame, die spontan nach dem Vortrag auf ihn zukam und ihn fragte, ob er Rudolf Steiner kenne. In seinen Ausführungen hatte sie Elemente erlebt, die sie zu dieser Frage geführt hatten. Als er dies verneinte, lud sie ihn am gleichen Abend zu einem Gespräch ein. Und so lernte Ibrahim Abouleish die Musikpädagogin Johanna Werth kennen, die mit ihm einen pädagogischen Versuch unternahm. Sie drückte ihm ein Buch in die Hand und bat ihn, einige Seiten daraus vorzulesen; dann unterbrach sie ihn und forderte ihn auf, das eben Gelesene wiederzugeben. Das aber gelang ihm erst nach mehrmaligem Lesen; ein Schock für den sich auf der Spitze seiner Persönlichkeit fühlenden jungen Mann. Als er, nach einer freundlichen Einladung, wiederzukommen, die Türe hinter sich schloss, schwor er sich, dieses Haus nicht mehr zu betreten. Die folgende unruhige Nacht ließ ihn jedoch mit dem festen Entschluss erwachen, mehr von Johanna Werth über diesen Rudolf Steiner zu hören. Er griff kurzentschlossen zum Telefon, und es begann ein gründliches Studium der Anthroposophie und die Freundschaft mit dieser Frau. Diese Begegnung war Anlass für eine Neuordnung seines Lebens und seiner Lebensziele.
Zwei Jahre später wurde eine Reise nach Ägypten geplant. Johanna Werth wollte der jungen Familie Abouleish das alte Ägypten zeigen, Ibrahim Abouleish seiner Lehrerin das neue Ägypten. Diese Reise ließ ihn Ägypten mit neuen Augen sehen; die Armut, die Hoffnungslosigkeit, die Arbeitslosigkeit, die mangelnde Bildung, das Gefangensein im Dogma des geistlos gewordenen Islam sah er jetzt mit anderen Augen. Er begann zu begreifen, dass sein bisheriger Lebensweg nur Vorbereitung war für eine neue Aufgabe. Die Auseinandersetzung mit der mitteleuropäischen Kultur, das Kennenlernen der amerikanischen Lebensart und die Erarbeitung eines neuen Erkenntnisinstrumentes für Welt und Mensch bildeten die Voraussetzung für die Verwirklichung dieser sich in seiner Seele zur Idee gestaltenden Aufgabe.Für den Erlös der verkauften Patente und des Wohnhauses wurden zwei Wüstengrundstücke gekauft. Das eine in der Nähe der Stadt Bilbeis am Rande des Nildeltas ist die heutige SekemFarm. Das andere lag damals noch in der Wüste, ist aber jetzt Randbezirk von Kairo-Heliopolis. Die Stadtnähe wurde damals in weiser Voraussicht für das zukünftige Vertriebszentrum gewählt. Es war ein schwerer Anfang, unterstützt von Gudrun Abouleish und bald auch von Helmy und Mona und einer Gruppe von ägyptischen Mitarbeitern, Fellachen und Beduinen. All das, was heute an Wirtschaftsbetrieben, Kultureinrichtungen und sozialen Errungenschaften entstanden ist, stand vor fünfundzwanzig Jahren unmittelbar und ständig dem Pionier Ibrahim als Idee vor Augen.
Noch sind die Bäume klein, die Felder vorbereitet. Der Heilmittelbetrieb ATOS ist eines der ersten Gebäude von W. Reindl
28. Januar 1981
Ein Sekem-Schicksalstag
Auf einer Ägyptenreise im Januar 1981 wurden Elfriede Werner und Frieda Gögler in der Säulenhalle im Tempel von Karnak als Anthroposophen angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass in der Nähe von Kairo die Sekem-Initiative von Dr. Ibrahim Abouleish bestehe. Ibrahim Abouleish suche Landwirte, Pharmazeuten und Ärzte, die ihn bei der Verwirklichung seiner Vorstellungen von einer zeitgemäßen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgesellschaftsform unterstützen wollten. Die verschiedensten Gedanken schwirrten durch unsere Köpfe: Ein Ägypter und Anthroposophie? Anthroposophie in Ägypten verwirklichen, und das auf einer Farm in der Wüste? Lohnt sich das, da hinzugehen?
Aber Elfriede war so fasziniert, ja elektrisiert von dieser Idee, dass sie alle Hebel in Bewegung setzte, um diesen Besuch möglich zu machen. Alle sich auftürmenden Schwierigkeiten und Hindernisse konnten ihren unabdingbaren Willen, diese Initiative zu besuchen und den Initiator kennenzulernen, nicht beeinflussen. Und so standen wir am 26. Januar 1981 vor dem aus Lehm gebauten Rundhaus auf der Sekem-Farm und mit ausgebreiteten Armen trat Ibrahim Abouleish durch die Türe und sagte: »Ich wusste, dass Ihr kommt.« Der Anblick dieses Menschen war für Elfriede die Bestätigung für das, was sie in der Nacht vorher geträumt hatte, und so war es nur ein kleiner Schritt für uns beide, den Entschluss zu fassen, mitzuhelfen, diese Ideen in Ägypten zu verwirklichen.
So sind wir Sekemer geworden, haben eine gemeinsame Lebensaufgabe gefunden und wieder einmal erlebt, wie das Schicksal Bedingungen schafft, Menschen aber solche Bedingungen erkennen und Entschlüsse fassen müssen. Dadurch werden dann Voraussetzungen geschaffen, die Weiteres ermöglichen. Denn am Flughafen in Stuttgart begann sich schon der nächste Schicksalsknoten zu knüpfen, als uns unser Freund Eugen Kuch voller Neugierde über unser Erleben in Ägypten begrüßte und gleich sagte: »Do komm I morge zom Kaffee zu aich, do wois I ebber« – das war Angela Hoffmann, die dann als eine der ersten nach Sekem kam und nun ihr zwanzigjähriges Sekem-Jubiläum feiert.
Der von mir wenige Wochen nach der Rückkehr von Ägypten veröffentlichte Bericht über Sekem in »Das Goetheanum« knüpfte einen weiteren Sekem-Schicksalsfaden: Christoph Graf, Leiter einer Eurythmieschule in Dornach, hatte seine Kindheit in Ägypten verbracht. Auf seinen langjährigen Wunsch, in Ägypten eine Aufgabe zu finden, hatte er gerade verzichtet. Aber das Lesen des Berichtes zündete in ihm. Ein sofortiger Anruf bei uns war der Keim für die nun schon viele Jahre sich entwickelnde Eurythmiearbeit in Ägypten. Der Entschluss, nach einundzwanzig Jahren, eine Eurythmieakademie aufzubauen, ist ein weiteres Beispiel, wie Karma wirkt.
Wie notwendig für Sekem rechtes Viehzeug, das heißt , eine Mist- und Milch liefernde Kuhherde als Voraussetzung für eine gute Komposterzeugung waren, erkannte Frieda Gögler. Frieda und Elfriede konnten ein Jahr später mit Freude nach Sekem berichten, dass vierzig Allgäuer Kühe verschifft werden können. Die GLS-Bank hatte uns großügigerweise einen Kredit eingeräumt – wir mussten aber diesen Kredit nie zurückzahlen.
Im Dezember 1983 war es dann so weit, dass Elfriede mit unermüdlicher Tatkraft ihren »Verein zur Förderung kultureller Entwicklung in Ägypten e.V. Niefern«, gemeinsam mit anderen Gründungswilligen ins Leben rufen konnte. Dazu gehörte besonders Renate Raubald, die treu und unermüdlich bis heute als Schatzmeisterin wirkt und auch Helga Yan, anfangs Vorstandsmitglied. Sie hat bis jetzt mit großem Einsatz die ganze Schreibarbeit des Vereins erledigt und die Sekem-Reiseberichte und diese Jubiläumsbroschüre geschrieben. Prof. Dr. Klaus Fintelmann trat einige Jahre später als Vorstandsmitglied und pädagogischer Berater hinzu. Er hat mit die Grundlagen für die Pädagogik der SekemSchule geschaffen.
Das Rundhaus steht als erstes Gebäude. Die Bäume beginnen zu wachsen, der Boden ist schon vorbereitet
Ägyptenreise
14. 6. bis 4. 7. 1982
14. Juni1982
Tiefste Stille umgibt mich. Wenn nicht am Himmel die Flugzeuge fast ununterbrochen brummen würden, so gäbe es jetzt nur Natur um mich. Eine Lerche erhebt sich aus dem Hof des Wüstenhauses in die Höhe, nicht anders als auf den Feldern meines schwäbischen Heimatlandes. Tirilierend steigt sie immer höher und höher, bis sie sich wie ein Stein in die Tiefe fallen lässt: auf zum Lichte – hinunter in die Schwere. Über den Rand des Dachrundes lugen neugierige Spatzen, fremdartige Vögel überfliegen es kreischend. Im runden Blumenbeet mit Rosmarin, Rosen, üppigem Oleander, großblättrigem feinduftendem Jasmin, Kamille und anderem, zirpt eine Grille und quakt ein Frosch. Dieser Hausfrosch wird von Lussie, dem weißen Spitz, gehütet und nährt sich von Moskitos, die zum Glück nicht bei Tage, aber in der Nacht, Opfer suchend umherschwirren. »Ist dies alles anders als in Europa?« frage ich mich. »Ist der strahlend blaue Himmel, aus dem der Halbmond zartlächelnd zu mir herunterschaut, anders?«
Als wir gestern abend nach unserem Flug ahnungslos von Bord kamen, fiel uns Ayman Shaaban - unser ›Pflegesohn‹, der gerade vier Wochen bei uns in Deutschland gewesen war, um den Hals. Wir wurden in einen kleinen Bus gezerrt und vor den Augen der staunenden Mitreisenden in Eiltempo ›entführt‹. In einem ruhigen Zimmer bei Aircondition und Kaffeegenuss, sprachen wir mit Ayman, während die Formalitäten von einem freundlichen Regierungsbeamten für uns erledigt wurden. Das war das Werk von General Shaaban, Aymans Vater, das uns langes Warten im dumpf-dunstigen Umkreis des Flughafengebäudes ersparte. So lernten wir ein Stück Ägypten kennen: kein Zoll, keine Passkontrolle, nichts machten wir durch. Vor dem Flughafen fanden wir Gudrun, die unser Gepäck schon in ihrem Auto verstaut hatte. Nach einer stürmischen Begrüßung fuhr sie uns zum Bürohaus Sekem, am Rande von Kairo. Ein riesiger Platz, von einem ›Mauerzaun‹ umgeben, lag im Dunkel vor uns, teilweise von Lampen erhellt. Ein Platz für das kleine Bürohaus, für eine spätere Waldorfschule, für ein Hospital, alles schon für eine mögliche Zukunft vorbereitet. Nicht gerade langsam ging es danach durch die Wüste zur Farm. Zu nächtlicher Stunde noch eine Fahrt übers Gelände und Einzug ins Rundhaus.
15. Juni
Ich gehe durchs Haus und sitze nun im offenen Hof mit der Frage: »Wo finde ich Ägypten hier?« Ich öffne das Fenster und lasse den Blick über das Farmland schweifen: wüstensandiger Boden mit kargem Wuchs, die Molkerei und die Gebäude zur Heilmittelherstellung, in der Ferne die Ställe und in der Weite zur Linken Bäume, zur Rechten Wüste. Das ist ein Teil Ägyptens: beginnende Fruchtbarkeit, dem toten Wüstensand abgerungen. Leben und Tod so nahe beieinander. Meine Gedanken gehen zurück zum Alten Ägypten, wo ich auf meine Frage Antwort finde: Die alten Ägypter pflegten die Liebe zum Leben, aber in dieser Liebe zum Leben hatten sie den Blick auf den Tod gerichtet. Das war ägyptisches Dasein. So raunte es aus der Nacht in den Tag, der uns die erste Wiederbegegnung mit der Farm und seinen Menschen bringen soll.
Wir machen uns auf, um die Farm zu durchstreifen. Die Sonne brennt schon heiß. Viele Menschen treffen wir bei der Arbeit. Besonders eindrucksvoll ist die Wiederbegegnung mit Ali, dem Buckligen, der die Güte und Liebe der ganzen Welt ausstrahlt. Überall ist die Erde durchzogen von Wassergräben, in denen das kostbare Nass dahinfließt. Alle möglichen Stufen von Bodenverwandlungen sehen wir. Üppig ist der Wuchs nicht, wird doch auf dieser Farm, entgegen dem sonst Üblichen, kein Kunstdünger verwendet, sondern mühsam versucht, durch Naturdünger und biologisch-dynamische Methoden aus dem Sand einen fruchtbaren Boden zu schaffen. Wird das gelingen? – Oder müssen neue, ganz andere Methoden entwickelt werden? Alles hier ist Versuch. Dort der kräftig wachsende Bestand an Zitrusfruchtgewächsen, die in diesem Jahr zum ersten Mal Früchte tragen werden; hier Bananen, Stechapfel, Sesam. Daneben stehen Rosen, Sonnenblumen und immer wieder dazwischen Eukalyptusbäume und Kasuarinen als Schattenspender. Die Fabrik mit Produktionshallen und Lager ist ziemlich gewachsen, seit wir zum ersten Male hier waren. Eine Molkerei entsteht. Die ostwestliche Achse, die breite Straße, führt vorbei an den Taubenhäusern zur Rechten zum Stall. Dort angelangt, staunen wir, was in der Zwischenzeit entstanden ist. Der Stall ist zu einem großen Teil schon mit ägyptischen und allgäuischen Kühen und vielen neugeborenen Kälbern gefüllt.
Ein munteres Leben hat sich entwickelt. Die .Tiere werden von Martin aus Pforzheim, Karin aus Göppingen und Jörg aus Norddeutschland betreut. Angela ist zur Zeit noch in Deutschland. Bald wird Milch fließen und Käse reifen. Wir fühlen uns aufgenommen und leben alle Höhen und Tiefen des Alltags mit. Gudrun, Ibrahim, Mona und Alea, die Ägypterin, schaffen und wirken mit uns zusammen durch den Tag.
16. Juni
Wie eine Labsal breitet sich über die sengende Hitze des Tages die kühlende Nacht. Zwei Tage sind wir nun hier und es scheint schon eine Ewigkeit. Wenn unser Radius auch bisher auf die Farm beschränkt war, so gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Einen Kilometer lang ist der Weg quer durch die Farm bis zum Stall. Kälble sind wieder angekommen.
Martin Abrecht aus Pforzheim ist 25 Jahre alt und gelernter biologisch- dynamischer Landwirt. Es ist eine wahre Freude zu erleben, welche Ruhe und Sicherheit er ausstrahlt. Diese Aufgabe ist seine Aufgabe und er lebt ganz in ihr. Karin ist von Beruf Glasritzerin. Fähigkeiten für die Arbeit auf der Farm hat sie nicht mitgebracht. Sie scheint aber Begabungen bei sich entdeckt zu haben, denn sie hat Kochen gelernt, versorgt die anderen Stallbewohner und hilft da und dort mit. Der dritte ist Jörg; man hat den Eindruck, er fühlt sich eher in diese Gegend verschlagen; er wirkt etwas unstet und unglücklich, weiß aber zuzugreifen. Diese Drei sind derzeit die Sendboten aus Deutschland und ihnen gilt unser Besuch im Stall. Weil heute betoniert werden muss, wird Landwirt Martin zum Maurer. Wehe, wenn er den Blick einige Zeit abwendet, dann geschieht sicher etwas, was nicht geschehen soll.
Am Nachmittag machen wir einen Umweg über den südlichen Rand der Farm. Da bleibt mein Blick, über die Felder schweifend, an einem dicht-buschigen Gewächs in der Ferne haften. Näherbei schaut mich Hyoscyamus aus seinen starren Blütenaugen an und ich erlebe diese Pflanze wie wesenhaft und ihre Verwandtschaft mit Belladonna.
Ein herrlicher Sonnenuntergang mit ständig sich wandelnden Farben beschließt diesen Gang. Noch eine Stunde später glüht der Himmel, am Horizont sich im Purpurrot verströmend. Nach dem Abendbrot erwarten wir die drei ›Landwirte‹ zur Arbeit an der ›Philosophie der Freiheit‹. Das Beobachten des Denkens ist Thema und wir erleben, dass Menschen, die den Tag über intensiv an der Erde gearbeitet haben, sich mit einer inneren Frische der geistigen Arbeit hingeben. Mit den ›Kinderszenen‹ von Schumann gibt uns Elfriede die Brücke in die nächtliche Welt. Über uns erstrahlt der Sternenhimmel mit Jupiter, Saturn und Mars. Die Luft ist erfüllt vom Zirpen der Grillen, Quaken der Frösche und dem auf- und abschwellenden, zänkischen Gebell der Hunde.
17. Juni
Es fehlt an Heilmitteln. Wir wollen eine Calendula- und Kamillensalbe, sowie von beiden Heilpflanzen Tinkturen herstellen. — Martin steht oft verzweifelt vor der Frage, wie er seine Tiere behandeln soll, denn der ägyptische Tierarzt kann seine Wünsche nicht befriedigen und ist mit Antibiotika und anderen scharfen Mitteln schnell zur Hand.
Eindrucksvoll war heute eine Durchquerung des Niltals; über Hunderte von Kilometern fruchtbares Land; eine alte Fruchtbarkeit, die seit der Antike besteht. So alt wie die Kultivierung, so alt sind auch die Methoden. Wasserräder drehende Büffel, hackende Männer und Frauen, zum Trocknen aufgehäufter Mist, der dann als ›mineralischer‹ Dünger ausgestreut wird. Aber auch ›moderne‹ Methoden werden geübt: Frauen streuen Weizenähren auf die Straße, damit sie von den darüberfahrenden Autos gedroschen werden. Auch Traktoren sieht man. In Bilbeis, der Kreisstadt von Sekem, erleben wir andere ägyptisch-arabische Verhältnisse: Schmutz auf den Straßen und in den Gassen; wildes Gestikulieren und Geschrei von Männern und Frauen, eselantreibende und handelnde, lungernde und handwerkende Menschen. Alles ist überdröhnt vom Gehupe der sich immer wieder chaotisch verfilzenden Autos und arabesker Musik aus Radio und Fernseher. Es steigert sich zum Inferno und ebbt wieder ab; Welcher Kontrast zu den Weiten des Nildeltas mit altem Palmen- und Eukalyptusbaumbestand, verstreuten, wenn auch oft baufälligen Häusern und arbeitenden Menschen. Das Land ist durchzogen von Wasserkanälen, die je nach Bewässerungsstand voll oder trocken, die Fruchtbarkeit des Landes bedingen.
21. Juni
Eine viertägige ›Klausur‹ mit der Familie Shaaban ist beendet. Wir sind überwältigt von der ägyptischen Gastfreundschaft, die sich vor allem im fortwährenden Anbieten von Essen und Trinken auslebt. Man muss sich hüten, auch nur die Andeutung eines Wunsches von sich zu geben, weil sonst alles in Bewegung gesetzt wird, um diesen Wunsch des Gastes zu erfüllen.
Heute hat eine besondere Zeit für Ägypten und den gesamten Bereich des Islam begonnen — der Ramadan, die 28-tägige Fastenzeit. In dieser Zeit darf von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang nicht gegessen und getrunken werden. Dafür aber wird die Nacht zum Tage gemacht und das Entbehrte in mehrfacher Weise nachgeholt. So schwinden in dieser Zeit die Bäuche nicht, sondern nehmen eher an Umfang zu. Trotzdem wird diese Festeszeit sehr ernst genommen, die Arbeitszeit etwas verkürzt und tagsüber mehr geschlafen. Der Prophet hat diese Fastenzeit sicher nicht unter der Voraussetzung eingeführt, dass in der Nacht nachgeholt wird, was am Tage entbehrt werden muss.
23. Juni
Dieser Tag ist der erste wirkliche Farmtag, an dem Martin, lbrahim und ich über die verschiedenen Probleme sprechen. Eindrucksvoll ist, wie sich Martin mit der Farm identifiziert und schon nach sechs Wochen ganz in die Probleme eingelebt hat.
Wir besprechen die Frage der Bewirtschaftungsform: Soll vorübergehend Kunstdünger eingesetzt werden? Oder müssen alle noch nicht berücksichtigten Möglichkeiten der biologischen Bearbeitung vor einem solchen Schritt angegangen werden? Daraus ergeben sich Fragen zur Bodenform hier in Ägypten, Fragen, ob sich überhaupt Humus bilden kann, oder ob eine mineralische Düngung jährlich einfach notwendig ist, weil sich kein Humus bilden kann. Die Einrichtung der Käserei ist entscheidungsreif. Soll sie groß- zügig und automatisch arbeitend eingerichtet werden, um möglichst schnell Kapital in Fluss zu bringen oder soll mehr der Handarbeit und damit der Arbeit mit Menschen der Vorzug gegeben werden? Die Farm muss allmählich ein Einkommen haben, und so entscheiden wir uns, eine 5000 Liter Milchkapazität umfassende große Anlage einzurichten und die biologische Milch der Farm in Handarbeit zu Käse zu machen. Die Sprühtrocknung von Drogen in großem Maßstab muss noch etwas warten. Eine Begehung der Farm folgt – es ist in dieser Mittagszeit empfindlich heiß – die mit einem Besuch in der Stallwohnung bei einem kühlwarmen Trunk endet.
Allmählich träumt die im Abendlicht dämmernde Farm in die rasch einbrechende Nacht hinein. Elfriede und Mona geben uns ein Klavierkonzert, das in einer wunderbaren Akustik den Innenhof und das Rundhaus durchtönt.
24. Juni
Es ist Salbenkochtag. Mit viel Mühe haben wir Vaseline, Calendula- und Kamillenblüten bekommen. Nun fehlen noch die Töpfe, das Sieb, das Wasserbad, die Waage und der RührlöffeL Alles hat sich mit der Zeit, unter vielem Warten, eingestellt. Mona und ich hatten in dreistündiger Arbeit 120g Calendulablütenblätter von den vertrockneten Blütenkörbchen abgesammelt. Das Kochen der Vaseline kann also beginnen.
Der Abend beschert uns einen herrlichen Sonnenuntergang mit einem ruhigen Gespräch im Freien, einem Haydn-Kiavierkonzert und einer gemeinsamen geistigen Arbeit.
25. Juni
Der Beduine Mohammed Alian, einer der ersten Mitarbeiter der Farm, ist krank geworden. Er hatte damals auf dem Wüstenland, das jetzt Farm geworden ist, sein Zelt aufgeschlagen und trat Ibrahim mit den Worten gegenüber: »Ich bin dein Wächter!« Seither ist er der treueste Beduinen-Mitarbeiter auf der Farm. Nun hat ihn wohl der Ramadan seelisch und körperlich zerstört. Leibschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Verstopfung und allgemeines Schwächegefühl sind seine Klagen. Er lässt sich willig spritzen und sagt: »Die Spritze muss in den Bauch, da tut es mir weh.« Heute war er wieder da. Alle Schmerzen sind verschwunden.
26. Juni
Mona und ich rühren Kamillen- und Calendulasalbe. Danach stellen wir einen Ansatz von Calendula mit Alkohol her. Vormittag und Nachmittag füllen Gespräche über die Farm und deren Lebensprobleme den Tag vollends aus. Ibrahim und ich machen unseren täglichen Gang vor Sonnenuntergang diesmal zur Besichtigung der Tagetafelder. Die Blüten werden für die Farbstoffgewinnung verwendet. Daneben steht ein Feld mit Henna, dessen Blätter einen roten Farbstoff liefern. Die Farbstoffe werden für die Lebensmittelchemie gebraucht.
Zwei Wochen sind wir nun schon hier, und es scheint uns eine Ewigkeit zu sein. Wir haben in der Zwischenzeit mehr Einblick gewonnen in die großen Schwierigkeiten, die täglich zu bewältigen sind, aber auch in die Probleme, die langfristig das Leben hier schwer machen werden. Es ist ein langsam fortschreitender Aufbau, der sicherlich noch viel Einsatz, Geduld und Ausdauer brauchen wird, und für den die richtigen Menschen immer wieder gefunden werden müssen
28. Juni
Es wird immer heißer. Wenngleich wir uns an die Hitze gut gewöhnt haben, geht sie doch mit weniger Wachheit und geringerer Konzentrationsfähigkeit einher. Bei einer solchen Hitze kann tagsüber keine konzentrierte Arbeit geleistet werden. So erklärt sich auch, dass das Leben in diesen südlichen Ländern erst am Abend beginnt und bis in die Nacht hinein geht.