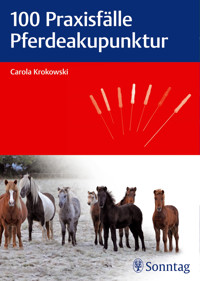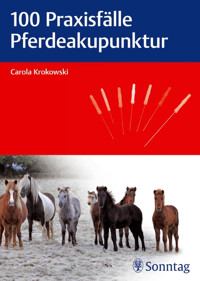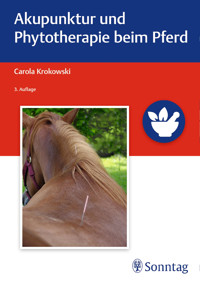
129,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sonntag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das bisher einzige Buch zur gesamten TCVM beim Pferd (Akupunktur und chinesische Phytotherapie). Als Standardwerk zur Akupunktur und Phytotherapie beim Pferd schlägt es die Brücke von der alten chinesischen Medizin bis in die moderne Praxis. So wird die traditionelle chinesische Veterinärmedizin für Sie greifbar und praktikabel: - Hintergrundwissen zur TCM - Anleitung zur chinesischen Diagnostik (inkl. Puls- und Zungendiagnostik) - Kapitel zu den Themen Wandlungsphasen und Balancemethoden - Akupunkturtechniken und Nadelanleitungen - zahlreiche chinesische Rezepturen aus der Phytotherapie - Erkrankungsteil gegliedert nach westlichen Indikationen, erläutert und therapiert aus Sicht der TCVM - Farbtafeln mit Lage, Wirkung und Indikation zu jedem Akupunkturpunkt - aussagekräftige Bebilderung, übersichtliche Tabellen - die gesamte Nomenklatur ist ins Deutsche übersetzt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Autorin
Carola Krokowski
1962 in Berlin geboren
Ärztin (Humanmedizinerin), 4 Söhne
Reitausbildung bei Fritz Tempelmann in Essen
Dressurerfolge bis zur Klasse S
Ausbildung Akupunktur und Phytotherapie (Societas Medicinae Sinensis, München/Hamburg)
1995 Gründung des Islandpferde-Gestüts Igelsburg
1995 Aufnahme der TCM Praxistätigkeit (Human)
1997 Fahrpraxis (TCVM) für Pferde, Katzen, Hunde und Heimtiere
seit 1999 Dozententätigkeit „Tierakupunktur“, Mitglied im Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker
seit 1998 Publikation von 14 Lehrtafeln und 8 Fachbüchern zur TCM/TCVM (Stand 4/2010)
2010 3D-Animations-Lehrfilm und Lehrbuch „Pulsdiagnose in der chinesischen Medizin“ im Igelsburg-Verlag
2010 3D-Animations-Lehrfilm „Pulsdiagnose in der chinesischen Tiermedizin“ im Igelsburg-Verlag
Carola Krokowski
Akupunktur und Phytotherapie beim Pferd
3., korrigierte Auflage
75 Abbildungen
206 Tabellen
Vorwort zur 1. Auflage
Neue Blickwinkel ermöglichen andere Einsichten.
Wenn es gelänge, die westliche Medizin mit der Traditionellen Chinesischen Medizin zu verbinden, wäre dies ein wegweisender Schritt zu einer erfolgreicheren, effektiveren Therapie. Hierzu hoffe ich mit diesem Buch einen Beitrag geleistet zu haben.
Die Zeit zum Schreiben hat mir meine liebe Mutter ermöglicht, indem sie mir jederzeit Pflichten abgenommen und meine vier lebhaften Kinder im Zaum gehalten hat. Dafür innigsten Dank!
Mein ganz besonderer Dank gilt außerdem Herrn Dr. Thomas Kafka, Münster, der maßgeblich an der Zusammenstellung der Rezepte beteiligt war und immer für Fragen und Anregungen zur Verfügung stand.
Habichtswald, November 2002Carola Krokowski
Vorwort zur 2. Auflage
Derjenige, der etwas zerbricht, um herauszufinden, was es ist, hat den Pfad der Weisheit verlassen.J.R.R. Tolkien
Das faszinierende an der Traditionellen Chinesischen Veterinärmedizin (abgekürzt TCVM) ist, dass wir mit minimal oder gar nicht invasiven Verfahren solch große Wirkungen herbeiführen können.
Wir brauchen ein Pferd nicht zu operieren, Stoffwechselvorgänge zu unterdrücken oder Synapsen zu blockieren, um zahlreiche Erkrankungen zu heilen. Vielmehr unterstützen wir den Körper, helfen ihm, Störfaktoren zu eliminieren und regulieren den natürlichen Energiefluss. Dabei können wir uns auf eine viele Tausend Jahre alte Weisheit verlassen, die zu Recht als Wissenschaft bezeichnet wird.
Sinclair Lewis hat gesagt: „Die Wissenschaft ist die systematische Klassifizierung der Erfahrung.”
Umfangreiche eigene Erfahrungen haben zur Überarbeitung des Buches, besonders des Kapitels Phytotherapie, geführt. Dabei sind die in der ersten Auflage beschriebenen chinesischen Rezepturen selbstverständlich weiterhin korrekt, in den letzten Jahren haben sich aber besonders die neu aufgenommenen Rezepturen bei den jeweiligen Krankheiten bewährt.
Mein besonderer Dank gilt Agnes Fatrai, die durch ständige Literaturrecherche und Übersetzung der chinesischen Veterinärliteratur den Grundstein für immer neue Anregungen legt. Außerdem danke ich meinem Mann, Klaus Ohneberg, für die immer vorhandene positive Energie, die meine Arbeit erst möglich macht.
Habichtswald, Mai 2010Carola Krokowski
Dieses Buch widme ich meinem geliebten Vater
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Ernst Krokowski.
Du warst ein überragender, mitfühlender Arzt, ein herausragender Wissenschaftler, ein faszinierender Mensch und ein liebevoller Vater. Carola
Gewidmet außerdem allen Skeptikern, die ich mit Erfolgen überzeugen konnte.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der 1. Auflage
Vorwort der 2. Auflage
Teil I Geschichte der Akupunktur und Entwicklung der Veterinärakupunktur
1 Geschichte der Akupunktur und Entwicklung der Veterinärakupunktur
Teil II Gedankenansätze der Schulmedizin und der Traditionellen Chinesischen Medizin im Vergleich
2 Kausalitäts- und Synchronizitätsprinzip
3 Die vier Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin
4 Diagnosefindung
5 Terminologie der Traditionellen Chinesischen Medizin
Teil III Begriffe in der Traditionellen Chinesischen Medizin
6 Die Leitbahnen
7 Qi
8 Xue
9 Schleim (pituita)
10 Die acht Leitkriterien
10.1 Yin und yang
10.1.1 Zeichen einer yin-Erkrankung
10.1.2 Zeichen einer yang-Erkrankung
10.2 Schwäche/Leere und Fülle (depletio und repletio)
10.3 Das Innere und die Oberfläche (intima und extima)
10.4 Kälte und Hitze (algor und calor)
11 Krankheitsauslösende Faktoren
11.1 Die sechs klimatischen Exzesse (äußere Störfaktoren)
11.1.1 Wind (ventus)
11.1.2 Kälte (algor)
11.1.3 Feuchtigkeit (humor)
11.1.4 Drückende Sommerhitze (aestus)
11.1.5 Trockenheit (ariditas)
11.1.6 Glut (ardor)
11.2 Die sieben Emotionen
11.2.1 Die einzelnen Emotionen
11.2.2 Die Emotionsgruppen
Teil IV Funktionskreise und Wandlungsphasen
12 Die Funktionskreise
13 Die fünf Wandlungsphasen
13.1 Die Wandlungsphase Holz
13.1.1 Leberfunktionskreis (orbis hepaticus)
13.1.2 Gallenblasenfunktionskreis (orbis felleus)
13.2 Die Wandlungsphase Feuer
13.2.1 Herzfunktionskreis (orbis cardialis)
13.2.2 Dünndarmfunktionskreis (orbis intestini tenuis)
13.2.3 Herzbeutelfunktionskreis (orbis pericardialis)
13.2.4 Funktionskreis 3Erwärmer (orbis tricalorii)
13.3 Die Wandlungsphase Erde
13.3.1 Milz-Pankreas-Funktionskreis (orbis lienalis)
13.3.2 Magenfunktionskreis (orbis stomachi)
13.4 Die Wandlungsphase Metall
13.4.1 Lungenfunktionskreis (orbis pulmonalis)
13.4.2 Dickdarmfunktionskreis (orbis intestini crassi)
13.5 Die Wandlungsphase Wasser
13.5.1 Nierenfunktionskreis (orbis renalis)
13.5.2 Blasenfunktionskreis (orbis vesicalis)
13.6 Die Nebenfunktionskreise oder außerordentliche Funktionskreise (paraorbes)
13.6.1 Außerordentlicher Funktionskreis Gehirn (paraorbis cerebri)
13.6.2 Außerordentlicher Funktionskreis Mark (paraorbis medullae)
13.6.3 Außerordentlicher Funktionskreis Knochen (paraorbis ossum)
13.6.4 Außerordentlicher Funktionskreis Gefäße (paraorbis sinarteriarum)
13.6.5 Außerordentlicher Funktionskreis Uterus (paraorbis uteri)
13.6.6 Außerordentlicher Funktionskreis Gallenblase (paraorbis felleus)
13.7 Die acht unpaarigen Leitbahnen
13.7.1 Das Konzeptionsgefäß (sinarteria respondens)
13.7.2 Das Lenkergefäß (sinarteria regens)
13.7.3 Der yin qiao mai (sinarteria ascendens yin)
13.7.4 Der yang qiao mai (sinarteria ascendens yang)
13.7.5 Der yin wei mai (sinarteria retinens yin)
13.7.6 Der yang wei mai (sinarteria retinens yang)
13.7.7 Der chong mai (sinarteria impedimentalis)
13.7.8 Das Gürtelgefäß (sinarteria zonalis)
Teil V Die chinesische Diagnose
14 Vorüberlegungen zur Erstellung einer chinesischen Diagnose
15 Diagnostische Verfahren
15.1 Befragung
15.1.1 Akute Auffälligkeiten
15.1.2 Allgemeines Verhalten, Leistungsbereitschaft
15.1.3 Schweißneigung
15.1.4 Frühere Erkrankungen
15.1.5 Schulmedizinische Diagnose, erfolgte Behandlung, Medikamente
15.1.6 Fressverhalten, Fütterung
15.1.7 Verdauung
15.1.8 Durst
15.1.9 Haltungsbedingungen
15.1.10 Rangordnung innerhalb der Herde
15.1.11 Reitweise, Belastung, Training
15.2 Betrachtung
15.2.1 Fell
15.2.2 Augen
15.2.3 Austrahlung (shen)
15.2.4 Ernährungszustand
15.2.5 Hufe
15.2.6 Verletzungen
15.2.7 Aufgescheuerte Stellen
15.3 Tasten
15.3.1 Pulsdiagnostik
15.3.2 RAC
15.3.3 Zungendiagnostik
15.3.4 Untersuchung der Zustimmungs- und Alarmpunkte
15.4 Extremitätentemperatur
15.5 Hören und Riechen
16 Wie wird eine chinesische Diagnose erstellt?
Teil VI Die Akupunkturpunkte
17 Einteilung der Akupunkturpunkte
17.1 Die Antiken Punkte (fünf Induktorien, foramina quinque inductoria)
17.1.1 Brunnenpunkte (foramina putealia)
17.1.2 Bachpunkte oder Punkte des Ausgießens (foramina effusoria)
17.1.3 Flusspunkte oder Punkte des besonderen Einflusses (foramina inductoria der Induktorien)
17.1.4 Strompunkte oder Durchgangspunkte (foramina transitoria)
17.1.5 Meerpunkte oder Vereinigungspunkte (foramina coniunctoria)
17.2 Akupunkturpunkte mit spezieller Qualifikation
17.2.1 Quellpunkte oder Ursprungs-qi-Punkte (foramina qi originalia)
17.2.2 Anknüpfungspunkte, Verbindungspunkte, Luo-Punkte oder Passagepunkte (foramina nexoria)
17.2.3 Spaltpunkte (foramina rimica)
17.2.4 Meisterpunkte oder Zusammenkunftspunkte (foramina conventoria)
17.2.5 Zustimmungspunkte, shu-Punkte oder Einflusspunkte des Rückens (foramina inductoria dorsalia)
17.2.6 Alarmpunkte oder mu-Punkte (foramina conquisitoria abdominalia)
17.2.7 Verbindungspunkte oder Kreuzungspunkte (foramina copulo-conventoria)
17.2.8 Einschaltpunkte, Öffnungspunkte oder Kardinalpunkte
18 Beschreibung der Akupunkturpunkte
19 Wind (ventus) und die Behandlung von Windstörungen
19.1 Wind als exogener Störfaktor (ventus externus)
19.2 Innerer Wind (ventus internus)
19.3 Herausragende Akupunkturpunkte zur Behandlung von Wind (ventus)
Teil VII Die chinesische Phytotherapie
20 Die acht therapeutischen Verfahren
20.1 Erzielung von Schweiß (sudatio)
20.2 Auswerfen (vomitio et expectoratio)
20.3 Abführen (purgatio)
20.4 Harmonisierung des Energieflusses (compositio)
20.5 Erwärmung (tepefactio)
20.6 Erfrischung, Kühlung (refrigeratio)
20.7 Ergänzung, Zuführung von Energie (suppletio)
20.8 Ableitung und Zerstreuung (dispulsio und diffusio)
21 Eigenschaften chinesischer Therapeutika
21.1 Temperaturverhalten
21.2 Geschmack (sapor)
21.3 Wirktendenz
21.4 Funktionskreisbezug
21.5 Toxizität
21.6 Synergismus und Inkompatibilität
Teil VIII Akupunktur und Phytotherapie bei speziellen Erkrankungen
22 Allgemeinerkrankungen
22.1 Rezidivierende Infektionen, Abwehrschwäche
22.1.1 Basisakupunkturpunkte
22.1.2 Chinesische Ursachen
22.1.3 Kräuterrezepturen
22.2 Leistungsabfall
22.2.1 Basisakupunkturpunkte
22.2.2 Chinesische Ursachen
22.2.3 Kräuterrezepturen
22.3 Leistungsabfall bei Sportpferden
22.3.1 Basisakupunkturpunkte
22.3.2 Kräuterrezepturen
22.4 Überbeanspruchung
22.4.1 Basisakupunkturpunkte
22.4.2 Kräuterrezepturen
22.5 Fieber
22.5.1 Basisakupunkturpunkte
22.5.2 Chinesische Ursachen
22.5.3 Kräuterrezepturen
23 Augenerkrankungen
23.1.1 Basisakupunkturpunkte
23.1.2 Chinesische Ursachen
23.1.3 Kräuterrezepturen
24 Ohrerkrankungen
24.1.1 Basisakupunkturpunkte
24.2 Akute Otitis
24.2.1 Chinesische Ursachen und Therapie
24.3 Chronische Otitis
24.3.1 Chinesische Ursachen und Therapie
25 Hauterkrankungen
25.1.1 Basisakupunkturpunkte
25.1.2 Chinesische Ursachen und Therapie
25.2 Ekzeme, Mauke und Dermatophilose, Urtikaria
25.2.1 Ekzeme
25.2.2 Mauke und Dermatophilose
25.2.3 Urtikaria
25.2.4 Akupunkturpunkte
25.3 Hautmykosen
25.3.1 Akupunkturpunkte
25.3.2 Chinesische Ursachen
25.3.3 Kräuterrezepturen
26 Atemwegserkrankungen
26.1.1 Basisakupunkturpunkte
26.1.2 Chinesische Ursachen und Therapie
26.1.3 Chinesische Differenzialdiagnosen
26.2 Rhinitis und Sinusitis
26.2.1 Basisakupunkturpunkte
26.2.2 Chinesische Ursachen und Therapie
27 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
27.1.1 Basisakupunkturpunkte
27.1.2 Chinesische Ursachen und Therapie
28 Harnwegserkrankungen
28.1.1 Basisakupunkturpunkte
28.1.2 Chinesische Ursachen und Therapie
29 Erkrankungen der Geschlechtsorgane
29.1 Störungen der Rosse
29.1.1 Basisakupunkturpunkte
29.1.2 Kräuterrezepturen
29.1.3 Chinesische Ursachen und Therapie
29.2 Entzündliche Erkrankungen der Geschlechtsorgane
29.2.1 Basisakupunkturpunkte
29.2.2 Chinesische Ursachen und Therapie
29.3 Plazentaretention
29.3.1 Chinesische Ursachen und Therapie
29.4 Deckunlust bei Hengsten
29.4.1 Chinesische Ursachen und Therapie
29.5 Störungen nach Kastration
29.5.1 Basisakupunkturpunkte
29.5.2 Chinesische Ursachen und Therapie
30 Erkrankungen des Verdauungsapparates
30.1.1 Basisakupunkturpunkte
30.1.2 Chinesische Ursachen und Therapie
30.2 Obstipation
30.2.1 Chinesische Ursachen und Therapie
30.3 Diarrhö
30.3.1 Chinesische Ursachen und Therapie
30.4 Kolik
30.4.1 Chinesische Ursachen und Therapie
31 Erkrankungen des Bewegungsapparates
31.1.1 Chinesische Ursachen
31.1.2 Basisakupunkturpunkte
31.1.3 Kräuterrezepturen
32 ZNS-Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten
32.1 Ataxien
32.1.1 Chinesische Ursachen
32.1.2 Akupunkturpunkte
32.1.3 Kräuterrezepturen
32.2 Unruhe, Nervosität, Schreckhaftigkeit
32.2.1 Chinesische Ursachen
32.2.2 Akupunkturpunkte
32.2.3 Kräuterrezepturen
32.3 Koppen, Weben
32.3.1 Chinesische Ursachen
32.3.2 Akupunkturpunkte
32.3.3 Kräuterrezepturen
32.4 Head Shaking
32.4.1 Chinesische Ursachen
32.4.2 Akupunkturpunkte
32.4.3 Kräuterrezepturen
Teil IX Akupunkturtechniken
33 Nadelakupunktur
33.1 Stichtechnik
33.2 Nadelverweildauer
33.3 Bewegen der Nadeln
33.3.1 Heben und Senken
33.3.2 Drehen und Wirbeln
33.4 Entfernen der Nadeln
34 Laserakupunktur
35 Moxibustion
Teil X Techniken zur Unterstützung der Akupunktur
36 Akupressur
37 Magnetfeldtherapie
Teil XI Anhang
38 Weiterführende Literatur
39 Sachverzeichnis
Teil I Geschichte der Akupunktur und Entwicklung der Veterinärakupunktur
1 Geschichte der Akupunktur und Entwicklung der Veterinärakupunktur
1 Geschichte der Akupunktur und Entwicklung der Veterinärakupunktur
Über den Ursprung der Akupunktur gibt es unterschiedliche Angaben, möglicherweise liegen die Anfänge 4000 bis 6000 Jahre zurück. Zu dieser Zeit wurden vermutlich Steinnadeln, Bambussplitter und später Bronzenadeln für die Akupunktur eingesetzt. Die Veterinärakupunktur entstand in enger Verknüpfung mit der Humanakupunktur. Erste konkrete Angaben bei Tieren stammen von dem Reitergeneral Sun Yang 900 v. Chr. Er soll als Tierarzt Akupunktur und Moxibustion beim Pferd angewandt haben. Behandelt wurden zur damaligen Zeit lediglich Tiere, die einen besonderen Nutzen für den Menschen darstellten: Pferde, die im Kriegseinsatz von besonderer Bedeutung waren; Rinder, insbesondere Wasserbüffel, die landwirtschaftliche Arbeiten verrichteten sowie Schweine und Geflügel, da diese Tiere unter ernährungsenergetischen Gesichtspunkten besonders wichtig waren.
In der Zeit zwischen dem 2. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr. (Chin- und Han-Dynastie) entstand eines der maßgeblichen Werke der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der „Innere Klassiker des gelben Kaisers“ (Huang die Neijing). Er gibt die Dialoge des „gelben Kaisers“ Huang Di mit seinem Leibarzt Chi Po wieder. Dieses Werk wurde über die Jahrhunderte ergänzt und erweitert. Beschrieben werden die theoretischen Grundlagen der TCM. Auch finden sich Angaben zur Anatomie, Physiologie und Pathologie. Es werden die Diagnoseerstellung und die Therapiemöglichkeiten sowie die Leitbahnverläufe mit zunächst 160 Akupunkturpunkten beschrieben, ebenso verschiedene Nadeltechniken. Der „Innere Klassiker des gelben Kaisers“ gilt somit als Grundlage für die Traditionelle Chinesische Medizin im Humanbereich und in der Veterinärmedizin.
Aus der gleichen Zeit sind auch Holztafeln erhalten mit Rezepturen für die tiermedizinische Behandlung, Anleitungen für die Akupunktur bei Pferden und Darstellungen von Soldaten, die ihre Pferde mit Pfeilspitzen nadeln, um sie für eine Schlacht zu stimulieren bzw. zu stärken.
Von China aus verbreiteten sich Kenntnisse der Veterinärakupunktur auch nach Indien, Griechenland und darüber hinaus. Aus Ceylon ist ein etwa 1500 Jahre altes Buch mit Abbildungen von Tier- und Humanakupunktur bekannt, aus Indien gibt es Darstellungen von der Akupunktur bei Streitelefanten. In der Min-Dynastie (1368–1644 n. Chr.) dokumentierten die Brüder Yu Ben-Yuan und Yu Ben-Heng über einen Zeitraum von ca. 60 Jahren die Pulsdiagnose sowie den Verlauf der Leitbahnen und die Lokalisation der Akupunkturpunkte beim Pferd.
Teil II Gedankenansätze der Schulmedizin und der Traditionellen Chinesischen Medizin im Vergleich
2 Kausalitäts- und Synchronizitätsprinzip
3 Die vier Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin
4 Diagnosefindung
5 Terminologie der Traditionellen Chinesischen Medizin
2 Kausalitäts- und Synchronizitätsprinzip
Unser westliches Denken im Allgemeinen und die Schulmedizin im Besonderen sind geprägt vom Kausalitätsprinzip. Die kausalanalytische Medizin sucht für jede Erkrankung eine Ursache. Eine kausale Abfolge von Erkrankungszusammenhängen wird aufgezeigt, wobei die Ursache in der Vergangenheit liegt. Ein Lebewesen oder ein Problem (Krankheit) wird isoliert von seinem Kontext (Umwelt, Beruf, privates/soziales Umfeld; beim Pferd Aufzucht, Haltung, Fütterung, Belastung) betrachtet. Gesucht wird eine Eindeutigkeit; Widersprüche werden nach dem Entweder-Oder-Prinzip aufgelöst. Im Fokus steht der Befund.
In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist eine Erkrankung erklärt bzw. eine Diagnose gestellt, wenn die für die Erkrankung entscheidenden Beziehungen und Agenzien im dynamischen Krankheitsgeschehen beschrieben sind. Aufgezeigt werden also die induktiven Zusammenhänge, die Erkrankung wird unter Berücksichtigung des Ganzen gesehen. Im Denken und Wahrnehmen nach dem Synchronizitätsprinzip werden Sachverhalte in hohem Maße im Kontext, also zusammen mit den komplexen Beziehungen zwischen Lebewesen und der Umwelt betrachtet. Scheinbare Widersprüche in der kausalen Abfolge und nicht eindeutige Befunde – also schulmedizinisch unklare Situationen – stellen keine Probleme dar. So ist ein allein nach der TCM arbeitender Arzt überzeugt, den Ansatz für eine Diagnose gefunden zu haben, wenn er alle zur Erklärung einer bestimmten Erscheinung – Befindlichkeitsstörung oder Krankheit – notwendigen Beziehungen definiert hat. Gesetzmäßigkeiten werden im größtmöglichen Zusammenhang betrachtet. Im Fokus steht das Befinden.
Die TCM beruht auf der ganzheitlichen, übergreifenden Betrachtungsweise von synchron ablaufenden vernetzten Beziehungen. Auch in der Physik gewinnt diese Sicht der Dinge zunehmend an Bedeutung.
Selbst die klassische Physik mit der Quanten- und Relativitätstheorie rückt deutlich von dem Newton’schen Denkansatz ab, der streng von der kausalen Natur physikalischer Gegebenheiten ausgeht. So zeigt die Heisenberg’sche Unschärferelation (Man kann nicht gleichzeitig den Aufenthaltsort und den Impuls eines Teilchens genau bestimmen.), dass es keinen unabhängigen Beobachter gibt.
„Die Welt erscheint in dieser Weise als ein kompliziertes Gewebe von Vorgängen, in dem sehr verschiedenartige Verknüpfungen sich abwechseln, sich überschneiden und zusammenwirken und in dieser Weise schließlich die Struktur das ganze Gewebe bestimmt. “ (Dieses Zitat stammt von Werner Heisenberg und nicht aus der TCM!)
Auch in der Bootstrat-Hypothese von Geoffrey F. Chew wird das Universum als dynamisches Gewebe zusammenhängender Vorgänge gesehen. Dabei ergeben sich die Eigenschaften eines Teilchens aus den Eigenschaften der anderen Teilchen. Je tiefer man also in die moderne Physik – bis hin zu den subatomaren Teilchen – vordringt, umso mehr erscheint das Universum als grundsätzliche Einheit. Die Bestandteile der Materie und die Grundphänomene hängen zusammen, sind voneinander abhängig und stehen in vielfältiger Beziehung zueinander.
„Kausaler und akausaler Denkansatz sind Polaritäten, sich ergänzende Perspektiven der Wirklichkeit und können nicht aufeinander zurückgeführt, sondern nur miteinander verbunden werden. “ (Toni Fischer, Zeitschrift Chinesische Medizin 1999; 2)
3 Die vier Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin
Die Traditionelle Chinesische Medizin, wie sie für den Humanbereich entwickelt wurde, basiert auf vier Säulen:
Der Akupunktur mit Nadel oder Laser, einschließlich der Moxibustion.
Der Phytotherapie. Sie beinhaltet die Behandlung mit chinesischen pflanzlichen, tierischen und mineralischen Arzneimitteln. Von diesen Arzneimitteln sind die energetischen Wirkungen und Wirkmechanismen genau beschrieben, die biochemische Struktur ist von untergeordneter Bedeutung und wird erst in jüngster Zeit analysiert. Die Phytotherapie kann eine sehr sinnvolle und zum Teil notwendige Ergänzung zur Akupunktur darstellen.
Der Diätetik. Unter Diätetik versteht man die Lehre von den Nahrungsmitteln, ihrer Aufnahme und ihrer speziellen Wirkung, besonders unter energetischen Gesichtspunkten.
Dem qi gong. Es stellt eine spezielle Bewegungs- und Ruheübungslehre dar, bei dem der körpereigene Energiefluss, das qi, gespürt, gestärkt und speziell gelenkt werden soll.
Die Akupunktur und die Phytotherapie stellen im Gesamtzusammenhang der TCM den therapeutischen Anteil dar, die Diätetik und das qi gong haben mehr prophylaktische Funktion.
Für die Behandlung von Pferden sind jedoch nur die Akupunktur und die Phytotherapie von Bedeutung. Die Diätetik lässt sich aufgrund des schmalen Nahrungsspektrums von Pferden nur wenig nutzen.
Qi gong hat zum Ziel, den eigenen Energiefluss zu spüren und willentlich, bewusst zu steuern, d. h., es wird ein Bewusstsein, eine Reflexionsmöglichkeit und ein Verständnis der verbalen Anleitung dazu vorausgesetzt: „Die Energie folgt der Vorstellungskraft.“ Alle Arten von Gymnastik, Dehnübungen, Massagen etc. stellen im klassischen Sinn kein qi gong dar. Mit geschickten Übungen oder gutem Reiten kann der Energiefluss zwar angeregt werden, das Pferd steuert jedoch nicht willentlich seine Energie. Unter Berücksichtigung der Grundgedanken der gesamten TCM soll in diesem Buch daher im Wesentlichen auf die Akupunktur und die Phytotherapie eingegangen werden.
4 Diagnosefindung
Die Traditionelle Chinesische Medizin ist eine Erfahrungsmedizin, die sich über mehrere tausend Jahre entwickelt hat. Zu unserer kausalanalytischen, westlichen Schulmedizin bildet sie die ideale Ergänzung. Die Grundgedanken sollten sein:
Kooperation statt Konkurrenz
Kompetenz im Bereich der Schulmedizin und TCM statt Konfrontation zwischen Schulmedizin und TCM
Die ganzheitliche Betrachtung und Behandlung eines Lebewesens (Tier oder Mensch, Interaktion zwischen Mensch und Tier) muss sowohl die energetische Ebene – das qi, den ungestörten Energiefluss – als auch die stoffliche, körperliche, messbare Ebene beachten und behandeln.
Das Schlüsselwort in der westlichen Veterinärmedizin ist die Messbarkeit. Sie ist Grundlage der kausalanalytischen westlichen Schulmedizin. Für ein Tier wird organbezogen ein Befund erhoben, zahlreiche messbare Daten werden erfasst. Der Befund wird ermittelt, nicht das Befinden festgestellt! In der westlichen Medizin wird eine organbezogene Diagnose erstellt. Bestehen mehrere, verschiedenartige Störungen, werden organbezogen verschiedene Therapien durchgeführt, die keine Verknüpfung miteinander haben. So werden z. B. rezidivierende Augenerkrankungen, Störungen der Rosse und angelaufene Beine schulmedizinisch separat bewertet, chinesisch aber als einheitliche Störung des xue-Flusses angesehen.
Können keine pathologisch veränderten Messdaten gefunden werden – Röntgenbild, EKG, Ultraschall etc. ohne Befund, Laborwerte unauffällig – fehlt der Schulmedizin der Ansatz für eine Diagnose und somit für eine Therapie. Somit können Befindlichkeitsstörungen, also sogenannte funktionelle Beschwerden, wie Leistungsmangel, Erschöpfungszustände, rezidivierende Infektionen, Unruhe, Nervosität, unklare Lahmheiten, Verspannungen etc., schulmedizinisch oft nicht ausreichend erklärt und behandelt werden.
In der chinesischen Medizin werden Befinden und krank machende Faktoren bestimmt und in das System der Funktionskreise und acht Leitkriterien eingeordnet. Dementsprechend kann auch bei solchen Störungen oder Erkrankungen effektiv therapiert werden.
5 Terminologie der Traditionellen Chinesischen Medizin
Im deutschsprachigen Raum findet man zum einen die lateinische Terminologie (besonders von Porkert eingeführt) und zum anderen die deutsche Begriffsübersetzung. Obwohl die deutschen Begriffe bei uns geläufiger sind, bietet die Anwendung der lateinischen Terminologie gewisse Vorteile:
Erklärt man Pferdebesitzern oder nicht mit der TCM vertrauten Tierärzten/Therapeuten eine chinesische Diagnose und die daraus folgende Therapie, so vermeidet die Verwendung der lateinischen Terminologie nicht zuletzt durch die Bezeichnung „orbis“ (= Kreis) falsche Assoziationen. Der orbis hepaticus (Funktionskreis [FK] Leber) beinhaltet in der TCM weit mehr als nur das Organ Leber. Eine Lahmheit aufgrund einer energetischen Störung im orbis hepaticus (FK Leber) hat also nichts mit einer Leberfunktionseinschränkung im schulmedizinischen Sinn zu tun. Durch die Verwendung der weitreichenden lateinischen Begriffe gewöhnen sich zudem in der TCM weiterzubildende Tierärzte/Therapeuten leichter an das weit gefasste chinesische Denken und falsche Assoziationen entstehen erst gar nicht. Da aber die deutsche Terminologie wesentlich häufiger gebraucht und auch so unterrichtet wird, findet sich in diesem Buch die deutsche Terminologie und in Ergänzung häufig die lateinische.
lateinisch
Abkürzung
deutsch
Abkürzung
englisch
Abkürzung
orbis hepaticus
H
FK Leber
Le
liver
Liv/Lv
orbis felleus
F
FK Gallenblase
GB
gallbladder
GB
orbis cardialis
C
FK Herz
He
heart
He
orbis intestini tenuis
IT
FK Dünndarm
Dü
small intestine
Si
orbis pericardialis
PC
FK Perikard
PC
pericardium
Pe
orbis tricalorii
T
FK 3Erwärmer
3E
triple warmer
TW/SJ
orbis lienalis
L
FK Milz-Pankreas
MP
spleen
SP
orbis stomachi
S
FK Magen
Ma
stomach
St
orbis pulmonalis
P
FK Lunge
Lu
lung
Lu
orbis intestini crassi
IC
FK Dickdarm
Di
large intestine
Li
orbis renalis
R
FK Niere
Ni
kidney
Ki
orbis vesicalis
V
FK Blase
Bl
urinary bladder
UB/BL
sinarteria respondens
RS
Konzeptionsgefäß
Kg
conceptional vessel
Ren
sinarteria regens
RG
Lenkergefäß
Lg
governing vessel
Du
Teil III Begriffe in der Traditionellen Chinesischen Medizin
6 Die Leitbahnen
7 Qi
8 Xue
9 Schleim (pituita)
10 Die acht Leitkriterien
10.1 Yin und yang
10.2 Schwäche/Leere und Fülle (depletio und repletio)
10.3 Das Innere und die Oberfläche (intima und extima)
10.4 Kälte und Hitze (algor und calor)
11 Krankheitsauslösende Faktoren
11.1 Die sechs klimatischen Exzesse (äußere Störfaktoren)
11.2 Die sieben Emotionen
6 Die Leitbahnen
Unter dem Begriff Leitbahn (häufig wird auch der Begriff Meridian verwendet, dieser Begriff stammt aber ursprünglich aus einem anderen Kontext) versteht man eine Struktur, in der sich die körpereigene Energie, das qi, bewegt. Der lateinische Begriff sinarteria bedeutet so viel wie chinesische Arterie, ein anatomisches Korrelat für diese energieführenden Strukturen findet man jedoch nicht.
Das Leitbahnsystem gliedert sich in:
12 Hauptleitbahnen (sinarteriae cardinales)
8 unpaarige Leitbahnen (sinarteriae impaares)
12 Muskelleitbahnen (sinarteriae nervocardinales)
15 Netzleitbahnen (sinarteriae reticulares)
Verzweigungen der Netzleitbahnen und Hauptleitbahnen (sinarteriae parareticulares und sinarteriae reticulares paroulae)
Hautregionen (cutes regiones)
Im Leitbahnsystem haben nur die zwölf Hauptleitbahnen und zwei der unpaarigen Leitbahnen eigene Akupunkturpunkte.
Die Hauptleitbahnen stellen das Grundgerüst des Leitbahnsystems dar und jede Hauptleitbahn ist einem Funktionskreis zugeordnet.
Für die acht unpaarigen Leitbahnen gilt ein anderes System, sie sind nicht den Funktionskreisen zugeordnet und sechs (der acht) unpaarigen Leitbahnen haben keine eigenen Akupunkturpunkte.
Die Muskelleitbahnen entspringen jeweils am Brunnenpunkt (foramen puteale) und ziehen zur Muskulatur oder in den Kopfbereich.
Die Netzleitbahnen entspringen jeweils am Verknüpfungspunkt (foramen nexorium) und ziehen zum Quellpunkt (foramen qi originale, Ur-qi-Punkt) der gekoppelten Leitbahn.
Die kleinen Verzweigungen sichern die energetische Vernetzung des gesamten Körpers.
Bei der Darstellung der Hauptleitbahnen muss man beachten, dass dies nur die Darstellung der wichtigsten und oberflächlich verlaufenden Leitbahnen ist (vergleichbar mit Autobahnen). Umfangreiche Vernetzungen und tiefe Leitbahnwege sind notwendig, um alle Bereiche, Strukturen und Organe des Körpers zu erreichen (vergleichbar mit Bundes- und Landstraßen bis zu kleinen Feldwegen).
7 Qi
Die gängigste Übersetzung des Begriffes qi ist Energie. Mit dieser Übersetzung wird man der Bedeutungsvielfalt des Wortes jedoch nicht gerecht. So kann qi auch verstanden werden als die bewegende Kraft des Kosmos oder auch als die gegenwärtige Manifestation des Lebens. Alle Lebensformen sind Ausdruck des unterschiedlichen qi, die Körperstrukturen sind materielle Erscheinungsformen, der Geist (shen) stellt die immaterielle Erscheinungsform dar. Das qi hat yang-Charakter (im Gegensatz zu xue).
Das chinesische Schriftzeichen für qi setzt sich zusammen aus den Zeichen für Dunst oder Dampf und dem Zeichen für (vier) Reiskörner. Bildlich wurde das qi oft als der Dampf über einem kochenden Reistopf dargestellt.
Im engeren chinesisch-medizinischen Zusammenhang versteht man unter qi die individualspezifische aktive Energie, die Antriebskraft aller physiologischen Abläufe.
Zur weiteren Spezifizierung wird das qi eingeteilt in:
Physiologisches (orthopathisches) qi:
gleichmäßig fortgeleitetes, in physiologischer Richtung fließendes qi.
Pathologisches (heteropathisches) qi:
schräg laufendes qi, führt zu Blockierungen im Energiefluss.
Gegenläufiges (kontravektives) qi (qi contravectivum):
typische Beschwerden bei Kontravektionen sind Aufstoßen, Erbrechen oder Husten.
Angeborenes qi (qi nativum, xian tian zhi qi):
angeborene Konstitution, kann nur möglichst lange verfügbar gehalten und nicht (oder kaum) aufgefüllt werden.
Ursprüngliches qi (qi primum, yuan qi):
struktiver (= stofflicher) Teil des angeborenen qi.
Ursprungs-qi (qi originale, yuan qi):
aktiver Teil des angeborenen qi.
Gesamtheit der erworbene Energie (qi ascitum, hou tian zhi qi):
Gesamtheit der erworbene Energie oder Konstitution, momentane körperliche Verfassung.
Bauenergie (qi constructivum, ying qi):
hat einen struktiven yin-Aspekt im Gegensatz zum wei qi, der Wehrenergie, die einen aktiven yang-Aspekt enthält; wird in FK Milz-Pankreas, FK Magen und FK Leber gebildet.
Da Ursprungs-qi (qi originale) und ursprüngliches qi (qi primum) die pinyin-Umschrift yuan qi haben, werden sie oft als gleichbedeutend verstanden und in der Literatur häufig die Gesamtheit der angeborenen Energie xian tian zhi qi, das Ursprungs-qi yuan qi und das ursprüngliche qi yuan qi zusammengefasst. Dies ist jedoch falsch, da das Ursprungs-qi und das ursprüngliche qi unterschiedliche chinesische Zeichen und somit eine unterschiedliche Bedeutung haben.
Wehrenergie (qi defensivum, wei qi):
wei qi westlich: Immunsystem; wird vor allem im FK Lunge gebildet und von ihm aus verteilt. Bewegt sich auch außerhalb von definierten Leitbahnen durch den ganzen Körper und gelangt bis an die Körperoberfläche.
Nahrungs-qi (qi frumentarium, gu qi):
über die Nahrung neu gewonnene Energie.
Atmungs-qi (qi magnum, da qi):
über die Atmung aufgenommene Energie.
Kosmisches qi (qi caeleste, tian qi):
kosmische Energie.
Thorax-qi (qi genuinum, zong qi):
angeborene Anlage zu rhythmischen Bewegungen, besonders deutlich im Atemrhythmus. Das Thorax-qi wird im Brustraum (oberen Calorium) gesammelt.
Wahres qi (qi merum, zhen qi):
Gesamtheit der verfügbaren physiologischen Energie.
Leitbahn-qi (qi cardinale, jing qi):
Energie, die in den Leitbahnen fließt.
Störungen des qi können sein:
Schwäche (depletio):
qi-Schwäche, z. B. allgemeine Schwäche, Abwehrschwäche, Erkrankung oder Einschränkung von Organleistungen
Fülle (repletio):
Ansammlung von pathologischem qi, eingedrungene Störfaktoren
stagnierendes qi:
qi-Stau, z. B. Schmerzen, Spannungsgefühl, qi-Blockaden
Kontravektionen:
gegenläufiges qi, z. B. Erbrechen, Übelkeit, Reflux, Husten
Beachte: Wo qi fließt, fließt auch xue – qi zieht xue hinter sich her. Das qi kann mit der Lok eines Zuges verglichen werden, xue ist dabei der Kohlenwagen. Das qi ist der Antrieb, braucht aber xue (die Kohlen) zum Fahren.
8 Xue
Unter xue versteht man den stofflichen Energieträger eines Individuums. Es hat somit yin-Charakter. Die Übersetzung Blut ist richtig, aber nicht weitreichend genug. Xue stellt das stoffliche Gegenstück zum qi dar, die individualspezifische struktive Energie. Xue wird im mittleren Calorium, d. h., besonders im FK Milz-Pankreas, FK Magen und FK Leber aus Nahrungsenergie gebildet. Das xue ernährt und befeuchtet den Körper.
Störungen des xue können sein:
Schwäche (depletio): Schwäche von xue oder Mangel an xue, z. B. Anämie (dabei besteht meist eine blasse Zunge)
xue-Stase: ungenügender oder aufgehobener Fluss von xue (Durchblutungsstörungen), z. B. Tumoren, stechende Schmerzen (dabei besteht meist eine zyanotische Zunge)
Hitze des xue (calor xue): z. B. Blutungen, Nasenbluten, Spannungsgefühle (Zunge ist dabei meist scharlachrot)
Vom xue kann man die Körpersäfte, jinye, unterscheiden. Da die Trennung von xue und jinye keinen therapeutischen Nutzen bringt, werden in diesem Buch alle Körpersäfte (Sekrete, Lymphflüssigkeit und natürlich das Blut) unter dem Begriff xue zusammengefasst.
9 Schleim (pituita)
Pituita (tan) wird mit Schleim übersetzt und entsteht im Allgemeinen aus einer Schwäche im FK Milz-Pankreas bzw. aus eingestauter Feuchtigkeit (humor). Man kann substanzlosen Schleim von stubstanzhaftem Schleim (produktiver Husten oder Sekret in den Nüstern) unterscheiden.
Substanzloser Schleim kann sich manifestieren:
in der Haut: subkutane Knoten, Lymphknotenschwellungen,
in den Leitbahnen: unspezifische Bewegungs- oder Sensibilitätsstörungen, Schwindel,
im shen: Verhaltensauffälligkeiten.
Substanzhafter Schleim kann sich manifestieren
in den Atemwegen als Auswurf,
aus Körperöffnungen.
Weiterhin kann Schleim eingeteilt werden in:
heißen Schleim: gelb, zäh, schwer löslich,
kalten Schleim: hell, leicht löslich, dünnflüssig.
Typisch für Schleim ist ein schlüpfriger oder saitenförmiger Puls.
Der wichtigste Akupunkturpunkt zur Behandlung von Schleim ist sicherlich der Ma40 (S40). Bei einer längeren Ausgleitung von Schleim muss auf eine ausreichende Befeuchtung geachtet werden (MP4 [L4], MP6 [L6], MP10 [L10]). Erkrankungen mit Schleim bedürfen im Allgemeinen einer längeren Therapie.
10 Die acht Leitkriterien
Zu den acht Leitkriterien gehören vier Paare polarer Qualität:
yin
yang
Beschreibung der energetischen Polaritäten
Schwäche/Leere (depletio)
Fülle (repletio)
Beschreibung des Energiepotenzials
Inneres (intima)
Oberfläche (extima)
Beschreibung der Eindringtiefe
Kälte (algor)
Wärme (calor)
Beschreibung der Funktionsdynamik
Häufig treten bei Krankheitsgeschehen folgende Kombinationen auf:
Schwäche/Leere (depletio), Krankheitsgeschehen im Inneren bzw. an den inneren Organen (intima), Kälte (algor): Dies ergibt eine typische yin-Erkrankung.
Fülle (repletio), Erkrankung in der Oberfläche (extima) und Hitze (calor): Dies ergibt eine typische yang-Erkrankung.
Bei der Erstellung einer chinesischen Diagnose ist der erste Schritt die Zuordnung der Symptome, Beschwerden und Daten zu den acht Leitkriterien.
10.1 Yin und yang
Yin und yang sind die primären Begriffe für eine Grundprämisse des chinesischen Denkens, der Polarität aller Dinge und Wirkungen und ermöglicht die Beschreibung der polaren Relation zueinander. Die mit yin und yang beschriebenen entgegengesetzten natürlichen Phänomene schließen sich gleichzeitig aus und bedingen sich.
Beachte: Ohne Oben kein Unten, ohne Wärme keine Kälte etc.
Ursprünglich wurde mit yin und yang die sonnenbeschienene und die schattige Seite eines Berges bezeichnet. Für yin und yang besteht eine Abhängigkeit, und nur beide Polaritäten zusammen ergeben das Ganze.
Man sagt, das yang muss im yin verankert sein. Bei zu schwachem yin wird das yang nicht „gehalten“ und reagiert überschießend.
Beachte: Yang hat eine Wurzel im yin, yin die Seine im yang, ohne yin kann yang nicht entstehen, ohne yang kann yin nicht geboren werden.
Yin und yang sind unterscheidbar und gegensätzlich aber nicht trennbar. Im Hinblick auf die Gesundheit eines Lebewesens ist ein dynamisches Gleichgewicht von yin und yang anzustreben.
yin
yang
im Hinblick auf die Leitkriterien
Innen (intima)
Außen (extima)
Eindringtiefe
Kälte (algor)
Wärme (calor)
Funktionsdynamik
energetische Schwäche/Leere (depletio)
Fülle (repletio)
Energiepotenzial
Metall und Wasser
Feuer und Holz
Funktionskreise
Speicherorgane (zang)
Hohlorgane (fu)
Organzuordnung allgemein: Funktionskreis heißt lateinisch orbis – chinesisch zangfu
Herbst und Winter, die Nacht Mittag bis Mitternacht
Frühling und Sommer, der Tag Mitternacht bis Mittag
zeitliche Prozesse
Bauch das Innere das Untere
Rücken das Äußere das Obere
anatomische bzw. räumliche Beschreibungen
Passivität Beginnendes Ruhendes Bestätigendes Befestigendes Erstarrendes Verdichtendes Absinkendes
Aktivität Vollendendes Bewegendes Auslösendes Verwandelndes Veränderndes sich Entfaltendes Aufsteigendes
Kräfte
Organisierendes zentripetal reponsiv
Auflösendes/Zerstreuendes zentrifugal aggressiv
Kräfte
Bauenergie struktive Stoffe Trübes xue Weiches unterhalb des Zwerchfells
Wehrenergie aktive Säfte Klares qi Hartes oberhalb des Zwerchfells
medizinische (TCM-)Aspekte
Feuchtigkeit Regen Kälte Wasser weiblich Süßes, Scharfes das Dunkle Erde und Mond
Trockenheit Wind Wärme Feuer männlich Saures, Bitteres das Helle Sonne und Himmel
Natur
Krankheiten stellen somit ein Ungleichgewicht dar, wobei folgende Krankheitsmechanismen unterschieden werden:
Absolute und relative yang-Fülle können ein ähnliches Bild ergeben. Auf den ersten Blick fällt auf, dass mehr yang als yin vorhanden ist. Würde man jedoch bei relativer yang-Fülle das yang absenken statt yin aufzufüllen, hätte man zwar wieder ein Gleichgewicht herbeigeführt, jedoch auf einem deutlich niedrigeren Energieniveau. Bei einem therapierten Pferd stellt sich in diesem Fall eine deutliche Besserung ein, die Krankheitszeichen verschwinden, das Pferd findet aber nicht zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurück.
10.1.1 Zeichen einer yin-Erkrankung
Meist chronischer Verlauf, das Innere und die inneren Organe sind oft betroffen. Oft kombiniert mit Kälte (algor) und Schwäche/Leere (depletio). Im Allgemeinen ist eine längere Therapie notwendig, gegebenenfalls kann die Moxibustion sinnvoll sein. Typisch für eine yin-Erkrankung (mit Schwäche/Leere) ist, dass sich Schmerzen bei Druck bessern.
10.1.2 Zeichen einer yang-Erkrankung
Akutes, rasches Auftreten, betroffen ist zunächst die Oberfläche, meist liegt Hitze (calor) und eine Fülle (repletio) vor. Schmerzen verstärken sich durch Druck.
Yin und yang gehören immer zusammen. Eine Schwäche von yin führt zu überschießendem, unkontrolliertem yang mit der Tendenz zum Auflösenden, eine Schwäche von yang führt zur Erstarrung. Eine vollständige Trennung von yin und yang bedeutet den Tod.
10.2 Schwäche/Leere und Fülle (depletio und repletio)
Unter einer Schwäche/Leere (depletio, xu) versteht man die Abnahme bzw. Erschöpfung der Energie in einem oder mehreren Funktionskreisen oder aber die Schwäche, Kraftlosigkeit des Gesamtorganismus. Um eine Aussage über verminderte Kraft bzw. Energie oder Anfälligkeit treffen zu können, wird die Orthopathie, also die Geradläufigkeit der Lebensfunktionen bzw. der physiologische Energiefluss, herangezogen.
Als Fülle (repletio, shi) wird ein übermäßiger Füllzustand, ein unkontrolliertes, überschießendes Ausbreiten verstanden. Eine Fülle ist immer mit einer Heteropathie, einer Schrägläufigkeit der Energie, verbunden und stellt in jedem Fall eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der Leistungsfähigkeit dar.
Therapiert wird die Schwäche/Leere mit einer Suppletion, d. h., Stärkung, Auffüllung, Wiederherstellung des physiologischen Energiepegels. Die Fülle wird mit Dispulsion, d. h., Ableitung, Zerstreuung, Auflösung heteropathischer Energien therapiert.
10.3 Das Innere und die Oberfläche (intima und extima)
Mit extima (biao) wird die Oberfläche, die Haut, das Außenliegende und das direkt Zugängliche bezeichnet und mit intima (li) das Innere und auch die inneren Organe. Somit werden Aussagen über die Eindringtiefe möglich. Schädigende Einflüsse wie z. B. Wind, Hitze, Trockenheit, Kälte treffen zunächst auf die Oberfläche. Typische Symptome sind leichtes Fieber, Gliederschmerzen, Erkältungszeichen, dünner Zungenbelag. Bei längerem Bestehen können Erkrankungen bis zum Inneren, den inneren Organen, vordringen (z. B. Pneumonie). Typische Symptome sind hohes Fieber, fester Zungenbelag, Brust- oder Abdominalbeschwerden. Primäre Erkrankungen der intima werden meist durch Emotionen ausgelöst, können jedoch auch umgekehrt zur Oberfläche dringen (z.B. Abszesse bei einer im Inneren festsitzenden Hitze, paraneoplastische Syndrome).
Extrem aggressive Krankheitsauslöser können so schnell von der Oberfläche nach innen gelangen, dass die oberflächliche Erkrankung gar nicht wahrgenommen wird.
10.4 Kälte und Hitze (algor und calor)
Kälte (algor, han) und Hitze (calor, re) bezeichnen nicht nur pathologische Veränderungen der Körpertemperatur, sondern sie geben auch über die Dynamik der Lebensprozesse, die Aktivität und Schnelligkeit von Stoffwechselvorgängen Auskunft. Kälte weist auf verminderte Aktivität, Verlangsamung von Vorgängen, Hemmungen und Erstarrungen hin, während Hitze auf eine Beschleunigung der Vorgänge und Aktivitätssteigerung deutet.
Typische Kältezeichen: Ruhebedürfnis, geschlossene Augen, Zungenbelag ohne Befund oder weißlich, dünn. Die Zunge ist blass oder zartrosa, die Pulse sind im Allgemeinen tief, langsam, schwach. Es besteht eher Durchfall und wenig bis kein Durst.
Typische Hitzezeichen: Unruhe, Augen weit geöffnet, Zungenbelag dick, gelb, Zungenkörper rot; die Pulse sind oberflächlich, beschleunigt und es besteht eher eine Obstipation sowie starker Durst.
11 Krankheitsauslösende Faktoren
11.1 Die sechs klimatischen Exzesse (äußere Störfaktoren)
11.1.1 Wind (ventus)
Bei Wind (ventus, feng) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Holz. Wind kann mit allen anderen Faktoren kombiniert und als äußere Ursache krankheitsauslösend sein. Allerdings gibt es auch Wind, der von innen ausgeht (ventus internus) und der durch Emotionen oder Hitze (calor) im FK Leber erzeugt wird.
Typische Windzeichen: Die Beschwerden sind springend, haben wandernden Charakter, sind flüchtig, treten auf und verschwinden wieder. Typischerweise ist der Puls chordal (= saitenförmig, gespannt) und es findet sich eine deutliche Reaktion bei Gb20. Häufig tritt Fieber mit Wärmebedürfnis, leichter Husten oder Hauterkrankungen auf.
11.1.2 Kälte (algor)
Bei Kälte (algor, han) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Wasser.
Typische Kältezeichen: Häufig besteht Fieber mit Kältegefühl, kalten Extremitäten, aufgestelltem Fell, hochgezogenem Rücken und vermehrter Feuchtigkeit auf der Zunge. Bei Kälte, die bis ins Innere vorgedrungen ist, kommt es zu Durchfall und Schmerzen im Rückenbereich und an den Extremitäten.
11.1.3 Feuchtigkeit (humor)
Bei Feuchtigkeit (humor, shi) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Erde. Feuchtigkeit tritt bevorzugt auf bei Überlastung, Störung oder Schwächung des FK Milz-Pankreas und des FK Magen. Sie kann durch Emotionen ausgelöst und durch starke Nässeeinwirkung von außen provoziert werden. Feuchtigkeit ist oft mit Hitze (calor), Wind (ventus) oder gelegentlich Kälte (algor) kombiniert.
Typische Feuchtigkeitszeichen: Leistungsschwäche, angelaufene Beine, teigige Gewebekonsistenz, Verdauungsstörungen, aufgedunsene Zunge.
11.1.4 Drückende Sommerhitze (aestus)
Bei drückender Sommerhitze (aestus, shu) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Feuer. Meist steht Fieber, starker Durst, rote Zunge, aber auch Durchfall oder starkes Schwitzen im Vordergrund. Ein Hitzeschlag kann vorliegen. Häufig sind der FK Herz, der FK Dickdarm, der FK Dünndarm und der FK Perikard gestört.
Typische Zeichen einer drückenden Sommerhitze: Unruhe, Nervosität, hohes Fieber, Schocksymptomatik, Durst.
11.1.5 Trockenheit (ariditas)
Bei Trockenheit (ariditas, zao) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Metall. Oft ist der FK Lunge betroffen, da dieser Funktionskreis auch für die Verteilung der Säfte zuständig ist und empfindlich gegen Trockenheit reagiert.
Typische Trockenheitszeichen: Symptome einer „kühlen Trockenheit“ sind trockener Husten, verstopfte Nase/Nüster, rissige Nüster trockene Zunge, die unter Umständen einen hellen, weißen Belag aufweist. Anzeichen für eine „warme Trockenheit“ sind heftiger Husten, eventuell mit eitrigem Auswurf, trockene Nase/Nüster, rissige Nüster und trockene Zunge mit gelbem Belag. Häufig findet sich ein trockenes, schuppiges, sprödes Fell.
11.1.6 Glut (ardor)
Bei Glut (ardor, huo) besteht ein starker Bezug zur Wandlungsphase Feuer.
Typische Glutzeichen: Typisch sind extreme, sich schnell entwickelnde, zum Teil lebensgefährliche Erkrankungen, starke Verminderung der Säfte und ausgeprägte energetische Schwächung mit hohem Fieber, Unruhe, dunkelroter Zunge, oft mit dickem gelben Belag. Der Puls ist beschleunigt.
11.2 Die sieben Emotionen
In der Humanmedizin werden sieben Emotionen als übersteigerte, krank machende Gefühlsregungen unterschieden. Zunächst werden diese sieben Emotionen einzeln beschrieben, damit die Übertragung auf das Pferd und die Einteilung in drei Emotionsgruppen verständlich wird.
11.2.1 Die einzelnen Emotionen
Lust (voluptas)
Lust (voluptas, xi) ist der Wandlungsphase Feuer zugeordnet. Sie hat einen engen Bezug zum FK Herz. Übermäßige Lust führt zu einer Schwächung des Herz-qi.
Erregung (ira)
Die Erregung (ira, nu) ist der Wandlungsphase Holz zugeordnet. Sie hat einen engen Bezug zum FK Leber und FK Gallenblase. Ein Füllezustand (repletio) im FK Leber führt häufig zu Erregung, gesteigerter Aggressivität und Wutausbrüchen, dies wiederum beeinflusst das Leber-qi (negativer Kreislauf).
Sorge (solicitudo)
Die Sorge (solicitudo, you) ist den Wandlungsphasen Metall und Erde zugeordnet. Durch sorgenvolles Nachdenken werden der FK Lunge und der FK Milz-Pankreas energetisch beeinträchtigt.
Grübeln (cogitation)
Das Grübeln (cogitation, si) ist der Wandlungsphase Erde zugeordnet. Vermehrtes Grübeln führt zur Schädigung des FK Milz-Pankreas mit Müdigkeit, Verdauungsstörungen und Ruhebedürfnis.
Trauer (maeror)
Die Trauer (maeror, bei) ist der Wandlungsphase Metall zugeordnet. Sie wirkt besonders auf den FK Lunge, sekundär auch auf den FK Milz-Pankreas.
Furcht (timor)
Die Furcht (timor, kong) ist der Wandlungsphase Wasser zugeordnet. Furcht vor erwarteten, vermuteten Gefahren wird begünstigt durch eine Schwäche im FK Niere oder FK Herz. Dauerhafte Furcht kann aber auch zu einer Schwächung dieser Funktionskreise führen.
Schreck (pavor)
Der Schreck (pavor, jing) ist den Wandlungsphasen Feuer und Wasser zugeordnet. Er ist die plötzliche Reaktion auf eine echte Situation, Sache oder vermeintlich gefährliche Begebenheit. Dabei ist die Reaktion unangemessen. Schreckhaftigkeit beruht meist auf einer Schwäche im FK Herz und FK Niere, umgekehrt können Schreckerlebnisse diese beiden Funktionskreise schädigen.
11.2.2 Die Emotionsgruppen
Bei Pferden ist es sinnvoll, die Emotionen in drei Gruppen aufzuteilen:
A
Aktivitätssteigerung ohne Fluchttendenz
voluptas ira
Lust Zorn, Erregung, Aggressivität
FK Herz FK Leber
B
Leistungsschwäche Aktivitätsverminderung
solicitudo cogitatio maeror
Sorge Grübeln Trauer
FK Lunge FK Milz-Pankreas FK Lunge
C
Aktivitätssteigerung mit Fluchttendenz
timor pavor
Furcht Schrecken
FK Niere/FK Herz FK Herz/FK Niere
Gruppe A
Lust und Zorn, Erregung führen zunächst zu einer Aktivitätssteigerung, auch Unruhe, eventuell mit Aggressivität verbunden. Im Gegensatz zur Gruppe C liegt jedoch keine Fluchttendenz vor. Erst nach einer länger bestehenden Störung kommt es zur Schwächung oder zum Verbrauch des qi, besonders in FK Herz und FK Leber, insbesondere wenn es durch Emotionen zu einem inneren Wind (ventus internus) kommt.
Gruppe B
Sorge, Grübeln und Trauer gehören zur zweiten Gruppe von Emotionen beim Pferd. Diese führen zu Aktivitätsminderung, Abgeschlagenheit, Leistungsschwäche, vermehrtem Ruhebedürfnis, Teilnahmslosigkeit, und sind oft verbunden mit Erkrankungen der Atemwege und Husten. Zu beobachten ist häufig ein stumpfes Fell. Der FK Lunge und FK Milz-Pankreas werden geschwächt oder geschädigt und damit auch das wei qi, die Abwehrkraft. In der Folge kann es zu vermehrten Infekten, Abwehrschwäche und Husten kommen. Relativ häufig treten diese Symptome nach einem Stallwechsel, Besitzerwechsel oder bei schlechten Haltungsbedingungen auf.
Gruppe C
Furcht und Schrecken, Schreckhaftigkeit ergeben eine Aktivitätssteigerung mit Fluchtreaktion. Meist liegt eine Schwäche des FK Niere oder des FK Herz vor, woraus sich die übersteigerten Emotionen ergeben.
Haltungs- und Belastungsfehler, Verletzungen, schlechte Haltungsbedingungen und auch die daraus resultierenden Emotionen können verschiedenste energetische Störungen zur Folge haben:
Nässe und Kälte wirken zunächst negativ auf den FK Lunge, den FK Niere und den FK Blase.
Schlechte Futterqualität und Mangelernährung wirken zunächst negativ auf FK Milz-Pankreas, FK Dickdarm und FK Dünndarm sowie FK Magen, also auf die Verdauungsfunktionskreise.
Ungenügender Kontakt zu anderen Pferden und Stallwechsel (siehe Emotionengruppe B) wirken zunächst auf den FK Milz-Pankreas und FK Lunge, eventuell auch auf den FK Herz.
Ungenügende oder fehlende Bewegung, falsches Reiten sowie Überbelastung wirken zunächst schädigend auf den FK Leber, den FK Gallenblase und den FK Niere.
Verletzungen können den qi-Fluss blockieren. Diese Blockaden können auch nach Abheilung der primären Verletzung bestehen bleiben (Störfelder).
Teil IV Funktionskreise und Wandlungsphasen
12 Die Funktionskreise
13 Die fünf Wandlungsphasen
13.1 Die Wandlungsphase Holz
13.2 Die Wandlungsphase Feuer
13.3 Die Wandlungsphase Erde
13.4 Die Wandlungsphase Metall
13.5 Die Wandlungsphase Wasser
13.6 Die Nebenfunktionskreise oder außerordentliche Funktionskreise (paraorbes)
13.7 Die acht unpaarigen Leitbahnen
12 Die Funktionskreise
Die Funktionskreise werden im Buch teilweise mit „FK“ abgekürzt.
Unter Berücksichtigung der Polarität unterscheidet man bei den Funktionskreisen yin- und yang-Funktionskreise.
Den Funktionskreisen und hierbei speziell den yin-Funktionskreisen sind neben den einzelnen Organen besonders auch Funktionen, Charaktereigenschaften, eine Gewebeart, bestimmte Empfindlichkeiten, eine Farbe etc. zugeordnet. Die Funktionen und Zuordnungen für die yang-Funktionskreise ergeben sich in Verbindung mit den komplementären yin-Funktionskreisen. Jeweils einem yin-Funktionskreis ist ein yang-Funktionskreis zugeordnet.
Beachte: Die yin-Funktionskreise speichern und sind voll, die yang-Funktionskreise assimilieren, befördern und sind aufgefüllt (ohne je voll zu sein).
13 Die fünf Wandlungsphasen
Die fünf Wandlungsphasen (wu xing) stellen ein Denkmodell dar, in dem die dynamischen Kräfte in einem Lebewesen und auch in der Natur in ihrer physiologischen Abfolge oder ihren pathologischen Entgleisungen dargestellt werden. Die häufig gebrauchte Übersetzung als „fünf Elemente“ impliziert ein festgelegtes Verhalten, fixierte Eigenschaften und stellt somit eine starre Definition dar. Daher ist diese Übersetzung nicht zutreffend.
Jeder der fünf Wandlungsphasen (oder Elemente) – Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser – werden Eigenschaften und Funktionen zugeordnet. Jede Wandlungsphase steht als Sinnbild für die zugeordneten Eigenschaften, Funktionen und Abläufe. Zur Veranschaulichung der Eigenschaften und Verknüpfungen der Wandlungsphase dienen verschiedene Merksprüche, z. B.:
Wasser befeuchtet nach unten, Feuer schlägt nach oben, Holz kann gebogen und gerade gerichtet werden, Metall kann geformt werden und erhärtet, die Erde erlaubt das Säen, Wachsen und Ernten.
Die verschiedenen Zuordnungen zu den Wandlungsphasen korrespondieren mit denen für die entsprechenden Funktionskreise. Der Begriff Wandlungsphase ist jedoch umfassender und beinhaltet noch mehr allgemeine Aspekte.
Die Wandlungsphasen werden meist als kreisförmiger Regulationsmechanismus dargestellt. Der erste Zyklus wird als Reihenfolge der Hervorbringung, Weiterleitung oder Induktionskreis (sheng-Zyklus) bezeichnet und basiert auf der gegenseitigen Stützung und Hervorbringung (Mutter-Kind-Regel).
Merkspruch:
Wasser lässt Holz wachsen, Holz nährt das Feuer, Feuer hinterlässt Asche (Erde), Erde beherbergt Metall, mit Metall (Schaufeln) kann man Brunnen graben.
Die vorgeschaltete Wandlungsphase ist immer die Mutter der folgenden Wandlungsphase. Also:
Holz ist Mutter des Feuers, Feuer ist Mutter der Erde, Erde ist Mutter des Metalls, Metall ist Mutter des Wassers und Wasser ist Mutter des Holzes.
Somit ist jede Wandlungsphase Mutter und Kind gleichermaßen und jede Wandlungsphase ist auch gleichzeitig Großmutter und Enkelkind. Die Mutter stützt die folgende Wandlungsphase, also ihr Kind und das Kind zieht von der Mutter Energie ab.
Der zweite Zyklus wird als Reihenfolge der Bändigung oder Inhibition oder Kontrolle (ke-Zyklus) bezeichnet. Merkspruch:
Wasser löscht Feuer, Feuer schmilzt Metall, Metall (Axt) fällt Holz, Erde stoppt (oder verschüttet) Wasser, Holz (mit den Wurzeln) durchdringt Erde.
Dabei übt eine Wandlungsphase auf die übernächste – also den Enkel – eine Bändigung, Hemmung oder Kontrolle aus. „Die Großmutter zügelt den Enkel.“ Diese Kontrolle ist notwendig und physiologisch. Hervorbringung und Bändigung sollen in einem dynamischen Gleichgewicht sein, dann ist ein Lebewesen gesund.
Wenn sich diese Kontrolle in eine Überkontrolle oder pathologische Hemmung verstärkt ist, spricht man von dem cheng-Zyklus oder Invasion.
Es kann auch zu einer Umkehr der Kontrolle kommen, die entspricht der Reihenfolge der Überwältigung (wu-Zyklus) oder Revolte.
Energetische Störungen können über alle Zyklen die Wandlungsphasen beeinträchtigen. Eingedrungene Störfaktoren können sich in dem Kreislauf der Wandlungsphasen fortsetzen und von der betroffenen Wandlungsphase ausgehend die folgende (das Kind) oder die dahinterliegende (die Mutter) stören.
Bei einer energetischen Schwäche/Leere (depletio) kann die Wandlungsphase ihr Kind – also die folgende Wandlungsphase – nicht ausreichend stützen. Außerdem zieht die Wandlungsphase von ihrer Mutter – also der vorangehenden Wandlungsphase – zu viel Energie ab.
Erkrankungen, die sich über die Reihenfolge der Hervorbringung, Weiterleitung oder Induktionskreis ausbreiten, sind leichter zu therapieren.
Eine energetische Fülle (repletio) kann sich auch über den Kontrollzyklus ausbreiten. Wenn der Kontroll- oder Bändigungszyklus zu stark wird, nennt man dies Überkontrolle (cheng-Zyklus). Eine häufige Störung ist z. B.: „Der FK Leber greift die Mitte an.“ Erkrankungen, die sich über die Reihenfolge der Überkontrolle (cheng-Zyklus) ausbreiten, sind schwerer zu therapieren.
Bei einer Umkehr vom Bändigungs- bzw. Kontrollzyklus übernimmt „der Enkel Kontrolle über die Großmutter“. Wenn es z. B. zu einer Fülle (repletio) im FK Leber kommt, kann der FK Leber den FK Lunge schädigen, „das Enkelkind beherrscht seine Großmutter“.
Eine energetische Störung kann aber auch alle drei pathologischen Wege nutzen und so erreicht eine Störung in einer Wandlungsphase alle anderen Wandlungsphasen. Auch wenn eine Störung in einer Wandlungsphase – wie eben erklärt – häufig auf andere Wandlungsphasen übergreift, ist es dennoch meist sinnvoll, zunächst die primär gestörte Wandlungsphase zu behandeln.
Zu einer Wandlungsphase gehören zwei Funktionskreise (mit Ausnahme der Wandlungsphase Feuer, der vier Funktionskreise zugeordnet sind). Für die therapeutischen Überlegungen sind aber meist die yin-Funktionskreise maßgeblich. Weitergreifende therapeutische Überlegungen schließen die Therapie über Mutterpunkte, Großmutterpunkte oder Sohnpunkte mit ein.
Zur Bestimmung der jeweiligen Punkte ist die Kenntnis der antiken Punkte mit der Wandlungsphasen-Zuordnung zu Akupunkturpunkten notwendig. Eine einfache Behandlungsstrategie ist es, den gestörten Funktionskreis über den Wandlungsphasen-Punkt und den Zustimmungspunkt, eventuell zusätzlich noch mit dem Quellpunkt zu behandeln.
Der Wandlungsphasen-Punkt ist der Akupunkturpunkt auf einer Leitbahn, der die gleiche Wandlungsphase hat, wie die Leitbahn an sich. Er wirkt gut stützend auf die Leitbahn und die gesamte Wandlungsphase. Besonders stark trifft dies auf den Akupunkturpunkt Ma36 (S36) zu.
Der therapeutische Ansatz bei der Kombination über Mutter-Sohn-Punkte ist, dass die Mutter die folgende Wandlungsphase – also den Sohn – stützt, und dass der Sohn der Mutter Energie abnimmt. Bei der Kombination über den Kontrollzyklus kann man sagen, dass die Mutter ernährt und die Großmutter kontrolliert. Dabei kann die Großmutter zu viel kontrollieren in Form einer Überkontrolle (cheng-Zyklus) oder zu wenig kontrollieren, dann liegt eine ungenügende Kontrolle vor.
13.1 Die Wandlungsphase Holz
13.1.1 Leberfunktionskreis (orbis hepaticus)
Der FK Leber ist der Wandlungsphase Holz zugeordnet und damit der potenziellen Aktivität und Dynamik. Daraus leitet sich ab, dass im FK Leber Tatendrang, Impulse zur Aktivität und Antrieb gebildet werden. Beim Menschen wird er als Sitz von Fantasie, Entscheidungsfreude, Ideen, Mut, Initiative und Überlegungen angesehen. In seiner Funktion wurde der FK Leber in alten Texten mit einem Feldherren, Heeresführer oder General verglichen. Heutzutage könnte man den FK Leber auch als Power- oder Manager-Funktionskreis bezeichnen. Eine übersteigerte Aktivität in diesem Funktionskreis kann man vergleichen mit einem „Nur-Gas-Geben“, ohne zu bremsen.
Der FK Leber dynamisiert und moduliert das qi, er reguliert den freien Fluss des qi. Er ist außerdem der Speicher des xue, also der individualspezifischen struktiven Energie (xue). Als Ausgleichsreservoir kann er xue bei plötzlichen, außergewöhnlichen oder lang anhaltenden Belastungen abgeben und in Ruhephasen wieder aufnehmen. (Die Speicherfunktion bezieht sich auf den Funktionskreis. Die Leber-Leitbahn kann – wie allgemein die Hauptleitbahnen – nicht speichern, eine Speicherfunktion besitzen bei den Leitbahnen nur die unpaarigen Leitbahnen). Die Aktivität und Leistungsfähigkeit der anderen Organe wird also nicht nur über eine direkte Kopplung, sondern auch stark über das xue beeinflusst. Das zugeordnete Gewebe, die körperliche Darstellung, präsentiert sich in den Muskeln und Sehnen, in den aktiven Teilen vom Bewegungsapparat. Die äußere Darstellung hat der FK Leber in den Hufen.
Beachte: Brüchige, wässrige und trockene Hufe sind nicht immer als Zeichen für eine Störung im FK Leber zu werten. Sie können auch durch Störungen in anderen Funktionskreisen, besonders im FK Gallenblase, oder allgemein durch eine xue Stase oder einen xue-Mangel bedingt sein.
Die Augen sind das zugeordnete Sinnesorgan und die zugeordnete Körperöffnung. Der Glanz der Augen kann einen Rückschluss auf den energetischen Zustand des FK Leber geben. Der frühe Morgen und das Frühjahr entsprechen der zeitlichen Zuordnung. Der FK Leber ist sehr empfindlich gegenüber Wind (ventus), wobei sowohl externer Wind als klimatischer Faktor als auch durch Emotionen bzw. Hitze (calor) ausgelöster innerer Wind (ventus internus) den FK Leber belasten können. Generell herrschen beim FK Leber Füllestörungen gegenüber energetischer Schwäche/Leere vor. Das beim Menschen häufig vorkommende überschießende, emporschlagende yang vom FK Leber kommt beim Pferd auch vor.
Die im „Leber-Typ“ stehenden Pferde sind sehr leistungsfähige, oft muskulöse Tiere, die aber zu Muskelverspannungen, festem Rücken und Sehnenverletzungen neigen. Daher benötigen diese Pferde oft eine ausreichend lange Entspannungs- und Lösungsphase zu Beginn der Arbeit. Häufig sind diese Pferde in Leitpositionen in der Herde und neigen zu Aggressivität.
13.1.2 Gallenblasenfunktionskreis (orbis felleus)
Der FK Gallenblase ist der yang-Funktionskreis, der komplementär dem FK Leber zugeordnet ist.