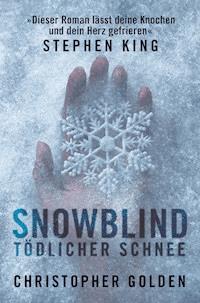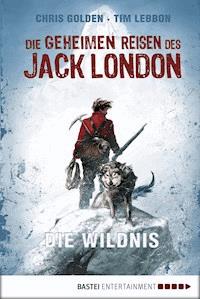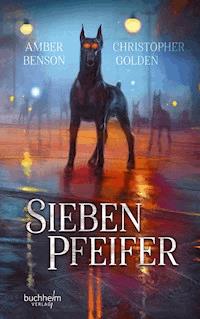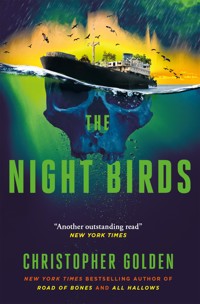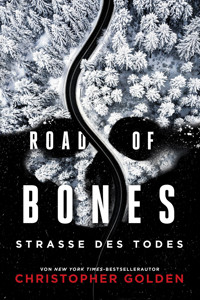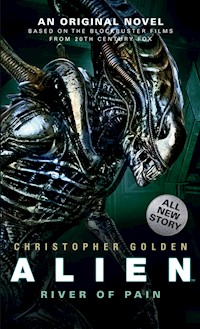6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ellen Ripley glaubte, die Aliens besiegt zu haben …
Als Ripley nach Jahrhunderten im All endlich zur Erde zurückkehrt, erfährt sie, dass die Menschen den Planeten Acheron kolonisiert haben. Acheron – besser bekannt als LV 426 – ist ein Planet, den Ripley nur allzu gut kennt, denn hier begegnete sie zusammen mit der Crew der Nostromo dem Xenomorphen, der tödlichen Kreatur, die als Alien in die Geschichte einging. Und der Kampf der Menschen gegen das Monster beginnt von Neuem ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ZUM BUCH
Wir schreiben das Jahr 2165, und inzwischen sind dreiundvierzig Jahre vergangen, seit Ripley und die Crew der NOSTROMOauf dem Planeten LV-426 gegen die Aliens kämpften. Heute heißt LV-426 Acheron und ist eine von der Weyland-Yutani Corporation gesponserte Kolonie der Erde. Denn der Großkonzern möchte endlich ein lebendes Exemplar der Aliens in die Hände bekommen, um es genauer zu untersuchen und Profit daraus zu schlagen. Vergeblich versucht Ripley, das Unternehmen vor den Aliens zu warnen, und ihre düsteren Vorahnungen bewahrheiten sich aufs Schrecklichste: Als die Wissenschaftler von Weyland-Yutani auf erste Spuren der Aliens stoßen, kommt es zu einer Katastrophe. Ripley bleibt nichts anderes übrig, als ein Raumschiff zu besteigen und den Kampf gegen die Aliens erneut aufzunehmen.
Ein neues atemberaubendes Abenteuer aus dem Alien™-Universum.
DER AUTOR
Christopher Golden ist in den USA bereits ein preisgekrönter New York Times-Bestsellerautor. Geboren und aufgewachsen ist er in Massachusetts, wo er auch heute noch mit seiner Familie lebt.
www.twitter.com/HeyneFantasySF
www.diezukunft.de
CHRISTOPHER GOLDEN
A L I E N
Der verlorene Planet
ROMAN
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
AlienTM – River of Pain
Deutsche Übersetzung von Kristof Kurz
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 4/2016
Redaktion: Werner Bauer
Copyright © 2014 by Christopher Golden
AlienTM & © 2014 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-16511-6V001
www.diezukunft.de
1
UNSER GAST
4. Juni 2122
Ripley hatte um die Krankenstation der NOSTROMO lange Zeit einen großen Bogen gemacht. Die weißen Wände und die grelle Beleuchtung verjagten selbst den kleinsten Schatten, und die Luft war ständig vom elektrischen Summen diverser medizinischer Apparate erfüllt.
Als dritte Offizierin der NOSTROMO verbrachte sie den Großteil ihrer Zeit im grauen Zwielicht der Raumschiffkorridore und Schotts, wo nur flackernde Neonlichter die Dunkelheit in Schach hielten. Schon seltsam – sie war auf so vielen Schiffen gereist, dass ihr die Schatten vertrauter gewesen waren als das Licht.
Doch all das hatte sich geändert.
Die NOSTROMO war mit zwanzig Millionen Tonnen Roherz durch das Zeta2-Reticuli-System in Richtung Erde geflogen, als der Bordcomputer – auch »Mutter« genannt – ein Notrufsignal von einem Planetoiden namens LV-426 aufgefangen hatte. Kurz darauf hatte er die Crew aus dem Hyperschlaf geweckt und ihr befohlen, dem Ursprung des Signals auf den Grund zu gehen.
Ripley war diese Anweisung von Anfang an suspekt gewesen. Sie waren weder Planetenforscher noch Kolonisten; so etwas gehörte nicht zu ihrem Aufgabenbereich.
Aber Befehl war Befehl. Kapitän Dallas hatte sie daran erinnert, dass allein der Konzern darüber entschied, was zu ihrem »Aufgabenbereich« gehörte und was nicht. Also hatten sie nachgeforscht.
Nach der Landung hatte Dallas mit seinem Ersten Offizier Kane und der Navigationsoffizierin Lambert die Planetenoberfläche betreten und sich auf die Suche nach der Quelle des Signals gemacht. Sie fanden ein verlassenes Raumschiff, das definitiv nicht menschlichen Ursprungs sein konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten bei Ripley alle Alarmglocken geklingelt. Zum einen hatten sie keine Ahnung, welche Gefahren in dem Schiff auf sie lauerten, zum anderen waren der Kapitän, der Erste Offizier und die Pilotin die falsche Besetzung für eine solche Expedition.
Sie liefen direkt in einen Albtraum.
Danach fühlte Ripley sich in den Schatten der NOSTROMO nicht mehr so wohl wie zuvor. Jetzt hielt sie sich so oft wie möglich in der Krankenstation auf – nicht etwa, weil sie ärztliche Hilfe gebraucht hätte, sondern wegen der guten Beleuchtung. Die Krankenstation war Ashs Reich – der wissenschaftliche Offizier des Schiffs, der sie mit seiner Überheblichkeit regelmäßig auf die Palme brachte. Manchmal hatte man den Eindruck, dass er keinen großen Unterschied zwischen seinen Mannschaftskameraden und den Proben sah, die er durch sein Mikroskop betrachtete.
Das machte ihr Angst.
Dennoch konnte er als wissenschaftlicher Offizier wohl noch am ehesten herausfinden, was zum Teufel in den tosenden Atmosphärenstürmen geschehen war, die auf der Oberfläche von LV-426 tobten – und was mit Kane passiert war.
Ripley weigerte sich, jedem Befehl blind zu gehorchen. Die Forderungen des Konzerns beunruhigten sie ebenso wie Mutters Fixierung auf die außerirdischen Lebensformen, auf die sie auf diesem trostlosen Mond gestoßen waren. Aber als sie ihre Bedenken zur Sprache brachte, war sie auf taube Ohren gestoßen.
Na ja, scheiß drauf. Sie würde ihnen keine Wahl lassen. Schließlich hatte sie eine Tochter auf der Erde. Und sie hatte Amanda versprochen, heil wieder zu ihr zurückzukommen. Ein Versprechen, das sie unter keinen Umständen brechen wollte.
Daher war sie ihrem Instinkt gefolgt, hatte Fragen gestellt und Antworten verlangt, ohne sich darum zu kümmern, wem sie dabei auf die Füße trat.
Ripley schlüpfte geräuschlos in die Krankenstation. Es war, als würde sie ohne die Erlaubnis des Königs fremdes Gebiet betreten. Sie sah sich um: Bildschirme, weiße Wände, gelbe Knöpfe an den verschiedenen Apparaten. Die Beleuchtung war gedämpft.
Dann betrat sie einen Laborbereich. Ash saß zu ihrer Rechten und starrte aufmerksam auf einen Bildschirm. Obwohl er nicht besonders groß war, hatte seine Präsenz etwas Ehrfurcht gebietendes. Sein braunes Haar ergraute bereits; seine blauen Augen waren kalt wie Stahl.
Dann beugte Ash sich über ein Mikroskop. Er war so konzentriert, dass sie sich ihm unbemerkt bis auf einen Meter nähern konnte. Als sie das Bild auf dem Monitor erblickte, schüttelte sie sich vor Abscheu.
Es war ein Scan der spinnenartigen Kreatur, die sich auf dem Gesicht des Ersten Offiziers festgesetzt hatte. Details waren nicht zu erkennen. Das Ding besaß eine Art Schwanz, den es um Kanes Hals gelegt hatte und jedes Mal zusammenzog, wenn sie versucht hatten, es zu entfernen. Als sie der widerwärtigen Kreatur einen Schnitt beigebracht hatten, war Säure aus der Wunde gespritzt und hatte sich durch drei Decks gefressen. Ein, zwei Etagen weiter, und sie hätte die Schiffshülle durchlöchert und sie alle ins Jenseits befördert.
Ash fand die Kreatur überaus faszinierend.
Ripley wollte ihr einfach nur den Garaus machen.
»Irgendwie komisch«, sagte sie leise und deutete mit dem Kinn auf den Bildschirm. »Was ist das?«
Ash blickte ruckartig auf.
»Ich würde sagen, es ist …«, begann er. »Noch weiß ich’s nicht.« Er schaltete den Bildschirm aus und setzte sich gerade hin. »Kann ich was für Sie tun?«, fragte er untypisch zuvorkommend.
So höflich, dachte sie. Wir sind beide so verdammt höflich.
»Ja, ich, ähm … ich wollte mich etwas mit Ihnen unterhalten«, murmelte sie. Offen gestanden wusste sie nicht so recht, weshalb sie hier war. »Wie geht’s Kane?«
Zwischen ihnen herrschte ständig eine gewisse Spannung. Sie hatte Ash von dem Augenblick an, als er sich der Besatzung angeschlossen hatte – oder ihr vom Konzern aufgezwungen wurde, bevor sie mit ihrer Ladung von Thedus ablegten – unsympathisch gefunden. Mit manchen Leuten kam sie einfach nicht klar. Sie mussten nur den Raum betreten, und schon fühlte sie sich unsicher. Wäre sie eine Katze gewesen – wie Jones, das Schiffsmaskottchen –, hätte sie bei jeder Begegnung mit Ash gefaucht und die Ohren angelegt.
Er vermied direkten Augenkontakt. Ganz offensichtlich konnte er es kaum erwarten, dass sie wieder verschwand.
»Bisher unverändert.«
Ripley deutete mit dem Kinn auf den schwarzen Bildschirm.
»Und … unser Gast?« Jetzt warf er ihr doch einen Blick zu.
»Hm … Ich bin noch nicht ganz fertig«, antwortete Ash, nahm ein MicroscAnnier-Tablet in die Hand und studierte das Display. »Ein paar Untersuchungen sind noch offen, aber ich habe festgestellt, dass seine Außenhaut aus einer Protein-Polysaccharidschicht besteht. Es hat die Angewohnheit, ständig Zellen abzustoßen und sie durch polarisiertes Silizium zu ersetzen, was seine Widerstandsfähigkeit gegenüber schädlichen Umwelteinflüssen beträchtlich … erhöht.« Er schenkte ihr ein kurzes Lächeln. »Genügt Ihnen das?«
Ob mir das genügt?, dachte sie. Ob mir das genügt? Er hätte ihr genauso gut befehlen können, sich zu verpissen.
»Ist ’ne ganze Menge«, sagte sie, ohne sich einschüchtern zu lassen. »Und was bedeutet das alles?«, fragte sie und beugte sich über das Mikroskop.
Ash verlor die Geduld. »Bitte unterlassen Sie das. Vielen Dank.«
Ripley legte den Kopf schief und zog unwillkürlich eine Grimasse. Sie wusste ja, dass er eigen war, was sein Labor betraf, aber was war so falsch daran, in ein Mikroskop zu sehen? Sie hatte es noch nicht einmal angefasst.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie in einem Tonfall, der das genaue Gegenteil zum Ausdruck brachte.
Ash beruhigte sich wieder. »Es handelt sich um eine wirklich interessante Kombination von Elementen, die es äußerst widerstandsfähig macht«, sagte er.
Ripley erschauerte. »Und Sie haben es reingelassen«, sagte sie.
Ash hob beleidigt das Kinn. »Ich habe nur einen Befehl befolgt, haben Sie das vergessen?«, erwiderte er gereizt.
Ripley musterte ihn genau, und dabei fiel ihr wieder ein, weshalb sie in die Krankenstation gekommen war.
»Ash, wenn Dallas und Kane nicht an Bord des Schiffes sind, habe ich die Befehlsgewalt.«
Seine Gesichtszüge erstarrten. »Richtig, das hatte ich vergessen.«
Hatte er natürlich nicht. Das wusste sie so gut wie er. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, einigermaßen überzeugend zu klingen. Was ihr jedoch die größten Sorgen bereitete, war das Weshalb. Einfach nur, weil Ash sich wie ein Idiot aufführen musste? Oder weil er ihren Platz in der Befehlskette nicht respektierte? Hatte es womöglich gar nichts mit ihr zu tun? War er einfach nur der Ansicht, tun und lassen zu können, was er wollte, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen?
Damit ist jetzt Schluss, entschied sie.
»Sie haben auch die Quarantänevorschriften unserer wissenschaftlichen Abteilung vergessen«, sagte sie.
»Die habe ich nicht vergessen«, entgegnete er ruhig.
»Verstehe«, sagte sie. »Sie haben sich einfach nur nicht daran gehalten.«
Ash drehte sich wütend zu ihr um und stemmte die rechte Hand in die Hüfte. »Was hätte ich denn mit Kane tun sollen? Seine einzige Chance bestand darin, ihn hier reinzubringen.«
Seine Wut erfüllte sie mit diebischer Freude. Schön, dass sie ihn aus der Fassung bringen konnte.
»Sie haben, indem Sie die Quarantänevorschriften missachtet haben, unser aller Leben aufs Spiel gesetzt«, widersprach Ripley.
»Vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre draußen geblieben«, sagte Ash. Dann kehrte seine gewohnte Arroganz zurück. »Möglicherweise habe ich die übrige Besatzung gefährdet, aber das Risiko nehme ich auf mich.«
Ripley rutschte etwas näher heran und blickte ihm in die Augen.
»Sie übernehmen ein sehr großes Risiko für einen wissenschaftlichen Offizier«, sagte sie. »Das ist sicherlich nicht im Sinne Ihrer Vorschriften.«
»Ich nehme meine Pflichten ebenso ernst wie Sie die Ihren, und das wissen Sie«, erwiderte Ash.
Ripley sah wieder zum Bildschirm hinüber. Sie hätte den Scan wirklich gerne gesehen, obwohl sie wahrscheinlich keine Ahnung gehabt hätte, was er darstellen sollte.
Ash starrte sie trotzig an. »Tun Sie Ihre Arbeit, und überlassen Sie mir meine.«
Ripley fielen spontan ein Dutzend Antworten darauf ein – keine war besonders höflich oder freundlich. Aber sie holte einfach nur tief Luft, atmete aus, drehte sich um und verließ den Raum. Sie hatte nie etwas anderes von Ash verlangt, als dass dieser seine Pflicht erfüllte. Er schien jedoch mehr an der Kreatur auf Kanes Gesicht interessiert als daran, dem Ersten Offizier das Leben zu retten.
Weshalb?
2
ERSCHÜTTERUNGEN
11. Oktober 2165
Greg Hansard stand in den tosenden Atmosphärenstürmen auf LV-426 und hätte am liebsten losgeschrien. Irgendwo in dem Atmosphärenwandler, der über ihm aufragte, kreischte Metall auf Metall. Dann wurde die Maschine so heftig durchgerüttelt, dass der Boden unter seinen Füßen bebte.
»Was zum Teufel macht ihr da drin?«, brüllte Hansard in sein Funkgerät. Sein Herz hämmerte im Takt des dröhnenden Atmosphärenwandlers. Er glaubte, hinter seiner Atemmaske zu ersticken, eine Ironie, die ihm durchaus bewusst war – trotzdem musste er gegen den Drang ankämpfen, sich die Maske vom Gesicht zu reißen. Natürlich würde er diesem Drang nicht nachgeben. Inmitten dieses höllischen Sturms konnte man zwar wahnsinnig werden, aber nicht so wahnsinnig.
»Wir geben unser Bestes, was denn sonst?«, antwortete einer der Mechaniker. Über dem Heulen des Windes war unmöglich zu verstehen, wem die Stimme gehörte. »In der Generatorverkleidung ist ein Riss. Wenn wir ihn auf halbe Geschwindigkeit runterdrosseln, können wir die Reparatur durchführen, ohne das ganze Ding abschalten zu müssen.«
»Na dann los«, brüllte Hansard zurück. »Aber macht schnell! Wir können uns keine weitere Verzögerung leisten.«
»Scheiße, Boss. Wir haben uns diesen verfluchten Planeten nicht ausgesucht«, entgegnete der Mechaniker.
Hansard ließ erschöpft den Kopf hängen. »Ich weiß, Mann«, sagte er. »Und ich würde den, der ihn ausgesucht hat, am liebsten erwürgen.«
»Hansard, komm mal hier rüber!«, meldete sich eine weitere Stimme über Funk, die er sofort erkannte.
»Was gibt’s, Najit?«, fragte er und umrundete die Maschine. Der Atmosphärenwandler war zwanzig Meter hoch, ratterte, dröhnte und stieß atembare Luft aus.
»Das siehst du dir besser mal selbst an«, antwortete Najit.
Drei Mechaniker befanden sich im Atmosphärenwandler, ein weiteres halbes Dutzend stand davor. Najit selbst war Bauingenieur. Seit sechs Jahren versuchte der Konzern nun schon, LV-426 – der jetzt den Namen Acheron trug – zu terraformen. Sogar die Fundamente für eine zukünftige Kolonie waren gelegt. Der Zentralkomplex stand bereits. Das Dutzend Kolonisten sowie die Bauarbeiter und Mechaniker, die ihn bewohnten, unterstanden Al Simpson, dem Kolonieverwalter.
Es verging kaum ein Tag, an dem ihm Simpson nicht wegen der Verzögerung des Terraformings in den Ohren lag. Für Hansard war Simpson nicht mehr als ein Idiot, der für noch viel größere Idioten arbeitete.
Die Kolonie – nach einem ihrer Gründer Hadley’s Hope getauft – war ein Gemeinschaftsprojekt der Erdregierung und der Weyland-Yutani-Corporation unter der Leitung der Kolonialverwaltung, auf der angeblich alle Gesetze und Vorschriften der Interstellaren Handelskommission Gültigkeit besaßen. Acheron selbst war kein Planet, obwohl ihn jeder als solchen bezeichnete. Er war ein Felsbrocken mitten im Nirgendwo, einer der Monde eines Planeten namens Calpamos.
Acheron wurde unaufhörlich von Windstürmen heimgesucht, endlosen wirbelnden Wolken aus Staub und Sand. Egal, wie dicht Hansard seine Maske und seinen Schutzanzug auch am Körper trug, der Staub drang noch in die kleinste Ritze.
Er war überall.
An jedem verdammten Tag.
Weshalb hatte sich Weyland-Yutani ausgerechnet diesen Ort für den Aufbau einer neuen Kolonie ausgesucht? Die atmosphärischen Bedingungen verhinderten, dass sie die Topografie Acherons vom All aus genau vermessen konnten. Trotzdem hatte irgendein Arschloch entschieden, dass es sich hier um bestes Bauland handelte.
Manchmal bekam Hansard den Eindruck, als wollte der Planetoid selbst sie loswerden. Sie hatten es geschafft, mehrere Atmosphärenwandler in regelmäßigen Abständen auf der Oberfläche zu verteilen. Der wichtigste von ihnen – der gewaltige, kathedralenähnliche Wandler eins – war noch im Bau. Die Probleme hatten kein Ende nehmen wollen. Durch Erdbeben taten sich tiefe Spalten in der Oberfläche auf, und einer der kleineren Atmosphärenwandler war förmlich vom Erdboden verschluckt worden. Unfälle, Messfehler und mangelhafte Ausrüstung sorgten für ständige Verzögerungen.
Und jetzt … was?
Hansard umkreiste das Fundament des Wandlers. Das stampfende Dröhnen der Maschine beunruhigte ihn. Der Boden bebte, und Hansard bebte mit. Er schmeckte Staub.
»Najit?«, rief er. Eigentlich hätte er ihm schon längst über den Weg laufen müssen.
»Hier!«, ertönte die Antwort.
Hansard spähte durch den tosenden Staubschleier und erkannte drei Gestalten, die in etwa vier Metern Entfernung vom Wandler standen und etwas auf dem Boden anstarrten.
Ach du Scheiße, dachte Hansard. Hoffentlich ist das nicht …
Der Wandler erzitterte. Hansard wirbelte herum und starrte ihn atemlos an. Die Maschine wurde so heftig durchgerüttelt, dass das Gehäuse klapperte. Mit einem Mal wurde ihm klar, dass nicht alle diese Erschütterungen von dem Wandler selbst stammen konnten.
»Gottverdammter Mist!«, rief er.
Aus dem metallischen Knirschen der Maschine wurde ein kreischendes Donnern.
Hansard drehte sich um und lief auf die anderen zu. Drei Männer standen vor dem Wandler. Und drei weitere befanden sich noch darin, zwischen den knarrenden, kreischenden Metallteilen.
»Was zum Teufel …«, setzte er an.
»Noch ein Spalt«, rief Najit.
Beim Näherkommen bemerkte Hansard den Riss im Boden. Die dicke Schicht aus Atmosphärenstaub und Vulkanasche rieselte wie Sand in den Spalt. Najit folgte ihm vom Atmosphärenwandler weg, um seine Länge abschätzen zu können. Dann blieb er stehen und wandte sich den beiden anderen Bauingenieuren zu.
»Fünf Meter!«, rief Najit. »Und er breitet sich aus!«
Hansard war es scheißegal, wie weit der Spalt vom Wandler wegführte. Er lief zum Gehäuse hinüber und beobachtete die Stelle, an der der Riss unter dem Gehäuse verschwand.
»Nein«, flüsterte er. »Neinneinnein.«
Er blickte in die Staubwolken hinauf. Der Atmosphärenwandler erzitterte ein weiteres Mal. Die Geräusche aus seinem Inneren erinnerten ihn an die Archivaufnahme einer altertümlichen Lokomotive, die er einmal gesehen hatte.
»Abschalten!«, brüllte er. »Schaltet das Ding sofort ab, und kommt da raus!«
»Chef …«, begann Najit vorsichtig.
»Weg da, ihr Trottel!«, fuhr Hansard die drei Ingenieure an und scheuchte sie zurück. »Wisst ihr nicht mehr, was mit Wandler drei passiert ist?«
Über Funk hörte er, wie sich die drei Mechaniker im Inneren des Wandlers anbrüllten. Befehle, Flüche, panische Rufe.
»Glaubst du, das hier wird auch so schlimm?«, fragte Najit.
Der Boden vibrierte weiter. Obwohl es sich nur um ein Erdbeben von begrenzter Reichweite handelte, konnte man unmöglich voraussehen, wie lange es dauern würde. Seit achtzehn Monaten hatten sie diesen Sektor schon unter Beobachtung und nicht die geringste Erschütterung bemerkt.
Und jetzt war es zu spät.
»Es ist bereits schlimm genug«, rief Hansard.
Der Atmosphärenwandler zischte. Dann ebbte das Dröhnen in seinem Inneren ab. Das Gehäuse vibrierte weiter. Eine kurze Flaute verschaffte ihm einen besseren Ausblick auf die Maschine. In etwa sechs Metern Höhe entdeckte er einen Riss im sonst glatten Metall.
Scheiße!
»Raus aus dem Wandler, sofort«, rief er. »Nguyen! Mendez! Raus mit …«
Hansard verstummte und blickte auf den Boden vor seinen Füßen. Das Erdbeben legte sich. Er hielt mehrere Sekunden lang die Luft an, bis er sich sicher sein konnte, dass es vorbei war. Aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr.
Man hätte den Wandler reparieren können, doch wozu? Das nächste Erdbeben – egal, ob morgen oder in zehn Jahren – konnte ihn endgültig zerstören. Dann würden sie die Maschine aufgeben, ausschlachten und auf stabilerem Untergrund neu aufstellen müssen. Zurück würde nur eine leere Metallhülle bleiben. Dummerweise konnte man auf Acheron nie mit Sicherheit sagen, ob der Boden stabil genug war.
»Chef?«, sagte Najit und stellte sich neben ihn.
Hansard starrte niedergeschlagen in die vom Wind aufgewirbelten Staubwolken.
Wer auch immer LV-426 seinen neuen Namen gegeben hatte, war sich der Absurdität des Ganzen bewusst gewesen. In der griechischen Mythologie ist der Acheron einer der Flüsse, der durch die Unterwelt fließt.
3
REBECCA
15. März 2173
Russ Jorden betrachtete die Schweißperlen auf der Stirn seiner Frau, und das Herz wurde ihm schwer. Sie drückte seine Hand so fest, dass die Knochen förmlich knirschten, und hielt den Atem an. Ihr Gesicht war zu einer Maske aus Wut und Schmerz verzogen.
»Du musst atmen, Annie«, beschwor er sie. »Bitte, Schatz. Atme.«
Annie keuchte, und einen kurzen Augenblick lang entspannte sich ihr Körper. Dann spitzte sie die Lippen und atmete lange und tief aus. Sie war schon seit Stunden leichenblass gewesen, und jetzt hatte ihre Haut eine graue Farbe angenommen. Die Ringe unter ihren Augen waren so dunkelblau wie ein Bluterguss. Sie ließ den Kopf zur Seite sinken und sah ihn mit flehentlichem Blick an. Doch sie beide wussten, dass er nichts anderes tun konnte als an ihrer Seite zu bleiben und liebevoll über sie zu wachen.
»Warum kommt sie nicht endlich raus?«, fragte Annie.
»Weil es da drin so gemütlich und das Universum ein großer und unheimlicher Ort ist«, antwortete Russ. »Da drin hat sie es warm und kann deinen Herzschlag hören.«
Annie warf einen Blick auf ihren gewaltigen Bauch, der sich in den letzten Stunden dramatisch gesenkt hatte. Sie runzelte die Stirn, die nun von tiefen Sorgenfalten durchzogen war.
»Jetzt komm schon raus, meine Kleine. Wenn du zu dieser Familie gehören willst, musst du mutig sein. Und ein kleines bisschen verrückt.«
Russ lachte, aber nicht so laut, wie er es sonst wohl getan hätte. Annie lag nun seit siebzehn Stunden in den Wehen. Ihr Gebärmutterhals hatte sich erst auf sieben Zentimeter geweitet und wollte seit drei Stunden nicht größer werden. Dr. Komiskey hatte ihr einen Wirkstoff verabreicht, um den Prozess zu beschleunigen – zusammen mit der Warnung, dass eine künstliche Aktivierung des Uterus die Schmerzen bei der Geburt noch vergrößern konnte.
Annie gab ein tiefes Stöhnen von sich. Ihr Atem wurde schneller.
»Russell …«
»Sie ist gleich hier«, versicherte er ihr. »Versprochen.« Na los,Rebecca, fügte er in Gedanken hinzu. Es wird langsam Zeit.
Gerade als Annie die Zähne zusammenbiss, den Rücken durchdrückte und jeden Muskel im Körper anspannte, trat ein Pfleger ein. Auch Russ hielt den Atem an – angesichts der Schmerzen seiner Frau hätte er am liebsten losgeschrien. Er sah sich panisch und hilfesuchend um. »Joel, kannst du denn nichts für sie tun?«
Der schlanke, dunkelhäutige Pfleger schüttelte mitfühlend den Kopf. »Wie gesagt, Russ – sie wollte eine natürliche Geburt, genau wie bei Tim. Jetzt ist es zu spät, um ihr etwas zu verabreichen. Mehr Schmerzmittel, als sie bereits intus hat, können wir ihr nicht geben, ohne das Baby zu gefährden.«
Annie warf ihm mehrere Flüche an den Kopf. Joel ging zu ihrem Bett und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Die Krämpfe ließen nach, und sie holte Luft.
»Dr. Komiskey wird gleich noch mal nach dir sehen.«
Russ funkelte ihn wütend an. »Und wenn sie keine Fortschritte gemacht hat?«
»Ein Kaiserschnitt kommt nicht infrage!«, keuchte Annie zwischen zwei Atemzügen.
Joel tätschelte ihre Schulter.
»Das ist ein völlig harmloser Eingriff. Und wenn du dir wegen der Narben Sorgen machst …«
»So ein Blödsinn. Seit der Geburt meiner Großmutter hat kein Kaiserschnitt mehr eine Narbe hinterlassen«, sagte Annie atemlos.
»Sage ich ja«, meinte der Pfleger. »Um des Babys willen …«
Annie starrte ihn entgeistert an. »Ist mit ihr alles in Ordnung, Joel?«
»Alles bestens«, bekräftigte Joel. »Die Schwangerschaft ist völlig normal verlaufen, und die Blut- und Gentests deuten auf ein gesundes Kind hin. Allerdings könnte es zu Komplikationen kommen, wenn … nein, das solltet ihr besser mit Dr. Komiskey besprechen.«
»Verflucht, Joel. Wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren«, blaffte Russ. »So groß ist die Kolonie nun auch wieder nicht. Wenn es Grund zur Beunruhigung gibt …«
»Nein. Schluss damit«, sagte Joel und hob eine Hand. »Problematisch wäre es nur, wenn ihr auf euch allein gestellt wärt. Aber das seid ihr nicht. Die komplette Besetzung der Krankenstation kümmert sich um euch und euer Baby. Und die Kolonie wartet nur darauf, das kleine Mädchen willkommen zu heißen.«
Annie schrie auf und drückte wieder Russ’ Hand. Er betrachtete das wunderschöne, vor Schmerzen verzerrte Gesicht seiner Frau. Mit einem Mal wurde ihm klar, dass einer der Tropfen auf ihrer Wange kein Schweiß, sondern eine Träne war. Sie hatten zu lange gewartet.
»Ruf Komiskey«, befahl Russ.
»Sie wird jeden Augenblick …«, fing Joel an.
»Jetzt!«
»Okay, schon gut.« Joel eilte davon und ließ die Jordens allein mit ihrer Angst, ihrer Hoffnung und einem Kind zurück, das es offenbar nicht eilig hatte, seine Eltern kennenzulernen.
Ängstliches Schweigen herrschte im Raum. Erschöpft nutzte Annie die kurzen Phasen zwischen den schmerzhaften Wehen, um Luft zu holen, sich auszuruhen und darauf zu hoffen, dass bei Dr. Komiskeys Ankunft der Gebärmutterhals vollständig geweitet war und sie das Baby zur Welt bringen konnte.
»Ich kapier das nicht«, flüsterte sie müde. »Bei Tim haben die Wehen nur vier Stunden gedauert. Und mein Rücken … Himmel, mein Rücken hat längst nicht so wehgetan wie jetzt. Was ist da nur los?«
Russ betrachtete die glatten weißen Monitorgehäuse neben und über dem Bett. Bei einem Notfall würden die Apparate sofort Alarm schlagen. Momentan waren auf den Bildschirmen jedoch nur grüne und blaue Blinklichter zu sehen. Bis auf ein sanftes, fast rhythmisches Summen war nichts zu hören. Hinter den dunklen, stillen Überwachungsmonitoren stand eine viel größere Apparatur mit einem durchsichtigen Deckel.
Sollte Komiskey einen Eingriff vornehmen müssen, um das Kind auf die Welt zu bringen, würden sie Annie in diese Kapsel stecken. Nicht eventuelle Narben machten ihr Angst, sondern die Tatsache, dass sie nicht länger von menschlichen Händen behandelt werden würde. Der Geburtschirurgie-Roboter war in der Lage, einen Kaiserschnitt mehr oder weniger selbstständig durchzuführen. Eine Vorstellung, die die Jordens mit Entsetzen erfüllte. Der Mensch war zwar nicht unfehlbar, doch immerhin nahm er Anteil an seinen Mitmenschen. Eine Maschine dagegen war sich der Bedeutung des Lebens nicht bewusst.
»Haben wir einen Fehler gemacht?«, krächzte Annie.
Russ tupfte ihre Stirn mit einem kühlen, feuchten Tuch ab. »Bei Timmy ging alles so einfach«, sagte er. »Das hat ja niemand ahnen können. Eine natürliche Geburt war damals die vernünftige Entscheidung.«
»Das meine ich nicht«, sagte seine Frau und wedelte schwach mit der Hand. »Ich meine, dass wir hierhergekommen sind. Nach Acheron. Nach Hadley’s Hope.«
Russ runzelte die Stirn. »Wir hatten keine andere Wahl. Zu Hause gab es keine Jobs. Diese Gelegenheit, off-planet zu arbeiten, war ein großer Glücksfall. Du weißt doch, dass …«
»Ich weiß«, schnappte sie. Dann verspannte sie sich wieder und atmete zischend durch die Zähne, als sich die nächste Wehe ankündigte. »Aber Kinder zu bekommen, hier …«
Die Bildschirme flackerten in dem kurzen Moment, in dem Annie sich verkrampfte und vor Schmerzen brüllte, rot auf.
»Das reicht!«, verkündete Russ. Er sprang auf, sodass der Stuhl umfiel, und wäre schnurstracks zur Tür gelaufen, hätte Annie seine Hand nicht weiter festgehalten. Er wollte gerade anfangen, mit ihr zu diskutieren, als sich die Bildschirme wieder grün färbten. Der Alarm war nicht ausgelöst worden.
Aber das war ihm egal. Ein rotes Flackern war mehr als genug.
»Komiskey!«
Er holte Luft, um abermals den Namen der Ärztin zu rufen, als Dr. Theodora Komiskey, eine gedrungene Frau mit einem braunen Lockenkopf, durch die Tür geeilt kam. Joel folgte ihr pflichtbewusst.
»Dann wollen wir mal sehen, wie weit wir sind«, sagte die Ärztin lächelnd und so fröhlich wie eh und je.
»Schon halb durch das beschissene Universum«, knurrte Russ. Er verachtete das falsche Lächeln, das die meisten Ärzte wie eine Maske trugen, und hätte es Dr. Komiskey mit Freuden aus dem Gesicht gebrüllt. Doch das hätte Annie und dem Baby auch nicht geholfen. Stattdessen musste er untätig zusehen, wie sich die fassförmige Frau Latexhandschuhe überstreifte, auf einem Hocker Platz nahm und zwischen Annies Schenkeln herumwühlte, als hätte sie dort etwas verloren.
»Ich kann den Kopf ertasten«, sagte Dr. Komiskey mit besorgter Stimme. »Jetzt verstehe ich das Problem. Das Baby liegt in der hinteren Hinterhauptslage …«
Russells Herz krampfte sich zusammen.
»Und was heißt das?«
Komiskey beachtete ihn nicht weiter, sondern wandte sich direkt an Annie. »Sie liegt mit dem Gesicht zum Bauch, was bedeutet, dass ihr Hinterkopf Druck auf Ihr Sakrum – das Kreuzbein – ausübt. Die gute Nachricht lautet, dass Ihr Muttermund vollständig geweitet ist und der Gebärmutterhals ausreichend verkürzt. Schon bald wird Ihr Baby die süßeste kleine Prinzessin von ganz Hadley’s Hope sein.«
Russ ließ den Kopf sinken. »Gott sei Dank.«
»Und was …« Annie holte zischend Luft. »Was ist die schlechte Nachricht?«
»Die schlechte Nachricht ist, dass es höllisch wehtun wird«, sagte Dr. Komiskey.
Annie erbebte förmlich vor Erleichterung.
»Bereit, wenn Sie es sind, Theo. Dann wollen wir die kleine Newt mal da rausholen.«
Russ lächelte. Sie nannten das Baby schon seit Monaten Newt – Molch –, weil sie sich vorgestellt hatten, wie sie von einem winzigen Punkt zu einem merkwürdigen kleinen Amphibienwesen und schließlich zu einem kompletten Fötus herangewachsen war.
»Also gut«, sagte Dr. Komiskey. »Sobald die nächste Wehe eintritt, müssen Sie …«
Annie wusste bereits Bescheid. Schließlich hatte sie schon eine Geburt hinter sich. Sobald die Wehe einsetzte, schrie sie auf. Diesmal klang es jedoch weniger wie ein Schmerzensschrei. Es war ein Schlachtruf.
Dreizehn Minuten später legte Dr. Komiskey Rebecca Jorden in die Arme ihrer Mutter. Russ grinste so breit, dass seine Gesichtsmuskeln schmerzten. Das Herz in seiner Brust schien vor Liebe förmlich platzen zu wollen. Annie drückte dem kleinen Mädchen einen Kuss auf die Stirn. Russ berührte ihre winzige Hand. Seine Tochter umklammerte seinen Finger mit erstaunlich starkem Griff.
»Hallo, kleine Newt«, flüsterte Annie und küsste sie noch einmal. »Pass auf, sonst wirst du diesen Spitznamen nie mehr los.«
Russ lachte. Annie lächelte ihn an.
Newt, dachte er. Du glückliches kleines Mädchen.
2. April 2173
Bei der Eröffnung des neuen Aufenthaltsbereichs von Hadley’s Hope machte sich keiner die Mühe, eine formelle Zeremonie auszurichten. Al Simpson, der Kolonieverwalter, steckte den Schlüssel ins Schloss, stieß die Tür weit auf, und schon konnte die Party beginnen. Die Gebrüder Finch steuerten etwas von ihrem selbst gebrannten Whiskey bei, Samantha Monet und ihre Schwester hatten alles schön dekoriert, und Bronagh Flaherty, die Köchin der Kolonie, hatte eine Auswahl speziell für diese Gelegenheit gebackener Kekse und Kuchen bereitgestellt.
Der Star des Abends war jedoch die zweieinhalb Wochen alte Newt Jorden. Al Simpson stand in der Ecke, nippte an einem heißen Irish Coffee und beobachtete, wie die übrigen Kolonisten mit großem Hallo das Baby begutachteten.
Sie war in eine Decke gewickelt und ruhte in den Armen ihrer Mutter. Zweifellos ein niedliches Ding. Dennoch hegte Al eine generelle Abneigung gegen kleine Kinder. Für gewöhnlich taten sie nichts anderes als schreien und kacken und sahen aus wie verschrumpelte, haarlose Affen. Ganz anders jedoch die kleine Newt: Bis jetzt war nicht ein Piep von ihr zu hören gewesen. Sie hatte alles nur mit ihren großen, entzückenden Augen angesehen, die neugierig und beinahe altklug aus dem geröteten, properen Babygesicht herausstrahlten.
Bei ihrer Ankunft auf LV-426 war Tim, der Junge der Jordens, ebenfalls noch ein Baby gewesen. Newts Geburt war ein Grund zum Feiern für die ganze Kolonie – das erste Kind, das auf Acheron zur Welt gekommen war. Wenn der gesamte Nachwuchs der Kolonie wie Newt geriet, war es ja halb so schlimm, dachte Al. Allerdings hegte er den dumpfen Verdacht, dass Newt eine Ausnahme darstellte und dass er seine Vorbehalte Neugeborenen gegenüber nicht so schnell ablegen würde … oder gegenüber Kindern im Allgemeinen, wenn er so darüber nachdachte.
»Niedlich«, sagte eine Stimme neben ihm.
Al zuckte zusammen, sodass Kaffee aus seiner Tasse schwappte und ihm die Finger verbrühte. Fluchend nahm er die Tasse in die linke Hand.
»Schleich dich doch nicht so an mich ran«, maulte er, während er den Kaffee von den Fingern schüttelte und dann darauf pustete.
»Sorry, Al. Tut mir leid«, sagte Greg Hansard und sah ihn mitfühlend an.
Al schüttelte weiter die Finger, obwohl der Schmerz längst aufgehört hatte.
»Zum Glück hab ich einen ordentlichen Schuss Sahnelikör reingekippt«, meinte er. »Das hat das Ganze etwas abgekühlt.«
Hansard grinste. »Nun, wenn die Verbrennungen nicht zu schlimm sind, kannst du mir ja verraten, wo du die Flasche versteckt hast.«
Eigentlich hatte Al sie mit niemandem teilen wollen, doch Hansard war immerhin der Chefingenieur der Kolonie und außerdem gute Gesellschaft. Da konnte er ein paar Fingerbreit aus seinem persönlichen Vorrat wohl verschmerzen.
»Ich werd’s mir überlegen«, sagte er und nahm einen großen Schluck. Bevor er Hansard eine Tasse brachte, wollte er seinen eigenen Kaffee trinken, solange er noch heiß war. »Aber du hast recht. Die Kleine ist wirklich ganz reizend. Ich frage mich nur, wieso, wenn man sich die Eltern so ansieht.«
Hansard lachte trocken.
»Ja, das ist allerdings rätselhaft.«
Al versteckte sein Grinsen hinter der Kaffeetasse und sah sich um. Üblicherweise hielt er mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, doch auf Hadley’s Hope saßen die Kolonisten förmlich aufeinander. Wenn der Kolonieverwalter hinter ihrem Rücken schlecht über andere redete, konnte das das Klima empfindlich stören. Allerdings war es nicht Annie Jordens wilde, widerspenstige Lockenpracht, die ihm so missfiel, oder dass Russ immer so aussah, als hätte er am vorigen Abend einen über den Durst getrunken.
»Die Vermesser sind schon ein wilder Haufen, was?«, murmelte Al.
»Und sie machen Ärger. So sieht’s aus«, entgegnete Hansard und deutete mit dem Kinn auf die kleine Gruppe, die noch immer verzückt um das Baby herumstand. Otto Finch war vor Tim – dem jungen Sohn der Jordens – in die Hocke gegangen und überreichte ihm ein pelziges Plüschtier. »Die Jordens selbst sind ja ganz nett. Nur um den Jungen mache ich mir Sorgen.«
Al sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Das gefiel ihm ganz und gar nicht.
»Inwiefern?«
Hansard verzog das Gesicht, als bereute er, so viel preisgegeben zu haben.
»Greg, du hast damit angefangen«, sagte Al. »Ich bin der Verwalter hier. Wenn du der Ansicht bist, dass es ein Problem geben könnte, muss ich der Sache nachgehen.«
»Kommt drauf an, was du unter ›Problem‹ verstehst.«
Al blickte wieder zu den Jordens hinüber. Die Eltern wirkten erschöpft, lächelten aber auch glücklich und waren sichtlich stolz auf ihre kleine Familie. Offiziell waren sie von der Kolonie als Landvermesser angestellt, doch wie etwa die Hälfte des Vermessungsteams arbeiteten sie nebenbei als freiberufliche Prospektoren. Sie suchten die Planetoidenoberfläche nach Erzlagerstätten, eingeschlagenen Meteoriten und allem anderen ab, was für den Konzern von Wert sein konnte. Das von Weyland-Yutani bereitgestellte Forschungsteam beauftragte sie mit der Beschaffung von Boden- und Erzproben sowie mit der Kartierung bestimmter Planetoidensektoren. Solche Expeditionen waren immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
»Na ja, sie leben ja nicht nur gefährlich«, sagte Hansard nachdenklich, »sondern sie bekommen auch Kinder. Klar, darum geht’s hier ja überhaupt. Aber diese freiberufliche Schürferei ist ein riskantes Geschäft, und mir scheint, dass Annie und Russ die Gefahr noch nicht so ganz begriffen haben. Schlimm genug, wenn die Kinder ihre Eltern verlieren. Wer soll sie dann aufziehen? Aber die Jordens … nun, die gehen noch einen Schritt weiter. Erst heute ist Russ zusammen mit Tim im Traktor zehn Meilen weit nach Norden gefahren.«
Al starrte ihn an. »Echt?«
Hansard nickte. »Aber ich will kein Drama daraus machen. Jedenfalls nicht heute Abend. Nur – für das Kind ist es dort draußen nicht sicher. Ich hab mehr verdammte Atmo-Stürme erlebt als die meisten hier, und wenn der Traktor feststeckt …«
Al hob die Hand. »Da bin ich ganz deiner Meinung. Leider gibt es kein Gesetz, das es ihnen verbietet. Ich habe bereits mit mehreren Prospektoren gesprochen, aber die halten das Ganze wohl für eine Art Familienbetrieb – wie Bauern, die ihre Kinder mit aufs Feld nehmen, um sie auf die Zukunft vorzubereiten und ihnen eine Vorstellung von ihrem eigenen Grund und Boden zu vermitteln.«
»So ein Blödsinn.«
»Mir gefällt das ja auch nicht.« Al kratzte sich den Nacken. Plötzlich war er todmüde. »Um ehrlich zu sein: Ich mache Weyland-Yutani dafür verantwortlich.«
Hansard hob eine Augenbraue. »Das sind gefährliche Ansichten, Al. Eine solche Bemerkung kann dich den Job kosten.«
»Wir versuchen, auf diesem gottverlassenen Felsbrocken so etwas wie eine Zivilisation aufzubauen. Ich glaube, denen sind meine Ansichten völlig egal, solange ich nur meine Pflicht erfülle. Seit wann bist du denn so ein glühender Anhänger der Firma?«
»Bin ich nicht«, räumte Hansard ein. »Aber ich werde gut bezahlt, und wenn ich von hier verschwinde – wenn meine Arbeit endlich erledigt ist –, hoffe ich auf einen etwas angenehmeren Job. Scheiße, ich frage mich schon seit meinem ersten Tag hier, wem ich ans Bein gepinkelt habe, um auf Acheron zu landen.«
»Nun, anscheinend hält man große Stücke auf dich. Diesen Ort hier bewohnbar zu machen ist weiß Gott keine leichte Aufgabe.« Al nahm noch einen Schluck. Der Kaffee wärmte ihn, der Alkohol entspannte. Ganz egal, wie stark die Koloniegebäude beheizt wurden, er fror ständig. Wir sind hier einfach zu weit von der Sonne entfernt, dachte er.
Er sah sich um, ob ihnen auch niemand zuhörte.
»Ich meine ja nur, dass sie bevorzugt Glücksritter und Dummköpfe als Kolonisten rekrutieren«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Von denjenigen, die alle Brücken hinter sich abgebrochen haben und jetzt ein neues Leben anfangen wollen, ganz zu schweigen.«
»Aber die Jordens magst du trotzdem«, sagte Hansard.
Al zuckte mit den Schultern. »Ich mag sie, aber sie sind zu risikofreudig, jagen zu verzweifelt dem Geld hinterher. Das Forschungsteam setzt die Prospektoren ein, weil sie sich nicht scheuen, Risiken einzugehen. Ich befürchte nur, dass sie uns irgendwann alle einem Risiko aussetzen. Bis diese Kolonie funktionstüchtig und voll belegt ist, dauert es noch Jahre. Mindestens ein Jahrzehnt. Bis dahin kann viel schiefgehen.«
Er sah zu Annie Jorden hinüber, die ihr Kind fest in den Armen hielt, seine weichen Wangen küsste und ihm liebende Worte ins Ohr flüsterte. Russ war neben dem kleinen Tim in die Hocke gegangen. Der Junge schmollte mit trotzig verschränkten Armen. Anscheinend war er auf das Baby eifersüchtig.
»Denk an meine Worte«, sagte Al. »Wenn wir auf diesem verdammten Felsen jemals in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, dann genau wegen solcher Leute.«
4
ANKUNFT
16. Mai 2179
Zum ersten Mal in Jernigans Berufsleben sah es so aus, als würde er ein Schiff plündern, nach dem er nicht einmal gesucht hatte. Während er in der Luftschleuse, die zum Bergungskorridor führte, in seinen Anzug schlüpfte, beobachtete er seine beiden Geschäftspartner und fragte sich, was sie wohl gerade dachten.
Nun, bei Landers war das nicht so schwer zu erraten. Der gierige Bastard freute sich schon auf die Schätze, die es in dem Geisterschiff zu entdecken galt. Fleet jedoch … Fleet war ein Mysterium. Jernigan hatte drei Jahre und vier Expeditionen lang vergeblich versucht, schlau aus ihm zu werden. Landers hatte nur gelacht und Jernigan geraten, es aufzugeben. Für ihn war Fleet beinahe ein Außerirdischer. Doch Jernigan blieb hartnäckig.
»Zielobjekt erfasst«, meldete sich eine verzerrte Stimme in seinem Kopfhörer. Es war Moore, der auf dem Flugdeck als ihre Augen und Ohren fungierte. Worüber Jernigan heilfroh war.
»Irgendwelche Hinweise darauf, wo es herkommt?«, fragte Jernigan.
»Negativ. Keine Notsignale, kein Funkkontakt, keine Lebenszeichen. Während ihr euch in eure Anzüge geworfen habt, habe ich das Schiff mindestens zwölfmal angefunkt. Nichts. Keine automatische Antwort vom Bordcomputer. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Nachrichten überhaupt angekommen sind. Nur Totenstille.«
»Was hältst du davon?«, fragte Landers. »Vielleicht ein altes Militärshuttle?«
»Auf keinen Fall«, meinte Moore. Landers ließ enttäuscht den Kopf hängen. Rein rechtlich gesehen war es verboten, Militärbesitz zu bergen, doch so weit hier draußen gab es niemanden, der kontrolliert hätte, was sie plünderten und an den Höchstbietenden verkauften. Normalerweise suchten sie sich beschädigte oder aufgegebene Schiffe und Raumstationen. Deren Positionen erhielten sie üblicherweise von der Firma, der das Wrack gehörte, gelegentlich aber auch von Privatleuten, die über gute Beziehungen verfügten und sich über den Wert einer solchen Bergungsexpedition im Klaren waren.
Oft genug handelte es sich dabei um zweifelhafte Informationen aus zwielichtigen Quellen. Mehrmals hatte Jernigan ein Schiff geentert, das eindeutige Anzeichen einer Zwangsräumung oder krimineller Aktivitäten aufgewiesen hatte. Einmal war er sogar auf die Spuren eines Feuergefechts gestoßen.
Die Bergung von Schiffswracks im Weltraum war nicht gerade ein respektabler Broterwerb. Jernigan interessierte es jedoch einen feuchten Dreck, was andere Leute von ihm dachten. Er hatte seine eigene Moral, und er war stolz darauf, einer Arbeit nachzugehen, für die die meisten wohl nicht den Mumm hatten.