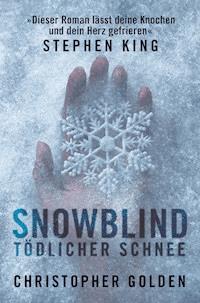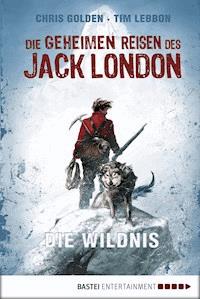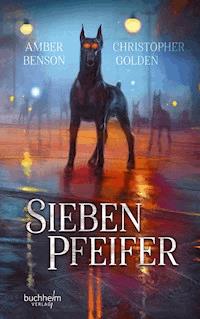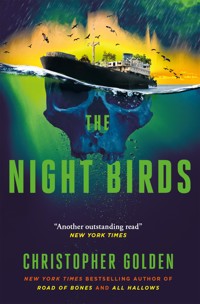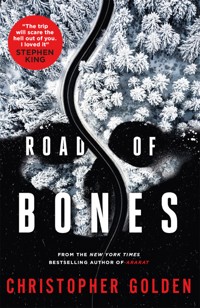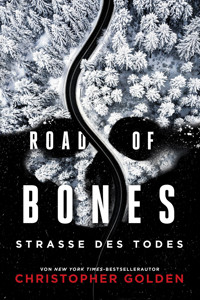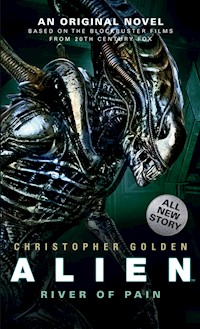Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buchheim Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: BLUTBESUDELTE WELTEN
- Sprache: Deutsch
Hinter dem Regenbogen läuft etwas schief … 1933. Verheerende Staubstürme verwandeln Kansas in ein Ödland. Das Wasser ist knapp, die Ernte verdorrt. Die Einwohner der Kleinstadt Hawley haben jede Hoffnung aufgegeben. Als schwere Unwetter aufziehen, erfährt die neunjährige Gayle Franklin auf barbarische Weise, dass das wahre Grauen erst bevorsteht. Denn nicht Regen benetzt die Äcker, sondern Blut. Und so schön der Regenbogen nach dem Sturm auch sein mag, an seinem Ende wartet kein Topf mit Gold – sondern die teuflischen Kreaturen von Oz. Monsters and Critics: "Du wirst das Land hinter dem Regenbogen mit neuen Augen sehen. Man kann nur hoffen, dass Golden und Moore ihre Hände von 101 Dalmatiner lassen." Ray Garton: "Einer der gruseligsten Romane, die ich gelesen habe. Golden und Moore haben offenbar Spaß daran, die magische Welt von Oz in einen Albtraum zu verwandeln."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von
Kristof Kurz
Grimma
Buchheim Verlag
2020
Deutsche Erstausgabe
ISBN E-Book: 978-3-946330-16-5
Auch als Vorzugsausgabe
Limitiert auf 555 Exemplare
Signiert von Christopher Golden, James A. Moore & Glenn Chadbourne
© 2020 Buchheim Verlag, Olaf Buchheim, Grimma
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagzeichnung: Arndt Drechsler
Übersetzung: Kristof Kurz
Lektorat: Claudia Pietschmann
www.buchheim-verlag.de
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
BLOODSTAINED OZ
Copyright © 2005 by Christopher Golden and James A. Moore
published in agreement with the author,
c/o BAROR INTERNATIONAL, INC.,
Armonk, New York, U.S.A.
© 2005 Vorwort: Ray Garton
Diese Geschichte ist unseren Ehefrauen Bonnie Moore und Connie Golden gewidmet, die uns jeden Tag tausend Gründe zum Lächeln geben; Glenn Chadbourne und Paul Miller – Künstler und Verleger –, beide Gentleman, die uns immer wieder anfeuerten; und L. Frank Baum, der solch erstaunliche Geschichten und eine phänomenale Welt voller Schätze schuf.
Vorwort
Wir sind nicht mehr in Oz
Manchmal komme ich mir vor wie aus einer anderen Welt. Als ich noch ein kleiner Junge war, gab es drei Fernsehsender. Mehr nicht. Erst später kamen mit dem Kabelfernsehen weitere dazu. Wenn man einen Film sehen wollte, musste man ins Kino gehen, solange er noch lief. Bei besonders erfolgreichen Filmen hatte man etwas länger Zeit, da diese mehrere Wochen hintereinander gezeigt wurden. Danach blieb einem nichts anderes übrig, als ein oder zwei Jahre zu warten, bis er ins Fernsehen kam – stark geschnitten, mit Werbepausen und auf TV-Format zusammengestaucht.
Der Zauberer von Oz wurde genau einmal pro Jahr im Fernsehen gezeigt. Das war für mich und meine Freunde immer ein großes Ereignis. Wir verpassten den Film nie und sprachen vorher und nachher von nichts anderem.
Damals wie heute ist Der Zauberer von Oz mein Lieblingsfilm, weil er einfach alles zu bieten hat: Er ist lustig, faszinierend, magisch – und nicht zuletzt verflucht gruselig. Egal wie oft wir den Film sahen, die Hexe und ihre verdammten fliegenden Affen jagten uns jedes Mal einen Heidenschreck ein.
Der Zauberer von Oz war neben Peter Pan auch mein Lieblingsbuch – aus denselben Gründen, aus dem er auch mein Lieblingsfilm war. Außerdem ist das Buch viel blutiger als der Film. Da rollt eine ganze Menge abgetrennter Köpfe.
Doch zurück zum Film: Er wurde einmal im Jahr gezeigt, und für uns Kinder war das so etwas wie ein hoher religiöser Feiertag. Zwei Stunden lang blieb die Zeit stehen, und wir ließen uns aus unseren Wohnzimmern in ein zauberhaftes Land der Hexen, Munchkins und griesgrämigen Apfelbäume entführen.
Heutzutage ist selbstverständlich alles anders. Da alles vom Einspielergebnis des ersten Wochenendes abhängt, laufen nur wenige Filme noch wochenlang im Kino. Monate später tauchen sie dann in den Streamingdiensten auf, werden auf Blu-Ray und DVD veröffentlicht und am Ende im Kabelfernsehen ausgestrahlt.
Der Zauberer von Oz wird nach wie vor jedes Jahr im Fernsehen gezeigt, doch es ist nicht mehr dasselbe. Wenn man ihn sehen will, muss man nicht länger auf den Sendetermin warten, sondern holt sich einfach die DVD, wenn man sie nicht sowieso schon im Regal stehen hat.
Auf gewisse Weise hat das dem Film etwas von seinem Zauber genommen. Es war etwas ganz Besonderes, ihn nur einmal im Jahr sehen zu können. Jetzt ist er ein Film wie alle anderen auch – zwar immer noch mein Lieblingsfilm, aber eben: ständig verfügbar.
Ich habe Der Zauberer von Oz unzählige Male gesehen. Ich kann die Lieder mitsingen und die Dialoge mit den Schauspielern mitsprechen. Wie Millionen andere Leute auch, da bin ich mir sicher. Wenn Judy Garland »Somewhere over the Rainbow« trällert, wird mir ganz warm ums Herz, und wenn sich Dorothy von ihren neuen Freunden aus Oz verabschiedet, bekomme ich auch heute noch feuchte Augen. Diesem bemerkenswerten Film scheint der Zahn der Zeit nichts anhaben zu können, und er wird auch zukünftige Generationen begeistern. Der Film und das Buch waren – als Kind und als Erwachsener – stets ein Trost für mich. In seiner Welt fühlte ich mich sicher.
Doch nun zu Blutbesudelt OZ. Wir alle haben Der Zauberer von Oz Dutzende Male gesehen und vielleicht sogar die Bücher gelesen. Christopher Golden und James A. Moore sind sich dessen bewusst – und sie bestrafen uns dafür, dass wir dieser zeitlosen, magischen Geschichte so verfallen sind, indem sie uns mit den allseits bekannten und beliebten Elementen der Oz-Geschichte eine Scheißangst einjagen wollen.
Das ist ihnen gelungen.
Für jeden, der diese Novelle gelesen hat, wird Oz niemals mehr so sein wie zuvor. Ob man den Film sieht oder die Bücher liest: Blutbesudelt OZ wird einem dabei stets im Kopf herumspuken und mit fieser, zischender Stimme flüstern: Du bist hier nicht mehr sicher.
Golden und Moore verstehen sich auf geschliffene, sparsame Prosa – und sie setzen sie geschickt ein, um die Axt an eine der beliebtesten Geschichten der Welt anzulegen. Sie haben eine diebische Freude daran, die Figuren und Kreaturen dieser Traumwelt in Albträume zu verwandeln.
Blutbesudelt OZ ist die unheimlichste Geschichte, die ich seit Langem gelesen habe. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich drüber weg bin. Sie schont den Leser nicht und gönnt ihm auch keine Atempause, sie ist so unbarmherzig wie Furcht einflößend – und mehr werde ich Ihnen an dieser Stelle nicht darüber verraten.
Bestimmt verbinden Sie mit Der Zauberer von Oz viele schöne Erinnerungen. Wissen Sie noch, wie Sie den Film als Kind gesehen haben, wie Sie über die technicolorbunten Munchkins und die gute Hexe Glinda gestaunt haben, über die tanzende Vogelscheuche, den armen Blechmann, der sich ein Herz wünscht, und den ängstlichen Löwen, der so gerne König des Dschungels sein will? Vielleicht hat Ihnen Ihre Mutter ja auch aus dem Buch vorgelesen, oder Sie haben unter der Bettdecke selbst darin geschmökert. Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal ganz genau, wie sehr Sie diese Geschichte lieben.
Denn damit ist es spätestens jetzt vorbei …
Ray Garton
Dezember 2005
Anderson, Kalifornien
Eins
Im Sommer des Jahres 1933 blieb den braven Bürgern von Hawley in Kansas nichts anderes übrig, als ihre Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft auf Dachböden, in Kellern und in Abstellkammern zu verstauen – wie etwas, von dem man sich einredet, dass man es irgendwann einmal gebrauchen kann, obwohl man in Wirklichkeit nur zu sentimental oder zu geizig ist, um es wegzuwerfen. Das Leben war nicht nur hart, es war eine staubige Hölle; doch das hieß nicht, dass es nicht noch schlimmer kommen konnte. Zumindest diese Lektion hatten die Einwohner von Hawley in den letzten beiden Jahren gelernt: Es konnte immer noch schlimmer kommen.
Die zwanziger Jahre waren eine Zeit des Aufschwungs gewesen. Durch die große Nachfrage nach Weizen war der Preis in die Höhe geschnellt. Die Great Plains hatten sich in ein viele Millionen Hektar großes Getreidefeld verwandelt. Wenn man den Zeitungen Glauben schenken wollte, wurden bei der Rekordernte von 1931 über drei Millionen Tonnen Weizen eingefahren. Bei dieser riesigen Menge fiel der Weizenpreis, der im Vorjahr noch achtundsechzig Cent pro Bushel betragen hatte, auf fünfundzwanzig.
Farmen wurden aufgegeben, Felder lagen brach, und viele verloren den Mut und zogen fort.
Die meisten Einwohner Hawleys jedoch hatten Vertrauen in ihr Land. Viele konnten sich noch an die alten Zeiten erinnern, als sie in Kansas angekommen und mühsam ihre Siedlungen und Häuser in der Prärie errichtet hatten. Der Pioniergeist war ihnen geblieben, und genau wie die Pioniere wussten sie, was man tun musste, um zu überleben: Man betete frühmorgens und abends, und dazwischen arbeitete man den lieben langen Tag im Schweiße seines Angesichts.
Die Bauern vergrößerten ihre Kuhherden, verkauften die Sahne und fütterten die Hühner und Schweine mit der entrahmten Milch. Doch es war nicht der Weizenpreis allein, der dem Land zum Verhängnis wurde.
Es war der Zorn Gottes.
Das behauptete jedenfalls Gayle Franklins Daddy. »Ganz recht, mein Schatz, der Zorn Gottes. Wir hätten auf das Land achtgeben müssen, hat er uns nicht deshalb hierhergeführt? Aber die Leute sind gierig geworden.«
Gayle hatte große Angst vor Gott.
Schon 1932 war ein trockenes Jahr gewesen, und es wurde immer schlimmer. Staub bedeckte die brachliegenden Felder. Noch nie habe er so einen Wind erlebt, wie er jetzt übers Land pfiff, erzählte Bart Franklin seiner kleinen Tochter, noch nie solche Stürme, wie sie von Zeit zu Zeit über sie hinwegzogen. Biblisches Wetter, so nannte er es. Sengende Hitze, Dürre und Windböen, die die wenigen Feldfrüchte, die noch wuchsen, unter einer Staubschicht begruben.
Diese endlose trockene Ödnis wurde als Dust Bowl bekannt. Die Staubschüssel.
Als Gayles Daddy einmal einen Whiskey zu viel getrunken hatte, sagte er, dass dieser Ausdruck zu niedlich und beinahe heimelig klang. Das hier sei keine Staubschüssel, sondern die Hölle. Gayle war sich sicher, dass er das nicht ernst gemeint hatte.
Obwohl …
Als der Boden zu trocken wurde, um Weizen und anderes Getreide darauf anzubauen, verlegten sich die Bauern auf Disteln. Als auch die Disteln eingingen, packten viele, die bisher durchgehalten hatten, ihre Sachen und zogen weg. Gayles Mutter und Vater blieben. Sie ließen sich nicht unterkriegen. Dann gruben sie eben Seifenwurz aus der kreidigen Erde, stopften sie in die Futtermühle und gaben sie den Tieren zu fressen. Mr. Yancey, ihr nächster Nachbar, bemühte sich ebenfalls nach Kräften, über die Runden zu kommen. Irgendwann fand ihn sein Sohn Chester tot in der grellen Sonne liegend. Herzinfarkt.
Blizzards, Tornados und Staubstürme suchten das Land heim, als wäre das Ende der Welt gekommen, und entwurzelten einen Großteil der Pflanzen. Große schwarze Wolken machten den Tag zur Nacht. Viele kapitulierten vor den Elementen und verzweifelten. Doch die Pioniere überlebten.
Die Bauern der Dust Bowl im Allgemeinen und die Bewohner von Hawley in Kansas im Besonderen waren der festen Überzeugung, dass sie alles, was ihnen aufgebürdet wurde, überstehen konnten, und auch Gayle Franklin zweifelte insgeheim nicht daran. In dieser Hinsicht war Gayles Daddy ein leuchtendes Vorbild.
Egal wie schlimm es noch werden mochte: Alles ließ sich überstehen, wenn sie den Glauben nicht verloren. Den Glauben an das Land und an sich selbst.
Eine törichte Vorstellung.
An einem glühend heißen Julinachmittag saß die neun Jahre alte Gayle auf der Veranda ihres Elternhauses und betrachtete ihre schmutzigen Füße. Sie hielt ein mit Wasser gefülltes Glas in der Hand, nahm einen Schluck, fuhr mit der Zunge über die gesprungenen Lippen und genoss die Feuchtigkeit. Das Wasser war zwar warm, im Vergleich zur Hitze des Tages aber immer noch kühl. Sie sah sich um, ob jemand sie beobachtete, dann ließ sie ein paar Tropfen auf ihren linken Fuß fallen und betrachtete fasziniert die dunklen Schmutzstreifen, die sie auf ihrer Haut hinterließen. Es hatte seit fast einem Monat nicht mehr geregnet, und wenn Daddy mitbekam, dass sie Wasser verschwendete, würde er ihr den Hintern versohlen. Aber es fühlte sich gut auf der Haut an und sah interessant aus.
Ein Windstoß rüttelte an der Haustür. Das kleine Mädchen runzelte die Stirn und sah nach Westen, in die Richtung, aus der der Wind gekommen war.
Der Horizont war pechschwarz. Schwarze Wolken fraßen den blauen Himmel. Ein Sturm war im Anzug. Endlich Regen, dachte Gayle. Doch wenn der Sturm zu heftig wurde, gab es zwar Wasser, aber keine Pflanzen mehr.
Eine weitere Bö fuhr in ihr Haar. Staub brannte in ihren Augen. Sie hob die Hand, um ihn abzuwischen. Der Wind schlug die Tür immer wieder auf und zu.
Dann ließ der Wind einen winzigen Augenblick lang nach. Sie sah ihren Daddy, der in einiger Entfernung durchs Maisfeld ging. Die Pflanzen waren von der Trockenheit welk, trotzdem konnten sie sich glücklich schätzen: Den meisten Bauern in Hawley war der Mais in diesem Sommer eingegangen. Eine dunkle, steife Gestalt pendelte zwischen den Stauden hin und her – die Vogelscheuche, die Daddy aufgestellt hatte, sobald die Pflanzen einigermaßen gewachsen waren.
»Ein frommer Wunsch«, hatte Momma dazu gesagt. Gayle wusste nicht so recht, wie sie das gemeint hatte, aber besonders nett hatte es nicht geklungen.
Daddy drehte sich um und ging mit dem stärker werdenden Wind im Rücken auf sie zu. Plötzlich fegte eine heftige Bö über sie hinweg, und ein Krach ertönte, so laut wie Daddys Schrotflinte. Die Vogelscheuche kippte um und purzelte über das Feld. Der Wind hatte die Holzstange, an der sie befestigt war, glatt auseinandergebrochen.
Noch hatte der Sturm das Farmhaus nicht erreicht.
Gayle beobachtete gespannt, wie die schwarze Wand auf sie zukam.
Dann flaute der Wind ab. Ihr Haar fiel wieder auf ihre Schultern und die Tür schlug nicht länger auf und zu, aber sie ließ sich nicht täuschen.
Der Sturm war noch längst nicht vorüber, und er brachte die Finsternis mit sich.
Zwei
Die Wärter der Haftanstalt Guilford wussten eigentlich gar nicht so genau, woran die Insassen überhaupt arbeiteten. Angeblich hoben sie Bewässerungsgräben aus, doch das war bei diesem trockenen, harten Boden etwa so sinnvoll wie Schafen Wollpullover zu stricken. Wenn es regnete, was selten genug vorkam, wurde die Prärie ein, zwei Tage lang regelrecht überflutet, und dann war das Wasser auch schon wieder versickert und der Boden noch unfruchtbarer als vorher. Immerhin – die Zisternen füllten sich.
Bewässerungsgräben waren nur sinnvoll, wenn man das Wasser eines Flusses umleiten wollte, und im Umkreis von zehn Meilen um Hawley in Kansas war jeder noch so kleine Bach längst ausgetrocknet. Manchmal wurden die Gefangenen losgeschickt, um die kärgliche, mühselig dem Boden abgetrotzte Ernte an Weizen und Mais einzubringen. Häufiger jedoch pflückten sie einfach nur Disteln und Gestrüpp als Futter für die Tiere. Ohne die harte Arbeit ihrer Insassen hätte niemand in der Haftanstalt, ob Gefangener, Wärter oder Direktor, etwas zu essen auf dem Teller gehabt.
Die Bewässerungsgräben jedoch … Bei der Arbeit daran kam sich Hank Burnside vor, als würde er sein eigenes Grab schaufeln.
Die mit Schrotflinten und Gewehren bewaffneten Wärter suchten so weit wie möglich den Schatten und hielten sich von der sengenden Sonne fern, was für die Häftlinge Fluch und Segen zugleich war. Einerseits waren die Wärter viel zu träge, um die Gefangenen zum bloßen Vergnügen zu drangsalieren, wie sie es bei kühleren Temperaturen oft taten. Die Hitze sorgte jedoch auch dafür, dass ihnen schnell der Geduldsfaden riss. Die Gefangenen taten also gut daran, sie nicht zu provozieren.
Hank hielt inne, rammte die Schaufel in den Boden und stützte sich darauf. Er zog einen Lappen hervor und wischte sich mit übertriebener Geste den Schweiß von der Stirn. Die Wärter sollten ruhig mitbekommen, wie hart er arbeitete. Doch als er die Schaufel wieder aufnahm und in die lockere, trockene Erde stieß, tat er dies mit langsamen Bewegungen, um sich nicht zu überanstrengen. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie andere Gefangene vor Erschöpfung zusammengebrochen und im Dreck liegen geblieben waren, und hatte nicht vor, dieses Schicksal zu teilen. Solange er so tat, als würde er hart arbeiten, würde ihm kein Wärter zu nahe kommen.
Das war bei dieser Hitze sowieso viel zu anstrengend.
Er umklammerte den Griff der Schaufel noch fester mit den schwieligen Händen. Nach zwei langen Jahren im Lager hatte er sich an die ständige Erschöpfung gewöhnt. Mit dem gestrigen Tag hatte er die Hälfte seiner Haftstrafe verbüßt, und es lagen weniger Tage in Gefangenschaft vor als hinter ihm. Dieser Gedanke machte die Hitze, den Schweiß, die schmerzenden Knochen, den an der Haut klebenden Schmutz und den Staub, der in den Augen brannte, etwas erträglicher.
Das Schaufelblatt stach mit einem kratzenden Schabgeräusch in das graue, lockere Erdreich. Hank hielt inne. Der Schweiß, der seinen Rücken hinunterlief, fühlte sich auf der sonnenverbrannten Haut beinahe kühl an, und er schauderte.
Plötzlich kam Wind auf. Er drehte schnell den Kopf zur Seite, um keinen Staub zu schlucken.
»Grundgütiger, sieh dir das an.«
Hank legte schützend eine Hand über die Augen und spähte in Richtung Horizont. Der Anblick verschlug ihm den Atem. In vier bis fünf Meilen Entfernung endete die sonnenverbrannte Erde vor einer tiefschwarzen Mauer, einer brodelnden Wolke aus kohlschwarzen Schatten, als hörte die Welt vor einem bodenlosen Abgrund einfach auf.
»Scheiße auch, Hank, hast du schon mal so einen Sturm gesehen?«, fragte Terry Pritcher, ein Viehdieb, der seit seinem siebzehnten Lebensjahr hier einsaß. Vierzehn Jahre Feldarbeit hatten ihm zu einem sehnigen, muskulösen Körper verholfen, ihn aber leider nicht schlauer gemacht.
Hank schüttelte den Kopf, ohne Terry anzusehen. »Noch nie.«
Sekunden später zerrte heftiger Wind an ihnen und wirbelte den Staub auf. Die winzigen Körner peitschten gegen ihre Haut. Hank hielt sich die Hände vors Gesicht und konnte trotzdem den Blick nicht vom Sturm abwenden.
Er kam genau auf sie zu.
Der Himmel über ihnen verdunkelte sich.
»Was sollen wir machen, Boss?«, fragte er den nächsten Wärter. »Wir sollten uns irgendwo unterstellen, meinen Sie nicht?«
Dicke, warme Regentropfen fielen auf ihn herab, doch anstatt die Hitze zu lindern, schienen sie Hank regelrecht zu verbrühen. Der trockene, durch die Luft wirbelnde Staub saugte die Feuchtigkeit gierig auf.
Der Wärter, ein gewisser J. D. Cotton, runzelte die Stirn, blickte dann aber doch in die Richtung, in die Pritcher zeigte. Sobald er das tat, folgten alle anderen, die Wärter wie auch die zur Zwangsarbeit abkommandierten Gefangenen, seinem Beispiel.
Die Oberkante des Staubsturms wurde immer breiter, dehnte sich aus, als wollten die dunklen, grimmigen Wolken die ganze Welt verschlingen. Schon bald hatten sie die Sonne völlig verdeckt. Aus helllichtem Tag wurde Nacht, und sie waren dem Wind und dem Staub schutzlos ausgeliefert.
»Na schön, Männer.« Cotton hob die Schrotflinte und schoss in die Luft. »Setzt euch in Bewegung, aber bleibt zusammen. Wer das für eine günstige Gelegenheit hält, die Fliege zu machen, kann sich schon mal auf ein paar Schrotkugeln in den Eiern freuen. Na los!«
Die Männer brachten die Schaufeln und Schubkarren zu den Lastwagen hinüber und luden sie ein.
Dann veränderte sich etwas in der Luft.
Hank spürte es und blieb stehen. Sein Hintermann lief in ihn hinein.
»Himmelarsch, Burnside, was zum Teufel ist los mit dir?«, bellte eine wütende Stimme.