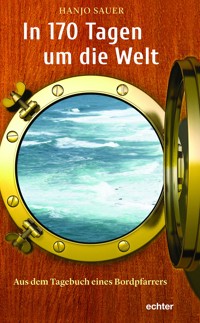Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
1949 gründete Hermann Gmeiner in Imst im österreichischen Tirol das erste SOS-Kinderdorf. Waren es in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anfangs in einem nicht unerheblichen Umfang Waisenkinder, die in einem SOS-Kinderdorf lebten, sind es heute meist Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen, die Unterstützung und Förderung erfahren. Heute gibt es weltweit in 138 Ländern Kinderdörfer, Jugendwohngemeinschaften, Schulen, Berufsausbildungszentren und familienstärkende Angebote. Hanjo Sauer hat seit seiner Begegnung mit Hermann Gmeiner über mehrere Jahrzehnte hauptamtlich und ehrenamtlich in unterschiedlichen Funktionen die Entwicklung der SOS-Kinderdörfer begleitet. Hier beschreibt er seine Erfahrungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanjo Sauer
Alle Kinder dieser Welt
sind unsere Kinder
Hanjo Sauer
Alle Kinder dieserWelt sindunsere Kinder
Begegnung mitHermann Gmeiner
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf die Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2024
© 2024 Echter Verlag GmbH, Würzburg
Umschlag: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen
Coverbild: Hanjo Sauer
Innengestaltung: Crossmediabureau, Gerolzhofen
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05952-1
978-3-429-06655-0 (PDF)
978-3-429-06656-7 (ePub)
Inhalt
Vorwort: Was will dieses Buch?
1)Erste Begegnung mit Hermann Gmeiner
2)Bereit für das neue Projekt
3)Hermann Gmeiner und das SOS-Kinderdorf
4)Von Imst in die Welt
5)Hilfe für Äthiopien
6)Ein SOS-Kinderdorf in Kairo
7)Gewinnung neuer Mitarbeiter
8)Die Ausbildung der Kinderdorfmütter
9)Die Baupläne
10)Mobilität und Ausbau der Mütterschule
11)Besuch von der Frau des deutschen Außenministers
12)Im Apartment in Heliopolis
13)Abschied von Kairo
14)Die Studiengruppe
15)Ein Konzept für die Akademie
16)Eröffnung des Kinderdorfs in Caicó, Brasilien
17)Studie in Israel
18)Wallfahrt nach Assisi
19)Ehrenmitglied des deutschen SOS-Kinderdorf-Vereins
20)Mitarbeit im Verwaltungsrat
21)Vorsitz im Verwaltungsrat
22)Der pädagogische Beirat
23)Feste und Jubiläen
24)Vom Einsteiger zum Urgestein
25)Verabschiedung in Dießen
26)Einkehrtage und Neueingestellten-Tagungen
27)Was bleibt?
28)Chronologie
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Vorwort: Was will dieses Buch?
An Literatur über Hermann Gmeiner, den Gründer der SOS-Kinderdörfer, der von 1919 bis 1986 gelebt hat, herrscht kein Mangel. Insbesondere der frühere Generalsekretär von SOS-Kinderdorf-International Hansheinz Reinprecht, hinsichtlich seiner Profession ein Vollblut-Journalist, hat in immer neuen Anläufen die Geschichte des SOS-Kinderdorfs erzählt und die Bedeutung Hermann Gmeiners zu würdigen versucht. Naturgemäß diente die große Zahl seiner Publikationen vor allem der Werbung für das weltweit agierende Sozialwerk. Reinprecht stand in unangefochtener Loyalität zu Gmeiner und sah es als seine Aufgabe an, die Werbetrommel zu rühren. Dies ist ihm in bewundernswertem Ausmaß gelungen. Historisch-kritische Überlegungen oder die Einbettung seiner Überlegungen in gesellschaftliche und geschichtliche Zusammenhänge lagen ihm fern. Zu Gmeiners Idee schreibt der Historiker Richard Münchmeier, der im Auftrag des deutschen SOS-Kinderdorf-Vereins eine Gesamtdarstellung von dessen Geschichte geschrieben hat, zu Beginn seines Buches sehr anschaulich: „Manchmal sind es die kleinen Ideen, die große Wirkungen erzielen: 1949 gründete Hermann Gmeiner in Imst im österreichischen Tirol das erste SOS-Kinderdorf. Waren es in dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anfangs in einem nicht unerheblichen Umfang Waisenkinder, die in einem SOS-Kinderdorf lebten, sind es heute hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus schwierigen Lebenslagen, oft komplizierten Familienverhältnissen, belastenden sozialen Situationen, die Hilfe, Unterstützung und Förderung durch das SOS-Kinderdorf erfahren. Seit den Anfängen 1949 sind über den ganzen Globus verteilt in 133 Ländern Kinderdörfer, Jugendwohngemeinschaften, Schulen, Berufsausbildungszentren, zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien entstanden.“1 Mehrere Versuche, eine Biografie Gmeiners zu schreiben, die heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, kamen über erste Ansätze nicht hinaus. Meine Überlegungen sind weit davon entfernt, dieses Defizit aufzuarbeiten. Es sind sehr persönliche Gedanken, die vor allem einem Anliegen dienen: mir und anderen Rechenschaft abzulegen über die Begegnung mit Hermann Gmeiner und deren Folgen. Zu den großen Stärken Gmeiners hat es gehört, Menschen anzusprechen und für sein Anliegen der Sorge für verlassene Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Diese Menschen waren sehr unterschiedlich. Aber alle verband der Gedanke, den Dienst für das SOS-Kinderdorf nicht nur als einen Beruf, sondern als eine Berufung zu sehen. In den frühen Jahren, als finanzielle Mittel an allen Ecken und Enden fehlten, gehörte eine außerordentliche Portion von Idealismus dazu, sich auf Einschränkungen einzulassen und auf eine berufliche Karriere zu verzichten. Als ich 1974 beim Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e. V. angestellt wurde, war die Entlohnung noch durchaus bescheiden, aber je mehr in den Führungsgremien die Frauen und Männer der ersten Stunde durch Menschen mit hoher beruflicher Kompetenz ersetzt wurden, musste sich das Engagement des Einsatzes nicht mehr in finanziellen Einschränkungen abbilden. Für nicht wenige, die zum Urgestein gehörten, stellte sich die Frage, ob es mit dem Idealismus des Anfangs nun vorbei sei. Tatsächlich hat sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten, in denen ich die weitere Entwicklung des SOS-Kinderdorfs aus nächster Nähe mitverfolgen konnte, eine enorme Dynamik an jeweils neuen Herausforderungen und Aufgabenstellungen entwickelt. Einiges davon versuche ich in diesem Buch nachzuzeichnen.
Das SOS-Kinderdorf versteht sich als ein Sozialwerk. Soziale Beziehungen machen den Kern der Sache aus. Beziehungen in erster Linie zu den betreuten Kindern und Jugendlichen, um die sich im Grunde alles dreht, dann aber auch – ebenso wichtig – Beziehungen unter den Erwachsenen, die sich der gemeinsamen Aufgabe verschrieben haben. Für mich besteht Gmeiners Sozialwerk aus vielen Gesichtern, Menschen, die ich weltweit kennengelernt habe. Unter ihnen gab es nicht wenige Originale mit allen dazugehörigen Schrullen und liebenswerten Eigenarten. Mit einigen von ihnen habe ich mich bewusst angelegt, nicht auf Grund einer persönlichen Feindschaft, sondern auf Grund sehr verschiedener Ansichten und Überzeugungen. Gmeiner selbst war im Hinblick auf Konfliktfreudigkeit ein Vorbild. Er verstand es, die Menschen in seiner engsten Umgebung aufs äußerste herauszufordern. Wozu? Er wollte unter allen Umständen wissen, wie es um diese Menschen stand. Ob er sich bedenkenlos auf sie verlassen kann. Aber regelmäßig nach dem Donnerwetter begann wieder die Sonne zu scheinen, sodass man sich unwillkürlich fragte: War da was gewesen? Ja, es war etwas gewesen, nämlich eine gemeinsam durchgestandene Konfliktgeschichte.
Vor vielen Menschen, denen ich in diesen Jahren des Dienstes für SOS begegnet bin, habe ich große Hochachtung. Nicht wenige waren für mich ein Maßstab für das eigene Lebensverständnis. Um diesen Gedanken konkret zu machen: Nach vielen Gesprächen und Diskussionen im Zusammenhang mit der Planung eines neuen SOS-Kinderdorfs in Israel musste ich mich von dem damaligen Vorsitzenden und geistigen Mentor des SOS-Kinderdorf-Vereins in Israel, Moshe Kurtz, verabschieden. Er hatte noch vor der nationalsozialistischen Herrschaft in Wien studiert und daher ein Nahverhältnis zur europäischen Kultur. Ich wagte mich auf Grund unseres Vertrauensverhältnisses, ihm sehr persönliche Fragen zu stellen: Wie er mit dem plötzlichen Tod seiner Frau umgegangen sei? Was ihm die jüdische Tradition und Religion persönlich bedeute? Was für ihn das Leben lebenswert mache? Es hat mich sehr berührt, dass Moshe Kurtz, der gläubige Jude, zum Abschied ein „Neues Testament“ aus seinem Bücherregal hervorholte und mir ein Zitat aus dem Johannesevangelium vorlas: „Bleibet in meiner Liebe!“ (Johannes 15,9). Natürlich vergaß er nicht, darauf hinzuweisen, dass für ihn als gläubigen Juden dieser Text „nicht ganz koscher“ sei, aber der Gedanke sei doch trotzdem recht schön. Mich hat diese Geste sehr berührt. Ich habe sie damals so verstanden, dass er als gläubiger Jude mir, dem gläubigen Christen, aufs Äußerste entgegenkomme, um die Gemeinsamkeit für die Sache auszudrücken. Ich habe Moshe Kurtz später nicht mehr getroffen. Er ist kurze Zeit nach meiner Rückkehr nach Österreich verstorben. Zu meinen Aufgaben im Alter wird es noch gehören, eines Tages wieder nach Jerusalem zurückzukehren und einen Stein auf sein Grab zu legen.
Meine Jahre beim SOS-Kinderdorf sind voll von solchen Begegnungen. Von einigen werde ich erzählen können. Manche sind auch im Dunkel der Erinnerung verblasst und es bedarf eines Impulses von außen, sie zu neuem Leben zu erwecken. Allen diesen Menschen schulde ich viel und ich verstehe es als Verpflichtung, meine Dankesschuld abzutragen, mir und ihnen Rechenschaft zu geben, was gewesen ist und was in Zukunft sein soll.
Der Titel dieses Buches nimmt Bezug auf ein Wort von Hermann Gmeiner: „Alle Kinder dieser Welt sind unsere Kinder.“ Dieses Wort ist manchmal missverstanden worden im Sinn einer weltweiten Allzuständigkeit des SOS-Kinderdorf-Vereins. Ich deute es anders und habe gute Gründe, Gmeiners Intention genau zu treffen. Es geht um ein universelles Verantwortungsbewusstsein in dem Sinn, dass uns allen das Wohl und Wehe der Kinder, die auf diesem Planeten leben und aufwachsen, am Herzen liegen muss. Universelles Verantwortungsbewusstsein ist ein hochgestecktes Ideal, denn allzu häufig geht der Trend in die andere Richtung, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen Loyalität und Empathie zu haben. Was gehen mich die Menschen an, die irgendwo ferne und unerreichbar ihr Leben fristen? Die Slogans vieler politischen Lager machen sich diesen tief eingewurzelten Partikularismus zu eigen und werben mit ihm. Das lässt sich von Trumps „America first“ bis zu Viktor Orbáns Traum von einer erfolgreichen Nation und weiter bis zu Giorgia Melonis Verehrung für Benito Mussolini weiterverfolgen. Mit partikulären Bevorzugungen der eigenen Bevölkerungsgruppe lassen sich heute Stimmen gewinnen, mit universalistischen Visionen nicht. So mühsam es auch sein mag, den Sinn für eine Loyalität aller Menschen füreinander – quer durch Kultur, Hautfarbe, Sprache und Religion – durchzuhalten, so wichtig erscheint er mir. Hermann Gmeiner trat engagiert dafür ein, ohne doch jemals die Beschränkungen seiner persönlichen Herkunft zu verleugnen oder aus den Augen zu verlieren. Dieses Engagement macht Gmeiner aktuell.
Dank schulde ich in erster Linie allen, die mich im Rahmen des SOS-Kinderdorf-Vereins auf dem Weg begleitet haben. Ihnen allen ist dieses Buch gewidmet. Mein Dank gilt insbesondere Ilse Schulenberg für die Lektüre des Manuskripts und die Korrekturvorschläge sowie Herrn Reiner Bohlander und Frau Wendler vom Echter-Verlag in Würzburg.
1)Erste Begegnung mit Hermann Gmeiner
Für mich begann alles in Innsbruck. Die Stadt Innsbruck war für mich zu Beginn meines Studiums die Stadt meiner Träume. An der Theologischen Fakultät lehrten damals die Brüder Hugo und Karl Rahner, von denen Elmar Klinger, mein um einige Jahre älterer Mitschüler, der wie ich im Studienseminar Aufseesianum in Bamberg aufgewachsen war und fünf Jahre vor mir sein Abitur am humanistischen Alten Gymnasium in Bamberg absolviert hatte, in allergrößter Hochachtung sprach. „Hier kannst du denken lernen!“, sagte er mir immer wieder. Das machte großen Eindruck auf mich. Klinger wurde später Assistent von Karl Rahner in Münster und lehrte dann selbst Fundamentaltheologie in Würzburg. Begonnen hatte ich mein Studium in Bamberg. Hier gab es eine Philosophisch-Theologische Hochschule, die jedoch eher provinziellen Charakter hatte. Meine Studienerfolge waren so gut, dass ich mich beim Regens des Bamberger Priesterseminars um eine „Beurlaubung“ zum Studium in Innsbruck bewarb. Dieser Begriff „Beurlaubung“ war mir schon damals nahezu absurd vorgekommen, ging es doch nicht darum, einige Jahre Erholung zu genießen, sondern ganz im Gegenteil, sich noch intensiver und gründlicher der Theologie zu widmen. Meine offizielle Begründung war, dass ich mein Studium mit einer Promotion abschließen wolle und dies wäre in Bamberg damals nicht möglich gewesen. Zugute kam mir ein Wechsel des Regens im Bamberger Priesterseminar. Der alte Regens Dr. Ernst Schmitt (1921–1990), der den Klerus in Analogie zum Militär sah, legte großen Wert darauf, eine möglichst große Zahl von Alumnen im Bamberger Priesterseminar zu haben.1 Für persönliche Wünsche und Befindlichkeiten hatte er wenig Sinn. In einem Gespräch hatte er mir unmissverständlich klargemacht, dass ein Wechsel des Studienorts frühestens nach dem Abschluss des Philosophiestudiums nach vier Semestern, also nach dem sogenannten „Admissionsexamen“, möglich sei. So meldete ich mich nach diesen ersten vier Semestern unverzüglich beim neuen Regens Rudolf Nickles (1912–2004), einem grundgütigen und sehr einfühlsamen Mann. Für Alumnen in Bamberg kamen als Studienorte außerhalb nur das von Jesuiten geführte St. Georgen bei Frankfurt, die Theologische Fakultät in Innsbruck und das Germanicum in Rom mit dem Studium in der Gregoriana in Frage. Seit der Neuaufstellung des Lehramts der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert hatten die Jesuiten in der Ausbildung der Führungseliten also faktisch eine Monopolstellung. Für mich gab es überhaupt kein Zögern: Ich wollte nach Innsbruck. Dort gab es ein internationales Konvikt, das sogenannte „Canisianum“. Es wurde von Jesuiten geführt. Was mir sehr zugutekam: Der neue Regens Nickles hatte selbst sein Studium in Innsbruck absolviert und befürwortete wohlwollend meinen Antrag. So begann ich im Oktober 1965 mein Studium an der „Alma Mater Oenipontana“, wie die Innsbrucker Universität offiziell in lateinischer Sprache hieß. Die Jahre meines Studiums in Innsbruck gehören zu den schönsten meines Lebens. Ungemein inspirierend war die Internationalität der Theologischen Fakultät. Es gab im Canisianum unterschiedliche Landsmannschaften, wo einerseits das regionale Flair gepflegt wurde, andererseits jedoch auch Gastfreundschaft und weltweite Offenheit herrschten. Besonders präsent – zahlenmäßig, aber auch hinsichtlich ihrer vielen Aktivitäten – waren die US-Amerikaner. Bereits nach dem ersten Studienjahr unternahm ich mit Hilfe der vielen neuen Kontakte amerikanischer Konviktoren eine dreimonatige Nordamerikareise. Eine einmalige Werbeaktion der Busgesellschaft „Greyhound“ kam mir entgegen: „99 Days for 99 Dollars“. Billiger konnte man nie wieder auf einem Kontinent unterwegs sein. Als Übernachtungsmöglichkeit hatte ich mir ein Netz von Pfarrhäusern über das ganze Land erschlossen, die ich mit der Bitte um eine Unterkunftsmöglichkeit von Innsbruck aus angeschrieben hatte. Nahezu alle haben postwendend geantwortet, meist nur mit der kurzen Botschaft, einfach zu kommen. Ähnlich intensiv kam ich in den folgenden Jahren mit Spanien, England und Frankreich, aber auch mit dem afrikanischen Kontinent, in Kontakt. Die Freundschaften, die während des Studiums entstanden sind, haben zum Teil noch bis heute Bestand. Abgesehen von einem Jahr des Auswärtsstudiums am Institut Catholique in Paris war also Innsbruck mein Lebensmittelpunkt geworden. Inzwischen hatte ich auch meine Promotion an der Theologischen Fakultät fast abgeschlossen, als es zu einer Begegnung kam, die mein Leben von Grund auf verändern sollte. Diese Begegnung geschah am 19. Januar 1974, abends um 19 Uhr im Mädchenheim des SOS-Kinderdorf-Vereins in Innsbruck. Frau Christa Puschmann, die Heimleiterin des Marienheims, eines Wohnheims für Schülerinnen, hatte mich eines Abends auf Hermann Gmeiner, den Gründer der SOS-Kinderdörfer, angesprochen. Ich hatte Frau Puschmann kennengelernt, weil ich gemeinsam mit Kollegen im Marienheim regelmäßig Gottesdienste hielt, die jugendgemäß gestaltet sein sollten. Das setzte einen gewissen Vorbereitungsaufwand voraus und in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils und seines neuen Liturgieverständnisses setzten wir jungen Theologen (die weibliche Form sollte erst Jahre später aktuell werden!) unseren Ehrgeiz darein, ansprechende gottesdienstliche Formen zu finden. Zudem wurde dieses Angebot auch durch weitere Veranstaltungen wie Gruppen- und Diskussionsrunden sowie Vorträgen ergänzt. Im Laufe der Zeit wuchs aus den vielen Vorbereitungsgesprächen eine enge Freundschaft. Christa Puschmann war pädagogisch äußerst interessiert und engagiert. Eines Abends fragte sie mich: „Kennst du eigentlich Hermann Gmeiner?“ Ich hatte nur eine sehr vage Vorstellung von ihm. Zudem bekam ich ab und zu einmal eines dieser bunten Blättchen mit dem Namen „SOS-Kinderdorf-Bote“ in die Hand, fand die Werbung an ein breites Publikum gerichtet und konnte nicht sagen, dass ich sonderliches Interesse dafür aufbrachte. Christa Puschmann ließ nicht locker: „Gmeiner musst du kennenlernen! Es gibt wenige charismatische Menschen wie ihn. Er hat nach dem Krieg aus dem Stand ein weltweites Sozialwerk aufgebaut und ein ganz besonderes Gespür dafür, sich die richtigen Leute für sein Werk auszusuchen.“ Eher um ihr einen Gefallen zu tun als aus eigenem persönlichen Interesse, sagte ich zu und sie erklärte sich bereit, einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren. Nach kurzer Zeit kam das Treffen zustande. Es fand in dem bereits erwähnten Mädchenheim des SOS-Kinderdorf-Vereins statt. Zum Hintergrund muss gesagt werden, dass SOS-Kinderdörfer zur damaligen Zeit ausnahmslos in ländlicher Umgebung angesiedelt waren. Das war kein Zufall, denn in dem Weltbild der Fünfziger- und Sechzigerjahre in Tirol spielte der Gegensatz von Stadt und Land noch eine wichtige Rolle. Das Land wurde mit einer unberührten Natur und einer heilen Welt in Verbindung gebracht, die Stadt dagegen als Ort der wirtschaftlichen und technischen Auseinandersetzung auch mit einer Lockerung der Sitten assoziiert. Kinder sollten am besten in der Nähe der Natur, also auf dem Land, aufwachsen, erst für die Heranwachsenden, die eine Lehre machten oder eine weiterführende Schule besuchen wollten, musste eine Unterkunftsmöglichkeit in der Stadt Innsbruck gefunden werden. Also baute der SOS-Kinderdorf-Verein dafür geeignete Einrichtungen auf, sogenannte „Jugendhäuser“. Die Buben kamen im Osten der Stadt in einem ehemaligen Erholungsheim der Krankenkasse in Innsbruck-Egerdach unter, die Mädchen in einem Hochhaus in der Stadtmitte. Dieses Mädchenheim hatte eine charismatische Leiterin namens Henriette Rieder, der es gelang, zu den ihr Anvertrauten eine vertrauensvolle Bindung aufzubauen.2 Sie wusste sehr gut, dass alle Maßnahmen repressiver Art überhaupt nichts fruchteten, sondern Empathie und Eingehen auf persönliche Bedürfnisse viel weiter halfen. Kurz: Die Atmosphäre im Haus war spürbar angenehm und entspannt. Dies hat wohl auch der Chef des ganzen SOS-Kinderdorf-Vereins, Herrmann Gmeiner, so empfunden. Er kam häufig zu Besuch, ja mehr noch, er funktionierte zeitweise das große Wohnzimmer des Heims zu seinem privaten Arbeits- und Empfangszimmer um. So lud er sich dort regelmäßig Gäste ein, die dann auch von der Küche des Heims bewirtet werden mussten. Hier haben wir uns also an jenem Abend getroffen. Nach meinem ersten Eindruck war ich etwas enttäuscht. Ich hatte mir Gmeiner unwillkürlich größer und stattlicher vorgestellt. Stattdessen war er von kleiner Gestalt und wohl auch etwas korpulent. Eindrucksvoll waren seine großen, wachen Augen und seine ausgeprägt hervorstehende Nase. Tatsächlich wurde in Kinderdorfkreisen oft auf diese Nase angespielt mit der symbolischen Bedeutung: Gmeiner hat eine Nase dafür! Kaum hatten wir uns gesetzt, sprach Gmeiner mich mit „Du“ an. Es war ganz offensichtlich, dass er Interesse an mir hatte. Ich musste ihm genau berichten, wer ich war und was ich machte. Ich erzählte ihm, dass ich gerade dabei sei, meine Promotion in systematischer Theologie abzuschließen, und dann wohl in der Seelsorge der Diözese Bamberg eingesetzt werde. Ich ließ wohl auch durchblicken, dass ich Innsbruck ungern verlassen würde. Tatsächlich waren in den Jahren des Studiums viele Kontakte und Freundschaften entstanden und es war klar, dass ich diese von der fränkischen Heimat aus nicht in dem gewünschten Ausmaß würde pflegen können. Unser Gespräch hatte kaum zehn Minuten gedauert, da eröffnete mir Gmeiner: „Bub, dich brauche ich!“ So ganz ernst konnte ich diese Einladung nicht nehmen, denn an einen grundlegenden Wechsel meines Berufs hatte ich noch nie gedacht. Die Theologie, wie ich sie auf höchstem Niveau bei meinem Doktorvater Franz Schupp kennengelernt hatte, faszinierte mich nach wie vor. Dass ich von meiner Bamberger Heimatdiözese, wie es damals üblich war, erst für zwei oder drei Jahre zu seelsorglicher Praxis eingesetzt würde, hatte ich innerlich längst akzeptiert, doch ich sah meine eigentliche Berufung tatsächlich in der Theologie und wollte auf lange Sicht auf jeden Fall an der Universität bleiben. Auch die didaktische Seite der Theorievermittlung machte mir Freude. Ich hatte neben meiner Promotion über mehrere Jahre als Tutor gearbeitet und auch kreative Formen der Einführung in theologisches Denken ausprobiert. In besonderer Erinnerung ist mir ein Wochenende mit einer Gruppe von engagierten Studenten, das auf dem Zenzenhof, einem Erholungsheim der Jesuiten südlich von Innsbruck, stattfand und sich mit dem Konzil von Trient, seinen inneren Spannungen und seinen Lehrtexten befasste. Dieses ganze Programm lief komplett parallel zum üblichen universitären Studienbetrieb, war also nur etwas für besonders an der Theologie Interessierte. Einer der Studenten, die damals dabei waren, hießt Józef Niewadomski. Ich habe ihn Jahre danach als Professor für Dogmatik in Linz wiedergetroffen. Später hatte er an der Theologischen Fakultät in Innsbruck den Lehrstuhl für Dogmatik inne. Kurz, ich dachte nicht daran, aus diesem Szenario auszusteigen zu Gunsten einer nur vage beschriebenen Tätigkeit im Sozialwerk von Hermann Gmeiner. So antwortete ich freundlich ablehnend: Ich fühle mich von so viel Vertrauen geehrt, doch ich sei im kirchlichen Dienst und somit nicht zu haben. Gmeiner beeindruckte das wenig. Mit einer weit ausholenden Geste wischte er meine Bedenken vom Tisch. Das sei alles kein Problem. Ich könne mich doch für eine Tätigkeit bei ihm vom Bischof in Bamberg freistellen lassen. Diese Mischung aus souveränem Selbstbewusstsein und Hartnäckigkeit hat mich tatsächlich beeindruckt. Ich fragte also, wie er sich die Sache konkret vorstelle. Gmeiner sagte, er würde sich darum kümmern, dass ich drei hochkarätige Empfehlungsschreiben erhalte: eines vom österreichischen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger, eines vom Wiener Kardinal Franz König und eines vom Tiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer. Zu allen dreien habe er guten Kontakt und er sehe kein grundsätzliches Problem, falls ich selbst bereit sei, in den Dienst des SOS-Kinderdorfs zu treten. Für mich eröffnete sich ein neuer Horizont: eine Tätigkeit in einem weltweit agierenden Sozialwerk, wo es offensichtlich darum ging, Pionierarbeit zu leisten, also nicht ausgetretene Pfade zu betreten, sondern wie bei einer Abfahrt vom Glungezer, einem wunderschönen Berg in der Nähe von Innsbruck, der damals erst mühsam mit Fellen auf den Skiern bestiegen werden musste, im unberührten Schnee neue Spuren zu hinterlassen. (Die Glungezerbahn wurde erst in späteren Jahren gebaut. Wir haben als Studenten den Berg noch weitgehend unberührt erlebt.) Diese Gedanken gingen mir in Sekundenschnelle durch den Kopf und irgendwie war mir bewusst, dass ich wohl niemals mehr in meinem Leben vor eine solche Entscheidung gestellt werden würde. Damit war innerlich die Sache für mich bereits klar. Ich hatte nichts zu verlieren, wenn ich mich auf Gmeiners Vorschlag einließ. Wir verabschiedeten uns an diesem Abend mit einem festen Händedruck und einem tiefen Blick in die Augen, Gmeiners üblichem Ritual, wenn er neue Beziehungen knüpfen und jemandem sein Vertrauen schenken wollte. Er gab mir eine Visitenkarte mit seiner Adresse in der Stafflerstraße in Innsbruck, und alles nahm seinen Lauf in relativ kurzer Zeit und ohne alle Probleme. Mir blieb ein knappes halbes Jahr, meine bereits abgeschlossene Promotionsarbeit druckfertig zu machen und mich auf die neue Tätigkeit einzustellen. Ich hatte eine Reihe von Besuchen zu absolvieren, um mich den entscheidenden Leuten vorzustellen und etwas über das Kinderdorfwerk zu erfahren. Es war typisch für Gmeiner, dass er mir nicht etwa eine Liste von Leuten in die Hand drückte, zu denen ich Kontakt aufnehmen sollte, sondern es vollkommen mir selbst überließ, herauszufinden, wen ich kennenlernen musste. Ein erster Besuch führte mich zu Kardinal König nach Wien. Es spricht für sich, dass er mir nicht einfach nur ein Gefälligkeitsgutachten schreiben wollte, sondern erst nach einem ausführlichen Gespräch, in dem er sich ein Bild von mir gemacht hat, das Empfehlungsschreiben nach Bamberg auf den Weg brachte. In Wien hatte auch der Generalsekretär Hansheinz Reinprecht sein Büro. Vom ersten Augenblick an habe ich von seiner Seite aus eine gewisse Reserve gespürt. Er wusste nicht so recht, wie er mit mir umgehen sollte. Gmeiner hatte ihn wieder einmal mit meiner Anstellung vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne seine Meinung dazu einzuholen. Es war nicht verwunderlich, dass Reinprecht Misstrauen zeigte. Er konnte ja in keiner Weise abschätzen, was da Neues auf ihn zukam und ihn möglicherweise im sehr komplexen hierarchischen Gefüge des SOS-Kinderdorf-Werks in seiner Stellung bedrohte. Reinprecht und ich haben in den folgenden Jahren noch oft die Klingen miteinander gekreuzt. Zu verschieden waren unsere Professionen, Temperamente und Mentalitäten. Ich hatte kein Verständnis für seinen propagandistischen, in meinen Augen völlig unkritischen Journalistenstil und er ließ mich die nicht selten anzutreffenden österreichischen Vorbehalte gegen die Deutschen spüren. Wenn sie auftauchten, müsse man nach seiner Überzeugung immer auf der Hut sein. Doch alles Ressentiment half nichts. Wir mussten uns wohl oder übel aufeinander einlassen. Was es mir in den folgenden Jahren leicht gemacht hat, mich auf Reinprecht einzulassen, war sein genialer Humor. Er schaffte es, sich nach einem langen Konferenztag für kurze Zeit hinzusetzen und ein freches Gedicht zu schreiben, in dem alle – einschließlich er selbst – durch den Kakao gezogen wurden. Das war absolute Spitze und das hat ihm niemand nachgemacht. Schließlich war diese ironische Selbstinszenierung ungemein befreiend und relativierte in angenehmster Weise die harten Auseinandersetzungen. Ein weiterer wichtiger Besuch führte mich nach München zu Dr. Michael Gschließer, dem Geschäftsführer des Hermann-Gmeiner-Fonds. Gschließer war gebürtiger Tiroler, verdankte seine Position dem ausgezeichneten Renommee seines Vaters, zu dem Gmeiner eine sehr vertrauensvolle Beziehung pflegte. Trotz allem hatte Gmeiner mit dieser Personalentscheidung einen wirklichen Treffer gelandet. Gschließer wirtschaftete als Marketing-Mensch über viele Jahre ausgesprochen erfolgreich und schaffte es, aus dem kleinen Pflänzchen des neu gegründeten Vereins zur Unterstützung der SOS-Kinderdörfer in aller Welt ein regelrechtes Imperium zu machen. Nachdem ich formell beim Hermann-Gmeiner-Fonds angestellt werden sollte, war Gschließer mein unmittelbarer Vorgesetzter. Seine Weisungsbefugnis hat sich in den folgenden Jahren nur auf die Finanzen bezogen. Inhaltlich hat mir Gschließer, so wie auch Gmeiner selbst, vollkommene Freiheit gelassen, wie ich selbst meine Tätigkeit verstehen und meine Schwerpunkte setzen wollte. Dieses Privileg war mir von Anfang an bewusst und ich sah es als meine Aufgabe an, diesem Vertrauen und den hoch gespannten Erwartungen zu entsprechen.
2)Bereit für das neue Projekt
Die Entscheidung war also gefallen. Ich würde in den nächsten Jahren im Rahmen von SOS-Kinderdorf International tätig sein. Die Begeisterung war groß, auch wenn mir mein nüchterner Verstand sagte, dass vieles noch geklärt werden müsse. Es war zu erwarten, dass es aus den Reihen der Führungsmannschaft von Gmeiner erhebliche Widerstände geben werde. Schließlich hatte Gmeiner mit meiner Anstellung eine Personalentscheidung getroffen, die über alle Köpfe hinweggegangen war. Auch wenn Gmeiners engster Kreis wusste, dass von seiner Seite immer mit solchen Alleingängen zu rechnen war, so gab es als Reaktion zwar keinen offenen Protest, jedoch einen zähen passiven Widerstand. Tatsächlich hat es Jahre gedauert, bis ich mir von allen engen Mitarbeiter:innen Gmeiners so viel Vertrauen erworben hatte, dass eine reibungslose Zusammenarbeit garantiert war. Glücklicherweise wurden durch Personalentscheidungen dieser Art die Kompetenzbereiche, die sich die Mitglieder der Führungsmannschaft Gmeiners in vielen Jahren – meist oft nach zähem Ringen – erkämpft hatten, nicht unmittelbar eingeschränkt. Dennoch gab es ein nicht ganz unbegründetes Misstrauen, dass Gmeiner sein Interesse (und sein Vertrauen) auf neue Leute setzte und die Folgen einer neuen Machtverteilung im internationalen Bereich nicht absehbar waren. Alle diese Überlegungen standen nach der Entscheidung für Hermann Gmeiner bei mir nicht im Vordergrund. Zunächst galt es ja erst einmal, den Mitarbeiterstab kennen zu lernen. Das pflegte Gmeiner höchst unbürokratisch zu tun. Statt mir ein Organigramm in die Hand zu drücken oder mir die Strukturen des Vereins bzw. der Vereine zu erklären, lud er mich einfach nach Caldonazzo ein. Caldonazzo im Trentino sollte bald zum Mythos werden. Dort befand sich das große Ferienlager der SOS-Kinderdörfer, in das in den besten Zeiten im Sommer über 1000 Kinder und Jugendliche kamen und dort ihre Ferien verbrachten. Alle SOS-Kinderdörfer in Mitteleuropa, vor allem aus Österreich, Deutschland und Italien, hatten die Möglichkeit, mit einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen anzureisen. Der Ort, direkt am Caldonazzo-See, bot außer dem Baden eine Reihe großartiger Freizeitaktivitäten, angefangen von mehrtägigen Bergtouren bis hin zu vielen Sportmöglichkeiten. Gmeiner war gerne dort und hatte die Angewohnheit, im August an ein paar von ihm festgelegten Tagen „Hof zu halten“. Das heißt, seine engsten Mitarbeiter:innen kamen zu Besuch, meist um selbst ein paar Tage Ferien zu machen, und standen in dieser Zeit zu Beratungen, bei denen zum Teil wichtige Entscheidungen getroffen wurden, zur Verfügung. Gmeiner liebte es, sich nicht dem strengen Sitzungsprotokoll mit einer genauen Tagesordnung und fest vereinbarten Zeiten zu unterwerfen, sondern sehr informell zu konferieren und Meinungsbildung zu betreiben. Meist musste das, was in Caldonazzo besprochen (und faktisch auch schon entschieden) worden war, später in den zuständigen Gremien nochmals auf die Tagesordnung gesetzt, nach den vorgegebenen Regeln behandelt und offiziell abgesegnet werden. Doch meist hatte Gmeiner eine so große Autorität, dass man sich nicht gegen das stellte, was er wollte und für sich auch schon entschieden hatte. Selbstverständlich war dies jedoch nicht. Vom Hörensagen weiß ich von einzelnen Fällen, dass Gmeiner von den Gremien mächtiger Vereine auch wieder dazu bewegt wurde, zurückzurudern und seine Entscheidung zu überdenken oder zu revidieren. Das alles erschloss sich mir erst im Laufe der Zeit. Zunächst erlebte ich, wie mich Gmeiner in der großen Runde seinen Getreuen vorstellte und erklärte, dass es meine Aufgabe sei, für die internationale Arbeit, die sich mit großer Dynamik entwickelte, Projektleiter:innen zu finden, auszubilden und bei ihrer Arbeit zu betreuen. Es wäre naheliegend gewesen, wenn jemand nachgefragt hätte, welche fachliche Kompetenz ich denn für diese Aufgabe mitbringen würde. Doch niemand hat nachgefragt. Gmeiner hatte in diesem Kreis so großes Vertrauen, dass man wohl der Auffassung war, er würde schon wissen, was er mache, und seine guten Gründe für diese Personalentscheidung haben. Man könnte sich natürlich auch wundern, warum sich Gmeiner nicht selbst gefragt hat, ob ich denn diese Aufgabe überhaupt erfüllen könne. Immerhin war ich ein kompletter Neueinsteiger und brachte weder eine Erfahrung im Fach der Pädagogik noch im Personalmanagement mit. Doch Gmeiner setzte offensichtlich so viel Vertrauen in mich, dass er der Überzeugung war, ich würde mir das notwendige Wissen schnellstmöglich aneignen. Tatsächlich halte ich dieses Vertrauen für die stärkste Motivation für einen engagierten Einsatz, der auch andere überzeugen kann.
Ich hatte später in Innsbruck tatsächlich daran gedacht, außer meiner Promotion in systematischer Theologie auch eine Promotion in Erziehungswissenschaft zu machen. In den notwendigen Vorgesprächen an der Universität war man daran interessiert, über mich an empirisches Material des SOS-Kinderdorf-Vereins heranzukommen. In meiner Position sollte das kein Problem sein. Begonnen habe ich dieses Studium mit großem Interesse. Der Gedanke, nach dem weitgehend spekulativen Arbeiten, mit dem ich es in der Theologie zu tun hatte, einmal handfestes empirisches Material bearbeiten zu können, hat mich durchaus fasziniert. Tatsächlich lag es regelrecht in der Luft, die hochfliegende systematische Theologie mit den harten, empirisch erhobenen Fakten zu konfrontieren. Besonders die Pastoraltheologie war dafür prädestiniert und als einer der Ersten begann in Wien Paul Zulehner sich dieser Herausforderung zu stellen. Hier hoffte ich, mir beim Studium der Erziehungswissenschaft die notwendige Kompetenz aneignen zu können. Doch nach dem Besuch einiger Wochen von Vorlesungen an der erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Innsbruck trat große Ernüchterung ein und ich spürte bald, dass hier auch nur mit Wasser gekocht wurde, um es behutsam auszudrücken. Der weitere Lauf der Dinge hat mir zudem keine Zeit mehr zu einem Studium nebenbei gelassen, noch war ich daran sonderlich interessiert. Tatsächlich habe ich ein erziehungswissenschaftliches Studium in den kommenden Jahren selbst nicht gebraucht. Im SOS-Kinderdorf-Verein sowohl in Österreich als auch in Deutschland gab es genug Fachleute, die ihre Expertise einbringen konnten. Zudem hatte ich viel mehr mit Managementfragen zu tun als mit Fachfragen der Pädagogik.
Die kommenden Monate seit meiner ersten Begegnung mit Gmeiner bis zur Vorstellung in Caldonazzo habe ich gründlich dazu genutzt, mich damit vertraut zu machen, was SOS-Kinderdorf bedeutet: in der Theorie und in der Praxis. Gelesen habe ich alles, was ich in die Finger bekam. Das waren zuerst die Bücher des Generalsekretärs Hansheinz Reinprecht. Auch wenn ich darin manches Informative, insbesondere über die Biografie Hermann Gmeiners, fand, kostete es mich doch einige Überwindung, mich auf Reinprechts Hofberichterstattung und seine Propaganda einzulassen. Reinprecht hat dies in der persönlichen Begegnung von Anfang an gespürt und mir unterstellt, ich würde zu Gmeiners Werk in großer Distanz stehen, mit anderen Worten, ich sei zu wenig begeisterungsfähig. Mich störte umgekehrt das völlige Desinteresse an historisch-kritischer Betrachtungsweise. Hier wurden Geschichten erzählt, und je öfter sie erzählt wurden, desto legendärer wurde alles, sodass am Ende praktisch niemand mehr sagen konnte, wie sich die Dinge in aller Nüchternheit abgespielt hatten.
Viel interessanter als die wenig aussagekräftige Lektüre durchzusehen, waren jedoch die persönlichen Begegnungen. Ich nutzte alle Gelegenheiten, die sich boten, um möglichst viele der Getreuen Gmeiners, möglichst noch aus der frühen Zeit des Aufbaus, kennenzulernen. Das war ungeheuer spannend! Nahezu alle dieser Mitarbeiter:innen Gmeiners haben mich mit offenen Armen empfangen, haben mir ihre Geschichte erzählt und waren bereit, meine Fragen ausführlich und ehrlich zu beantworten. Wenn man mich später gefragt hat, was mir am SOS-Kinderdorf-Verein besonders gefällt, dann habe ich immer geantwortet: die vielen, so unterschiedlichen, aber ähnlich engagierten Menschen, denen ich begegnet bin. So ist der SOS-Kinderdorf-Verein für mich ein großes Bild, das aus sehr unterschiedlichen Gesichtern besteht. Hinter jedem Gesicht steht eine eigene Lebensgeschichte, steht eine unverwechselbare Persönlichkeit – ganz gleich ob es sich um Menschen in Führungspositionen handelt oder um solche, die mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut sind oder ob es sich um Kinder und Jugendliche handelt, die betreut werden und unserer Verantwortung überantwortet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass Gremienmitglieder wenig Kontakt zu den Betreuten haben. Ganz lebendig ist mir das Statement einer Kinderdorfmutter bei einer Tagung in der Hermann-Gmeiner-Akademie in Innsbruck in Erinnerung, die uns Gremienmitgliedern an den Kopf warf: „Sie haben doch überhaupt keine Ahnung von der Basis. Kennen Sie denn ein einziges Kind aus dem Kinderdorf persönlich?“ Dieser Affront hat gesessen und ich war entschlossen, diesen Vorwurf nicht auf mir sitzen zu lassen. In einer Sitzungspause habe ich dann die Kinderdorfmutter gebeten, ihren Terminkalender zu holen. Ich sei bereit, für einige Tage eine Vollvertretung zu übernehmen. Wir haben dann tatsächlich etwas vereinbart und aus dem Besuch ist eine jahrelange Freundschaft geworden, die noch bis heute lebendig ist. Die Kinderdorfmutter Elisabeth Jansen aus dem SOS-Kinderdorf Pfalz schrieb viele Jahre später anlässlich meiner Verabschiedung in der Festbroschüre: „Ich darf Hanjo zu Dir sagen – denn Du warst mein Praktikant! Vor 20 Jahren trafen wir uns bei einer Tagung von SOS-Kinderdorf in Innsbruck. Während einer hitzigen Diskussion meinte ich, die hohen Herren da oben hätten ja keine Ahnung, wie es denn in den Dörfern wirklich zugehe. Später kamst Du zu mir und hast mir angeboten, bei mir ein Praktikum zu machen, um diese Wissenslücke zu schließen. Du würdest alles machen – sogar Böden schrubben! Ich dachte mir, dass das die Quittung für mein vorlautes Mundwerk sei, und hoffte heimlich, dass Du das nach der Tagung vergessen würdest. Du hast es nicht vergessen! Einige Wochen später hast Du eine Praktikantenstelle bei mir angetreten. Ich hatte ziemliches Bauchweh. Es wurde dann aber doch eine sehr schöne Woche. Ich war gnädig und Du musstest die Böden nicht schrubben. Dafür haben wir viele gute, sehr interessante Gespräche geführt, viel Spaß gehabt, und die Kinder fanden Dich sowieso toll – sicher auch, weil sie mit Dir am Computer spielen durften. Ich musste feststellen, dass Du sehr wohl wusstest, was so in den Kinderdörfern los war. Du hattest bei Deinen Reisen in verschiedene Länder dort auch immer die Kinderdörfer besucht. Du hattest gute Antennen für die Sorgen und Nöte der Kinderdorfmütter und der Kinder und zeigtest Interesse an vielen Dingen – so z. B. auch, wo man die Tischdecke kaufen konnte, die aussah wie aus Stoff, aber abwaschbar war. Praktisch!
Wir trafen uns dann noch auf vielen Veranstaltungen, Fortbildungen und Tagungen. Warst Du in der Nähe von Eisenberg, kamst Du uns besuchen. Immer interessierte es Dich, etwas über meine Kinder zu erfahren. Du hattest ein offenes Ohr für Probleme in meiner Familie und für die Situation im Dorf. Oft redeten wir aber nur über Gott und die Welt. Dein feinsinniger Humor, Dein Einfühlungsvermögen und Deine Empathie waren dabei für mich immer sehr bereichernd.“1
Mit dieser wunderschönen Episode, die in den Jahren der Erfahrungen im SOS-Kinderdorf-Verein nicht fehlen darf, habe ich weit vorgegriffen. Wir stehen noch ganz am Anfang, als es darum ging, sich mit den Grundbegriffen der Arbeit und des Konzepts von Hermann Gmeiner vertraut zu machen. Gmeiner hatte mich eingeladen, nach Caldonazzo zu kommen. Dort wollte er mich seinem engsten Kreis vorstellen. Wie es seine Art war, bekam ich weder eine genaue Ortsbeschreibung noch einen genauen zeitlichen Termin. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir die letzten Augusttage des Jahres 1974 vereinbart. Mit großem Interesse und offen für das Neue, das mich erwartete, machte ich mich von Innsbruck aus auf den Weg. In einem kleinen Gasthof in San Michele, nach der Autobahnausfahrt, die ich nehmen musste, um dann den Weg in Richtung Osten in die Berge zu nehmen, kehrte ich zu Mittag ein und erinnere mich noch, ganz ausgezeichnet gegessen zu haben. Irgendwie kam mir der Vergleich mit einer Henkersmahlzeit in den Sinn, denn mir war auch etwas unheimlich, was auf mich wartete. Nach einem Espresso ging es dann das letzte Stück bis zum Lago di Caldonazzo. Der Ort war nicht allzu groß und ohne Probleme konnte ich das Ferienlager finden. Erst später bekam ich dann mit, dass es zwei unterschiedliche Gelände gab: einmal das Ferienlager für die Buben direkt am See. Dort standen ursprünglich Zelte. In späteren Jahren hatte man sie dann durch massive Bungalows ersetzt, die auch über ein gemeinsames Bad verfügten. Die Mädchen waren in einem Anwesen im Dorf untergebracht, das von einer hohen Mauer umgeben war. Diese war auch nötig, um nachts halbwegs seine Ruhe vor der interessierten männlichen Dorfjugend zu haben. In diesem Gehöft gab es ebenfalls kleine Bungalows und gleich an der Einfahrt das Gemeindehaus und die Küche, in der die Mahlzeiten für immerhin an die tausend hungrige kleine Mäuler zubereitet wurden. Gmeiner residierte im Gemeindehaus. Dort fanden die Treffen und Begegnungen statt. Ich meldete mich in der Küche an und bekam ein Zimmer in diesem großen Gemeindehaus zugeteilt. Gmeiner traf ich erst am Abend. Er begrüßte mich freundlich und sagte, ich solle mir erst einmal alles ansehen, die Leute kennenlernen und auch selbst Ferien machen. Am kommenden Abend sei ein größeres gemeinsames Essen geplant, zu dem ich mich dann einfinden solle. Eigentlich hätte ich mir mindestens ein Dutzend Namen merken müssen, doch bei manchen wusste ich nicht einmal, wie man sie richtig ausspricht, geschweige denn schreibt. Doch darüber machte ich mir nicht zu viele Gedanken. Dazu werde es sicher noch Gelegenheit geben. Jetzt ging es erst einmal darum, mit den wichtigsten Leuten ins Gespräch zu kommen und sich vor allem mit dem SOS-Kinderdorf und seiner Grundidee vertraut zu machen.
3)Hermann Gmeiner und das SOS-Kinderdorf
Will man Hermann Gmeiners „Kinderdorf-Idee“ verstehen, so muss man sich seine Biografie ansehen. Geboren am 19. April 1929 in einem Dorf namens Alberschwende in Vorarlberg entstammt Gmeiner einer kleinen Bergbauernfamilie als drittes Kind von zehn Geschwistern. Schon früh starb die Mutter. Mit dem Vater hat sich Hermann nicht sonderlich gut verstanden. Man kann sich ohne Mühe vorstellen, dass beide ausgeprägt alemannische Dickköpfe waren. Nach dem Tod der Mutter musste sich jemand um die vielen Kinder in der Familie kümmern. Diese Rolle übernahm Elsa, Gmeiners älteste Schwester. Was er hier in der eigenen Familie erlebte, hat er dann später auf sein Konzept des SOS-Kinderdorfs übertragen. Kinder brauchen eine feste Bezugsperson. Diese muss nicht unbedingt die leibliche Mutter sein, aber in Gmeiners Weltbild konnte er sich dafür nur eine Frau, keinen Mann vorstellen.
In Reinprechts Darstellung liest sich die Biografie Gmeiners so: „Gmeiner liebt sein Alberschwende! Hier wurde er geboren. Hier steht sein Vaterhaus. Hier erlebte er seine glückliche Kindheit. Hier lief er barfuß zur Schule, von hier fuhr er nach Feldkirch ins Gymnasium. Hier trieb er die Kühe des Vaters durch den Ort. Hier durfte er am Glockenstrang der Kirche ziehen, um die Menschen zum Gottesdienst zu rufen. Hier war das Grab seiner geliebten Mutter. Hier hatte er Abschied genommen von Vater und Geschwistern, Freunden und dem Pfarrherrn, als er voll jugendlichem Tatendrang zum Militär einrückte. Hier hatte er wieder Einzug gehalten nach dem Krieg, verwundet und in einer abgetragenen Uniform. Hier kannte er jedes Haus, jeden Baum, jeden Stein. Über diese Wiesen war er getollt, und im Wald dahinter hatte er Baumrinden gesammelt für die Weihnachtskrippe. Hier liebte er alles. Auch die würzige Luft und die Wolken, als würden sie nur hier – ober Alberschwende – vom Himmel grüßen und sich dann wieder auflösen. Hier war seine Heimat. Sein Daheim. Und da drüben steht das gute, alte Haus.
In diesem Haus hatten ihn die Hände seiner guten Mutter gestreichelt. Die Erinnerung daran war blass geworden, aber in seinem Herzen war ihr Bild lebendig. Er wusste um dieses Gesicht seiner Mutter, auch wenn er sie schon im Alter von fünf Jahren verloren hatte. Er sah dieses Antlitz jetzt vor sich, auf das rosa Kissen gebettet, blass und müde, aber mit jenen unvergesslichen Augen, die auf ihn gerichtet waren, als er von ihr Abschied nahm. Man hatte sie alle in ihr Sterbezimmer gerufen, Hermann und seine sieben Geschwister. Er war unter den Kleinen – hatte drei unter sich –, doch er sah über die Tuchent hinweg in das Gesicht der Sterbenden, die ihre Kinder noch einmal um sich haben wollte. Der Vater hatte sich abgewandt. Hermann hatte es wohl gesehen, aber nicht zu deuten gewusst, wie ihm alles so seltsam war in jener Stunde. Heute wusste er, dass Vater geweint hatte und seine Tränen verbergen wollte vor den Kindern und der Mutter. Sie standen um ihr Bett, und es war sehr still. Sogar die größeren Schwestern hatten zu schluchzen aufgehört. Von der Wand tickte die alte Kuckucksuhr. Draußen pochte leise der Regen an die kleinen Fenster. Zaghaft und vorsichtig, als wollte auch die Natur diese Stunde nicht stören. Und dann hatte Mutter einen nach dem anderen angesehen und gesagt: ‚Bleibt gut, Kinder!‘ Vater war aus dem Sterbezimmer gegangen. Die älteste Schwester nahm die Kleineren und führte sie auch hinaus.
Ja, dort drüben in dem guten, alten Haus hatte er seine Mutter verloren – und in seiner ältesten Schwester eine neue gefunden. Sie übernahm wie selbstverständlich die Pflichten der Verstorbenen, und alles wurde wieder wie früher für ihn. Nur wenn man zum Friedhof hinausging und Blumen niederlegte vor dem schlichten Kreuz, Unkraut auszupfte und ein Lichtlein anzündete, dann war ihm immer so seltsam zumute. Da hörte er wieder jenes ‚Bleibt gut, Kinder!‘ und spürte, dass er eine Mutter gehabt hat, der er verpflichtet war. Sein Leben lang. Manchmal war es ihm sogar, als redete seine Mutter mit ihm. Er fühlte dann ihre Gegenwart, aber es war nichts Unheimliches dabei, sondern eher etwas Selbstverständliches und Natürliches. Draußen im Krieg hatte er dies oft erlebt. Wenn die feindlichen Panzer anrollten und sich in den Lärm der Raupenketten die Schreie der Verwundeten mischten. Da war sie ihm immer ganz nahe gewesen. […] Daheim hatte man ihn schon erwartet. Der Händedruck des Vaters tat wohl. Er liebte seinen Vater, diesen kernigen, wortkargen Bauern. Da war Verstehen ohne viele Worte. Nie hatte der Vater etwas dagegen gehabt, dass der Sohn ein ‚Studierter‘ werden sollte. Er hatte eben noch kräftiger zugepackt, um aus dem Hof herauszuwirtschaften, was geht. Denn der Gymnasiast brauchte Geld in der Stadt. Er hatte auch nicht gemurrt, als Hermann nach dem Krieg wieder fortging, um in Innsbruck zu studieren, obwohl man ihn daheim gebraucht hätte. Vielleicht war er auch ein wenig stolz darauf, dass sein Sohn Arzt werden sollte.
Er ließ es sich zwar nicht anmerken, der alte Gmeiner, aber irgendwie war er doch immer anders, aufgeschlossener, redseliger, wenn sein Sohn von Innsbruck auf Besuch kam. Und dann waren die anderen da, seine Geschwister, die eine verschworene Gemeinschaft sind und zusammenhalten. Zu seiner ältesten Schwester freilich schaute er noch immer wie zu einer Mutter auf, und sie selbst konnte auch nicht das Bemuttern ganz ablegen, auch wenn ihr Hermann inzwischen schon erwachsen war.“1
Was Reinprecht in seiner Darstellung nicht thematisiert, sind die sozialen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Zeit. Das kleine Land Vorarlberg selbst kann als Symbol eines verwaisten Landes gesehen werden, das nicht so recht wusste, wo es hingehörte (und wo es selbst hingehören wollte). Als nach dem Ersten Weltkrieg die Weltmacht der Habsburger zerbrochen war und von dem gewaltigen Reich nur noch ein kleiner Rest übriggeblieben war, schlug der letzte Kaiser Karl vor seinem Thronverzicht vor, dass sich die österreichischen Länder föderal unter Wien als Reichshauptstadt neu organisieren sollten. Die Vorarlberger dachten anders. Sie wollten zur Schweiz. Eine Volksabstimmung, die 1919 durchgeführt wurde, brachte ein klares Votum: 70 Prozent der Bevölkerung votierte für den Anschluss an die Schweiz. Daraus wurde aber nichts, weil sich der Schweizer Bundesrat bei den Verhandlungen hartnäckig weigerte, sich an den anteiligen Kriegs-Reparationskosten zu beteiligen, die nach dem Versailler Vertrag den Achsenmächten auferlegt worden waren. So blieb Vorarlberg bei Österreich, weit weg von Wien. Es verstand sich als ungeliebt und unverstanden. Noch heute ist in vielen österreichischen Bundesländern ein mehr oder weniger stark ausgesprochener Vorbehalt gegen Wien und seinen Führungsanspruch zu spüren.
Ein tiefer Einschnitt in Gmeiners Leben war die Einberufung zum Wehrdienst in der großdeutschen Wehrmacht. Junge Menschen wie Hermann Gmeiner haben ihr Schicksal damals keineswegs bedauert, sondern erlebten mit einem Mal ein neues Lebensgefühl angesichts einer (auf Europa bezogenen) unbekannten Form der Globalität. So kam Gmeiner, dessen Leben sich geografisch in einem Radius von nur wenigen Kilometern abgespielt hatte, mit einem Mal nach Norwegen, dann in die Weiten Russlands. Sicher nicht in der Rolle eines Touristen, sondern eines in eine straffe Disziplin eingefügten Soldaten, dessen Bewegungsradius von den Befehlsstrukturen streng reglementiert war. Trotzdem waren viele, die als Soldaten den Krieg erlebt und überlebt hatten, ehrlich genug, die anfängliche Begeisterung zuzugeben. Wurde ich später gefragt, warum Hermann Gmeiner eigentlich nie für den Friedensnobelpreis ins Spiel gebracht wurde, dann ist die Antwort sehr einfach. Auch wenn er persönlich dafür nicht verantwortlich war, hat ihn die Tatsache, als Besatzer der deutschen Wehrmacht in Norwegen gewesen zu sein, ein für alle Mal für diese Auszeichnung disqualifiziert.2 In späteren Kriegsjahren wurde Gmeiner in Russland verwundet, hat aber den Krieg überlebt und kehrte nach Vorarlberg zurück. Sein Plan war, Arzt zu werden. So begann er unmittelbar nach dem Krieg mit dem Medizinstudium in Innsbruck. Die Anfänge seines sozialen Engagements liegen im Dunkel, denn es gab – zumindest für mich – nur Berichte aus zweiter Hand. Sicher ist, dass Gmeiner im Rahmen der katholischen Jugend, für die er sich engagierte, eine Jungengruppe führte. Einige dieser jungen Menschen waren kriegsbedingt sozial entwurzelt.
Gmeiner hat offensichtlich zunächst einen, dann auch einen zweiten Buben bei sich aufgenommen und für beide gesorgt. Um die Hilfe einer alten Dame, einer Kriegswitwe, die Gmeiner später auch den Haushalt geführt hat und allgemein als „Dietlmama“ bekannt war, hat er sich wohl erst viel später bemüht. In der ersten Zeit war er ganz auf sich allein gestellt. Natürlich war dieses Engagement für das Medizinstudium nicht gerade förderlich und es war allgemein bekannt, dass die Fakultät mit der ersten wichtigen Prüfung, dem sogenannten „Vorklinikum“, vor den klinischen Semestern eine Hürde aufgerichtet hat, um alle Student:innen loszuwerden, die man nicht als besonders qualifiziert einschätzte. Voraussetzung für diese erste Prüfung war, sich eine erhebliche Menge an Lernstoff anzueignen. Nun erzählte mir Ludwig Kögl, Weggefährte von Gmeiner von der ersten Stunde an, dass Gmeiner bei dieser Prüfung durchgefallen sei. Es gibt keinen plausiblen Grund, an diesem Bericht zu zweifeln, denn Gmeiner hatte zu der Zeit, als ich zum SOS-Kinderdorf stieß, bereits einen sagenhaften Ruf und seine Mitarbeiter:innen waren natürlich darauf bedacht, ihn in der Öffentlichkeit in einem guten Ruf dastehen zu lassen. Trifft also Kögls Version zu, dann stellt sich die Ursprungssaga in einem etwas anderen Licht dar. Gmeiner hat nicht in einem heroischen Akt sein Medizinstudium zurückgestellt oder ganz aufgegeben, um sich dem Kinderdorfwerk zu widmen, sondern er befand sich vielmehr in einer Krise und machte aus der Not eine Tugend, sich nämlich mit ganzer Kraft für den Aufbau eines Kinderdorfwerks einzusetzen.
Vom Reifen der Kinderdorf-Idee erzählt Reinprecht: „Kaplan Mayr saß über das Brevier gebeugt in seinem Zimmer. Er merkte nicht, dass Hermann Gmeiner eingetreten war. ‚Guten Abend, lieber Freund!‘ Kaplan Mayr sah auf. ‚Hermann!‘ Sie begrüßten einander freudig. Dann aber betrachtete ihn der Seelsorger und meinte: ‚Ja, um Gottes willen, du siehst heute aus, als wärst du bei der Staatsprüfung durchgerasselt. Was ist denn los mit dir?‘
Gmeiner setzte sich. ‚Weißt du, ich kann eine Frage nicht mehr loswerden; die Frage, was mit all diesen Kindern geschieht, die keine Eltern mehr haben. Ich glaube nicht daran, dass die Anstalten und Heime für die Zukunft der rechte Weg sind, diese Kinder zu betreuen. Wir leben doch im 20. Jahrhundert. Überall setzt sich der technische Fortschritt durch, und nur auf sozialem Gebiet sollten wir so rückschrittlich sein? Ich muss zu einer Lösung kommen. Ich möchte ein Programm entwerfen, um helfen zu können. Du weißt, meine Gruppe, die Buben. Ich kann es den Kleinen nicht antun, dass ich nur meine Heimabende mache und sie im Übrigen im Stich lasse. Ich möchte ihnen helfen, und ich weiß auch schon wie! Ich habe einen Plan gefasst. Mein Plan ist, ein Haus zu bauen, um diesen Buben dort ein Daheim zu schenken.