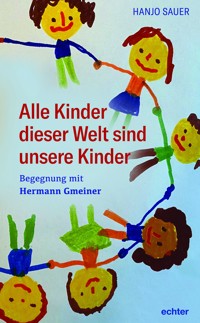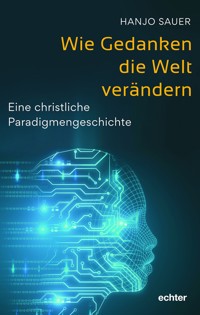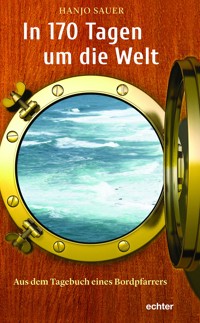
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Über 25 Jahre lang ist Hanjo Sauer als Bordgeistlicher auf Kreuzfahrtschiffen über die Ozeane gefahren. 170 Tage und Nächte ist er in diesem Buch unterwegs. Das Schiff macht Station in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika. Es ist eine Weltreise voller kleiner und großer Ziele sowie überraschender Begegnungen. Mit seinen Erfahrungen als Begleiter von Menschen rund um den Globus entführt Hanjo Sauer die Leser auf eine ganz besondere Fahrt. → Gedanken und Erlebnisse eines Pfarrers auf einem Kreuzfahrtschiff
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
In 170 Tagen um die Welt
Aus dem Tagebuch eines Bordpfarrers
HANJO SAUER
In 170 Tagen um die Welt
Aus dem Tagebuch eines Bordpfarrers
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2022
© 2022 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Covergestaltung: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen
Coverbild: © Bertold Werkmann/stock.adobe, Foto Hanjo Sauer
Fotos: © Hanjo Sauer
Bild S. 305: © Wikipedia
Weltkarte: © pingebat/Shutterstock.com
Layout Innenteil: satzgrafik Susanne Dalley, Aachen
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN 978-3-429-05780-0
ISBN 978-3-429-05225-6 (PDF)
ISBN 978-3-429-06581-2 (ePub)
INHALT
VORWORT
I. DER ATLANTK Dezember | Januar
II. UM AFRIKA HERUM Januar | Februar
III. QUER DURCH ASIEN Februar
IV. DER FÜNFTE KONTINENT Februar | März
V. IN DER SÜDSEE März | April
VI. SÜDAMERIKA April | Mai
VII. DIE KARIBIK Mai
VIII. RÜCKFAHRT Mai | Juni
DANK ZUM SCHLUSS
DER AUTOR
VORWORT
Jeder Weg hat ein Ziel. Eine Reise hat meist viele. Mit jedem Ziel, das erreicht ist, kommt ein Neues in den Blick. Das letzte Ziel einer Reise ist meistens die Rückkehr nach Hause. Der Weg oder auch die Reise ist eine beliebte Metapher für das Leben eines Menschen. Doch wie tragfähig ist diese Metapher? Gibt es auch ein Ziel des Lebens? Ist es nicht vielmehr so, dass jeder Tag, ja jede einzelne Stunde ihr eigenes Gewicht hat? Dass es in einem tatsächlichen Sinn zutrifft, dass der Weg selbst das Ziel ist! Im christlichen Sinn wird der Lebensweg Jesu so beschrieben, dass er unbeirrbar auf ein Ziel zusteuert, nämlich nach Jerusalem. Doch dieses Ziel ist eine Katastrophe. Dass dieses Ziel dann als der entscheidende Durchbruch zu einem neuen Leben verstanden wird, ist erst die spätere Sicht mit den Augen des Glaubens. Kann dieser Lebensweg Jesu als Modell für unser eigenes Leben gesehen werden? Macht das nicht Angst, so zu enden wie er? Was heißt Christ sein und christlich zu leben? Fragen über Fragen. Ich möchte sie nicht verdrängen, sondern mich ihnen stellen. Und ich werde es tun: auf einer Weltreise.
Nachdem ich seit über 25 Jahren Kreuzfahrtschiffe als Bordpfarrer begleite und ich mich daran gewöhnt habe, regelmäßig nach Checkliste meine Koffer zu packen, wird es jetzt das letzte Mal sein, dass ich als Bordpfarrer dabei bin. Die Altersgrenze wurde auf 70 Jahre gelegt und ich habe sie längst schon überschritten. Also wird diese Reise eine besondere sein, die letzte in einer gewissen Hinsicht. Ein Grund mehr, mich der Frage nach den Zielen einer Reise und dem Ziel der Lebensreise überhaupt zu stellen.
Es gibt viele Gründe, eine Reise zu unternehmen: das Abenteuer zu suchen, einfach Neugier auf fremde Menschen, Länder und Kulturen, die Flucht aus dem allzu vertrauten Zuhause mit dem bohrenden Gedanken: Das kann doch nicht alles gewesen sein. Es gibt hochdramatische Gründe und die Weltliteratur ist voll davon: sich auf die Suche nach einer fernen Geliebten zu machen, die man nur einmal kurz gesehen hat und deren Lächeln genügt hat, sich in die Ferne zu begeben, um sie zu finden. Noch immer berühren mich Clemens Brentanos Gedichte, die so großartig Gefühlen Ausdruck verleihen: „O Stern und Blume, Geist und Kleid, // Lieb’, Leid und Zeit und Ewigkeit!“ Oder das Gedicht „Ich träumte hinab in das dunkle Tal“.
Der Dichter folgt seiner Geliebten bis in die Hölle hinab und muss erkennen, dass es sich nicht um Wirklichkeit, sondern um eine Einbildung gehandelt hat. Immer bewegt hat mich auch der Gedanke, die blaue Blume der Romantik zu finden. Gibt es ein schöneres Symbol für das unsympathisch abstrakte Wort einer „Suche nach dem Sinn“?
Jede Reise hat ihr Ziel, sie hat aber auch viele kleine Ziele. Alle diese nehmen das große Ziel am Ende schon vorweg. Die Weltreise, die vor mir liegt, rund um den Globus, ist voller kleiner Ziele. In meinem Tagebuch möchte ich die Gedanken festhalten, was diese Ziele für mich bedeuten. Natürlich bieten große Ziele, zumal wenn sie von Mythen umgeben sind, eine enorme Projektionsfläche, um hier einen Ort für seine eigenen Gedanken zu finden. Ich finde das nicht schlimm, nur muss man sich dessen bewusst sein, dass wir vieles in die Dinge hineinlegen. Wir finden, was wir finden wollen.
Eine Kreuzfahrt ist keine Pilgerreise, aber auch nicht das Gegenteil davon, wenn man einmal vom kargen Lebensstil eines Pilgers absieht. Eine Kreuzfahrt bietet Luxus, doch dieser muss nichts Schlimmes sein, solange er nicht zum Selbstzweck wird. Eine Facette dieses Luxus ist die freie Zeit, gewonnen dadurch, dass andere für das Lebensnotwendige (Essen, Unterkunft, Fortbewegung) sorgen. Bei einer Pilgerreise geht es im Grunde oft um die Suche nach sich selbst, nach anderen und nicht zuletzt nach dem Geheimnis Gottes selbst. Dabei sind diese drei im Grunde eins. Immer ist die Suche nach dem eigenen Selbst sozial vermittelt. Ohne den Bezug zu anderen Menschen begreifen wir nicht, wer wir sind, was wir wollen und was wir hoffen dürfen. Und als Inbegriff dieser Suche sehe ich das Geheimnis Gottes, denn in ihm ist alles andere wunderbar geborgen. Dieses Geheimnis Gottes ist nichts Fremdes, sondern der eigentliche Schlüssel zu mir selbst, zu anderen und zu der Welt als ganzer.
I.DER ATLANTIK
Dezember | Januar
Elbphilharmonie in Hamburg
Einschiffung in Hamburg
Es gibt drei Momente zu Beginn einer Schiffsreise, die von besonderem Zauber sind: das Schiff sehen, das Schiff betreten, in die eigene Kabine gehen. Wie oft schon habe ich bei der Anreise Ausschau gehalten, bis der Schornstein des Kreuzfahrtschiffes hinter den Häusern auftaucht. Dieser Blick ist eine erste Kontaktaufnahme, fast eine liebevolle Begegnung. Das wird mein Ort im nächsten halben Jahr sein, ein zeitlich begrenztes Zuhause, ein Zufluchtsort. Etwas, an das ich mich binden kann, das mir Sicherheit verleiht, auch wenn es manchmal eine bedrohte Sicherheit ist. Das Schiff betreten: ein magischer Moment, das feste Land zu verlassen und sich einem künstlichen Boden anzuvertrauen. Deutlich wird das freilich nicht bei einem gigantischen Stahl-Koloss, der sich unter der Last eines einzelnen Menschen keinen Millimeter bewegt. Deutlich wird dieses Gefühl bei einem kleinen Boot, das zu schwanken beginnt, wenn es eine neue Last aufnimmt.
Schon die kleinen Tenderboote, die bei Landausflügen ins Spiel kommen, wo keine entsprechenden Hafenanlagen zur Verfügung stehen, fangen unter der Last einiger weniger Passagiere zu schwanken an. Hier wird erlebbar, was es heißt, sich Wind und Wellen anzuvertrauen. Jetzt noch der dritte magische Augenblick: das erste Betreten der eigenen Kabine. Tipptopp geputzt, einladend hergerichtet, ist es eine Freude, das kleine Zuhause für das nächste halbe Jahr in Empfang zu nehmen.
Am ersten Tage einer Seereise steht grundsätzlich eine Sicherheitsübung auf dem Programm. Am meisten gefordert sind dabei die Crewmitglieder. Für sie ist die Übung Teil ihres Dienstes. Mit viel Geduld und gutem Zureden suchen sie, halbwegs für Disziplin zu sorgen. Die Ansage: „Dass Sie den Befehlen der Crew unverzüglich Folge leisten, kann über Leben und Überleben entscheiden!“, beeindruckt nicht besonders. Zunächst geht es darum, der Demonstration zuzusehen, wie eine Schwimmweste sachgerecht angelegt wird. Die Ansage: „Bitte schauen Sie zunächst nur zu, bevor Sie dann selbst die Schwimmweste anlegen“, hindert manche Gäste durchaus nicht daran, sofort selbst auszuprobieren, wie das Ding funktioniert. Wieder geduldiges Zureden. „Bitte warten Sie! Nehmen Sie noch Platz!“ An der Schwimmweste ist eine Pfeife angebracht. Auch wenn die Ansage lautet: „Bitte benutzen Sie die Pfeife jetzt nicht!“, kann man darauf wetten, dass es einige Neugierige gibt, die in ein kleines Pfeifkonzert einstimmen. Dann der Gurt. Wenn die Schwimmwesten in der Kabine aufgehoben werden, ist der Gurt meist kurz zusammengezogen, um eine kompakte Unterbringung im Schrank zu gewährleisten. Also muss erst mal der Gurt auseinandergezogen werden, wenn ein Anlegen der Schwimmweste gelingen soll. Nicht wenige scheitern daran. Also geduldige Assistenz der Crew, bis endlich die Schwimmweste wirklich sitzt. Dann eine Demonstration, wie man sich bei einem eventuellen Sprung ins Wasser zu verhalten hat: die Nase zuhalten, die Schwimmweste dagegen sichern, dass sie durch den Sprung ins Wasser aufgetrieben wird. Alles wirkt sehr theoretisch und niemand mag sich vorstellen, wie es im Ernstfall aussehen könnte. Weil auch die Schiffsleitung daran interessiert ist, den Ernstfall nicht zu realistisch auszumalen, nimmt man zu diesem Ritual Zuflucht, das sich „Sicherheitsübung“ nennt. Es endet meist damit, dass der Kapitän seine Runde dreht und sich persönlich überzeugt, dass alle Passagiere auf Deck angetreten sind. Wahrscheinlich wird auf dieser Reise irgendwann einmal der Film „Titanic“, der gewaltige Blockbuster von James Cameron mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, auf dem Programm stehen. Er vermittelt recht realistische Bilder, was sich im Fall einer Katastrophe auf einem Schiff ereignet. Aber auch hier werden die Abwehrmechanismen funktionieren: Das war ja schon so lange her. Damals gab es die heutigen Sicherheitsstandards noch nicht …
Durch den Ärmelkanal
Habe zur Sicherheit den Wecker gestellt, denn heute, am Sonntagmorgen, steht ein Gottesdienst auf dem Programm. Die Albe mit Stola über den Arm! Kelch, Patene und Altarschmuck sind oben in der Apollo-Lounge auf Deck 9. Der Raum ist wunderschön, einer der schönsten auf dem Schiff überhaupt. Er befindet sich über der Kommandobrücke und erlaubt einen weiten Blick auf das Meer hinaus. Das Wetter ist bedeckt. Wir haben Windstärke 4, also schaukelt es etwas. Doch das dürfte sich heute im Rahmen halten, nicht so wie einmal im Mittelmeer, als wir gerade an der Mündung der Rhone vorbeikamen und der berüchtigte Mistral für eine stürmische See sorgte. Damals fand der Gottesdienst im Kino statt, als ich plötzlich bemerkte, dass sich durch die Erschütterungen der Altartisch langsam vorwärts, in Richtung Bühnenrampe, bewegte. Was blieb mir anderes übrig, als mit einer Hand den leichten, zusammenklappbaren Altartisch festzuhalten und mit der anderen die liturgischen Rituale zu vollziehen, für die ich sonst zwei Hände zur Verfügung hatte. Nein, so würde es heute nicht sein. Trotzdem, es ist gut, sich schön breitbeinig hinzustellen und für alle Fälle eine Säule im Blick zu behalten, die im Ernstfall Halt bieten könnte.
Es ist nun zehn vor neun. Die ersten Besucher kommen. Ich warte bis Punkt 9 Uhr und beginne dann mit der Begrüßung. Zuerst einmal mich selbst vorstellen.
Viele Gäste schätzen es sehr, von einem Bordpfarrer Persönliches zu erfahren. Ich bin Jahrgang 1944, geboren in der fränkischen Stadt Bamberg. Ich schaffte es gerade noch, in Bamberg auf die Welt gekommen zu sein, denn die meisten meiner Mitschüler hatten Burgwindheim als Geburtsort. Dorthin wurde nämlich die Frauenklinik verlegt, als sich die Fliegerangriffe häuften. Meine beiden Vornamen, Johannes und Joseph, verdanke ich den älteren Brüdern meiner Mutter, die beide in Russland gefallen sind. Der jüngere Bruder meiner Mutter hatte die Idee, dass man eine Abkürzung für beide Namen, Hans und Joseph, also „Hanjo“ verwenden könnte. Diese hat mir immer gut gefallen. Aufgewachsen bin ich nach dem Krieg in Bamberg. Mein Vater ist früh gestorben. Nachdem ich das einzige Kind meiner Eltern war, hat sich die Beziehung zu meiner Mutter sehr intensiv gestaltet. Das brachte auch Probleme mit sich, aber nachdem meine Mutter eine sehr kluge Frau war, hat sie mir immer den Freiraum gegeben, den ich gebraucht habe. Mit den Lehrern am Gymnasium hatte ich großes Glück. Fast alle waren jung und als Pädagogen sehr engagiert. Mein Interesse für die Fächer Religion und Geschichte führte dann zu der Berufswahl, katholische Theologie zu studieren und Priester zu werden. Das habe ich mit großer Hingabe getan, zunächst in Bamberg, dann in Innsbruck und in Paris. Mit der Promotion war der Weg zu einer akademischen Laufbahn geöffnet. Doch vor der Habilitation in Würzburg kam für mich noch eine spannende Zeit: Ich habe zur Ausbildung von Projektleiter*innen für die weltweite SOS-Kinderdorf-Organisation fünf Jahre eng mit Hermann Gmeiner, dem Gründer der SOS-Kinderdörfer, zusammengearbeitet. Ein knappes Jahr war ich beim Aufbau eines SOS-Kinderdorfes in Kairo. Später folgte dann ein ehrenamtliches Engagement für den deutschen SOS-Kinderdorfverein. Als Professor für Fundamentaltheologie war ich dann ab 1993 in Linz in Oberösterreich tätig, wo ich viele Freunde und Freundinnen kennenlernen konnte. Der relative Freiraum eines akademischen Lehrers machte es mir möglich, jedes Jahr ein oder zwei Kreuzfahrten als Bordpfarrer zu begleiten. So weit zu meiner Vorstellung.
Es folgt dann ein nützlicher Hinweis auf den ökumenischen Charakter des Gottesdienstes mit einem Wortgottesdienst und einer Eucharistiefeier – natürlich muss ich diesen Begriff sofort übersetzen mit „Mahlfeier“ oder „Abendmahl“, zu dem ich herzlich einlade. Das erste Lied klingt leider recht dünn, obwohl es eines der bekanntesten Adventslieder ist: „Tauet Himmel“. Ich hoffe, die Lust am Singen nimmt noch zu. Im Evangelium am heutigen vierten Adventssonntag ist von Johannes dem Täufer die Rede. Ein Evangelium, zu dem ich einen besonderen Bezug habe und zu dem mir viel einfällt. Bereits bei der Anreise nach Hamburg habe ich mir Gedanken gemacht. Ich möchte darauf hinaus, was es heißt, das Rechte zu tun. Das Rechte, das mir mein Gewissen sagt, nicht was im Umfeld der Gesellschaft besonders geschätzt wird. Das Projekt von Johannes dem Täufer scheint mit seinem gewaltsamen Tod gescheitert und doch bleibt er als aufrechter und kritischer Prophet, der sich nicht bestechen lässt, in Erinnerung und lebt so fort. Dabei fällt mir eine wunderschöne Formulierung des amerikanischen Politikwissenschaftlers Benedict Anderson für „unsere eigenen“Toten ein. Er sagt, es müsse an sie erinnert werden, damit „sie nicht umsonst gestorben sind“. Für die Bibel ist Johannes der Täufer nicht umsonst gestorben. Er verkörpert die beste prophetische Tradition Israels, die an der Weisung des Herrn festhält, dem Inbegriff des Humanen, gegenüber aller Bedrohung durch Gewalt. Nach dem Gottesdienst bitte ich um Applaus für Oleg, den Pianisten, der schüchtern kurz aufsteht und sich verbeugt. Jetzt vor dem Mittagessen noch ein kurzer Gang über die offenen Decks, auch wenn das Wetter nicht gerade einladend ist: kühl und leicht regnerisch. Als ich auf das offene Meer hinausschaue, fällt mir der geschichtsträchtige Ort ein, den wir durchfahren, nämlich der Ärmelkanal. Was hat sich hier nicht alles an kriegerischen Auseinandersetzungen abgespielt, angefangen vom Untergang der spanischen Armada im Kampf mit der britischen Flotte, dann – viel später – die Evakuierung der britischen Truppen im Jahr 1940 von Dünkirchen aus, schließlich, vier Jahre später, die Invasion der amerikanischen und britischen Truppen am D-Day, die die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs einleitete. Bei einem Urlaub in der Normandie habe ich einmal die wichtigsten Schauplätze besucht: Utah Beach, Omaha Beach, Juno und Sword Beach. Aus heutiger Sicht ist es nur mehr schwer nachvollziehbar, dass dieses Unternehmen trotz des gewaltigen Einsatzes an Menschen und Material ein Wagnis gewesen war. Militärhistoriker berichten, dass General Eisenhower bereits ein Schreiben verfasst hatte, mit dem er im Fall des Scheiterns der Operation der Öffentlichkeit Rechenschaft für seine Entscheidungen geben wollte.
In der Bucht von Biskaya
Ausschlafen ist nicht. Wir haben wieder einen Seetag und ich bin zur Morgenandacht um 9:15 Uhr eingeteilt. Heute ist Montag, der Tag vor Heilig Abend. Gut, dass noch etwas Zeit bleibt, die Weihnachtsfeier vorzubereiten. Die Morgenandacht wird das Thema „Advent“ haben. Eine liturgische Zeit, die ich sehr liebe, weil sie bewusst macht, wie sehr wir auf die Zukunft bezogen sind. Vom „Gott vor uns“ hat der berühmte Münsteraner Fundamentaltheologe Johann Baptist Metz in seinen Meditationen zum Advent gesprochen. Natürlich ist es dabei wichtig, keine Flucht in die Zukunft anzutreten, um damit den Herausforderungen der Gegenwart zu entfliehen. „Stirb nicht im Warteraum der Zukunft“hat der Theologe und Bestsellerautor Harvey Cox in den Sechzigerjahren gewarnt. Der Untertitel seines Buches war „Aufforderung zur Weltverantwortung“. Wenn wir uns gut neutestamentlich auf die Gestalt von Johannes dem Täufer beziehen – und das möchte ich heute in der Morgenandacht tun –, dann besteht keine Fluchtgefahr. Der Täufer setzte sich existenziell für die Veränderung der ungerechten Verhältnisse ein. Als er sich mit seinem Aufruf zur Buße nicht scheute, auch am Sessel der Mächtigen zu rütteln, bedeutete dies sein Todesurteil. König Herodes, der keinen Mahner und Sozialreformer brauchte und umstürzlerische Ideen im Keim ersticken wollte, ließ ihn enthaupten. Die junge Christengemeinde sah mit Recht in seiner Lebensgeschichte eine Parallele zur Lebensgeschichte Jesu und machte den Täufer zu einem „Vorläufer“, auch wenn die historischen Daten eher auf ein Konkurrenzverhältnis hinweisen, zumindest was die jeweilige Anhängerschar betrifft.
Damit diese Gedanken für die Morgenandacht auch optisch ansprechend sind, habe ich kleine Farbbilder mitgebracht. Eines ist eine Reproduktion des Ölgemäldes „Die Predigt Johannes des Täufers“ von Pieter Bruegel dem Älteren aus dem Jahr 1566, im Original im Szépművészeti Múzeum in Budapest zu finden. Was ist zu sehen? Auf einer Waldlichtung hat sich eine Menschenmenge versammelt. Zu sehen sind im Hintergrund ein Flusslauf, Berge und eine Burganlage. Man muss erst eine Zeitlang suchen, bevor der titelgebende Protagonist, nämlich Johannes der Täufer, zu finden ist. Sehr klein dargestellt in einem einfachen, braunen Bußgewand. Die Landschaft weist nicht auf den Orient hin, sondern auf Flandern, die Heimat Bruegels. Bei genauer Betrachtung finden sich unter den Zuhörern des Täufers auch fremdartig wirkende Gestalten: ein Osmane mit Turban, ein Chinese, ein Mongole. Nicht alle hören der Predigt zu. Manche sind mit sich selbst beschäftigt, diskutieren miteinander, sind auf Bäume geklettert. Der Täufer selbst weist auf Jesus hin, noch kleiner dargestellt als er selbst, aber durch ein helles Gewand aus der Menschenmenge hervorgehoben.
Man muss nicht lange rätseln, dass Bruegel in der Gestaltung seiner Menschenmenge ein Sinnbild für die Universalität aller Menschen darstellt, nicht eingegrenzt auf bestimmte soziale Schichten von Reichen oder Armen, nicht eingegrenzt auf bestimmte Länder oder Kontinente. Globalität war in der Zeit von Philipp II., dem spanischen Monarchen, dessen Reich bereits die neue Welt mit umfasste, eine Realität geworden. Gleichzeitig war in Europa längst die einende Klammer der Politik, wie des gemeinsamen Glaubens, zerbrochen. In den südlichen Niederlanden war es unter dem Einfluss des Calvinismus zu Bilderstürmen gekommen, in denen die Kunstwerke in den Kirchen vernichtet worden waren. Allenthalben lag Aufruhr in der Luft.
Möglicherweise ist die Darstellung Bruegels auch den damaligen „Heckenpredigten“ nachempfunden, in denen religiöse Eiferer das Volk für den neuen Glauben zu begeistern suchten. Nachdem solche Versammlungen offiziell verboten waren, fanden sie außerhalb der Städte unter offenem Himmel statt. Der Reiz des Bildes besteht darin, dass seine Botschaft nicht eindeutig ist. Eindeutig ist jedoch die Absicht des Malers, zwischen dem biblischen Geschehen und seiner Gegenwart einen Bezug herzustellen. Doch je mehr man die Symbole des Bildes zu entschlüsseln sucht, umso mehr Fragen ergeben sich. Genau dies ist die kreativste Einstellung gegenüber alten Texten, also auch der Bibel. Diese Texte werden aus dem toten Buchstaben wieder lebendig, indem wir mit ihnen zu kommunizieren beginnen. Gäbe es eine bessere Vorbereitung zum Weihnachtsfest als diese Offenheit dem Neuen gegenüber, wie sie Johannes der Täufer verkörpert?
Heiliger Abend – Fahrt um das Kap Finisterre
Heute ist Heiliger Abend. Wenn ich in das Tagesprogramm sehe, wird mir wieder die Paradoxie bewusst, einen ganzen Tag nach einem Teil des Tages, nämlich dem Abend, zu benennen. Aber der Abend ist so bedeutsam, dass er den ganzen Tag prägt. Für mich ist heute Großeinsatz: zunächst um 9:15 Uhr die Morgenandacht, dann um 20 Uhr bei der Show zum Heiligen Abend eine allgemeine Ansprache, schließlich ein Impuls im kleinen Kreis der Mitglieder des Ariadne-Teams (eine Idee, die ich mit dem Kreuzfahrtdirektor abgesprochen habe) und schließlich um 23 Uhr die Mitternachtsmette, zu der auch die Mitglieder der Besatzung eingeladen sind. Nachdem die meisten von ihnen von den Philippinen kommen, ist es zwingend, einen Teil der Liturgie in englischer Sprache zu gestalten. Einen Großteil des Programmes habe ich schon zu Hause vorbereitet, so kann ich mich richtig auf den Tag und insbesondere den Abend freuen. Glücklicherweise hat der Wind etwas nachgelassen, sodass kaum mit zu viel Seegang zu rechnen ist. Wäre ja schade, wenn auf diese Weise der Heilige Abend buchstäblich ins Wasser fallen würde. Zur Morgenandacht sind etwa 25 Personen erschienen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie auch heute Abend wieder dabei sein.
Dem Tag entsprechend geht es um die Herbergssuche. Im Johannesevangelium 1,11 so formuliert: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Es liegt nahe, diesen Gedanken zu vertiefen: Was heißt Heimat? Wo sind wir zuhause? Was bedeutet es, in der Fremde zu leben? Mir fällt die Formulierung des Tübinger Philosophen Ernst Bloch ein, ein Philosoph, der sich selbst einen Atheisten nannte, aber die Bibel besser kannte als mancher Theologe. Er schreibt am Ende seines Werkes „Das Prinzip Hoffnung“:
„Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten. […] Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“
Der marxistische Hintergrund ist unverkennbar. Die Fokussierung auf den schaffenden Menschen, der sich selbst aus der Entfremdung befreit. Doch von Bloch kann man immer lernen. Und es tut gut, dem Klischee von „Heimat“ – man muss nur an die rührseligen „Heimatfilme“ denken – die Kritik in Form der Utopie entgegenzustellen. Heimat ist etwas, das erst werden muss. Ganze Bücher wurden über diese Bestimmung der Heimat geschrieben „das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war“. Im christlichen Glauben lässt sich der Begriff der Heimat, positiv besetzt und voller Versprechungen, in die Nähe des „Reiches Gottes“, wie es Jesus verkündet hat, rücken. Und der Johannesprolog, den ich vorlesen möchte, schaut nicht nur in die Zukunft, sondern interpretiert die Gegenwart als den Ort, in den Gott selbst gekommen ist. Hohe Theologie und doch übersetzbar.
Weihnachten ist der Geburtstag Jesu. Die Schilderungen der Kindheitserzählungen in den Evangelien machen allesamt deutlich: Die Umstände von Jesu Geburt waren alles andere als idyllisch. Er hat keinen Ort, kein Bleiberecht, er rückt in die Gemeinschaft der Marginalisierten und die ersten, die an die Krippe kommen, sind selbst Marginalisierte, die kein Bürgerrecht haben, die im Ansehen der Gesellschaft ganz unten stehen. Gerade ihnen wird von den Engeln die Botschaft gesungen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seiner Gnade“ (Lk 2,14).
Am Abend werde ich etwas zum Weihnachtsfest und seiner Bedeutung sagen. Ursprünglich wurde an diesem Datum im römischen Reich das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes „Sol invictus“ gefeiert. Die Christen legten dann auf diesen Tag die Feier der Geburt Jesu. Diese Entscheidung war genial, denn es kam zu einem Zusammentreffen von Natur- und Geschichtskategorien. In der Natur wird die Wintersonnwende gefeiert, der kürzeste Tag. Nun werden die Tage wieder länger. Diese Erfahrung greift tief in das Leben von Naturvölkern ein. Denn Licht bedeutet Leben – weiterleben können. Die Geschichte bezieht etwas historisch Greifbares, nämlich die Geburt Jesu, auf diese Grunderfahrung des Lichtes. Im Johannesevangelium ist das Licht ein Heilssymbol. Es ist nahezu synonym mit dem Leben. „In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst.“ So heißt es in den Versen 4 und 5. Und im Vers 9 heißt es von der Geburt Jesu: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“ Doch auf dieser abstrakten Ebene möchte ich mich bei meiner Weihnachtsansprache nicht bewegen. Sie soll ein erzählendes Moment haben.
Im Hinblick auf das Licht fiel mir die Geschichte vom König und seinen drei Söhnen ein. Sie eignet sich wunderbar zum Erzählen. Ein König kann sich nicht entscheiden, wem von seinen drei Söhnen er die Nachfolge der Regierung seines Reiches anvertrauen soll. Er liebt sie alle gleich. Er befragt seine Weisen, was er tun könne. Sie raten ihm, er solle seinen Söhnen eine Prüfungsaufgabe geben. Wer sie am besten erfülle, der solle der König sein. Die Aufgabe besteht darin, die größte Halle des Königreiches in einem Tag mit etwas zu füllen, das sich die Söhne aussuchen können. Der älteste Sohn wählt Stroh. Er organisiert Hunderte von Wagen und lässt sie alles Stroh, das er finden kann, in die Halle bringen. Doch so sehr sich die Knechte auch anstrengen, die Halle wird bis zum Abend nur bis zur halben Höhe voll. Nun kommt der zweite Sohn an die Reihe. Er überlegt, dass sich vielleicht Heu besser eignen könne. Es sei leichter. Tatsächlich kann er die Halle höher füllen als der älteste Sohn, doch ganz voll wird sie nicht. Nun kommt der jüngste Sohn an die Reihe. Alle wundern sich, dass den ganzen Tag über nichts geschieht. Keine Wagen sind unterwegs. Nichts wird transportiert. Am späten Abend lädt der Königssohn seinen Vater und dessen Gefolge in die Halle ein und lässt die Tore schließen. Es ist stockdunkel. Er öffnet ein kleines Kästchen und zündet eine Kerze an. Dieses Licht der Kerze dringt bei der völligen Dunkelheit bis in die letzten Winkel der großen Halle, bis ganz unter das Dach. Der König ist überzeugt. Indem sein jüngster Sohn das Licht gewählt hat, hat er sich als würdiger Nachfolger erwiesen.
Gisela, die Künstlerbetreuerin, hat mir den Ablaufplan der Feier gegeben. Ich habe für meine Ansprache einen prominenten Platz, nach den Worten des Kapitäns und des Kreuzfahrtdirektors. Und ich habe eine prominente Begleitung. Zwei junge Damen des Show-Ensembles begleiten mich, angetan mit einem Engelskostüm, auf die Bühne. Wunderschöne weiße Seide, mit einem Strahlenkranz auf dem Kopf. Sie tun das mit der ihnen eigene Grazie. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich sagen möchte und darf mich von ihnen nicht ablenken lassen. Das geht umso leichter, als sie nicht in meiner Blickrichtung stehen, sondern links und rechts von mir. Der Kameramann aus Wien, mit dem ich mich im Laufe der Zeit anfreunden werde, hat diese ganze Szene aufgenommen, sodass ich sie mir einige Tage später in Ruhe ansehen kann. Diese zehn Minuten gehören mit zum Kostbarsten, das ich je auf einem Schiff erlebt habe.
Nach der allgemeinen Weihnachtsfeier bleibt nicht viel Zeit. Ich gehe zum internen Treffen der Mitglieder des Ariadne-Teams. Einer von den jungen Leuten des Bordreisebüros hat eine Mundharmonika mitgebracht. Ihr Klang tut als Kontrast zur Bordkapelle, die mit kräftiger elektronischer Unterstützung spielt, ausgesprochen gut. Dann erzähle ich das Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzchen von Hans Christian Andersen. Die Geschichte ist ganz einfach, aber sie geht ans Herz. Als ich von Andersen, seiner Lebensgeschichte und seinen Themen erzähle, bemerke ich, dass Meinhard, dem Golfprofi, dicke Tränen über die Wangen herunterlaufen. Ich werde ihn behutsam in den nächsten Tagen ansprechen. Heute bleibt keine Zeit für ein Gespräch, denn es gilt bereits, sich für die Christmette vorzubereiten, die um 23 Uhr in der Atlantiklounge stattfinden soll. Klugerweise habe ich auf meiner Kabine bereits alles zusammengestellt, was ich brauche. In der Mitte des Wortgottesdienstes wird die Weihnachtsgeschichte nach dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums stehen. „In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen.“
Zur Christmette habe ich außer allen Gästen auch die Besatzungsmitglieder eingeladen. Ich verweise ausdrücklich darauf, dass wir den Gottesdienst zweisprachig feiern werden. In den nächsten Tagen werde ich zu einem eigenen Gottesdienst in englischer Sprache in die Crew-Messe kommen. Heute müssen sich alle Besatzungsmitglieder, die gekommen sind, mit nur einigen, wenigen Elementen in englischer Sprache begnügen. Außer einer Kurzzusammenfassung meiner Ansprache werden das einige Teile des Hochgebets sein, die regelmäßigen Gottesdienstbesucher*innen vertraut sein sollten, sodass es mir zumutbar erscheint, ihnen den deutschen Text vorzuenthalten. Alle Texte doppelt, also sowohl in deutscher wie auch in englischer Sprache vorzulesen, würde die Liturgie der Christmette furchtbar schwerfällig und langatmig machen. Obwohl ich von diesem sprachlichen Kompromiss überzeugt bin, wird es am nächsten Tag Beschwerden an der Rezeption geben: „Nicht mal den Weihnachtsgottesdienst kann man hier in deutscher Sprache miterleben!“
Bezeichnenderweise ist niemand zu mir selbst gekommen, denn ich würde gerne einen Bezug von Inhalt und Form herstellen. Wie absurd ist es, eine Weihnachtsbotschaft von den Hirten an der Krippe vorzulesen, wenn hier am Schiff die in jeder Hinsicht Unterprivilegierten, die Tag für Tag für uns arbeiten und denen wir allen Komfort zu verdanken haben, von einer gemeinsamen Weihnachtsfeier ausgeschlossen werden? Ich kann meine Argumente für mich behalten, denn niemand von den Gästen, die sich aufregen, spricht mich an.
Weihnachten in Lissabon
Als ich früh aufwache, haben wir bereits am Pier von Lissabon festgemacht. Ich liebe Lissabon! Ich finde die Stadt eine der schönsten in Europa überhaupt. Gerade weil ihr die staatspolitisch repräsentativen Gebäude fehlen, die die Absicht haben, imperialen Eindruck zu machen. Okay, es gibt das Denkmal der Entdeckungen (portugiesisch: Padrão dos Descombriementos) mit 57 Metern Höhe, erst 1960 zum 500. Todestag von Heinrich dem Seefahrer durch das autoritäre Salazar-Regime errichtet, das mit diesem Monument sich selbst feiern wollte.
Es gibt das in Größe und Ausstattung einmalige Hieronymuskloster, ein Prachtexemplar der portugiesischen Spätgotik, beide im Stadtteil Belem gelegen, aber es gibt eben auch die zu eigenen Entdeckungen einladende Alfama, zwischen dem Castelo de São Jorge und dem Ufer des Tejo gelegen. Hier hat das Erdbeben des Jahres 1755 besonders gewütet, ein Erdbeben, das buchstäblich ganz Europa erschüttert hat. Der berühmte Universalgelehrte Leibniz sah seine steile theologische These, Gott habe für uns „die beste aller möglichen Welten“ geschaffen, angesichts dieser Naturkatastrophe, bei der nahezu 100.000 Menschen den Tod fanden, ad absurdum geführt. Lissabon ist eine geschichtsträchtige Stadt.
Ich will heute in die Alfama. Quer durch die Alfama geht die Straßenbahnlinie 12. Ursprünglich als Pferdeeisenbahn gebaut, sind nach der Stilllegung von mehreren Linien aus ökonomischen Gründen immerhin noch einige übrig geblieben. Vom Cruise Port in die Altstadt ist es nicht weit. Die Linie 12 ist schnell erreicht und ich muss auch nicht lange warten, bis einer der gelben Tram-Wagen kommt. Er ist halb leer. Das erlaubt eine gute Aussicht. Erstaunlich, wie das kleine Bähnchen die steilen Hügel hochkommt! Ich steige in der Nähe des Castello bei S. Tomé aus und laufe hinüber zur Barockkirche Igreja do Menino Deus. Es ist gerade kurz nach zehn und die letzten Gottesdienstbesucher eilen herbei. Die Plätze sind restlos besetzt. Ein wunderschöner, etwas traurig klingender Gesang. Die Besucher*innen – geschätzt meist über 60. Das ist in Deutschland nicht anders. Als die Predigt beginnt, verlasse ich die Kirche wieder. Nun also ein kleiner Stadtbummel in Lissabon. Es ist wunderschön, durch die schmalen Gassen mit den vielen Treppen in der Altstadt zu flanieren.
Lissabon: in der Alfama
Gebannt bleibe ich plötzlich vor einer bemerkenswerten Silhouette unter einem Torbogen stehen. Zwei alte Damen reden ununterbrochen aufeinander ein. Sie reden sehr schnell, beide gleichzeitig, und machen dabei einen äußerst zufriedenen, ja mir erscheint, einen beinahe glücklichen Eindruck. Ich bin fasziniert und warte darauf, dass eine von den beiden vielleicht kurz innehalten und nur zuhören könnte, aber nein, beide hören nicht auf zu reden und es geht ihnen sichtlich gut dabei.
Ohne mich weiter meinen Gedanken über Kommunikation zu überlassen, gehe ich weiter und beschließe, mir diese Szene mit den beiden alten Damen in Lissabon gut im Gedächtnis zu behalten. Ich werde sie auch am Abend als kleinen narrativen Einstieg in meinen Gottesdienst verwenden. Denn bei der Weihnachtsbotschaft geht es um etwas elementar Kommunikatives: Gott sagt sich in einem Kind der Welt zu. Er sagt ein Wort in die Welt, das Fleisch geworden ist. So werde ich es nicht sagen können, das klingt zu theologisch, zu abgehoben.
Hieronymus-Kloster in Lissabon
Ich werde also das Geschehen deutlicher in den Alltag versetzen: Schau ein Kind an und mache dir dabei bewusst, wie die Eigenschaften des Kindes das Handeln Gottes charakterisieren: verletzlich zu sein, ganz auf andere angewiesen, selbst nur empfangend. Das ist paradox, denn normalerweise erwarten wir, beschenkt zu werden. Nun aber – so die Botschaft von Weihnachten – werden wir in der Weise beschenkt, dass wir bereit sind, herzugeben, uns zu öffnen. Ich denke, mit diesen Grundgedanken wird sich etwas anfangen lassen.
Ich habe mir für den Weihnachtsgottesdienst in der Atlantik-Lounge nur Stichpunkte für die Predigt aufgeschrieben. Es soll möglichst spontan und lebendig sein. Da kann ich keinen ausartikulierten Text brauchen. Ich habe die schönsten Weihnachtslieder ausgewählt: „Es ist ein Ros entsprungen“, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“. Natürlich werde ich in ökumenischem Sinn darauf hinweisen, dass Martin Luther den Text dieses Liedes 1535 verfasst hat. Dann am Schluss „O du fröhliche“. Wer hätte gedacht, dass dieses Lied im 19. Jahrhundert ursprünglich für Kinder geschrieben wurde. Eine zweite Strophe bezog sich auf die Oster-, eine dritte auf die Pfingstzeit. Entscheidend für die Verbreitung war wohl die eingängige sizilianische Melodie, ursprünglich verwendet für ein lateinisches Schifferlied, das sich an die Jungfrau Maria gerichtet hat: „O sanctissima, o piissima“. Für unseren Geschmack zu schwülstig. Aber die Melodie ist eingängig und niemand mag sich heute mehr die alte Verwendung vorstellen.
Tatsächlich kommen viele Gäste. Die Zeit ist gut vor dem Abendessen platziert. Als ich dann nach dem Gottesdienst Stola und Albe ausziehe und auf die Kabine bringe, merke ich, wie der Druck nachlässt, der mir vorher gar nicht bewusst gewesen war. Es braucht aber einen gewissen Druck, manche sprechen von Lampenfieber. Ich würde sogar sagen: Ohne jedes Lampenfieber, ohne jede innere Anspannung, nimmst du deine Zuhörer*innen nicht ernst. Erst diese Spannung schafft die notwendige Konzentration.
Zurück in der Kabine suche ich mir zusammen, was ich zur Morgenandacht am kommenden Tag brauche. Das Thema soll lauten: „Christ sein heißt, immer wieder Christ zu werden.“ Es hat mich sehr beeindruckt und ist mir immer noch im Gedächtnis, als der bekannte Theologe Karl Rahner fünf Jahre vor seinem Tod sagte: Jeder Christ / jede Christin müsse und dürfe sagen: „Ich hoffe, dass ich ein Christ werde, das heißt, ein irgendwie sich dem Ideal eines Christen asymptotisch annähernder Mensch.“ Mich hat irritiert, dass Rahner das Wort „irgendwie“ gebrauchte. Das verwendet er sonst nie. Es signalisiert, dass er nicht durchblickt und dies offen zugibt. Es gelte also, sich „irgendwie“ dem Ideal eines konsequenten Lebens in der Nachfolge Christi anzunähern. „Asymptotisch“ will sagen: auf einer Linie, die erst im Unendlichen ihren angezielten Punkt trifft. Die Bemühung um sein eigenes Christsein drückt Rahner dann in einem Gebet aus:
„Lieber Gott, hilf, dass ich nicht nur meine, ein Christ zu sein, sondern wenigstens so langsam einer werde.“ Einer nämlich, „dem es irgendwie gelingt, gewissermaßen in der verschlossenen Existenz, in dem Gefängnis seines Lebens ein kleines Loch zu entdecken, durch das er in die Freiheit der Liebe, der Treue, der Hoffnung, der Selbstlosigkeit hinausgelangt.“
Eine wunderbare Metapher: ein kleines Loch im Gefängnis des eigenen Lebens, durch das man in die Freiheit gelangt. Gottes Freiheit, die wirkliche Freiheit, zu der wir unterwegs sind, ist ein großartiges Geschenk und ganz und gar nicht selbstverständlich. Ein Christ zu sein, sich als solche*r zu bekennen, meint daher immer, ein*e Christ*in zu werden.
Arrecife, Lanzarote
Heute werden wir die Kanarischen Inseln erreichen und die nördlichste Insel Lanzarote ansteuern. Das ist von der Routenplanung her eine gute Wahl, denn Lanzarote bietet aufgrund des vulkanischen Geschehens, das immer noch zu beobachten ist, eine einmalige Landschaftsformation. Zu meiner großen Freude bin ich zur Begleitung eines Ausflugs eingeteilt, der bei einer Fahrt mit dem Bus quer durch Vulkanlandschaften führt.
Der Ausflug beginnt am Nachmittag schon um 13:20 Uhr, also kurz nach dem Anlegen in Arrecife. Ausflugsbegleiter müssen bereits 20 Minuten vor dem Aufruf in der Atlantik-Lounge präsent sein. Ein türkisgrünes T-Shirt weist mich als Ausflugsbegleiter aus. Dann beginnt ein eingespieltes Ritual: mit erhobenem Lollipop (so heißt das Ding im Schiffs-Jargon, gemeint ist ein gut sichtbares Nummernschild am Stab) voran, die Treppen runter, dann bis zum Bus. Man kann darauf wetten, dass auf den letzten Metern zum Bus ein Rennen um die ersten Reihen stattfindet. Da helfen alle gut gemeinten Mahnungen nichts. Es ließe sich auch eine Liste der zehn originellsten Ausreden zusammenstellen, warum ein Platz in den vordersten Reihen so wichtig ist. „Auf den hinteren Reihen wird mir regelmäßig schlecht!“ ist noch die am wenigsten originelle Begründung der eingeforderten Privilegien. Von Kolleg*innen kommt immer wieder der satirische Vorschlag: Man sollte einen Bus konstruieren nur mit erster und auf Lücke versetzter zweiter Reihe – wahrscheinlich also mit Überbreite und vier Stockwerke hoch! Diesmal lief alles verhältnismäßig harmlos ab. Mein wichtigstes Argument im Vorfeld war: Sie können an den schönsten Sehenswürdigkeiten immer aussteigen und in Ruhe Fotos machen. Der erste Stopp bringt eine touristische Besonderheit, nämlich einen Kamelritt. Alles ist gut organisiert. Verhältnismäßig schnell werden die Gruppen paarweise aufgeteilt. Jeweils zwei Personen nehmen auf einem Doppelsessel, links und rechts des Kamelrückens Platz. Das Paar sollte im Hinblick auf das Gewicht einigermaßen ausgewogen sein. Wenn nicht, sieht man dies gleich, wenn eine Reiterin oder ein Reiter auf einer Seite kräftig herabhängt. Die Kamelführer nehmen das aber nicht so genau. Schließlich geht es um keinen langen Ritt durch die Wüste, sondern nur um eine große Runde um eine Düne, sodass wir in zwanzig Minuten wieder zurück sind.
Der Guide erklärt uns: Die Kamele hätten im Hinblick auf ihre Artgenossen das große Los gezogen. Nach nur zwei bis drei Stunden Arbeit am Tag dürften sie sich bester Unterkunft und bester Verpflegung erfreuen. Warum sollen nicht auch Kamele vom Tourismus profitieren? Der zweite Stopp mit dem Bus befindet sich an einer vulkanisch besonders aktiven Stelle der Insel, wo schon knapp unter der Oberfläche des Erdbodens die Hitze brodelt. Der nahezu voll belegte Busparkplatz macht deutlich, dass wir nicht die einzigen hier sind. Aber die Vorführung vollzieht sich in kurzen Taktzeiten, sodass wir nicht allzu lange warten müssen. Dabei wird die jahrelange Routine im Umgang mit Touristenmassen deutlich. Was demonstriert wird, ist in der Tat fotogen. Zunächst ein bisschen warme Vulkanerde, die jeder Person in die Hand gedrückt wird, dann ein bisschen Heu, tief genug in den Boden eingebracht, sodass es sofort zu brennen beginnt und schließlich ein paar Liter Wasser in die richtigen Bodenöffnungen gegossen, die dann in meterhohen Fontänen, ähnlich einem Geysir, aus dem Boden schießen. Das macht Eindruck.
Für mich am beeindruckendsten ist eine kurze Fahrt durch eine regelrechte Mondlandschaft. Die kühn trassierte Straße durch dieses Gelände wurde – so erklärt der Guide – erst vor Kurzem angelegt. Es geht weiter zu einer Vinothek. Auch hier funktioniert die bewährte Dramaturgie der Agentur, die für den Ausflug verantwortlich ist. Eine halbe Stunde für eine kleine Weinprobe (nicht zwingend!), ohne Stress etwas einkaufen, vielleicht noch einen Kaffee trinken, das trifft auf allgemeines Wohlbefinden und sorgt für die Zufriedenheit der Gäste. Pünktlich zum Abendessen kommen wir zum Schiff zurück.
Auf See in Richtung Kapverden
Es ist Sonntag. Für 9 Uhr ist ein Gottesdienst angesetzt. Pianist Oleg wird die Lieder begleiten. Der Tag verspricht wunderschön zu werden. Das Lido öffnet um 8 Uhr und ich gehöre zu den ersten Gästen beim Frühstück. Bei dem wunderschönen Wetter kann ich mich ins Freie setzen. Beim Gottesdienst geht es um das Fest der Heiligen Familie. Wer sich ein bisschen in der philosophischen Literatur auskennt, wird bei „Heilige Familie“ sofort an die satirische Schrift von Karl Marx und Friedrich Engels denken. Übrigens die erste Schrift, die beide gemeinsam verfasst haben! Hier wird das Propagandistische und Ideologische der Rede von der „Heiligen Familie“ beispiellos demaskiert. Das im Spott verwendete Symbol der Heiligen Familie steht für eine durch Religion und Philosophie geheiligte Ordnung, an der nicht gerührt werden darf. Marx spricht verächtlich von ihr: sie sei „fad geworden wie abgestandenes Wasser“. Diese falsche und im Grunde inhumane Ordnung müsse revolutionär verändert werden. Man muss sich nur einmal die Darstellung der Heiligen Familie im sogenannten Weltkatechismus der Katholischen Kirche aus dem Jahr 1992 ansehen, dann sieht man, dass Marx’ Kritik immer noch aktuell ist. Im Katechismus heißt es:
„Nazaret gemahnt uns an das, was eine Familie ist, an ihre Gemeinschaft in Liebe, an ihre Würde, ihre strahlende Schönheit, ihre Heiligkeit und Unverletzlichkeit … Schließlich lernen wir hier die zuchtvolle Ordnung der Arbeit. O Lehrstuhl von Nazaret, Haus des Handwerkersohnes! Hier möchte ich das strenge, aber erlösende Gesetz menschlicher Arbeit erkennen und feiern.“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 533)
Von Seiten der römisch-katholischen Kirche – im evangelischen Bereich war es im 19. Jahrhundert nicht wesentlich anders – hat man die Sichtweise von Marx und Genossen nur verketzert und als Werk des Teufels eingeschätzt. So hat etwa die Allgemeine Zeitung in Augsburg geschrieben: „Das Buch werde die schmerzlichste Entrüstung jedes deutschen Mannes hervorrufen, der sein Volk liebe und den christlichen Glauben heilighalte.“ Es hat sehr lange gedauert, bis man sich auch theologisch Gedanken darüber gemacht hat, was an der materialistischen Betonung der Praxis gegenüber der Theorie bedenkenswert sei. Als in Rom 1869 das Erste Vatikanische Konzil einberufen wurde, hatte der Mainzer Sozialbischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler in seinem Gepäck das „Kapital“ von Karl Marx mitgenommen. Er war der Meinung, darüber müsse man sprechen. Er war jedoch weit und breit der Einzige, der diese Meinung vertrat. Seine bischöflichen Kollegen waren an diesem Karl Marx nicht interessiert.
Zurück zum Fest der Heiligen Familie. Ich bin deshalb kein Fan, weil ich eine Instrumentalisierung der biblischen Botschaft wittere. Erstens steht das, was man als die Heilige Familie bezeichnen könnte, also die harmonisch gedachte Gemeinschaft von Josef, Maria und dem Jesuskind, sehr am Rand der biblischen Botschaft, die ihre Akzente ganz anders setzt und, zweitens, wird diese biblische Fiktion ganz unverhohlen zur Propaganda eingesetzt: So sollte eine Familie aussehen! Von all dem werde ich jedoch heute beim Gottesdienst nichts erzählen. Mir kommt es darauf an, etwas dazu zu sagen, was Lukas mit seiner Kindheitsgeschichte Jesu bezweckt, nämlich ein konsequent zusammengestelltes Präludium des Lebens Jesu überhaupt. Von der Krippe zum Kreuz führt bei ihm ein gerader Weg. Nach dem Gottesdienst habe ich mir angewöhnt, im Plauderton noch eine Brücke zu den Gästen zu schlagen. Da sind Anekdoten oder Witze höchst willkommen. Heute werde ich eine kleine Geschichte von Hugo Rahner, dem älteren Bruder des später viel bekannteren Karl Rahner erzählen. Hugo Rahner war ein Mann von Welt, hochgebildet, sprachkundig, souverän im Auftreten. So wurde er auch zum Rektor magnificus der Universität Innsbruck gewählt. Jahre nach seiner Wahl passierte folgende Geschichte. Er kam gerade aus der Toilette und zeigte im Vorraum einem Kollegen einen klein geschnittenen Zeitungsauschnitt zur Unterstützung des sparsam einzusetzenden Toilettenpapiers. Auf dem Zeitungsausschnitt war er selbst abgebildet in feierlicher Pose als Rektor mit einer prächtigen Kette, eindrucksvoll wie Kaiser Karl V. persönlich. Sein großartiger Kommentar: „Sic transit gloria mundi – so vergeht die Herrlichkeit der Welt“, Teil der Zeremonie bei der Inthronisation eines Papstes, der angesichts seines hohen Amtes zur Nüchternheit und Demut ermahnt wird.
Genau darin lag Hugo Rahners Größe, ganz nach dem Vorbild des Ordensgründers Ignatius von Loyola, dessen Orden er angehörte, das Größte mit dem Kleinsten, das Eindrucksvollste mit dem Erbärmlichen zusammenbringen zu können. Die Geschichte kam gut an. Insbesondere die Pointe hat genau getroffen. Damit war das Ritual geschaffen, dass nach einem Gottesdienst immer ein Witz oder eine kleine unterhaltsame Geschichte zu erwarten war.
Nach der Positionsmeldung um genau 10 Uhr, ebenfalls ein festes Ritual im Lauf eines Tages auf See, folgt heute kein Vortrag des Lektors, sondern ein im festen Rhythmus immer wiederkehrendes Ereignis: der bayrische Frühschoppen um 11 Uhr auf Deck 9. Das prachtvolle Wetter passt ganz ausgezeichnet. Natürlich gehört Musik dazu und ein von Weißwürsten, Bratwürsten und Rippchen überquellendes warmes Büffet. Schaut man in die Runde und insbesondere auf die hoch aufgeschichteten Teller, könnte einem der Gedanke kommen: Wir haben hier eine Gruppe von Menschen vor uns, die seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen haben und jetzt vorsorgen müssen für die nächsten Tage, an denen es wieder nichts zu essen gibt. Zur warmen Mahlzeit gibt es Freibier in Mengen. Nach üppigem Biergenuss ist eine längere Siesta angesagt. Dann folgen ein ruhiger Nachmittag und Abend.