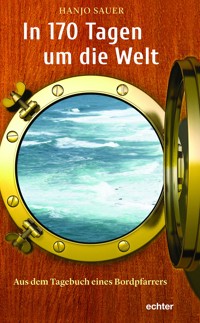Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Zu den größten Geheimnissen der menschlichen Kulturgeschichte gehört es, der Frage nachzugehen, wie Neues entdeckt wird. Gemeint sind radikal neue Gedanken, die bisherige Denkweisen tiefgreifend verändern. Zum innersten Kern der menschlichen Kultur gehört die Religion und damit die Frage nach dem Geheimnis der menschlichen Existenz, insbesondere die Frage nach Gott. Die Gottesvorstellung unterliegt bestimmten Erfahrungen und Traditionen, die sich solange fortsetzen, bis sie von einem kritischen Geist in Frage gestellt werden. Bisher geltende Denkmuster, sogenannte "Paradigmen", werden durch neue ersetzt. Anhand der Paradigmenwechsel in der christlichen Theologie will das Buch darstellen, wie sich durch neue Ideen die Welt des Glaubens verändert hat, und zeigen dass solche Veränderungen zur Geschichte des christlichen Glaubens selbst und zu seiner Lebendigkeit dazugehören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanjo Sauer
Wie Gedanken dieWelt verändern
Hanjo Sauer
Wie Gedanken dieWelt verändern
Eine christliche Paradigmengeschichte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2023
© 2023 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Cover: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen
Umschlagfoto: © 2018 Golden Dayz / Shutterstock
Innengestaltung: Crossmediabureau
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05860-9
978-3-429-05254-6 (PDF)
978-3-429-06603-1 (ePub)
Inhalt
Vorwort: Was will dieses Buch?
1)Geschichte und Paradigmen in der Theologie
2)Die Wurzeln des christlichen Glaubens im Spätjudentum und die Entstehung der christlichen Gemeinde
3)Paulus – der Stachel im Fleisch
4)Marcion, „der Erzketzer“
5)Justin findet überall „Samenkörner der Wahrheit“
6)Origenes: Ein schöpferisches Prinzip konstituiert die geistige Welt
7)Athanasius und die Folgen – ein Leben im Kampf gegen den Arianismus
8)Basilius von Caesarea: Die Lehre der Kirche muss weiterentwickelt werden
9)Augustinus: Gott und die Seele – sonst nichts!
10)Das Wahrheitswissen des Glaubens: Thomas von Aquin und die Scholastik des Mittelalters
11)Eine innovative Form religiösen Lebens: Thomas von Kempen und die „Devotio moderna“
12)Der Mensch, schöpferischer Bildhauer seiner selbst: Pico della Mirandola und die Renaissance
13)Kampf und Mystik: Die Reformation des Martin Luther
14)Theologische Selbstvergewisserung in einem neuen Horizont: Melchior Cano
15)Und wieder Augustinus: Cornelius Jansenius und die andere Reformation
16)Theologie, Pädagogik und Seelsorge im Zeitalter der Aufklärung: Johann Michael Sailer
17)Sinn und Geschmack für das Unendliche: Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
18)Der Einzelne und sein Gott: Sören Kierkegaard
19)Dogma und Geschichte: Johann Sebastian Drey und die Tübinger Schule
20)Zurück zur einer „Theologie der Vorzeit“: Joseph Kleutgen und die Neuscholastik
21)Der authentische Jesus: Adolf von Harnack und die liberale Theologie
22)Die Entdeckung des Glaubens: Ricarda Huch (1864–1947)
23)„Nein!“ – Die dialektische Theologie von Karl Barth
24)Das Geistige zu Wort kommen lassen: Romano Guardini
25)Die christliche Botschaft und der Geist der Moderne: Paul Tillich
26)Der Blick zurück und der Blick nach vorne: Congar und die „Nouvelle Théologie“
27)„Geist in Welt“: Karl Rahners transzendentale Theologie
28)Die Schau der Gestalt: Hans Urs von Balthasar
29)Der Geist kennt kein Geschlecht: Elisabeth Gössmann und die feministische Theologie
30)Die Stimme der Armen: Gustavo Gutiérrez und die Theologie der Befreiung
31)Sprachlosigkeit angesichts des Grauens: Johann Baptist Metz und das Denken an Auschwitz
32)Mystik und Widerstand: Dorothee Sölle
33)Gott als Ursprung des Neuen: Alfred North Whitehead und die Prozesstheologie
34)Zeitgenössische Herausforderung: Das Ende der Paradigmen?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenverzeichnis
Vorwort: Was will dieses Buch?
An Einführungen in die christliche Theologie herrscht kein Mangel.1 Sie verfahren in aller Regel chronologisch, d. h. entlang einer Darstellung der bisher zwanzig christlich geprägten Jahrhunderte.2 Gewürdigt werden die Autoren3 auf Grund der verfügbaren Quellen, die im Altertum weniger ergiebig fließen als in der Neuzeit. Diese Darstellungen haben ihre Legitimität, doch nicht selten kann es geschehen, dass man – sprichwörtlich gesagt – den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Selbst den theologisch bereits beschlagenen Leser*innen kann der Blick so sehr am Detail haften bleiben, dass das wirklich Neue, das sich zu Wort meldet, kaum angemessen gesehen und gewürdigt wird. Gerade um das Moment der Innovation aber geht es in diesem Buch. Neues zu finden gelingt selten. Der Schriftsteller Elias Canetti macht zu Recht darauf aufmerksam, dass für die Suche nach Neuem vollkommene Freiheit und Spontaneität die entscheidenden Voraussetzungen sind: „Wer etwas wirklich Neues finden will, muß sich vor allem vor jeder Untersuchungsmethode hüten. Er mag sich später, wenn er etwas gefunden hat, dazu gedrängt fühlen, seine Untersuchungsmethode nachträglich zu bestimmen. Aber das ist eine taktische Frage, besonders wenn es sich darum handelt, seinen Funden schon zu Lebzeiten Anerkennung zu verschaffen. Der ursprüngliche Vorgang selbst zeichnet sich durch absolute Freiheit und Unbestimmtheit aus, und von der Richtung seiner Bewegung kann einer, der sich zum erstenmal auf diese Weise bewegt, überhaupt keine Ahnung haben.“4
Nachdem in der mittelalterlichen Theologie der Begriff „neu“ (novitas) einem Verdammungsurteil gleichkam,5 nämlich dass etwas mit der Tradition konform war, erlebt das Adjektiv neu in unserem vom Marketing der Wirtschaft geprägten semantischen Sprachraum eine Art Inflation. Allein die Tatsache, dass etwas „neu“ auf den Markt kommt, wird mit dem Gedanken einer qualitativen Verbesserung verknüpft. Schaut man genau hin, dann wird man entdecken, dass tatsächliche Neuerungen eher selten sind. Genau um diese Neuigkeiten in der Theologie aber geht es in dieser kurzen theologiegeschichtlichen Darstellung. Weit davon entfernt, einen der komplexen theologischen Landschaft auch nur halbwegs angemessenen Überblick zu geben, soll der Fokus darauf liegen, einige wenige Beispiele tatsächlicher Innovation aufzugreifen. Exemplarisch, im besten Sinne des Wortes, soll gezeigt werden, wie Gedanken die Welt verändern. Ein Qualitätskriterium ist die Fruchtbarkeit eines Gedankens. Wenn man zum Beispiel nachverfolgt, welche gewaltige Wirkungsgeschichte der Römerbrief von Paulus hatte, dass sich viele Generationen daran abgearbeitet haben und auf ihre Art in der Auseinandersetzung damit wieder etwas für ihre Zeit Neues hervorgebracht haben, dann kann man nur staunen.6 Ein weiteres Qualitätskriterium eines neuen Gedankens kann in seiner traditionsverändernden Kraft gesehen werden. Traditionen sind nicht selten immun gegen Neuerungen und versuchen sich mit aller Kraft nach außen abzuschirmen. Das gelingt jedoch nicht immer. Verliert die herkömmliche Tradition an Plausibilität, kann es zu einem Paradigmenwechsel kommen. Davon soll noch die Rede sein. Wie entsteht ein neuer Gedanke, der beträchtliche Veränderungen nach sich zieht? Es hängt mit dem Geist des Menschen selbst zusammen, dass er sich nicht damit begnügt, das Wahrgenommene zu katalogisieren und nach Kategorien einzuteilen, sondern ebendiese selbst in Frage zu stellen. Karl Rahner war davon überzeugt, dass in jeder geistigen oder willentlichen Tätigkeit der Mensch „immer schon“, wie er sagte, Anteil am Geheimnis Gottes selbst hat. Mit anderen Worten: In anonymer Form ist das Geheimnis Gottes immer schon im Menschen am Werk. Die Findung oder Erfindung eines Neuen ist sozusagen nur die Spitze vom Eisberg, der sich zum größten Teil unsichtbar unter Wasser befindet und der – metaphorisch gesprochen – die Geistigkeit des Menschen, im Grunde sein Leben als Mensch ausmacht. Theologisch gesprochen haben wir es also immer dann, wenn etwas Neues auftaucht, mit einer praktischen Pneumatologie zu tun, einer Entfaltung des Lebens von Gott selbst im Heiligen Geist. So wie das unergründliche Geheimnis Gottes staunen macht, gibt uns auch die Betrachtung von etwas Neuem in der Geschichte allen Grund, staunend und ehrfurchtsvoll zu erfahren, was sich durch dieses Neue in der Welt verändert.
Vermag der Geist des Menschen die Wirklichkeit zu verändern? An dieser Frage hat sich die Philosophie der Neuzeit abgearbeitet. Immanuel Kant war so optimistisch, in der aufgeklärten Vernunft des Menschen die entscheidende Kraft zu sehen, mit deren Hilfe sich der Mensch von den Zwängen der Gesellschaft und – weitgehend – auch der Natur zu befreien vermochte. Am radikalsten sah der Lösungsvorschlag von Gottfried Wilhelm Hegel aus: Er sah im Geist die Wirklichkeit schlechthin. Der Geist bedeutete ihm alles. Eine Wirklichkeit, die unabhängig von ihm bestand oder sich ihm widersetzte, konnte nicht mehr „wirklich“ im eigentlichen Sinn des Wortes genannt werden. Hegels Schüler haben vehement widersprochen. Sie meinten, den Meister „vom Kopf auf die Füße“ stellen zu müssen. In materialistisch konzipierten Grundansätzen verlor der Geist seine beherrschende Stellung. Er wurde herabgewürdigt zum Epiphänomen der alles entscheidenden materiellen Prozesse. Die Skepsis gegenüber der Wirkmächtigkeit des Geistes findet gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei Nietzsche einen neuen Höhepunkt. Dieser Skepsis gegenüber der Wirkmacht des menschlichen Geistes hat Robert Musil in seinem Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ einen prägnanten Ausdruck gegeben. Der Protagonist Ulrich äußert gegenüber seiner Cousine Diotima: „Es ist einfach meine Überzeugung […] dass Denken eine Einrichtung für sich ist, und das wirkliche Leben eine andere. Denn der Stufenunterschied zwischen den beiden ist gegenwärtig zu groß. Unser Gehirn ist einige tausend Jahre alt, aber wenn es alles nur halb zu Ende gedacht und zur anderen Hälfte vergessen hätte, so wäre sein getreues Abbild die Wirklichkeit. Man kann ihr nur die geistige Teilnahme verweigern.“ Bestärkt wird Ulrich in seiner Ansicht durch eine Äußerung von Arnheim, einem weltläufigen Intellektuellen, von dem Ulrich berichtet: „Er hat mir gesagt, dass der Geist heute ein machtloser Zuschauer der wirklichen Entwicklung ist, weil er den großen Aufgaben, die das Leben stellt, aus dem Weg geht. Er hat mich aufgefordert, zu betrachten, wovon die Künste handeln, welche Kleinlichkeiten die Kirchen erfüllen, wie eng selbst das Blickfeld der Gelehrsamkeit ist!“ So weit der Schriftsteller Robert Musil, der in seinem Werk der Skepsis seiner Zeit einen nahezu klassischen Ausdruck gibt.7 Hat sich diese Skepsis bis in die Gegenwart durchgehalten? Außer Frage steht, dass vielfältige wissenschaftliche Diskurse naive Vorstellungen, dass der Mensch unproblematisch seine Wirklichkeit zu gestalten vermag, Lügen strafen. Sigmund Freuds Tiefenpsychologie machte etwa deutlich, wie viel wir an Un- oder Unterbewusstem mit uns tragen, das in hohem Maße unser Leben und Denken bestimmt, das jedoch prinzipiell erforschbar ist und so keine absolute Determinierung ausüben kann. Die Diskurse der Soziologie machen die tiefe Verflechtung in einem allgemeinen gesellschaftlichen Kontext deutlich, die auch dann noch mitbestimmend ist, wenn wir meinen, völlig frei und autonom denken und handeln zu können. Diese Beispiele ließen sich in die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen hinein fortsetzen. Und doch: Es bleibt eine Verantwortlichkeit, die nicht abgeschoben werden kann und darf. Jesus von Nazareth hat in Unbekümmertheit den Menschen seiner Zeit die Notwendigkeit von Umkehr und Buße gepredigt. Diese Predigt setzt in bester biblischer Tradition die grundsätzliche Möglichkeit dazu voraus. Sie geht daher von einem im Grunde optimistischen Menschenbild aus – trotz aller Begrenzungen und Einschränkungen. Christliche Theologie ist ohne dieses Erbe undenkbar. Doch es handelt sich um ein Erbe, das nicht ein für allemal festgelegt ist, sondern das sich entfaltet. Ein Erbe, das Innovationen erfährt. Die Zäsur zum Überkommenen ist dabei nicht absolut, vielmehr wird das Bekannte in einen neuen Horizont gestellt. Darum soll es hier gehen. Wie und in welcher Weise neue Gedanken und Entdeckungen den herkömmlichen Horizont verändern.
Die Überlegungen dieses Buches verdanken sich der Vorlesung „Geschichte und Paradigmen“, die ich an der Katholischen Universität Linz angeboten habe und die nun zu meiner Freude meine Nachfolgerin Isabella Guanzini übernommen hat. Dank schulde ich Frau Ilse Schulenberg für die Korrektur, ebenso Herrn Jürgen G. Lang und Herrn Reiner Bohlander vom Verlag Echter in Würzburg.
1)Geschichte und Paradigmen in der Theologie
Keine der großen Weltreligionen – das Judentum ausgenommen – ist so eng mit der Geschichte verbunden wie das Christentum. Es ging aus Geschichten hervor, die Augenzeug*innen und später die Angehörigen der zweiten und dritten Generation über Jesus von Nazareth erzählt haben. Diese Geschichten waren von Anfang an keine distanzierte Sicht auf die Ereignisse, die sich zu Beginn der Dreißigerjahre in Palästina und insbesondere in Jerusalem abgespielt haben. Der Evangelist Lukas beginnt seine Evangelienschrift in folgender Weise: „Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.“ Es ist offensichtlich, dass sich hier bereits ein Erzähler zu Wort meldet, der einerseits zwar auf der Authentizität der Berichterstattung besteht, die er den Augenzeug*innen verdankt, andererseits jedoch den erzählten Traditionen bereits eine geordnete Form zu geben sucht und in diesem Zusammenhang von einer „Lehre“ spricht, also einer kondensierten Form des Inhalts der Predigt des Jesus von Nazareth, der im Mittelpunkt der Ereignisse steht. Die Unmittelbarkeit der Wahrnehmungen und Anschauungen der ersten Generation hat also bereits vielfältige Reflexionen erfahren, sodass ein geordneter Bericht geschrieben werden kann, der sich dann „Evangelium“ (Frohe Botschaft) nennt als Inbegriff der Intention des Messias, den seine Gemeinde erfahren hat und in der Form seines Geistes weiterhin am Werk sieht. Insofern gehören also die von Anfang an erzählten Geschichten, die dann in eine gemeinsame Geschichte einmünden, zum ursprünglichen Kern des Christentums.
Was bedeutet der Begriff „Geschichte“? Wir haben es dabei mit einem zentralen geistesgeschichtlichen Terminus zu tun. Werfen wir einen Blick auf die Etymologie, die Herkunftsgeschichte des deutschen Wortes „Geschichte“! Anders als der lateinische Begriff „historia“ (im Italienischen „storia“, im Französischen „histoire“ oder im Englischen „history“) umfasst das deutsche Wort entsprechend seiner Herkunft ein etwas anderes Bedeutungsfeld, das differenziert in den Blick genommen werden muss. Der lateinische Begriff geht auf das Griechische „istoria“ zurück. Gemeint ist eine „Erkundung“. Aristoteles bezeichnet damit die Darstellung des Einzelnen im Gegensatz zur Poesie, die – nach ihm – das Allgemeine darzustellen hat. Aristoteles macht einen Unterschied zwischen der Darstellung der Tatsachen und deren Begründung. Für ihn geht es der Philosophie immer um Fragen der Begründung. Historie sieht er also nicht als ursprüngliches Element der Philosophie. Tatsächlich hat sich diese Denkweise noch bis ins 19. Jahrhundert erhalten. Der Philosoph Friedrich Kambartel sagt in seiner Habilitationsschrift „Erfahrung und Struktur“ über das aristotelische Verständnis: Historie „kann jeder durch unmittelbare eigene oder fremde Beobachtung gesicherte Bericht heißen, der sich auf besondere Geschehnisse, Tatsachenaufnahme beschränkt und damit auf systematische und begründende Zusammenhänge verzichtet. Nach diesem Verständnis steht die ‚historische‘ Aussage- und Literaturgattung in einem allgemeinen und grundsätzlichen Gegensatz zu solchen Unternehmungen, die nach Aristoteles das Prädikat ‚theoretische Wissenschaft‘ oder ‚Philosophie‘ verdienen.“1 Etwas anders hat sich der lateinische Begriff entwickelt: Im Unterschied zur ursprünglichen Annalen-Geschichtsschreibung ist bereits eine tiefere Zusammenhänge erfassende Darstellung im Blick. Damit kommt diese Begriffsverwendung unserer heutigen von „Geschichte“ schon erheblich näher. Im Mittelalter hat sich keine wesentlich neue Sicht eingestellt. In der Theologie wird die Heilige Schrift als Erzählung wirklicher Begebenheiten verstanden und damit ihr literarisches Genus weithin ausgeblendet. Diese Sichtweise hielt sich in der katholischen Theologie noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch, so dass die Päpstliche Bibelkommission darauf bestand, die ersten fünf Bücher Moses als dessen ureigenes Werk zu verstehen, was für jeden literarisch nur halbwegs geschulten Theologen bereits damals ein Unding gewesen war. In der mittelalterlichen Einteilung der Wissenschaften wird die Historie unter die so genannten „artes liberales“ gezählt; sie wird damit im Wesentlichen der Grammatik angegliedert oder sie rückt in der Rhetorik an den Begriff der „narratio“, der einen wahrheitsgemäßen Bericht eines Tatbestandes bezeichnet. Diese Begriffsverwendung verändert sich auch im Humanismus des 15. Jahrhunderts nicht und bleibt im Wesentlichen bis ins 18. Jahrhundert erhalten. In der Neuzeit verändert sich die Situation, insofern einerseits die Wahrheit eines historischen Berichts und andererseits ihre christlich-dogmatische Begründung, die durch Einordnung ins Heilgeschehen vorgenommen wird, auseinandertreten. Dieser Sichtweise entspricht die Unterscheidung zwischen einer die Wissenschaften (insbesondere die Naturwissenschaften!) prägenden Vernunft und einer göttlichen Offenbarung, die dem Menschen und seiner Vernunft prinzipiell nicht zugänglich ist. Die neuzeitliche Philosophie wird sich an der Frage abarbeiten, in welchem Verhältnis Vernunft und Offenbarung zueinander stehen.2
Damit stellen sich neue methodische und wissenschaftstheoretische Fragen. Bei dem einflussreichen englischen Mathematiker und Philosophen Thomas Hobbes (1588–1679), dem Wegbereiter des Empirismus Francis Bacon (1561–1626), dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716) und schließlich auch bei Immanuel Kant (1724–1804) wird Historie auf das Ganze des Wissens aus Erfahrung bezogen, sei es im Raum der Natur, sei es im Raum der eigentlichen Geschichte. Wissen aus Erfahrung zu gewinnen, das war der Zug der Zeit. Gleichzeitig sollte das Wissen nicht mehr von Autoritäten abhängig sein, sondern von jedermann überprüft werden können.
Sehen wir uns nun nochmals die Herkunftsgeschichte des Wortes „Geschichte“ an! Im Althochdeutschen hat es die Bedeutung von Ereignis, Zufall oder Hergang. Im Mittelhochdeutschen wird es zusätzlich auf ein ganz bestimmtes Ding oder ein ganz bestimmtes Wesen bezogen. Im Frühneuhochdeutschen schließlich kommt die Erzählung von Geschehenem in den Blick. Zwar dominiert bis ins 18. Jahrhundert die Bedeutung von Historie als Erfahrungsbericht, jedoch taucht bereits ab dem 8. und 9. Jahrhundert auch das Wort „Geschichte“ auf. Erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts erhält der moderne Geschichtsbegriff seine aktuelle und gültige Fassung als Inbegriff einer Einheit von Darstellung und dessen Deutung. Charakteristisch ist die Bildung des so genannten Kollektivsingulars (unterschiedliche Vorgänge werden in einem zusammengefasst). Zudem verschmelzen in der deutschen Sprache die Begriffe von Historie und Geschichte, sodass sie deckungsgleich werden und keine unterschiedliche Bedeutung mehr haben. Die Summe der einzelnen Geschichten wird somit in einem gemeinsamen Begriff gebündelt. Mit der Verflechtung von „Historie“ und „Geschichte“ lassen sich sodann drei Ebenen unterscheiden: 1) der Sachverhalt („res gestae“), 2) die Darstellung (historia rerum gestarum) und 3) die Wissenschaft, die als „Geschichte“ auf einen einzigen gemeinsamen Begriff gebracht wird. Dieses neue, methodisch hochdifferenzierte Geschichtsverständnis führt dann zu einer neuen Wertschätzung der Geschichte als einer wissenschaftlichen Disziplin. Im 19. Jahrhundert findet sich dann ein im Rahmen der Universität voll anerkanntes, methodisch sorgfältig diszipliniertes, institutionell abgesichertes und professionell betriebenes Lehr- und Forschungsfach. Ja mehr noch: Dieses Fach der Geschichtswissenschaft wird zur geistesgeschichtlichen Leitwissenschaft, an der sich die anderen geistesgeschichtlichen Fächer orientieren. Wir brauchen nur an die berühmten Vertreter des Faches in der deutschen Geschichtsschreibung zu denken wie Leopold von Ranke (1795–1886), Heinrich von Treitschke (1834–1896), Johann Gustav Droysen (1808–1884) und Friedrich Meinecke (1862–1954). Wilhelm Dilthey (1833–1911) bot mit seinen tiefschürfenden Überlegungen die wissenschaftstheoretische Grundlegung des Fachverständnisses der Historiker*innen. In der Philosophie des Neukantianismus gilt die Geschichte als Zentrum der Kulturwissenschaft schlechthin.
Die Grundlagendiskussion über Gegenstand, Methode und Ziele der Geschichtswissenschaft im Gegensatz zu den Methodenidealen der Naturwissenschaft hält bis heute an. Als ein wichtiges Ergebnis der Diskussion kann die Erkenntnis festgehalten werden, dass sich aus dem Anfang der Geschichte keine Regel ableiten lässt, aus der sich irgendwelche Rückschlüsse auf das Ende der Geschichte ziehen ließen. Wissenschaft steht auch immer in enger Wechselwirkung zu den Ideen, Sehnsüchten und Ängsten einer Zeit. So wurde die Geschichte im 19. Jahrhundert emphatisch als der Raum der Freiheit verstanden, der keine bestimmten Vorannahmen gelten lasse. Das, was wir Menschen durch unsere Geschichte sind, also das, was die Gattung Mensch durch ihre Geschichte ist, kann nicht als Resultat ungebrochener Handlungsrationalität verständlich gemacht werden. Geschichten sind in diesem Sinn – wie der Philosoph Hermann Lübbe sagt – „Medien der Vergegenwärtigung eigener und fremder Identität“3 und gehören darum in den Raum einer „Kontingenzerfahrungskultur“4. Wie der Historiker Reinhart Koselleck (1923–2006) deutlich macht, wird seit dem 18. und 19. Jahrhundert die reale Beschleunigung geschichtlicher Abläufe identitätsbedrohend erfahren. Geschichte wird damit als Herausforderung an diese Erfahrung verstanden.5 Der Historismus des 19. Jahrhunderts kann daher als eine „Kultur der Vergegenwärtigung und Anerkennung unseres nicht rechtfertigungsfähigen, jeweils historisch bedingten Andersseins“ begriffen werden.6 In seiner moralischen und politischen Dimension könne der Historismus keineswegs als gänzlich überholt bezeichnet werden. In diese Diskussion werden wir nicht einsteigen. Uns soll dieser kurze Blick auf den Begriff der „Geschichte“ und seine wissenschaftstheoretischen Implikationen genügen. Diese Überlegungen zur Geschichtstheorie können und sollen hier nicht weiter vertieft werden. Festzuhalten ist die zentrale Bedeutung des Geschichtsbegriffs für unsere Thematik. Ein Glaube, der sich nicht in der Geschichte verortet, ist kein christlicher Glaube. Zur Frage „Wozu noch Historie?“ schreibt Koselleck am Ende seines Aufsatzes: „Im Durchgang durch ‚die Geschichte‘ werden die Geschichten neu entdeckt – die früheren und die von heute.“7
Nun zu unserem zentralen Begriff, dem diese Untersuchung gilt: Was ist ein Paradigma? Was sind Paradigmen der Theologie? In der antiken Rhetorik handelt es sich bei diesem aus dem Griechischen stammenden Begriff noch um einen Beleg für eine Argumentation, also eine Begebenheit, mit der veranschaulicht werden kann, was gemeint ist und was begründet werden soll. Es klingt also jene Begriffsverwendung an, die wir heute als „Beispiel“ bezeichnen würden. Ganz anders in der Philosophie von Platon (428–348 v. Chr.). Hier wird erstmals dem Geist die tragende Rolle zur Erklärung der Wirklichkeit zugesprochen, näherhin nicht dem menschlichen Geist, sondern vielmehr dem göttlichen. So werden in der platonischen Philosophie mit „paradigmata“ die ewigen Urbilder der sinnlich wahrnehmbaren Dinge bezeichnet. Platon stellt sich vor, dass die gesamte erfahrbare Wirklichkeit im göttlichen Geist verankert ist. „Wirklich“ im eigentlichen Sinn des Wortes sind nicht die Dinge, die uns in der Erfahrung gegeben sind, sondern die göttlichen Ideen. Zwischen den Dingen der Erfahrung und den paradigmata herrscht folgende Beziehung: Die Urbilder sind ewig, unveränderlich und ermöglichen das Dasein der Dinge; Die Abbilder, also die Dinge der Erfahrungswelt, dagegen sind veränderlich und vergänglich. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889–1951), der von Platons Philosophie beeindruckt war, hat diese alte Terminologie wieder aufgegriffen und spricht von Paradigmen als „Mustern“ oder auch „Standards“, an denen die Erfahrung geprüft, mit ihnen verglichen und beurteilt wird. Paradigmen sollen bei Wittgenstein eine gemeinsame Praxis und wahrheitsfähige Sätze ermöglichen. Sie gehören also zu den Voraussetzungen der Erfahrung. Sie bilden gleichsam ein apriorisches Gerüst unserer Orientierung. In den „Philosophischen Untersuchungen“ bezeichnet er sie als Mittel der Praxis, womit in einem Spiel, d. h. in einer Praxis, ein Vergleich erfolgt. Waagen oder das Urmeter in Paris sind solche Paradigmen. Entscheidend ist dabei der Gedanke, dass ein Paradigma der Untersuchung und der Erfahrung vorausliegt. Das Paradigma kann als Maßstab der Prüfung nicht selbst auf gleiche Weise überprüft werden wie das mit ihm Verglichene. Das Paradigma hat seinen Gebrauchswert nicht für sich, sondern stets für etwas anderes. Wittgenstein sagt: „Was zum Wesen gehört, lege ich unter den Paradigmen der Sprache nieder.“8 Das Paradigma wird situationsinvariant verwendet. Natürlich ist die Geltung der Paradigmen nicht für immer gegeben: sie können vergessen werden, sich als unbrauchbar erweisen oder als unübersichtlich und nicht mehr überzeugend.
In der modernen Wissenschaftstheorie wurde der Begriff der „Paradigmen“ vor allem durch das Werk von Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen,9 in die Diskussion eingebracht. Thomas S. Kuhn, geboren 1922, war Professor für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte in Princeton (USA).10 Kuhn hat mit seiner These überzeugt, dass sich der Prozess des Fortschritts wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht durch kontinuierliche Veränderung, sondern durch revolutionäre Prozesse vollzieht. Wissenschaftliche Revolutionen werden dabei als Durchsetzung neuer Weltbilder beschrieben. Kuhn verwendet für seine Studien einen die Forschung leitenden Schlüsselbegriff, nämlich den des Paradigmas. Bei Wissenschaftsrevolutionen kommt es entsprechend zu Paradigmenwechsel. Besonders dieser letzte Begriff wurde dann breit rezipiert und war bald in aller Munde, so dass sein Gebrauch fast schon einen inflationären Charakter hatte, weil sich die wenigsten, die diesen Begriff gebrauchten, die Mühe machten, genau nachzusehen, was Kuhn mit diesem Begriff gemeint hat. Kuhn weist auf die Wissenschaftsgeschichte hin: Die deutlichsten Beispiele wissenschaftlicher Revolutionen sind „mit den Namen Kopernikus, Newton, Lavoisier und Einstein verbunden. […] Sie zeigen deutlicher als die meisten anderen Episoden, wenigstens in der Geschichte der Physik, worum es bei allen wissenschaftlichen Revolutionen geht. Jede von ihnen forderte von der Gemeinschaft, eine altehrwürdige wissenschaftliche Theorie zugunsten einer anderen, nicht mit ihr zu vereinbarenden, zurückzuweisen. Jede brachte eine Verschiebung der für die wissenschaftliche Untersuchung verfügbaren Probleme und der Maßstäbe mit sich, nach denen die Fachwissenschaft entschied, was als zulässiges Problem oder als legitime Problemlösung gelten sollte. Und jede wandelte das wissenschaftliche Denken in einer Weise um, die wir letztlich als eine Umgestaltung der Welt, in welcher wissenschaftliche Arbeit getan wurde, beschreiben müssen. Derartige Änderungen sind, zusammen mit den Kontroversen, die sie fast immer begleiten, die bestimmenden Charakteristika wissenschaftlicher Revolutionen.“11 Wie sich Neuentdeckungen konkret vollziehen, veranschaulicht er am Beispiel der Röntgenstrahlen: „Das erste Beispiel, die Röntgenstrahlen, ist ein klassischer Fall der Entdeckung durch Zufall, eine Art, die viel häufiger vorkommt, als die Regeln der unpersönlichen wissenschaftlichen Berichterstattung uns auf den ersten Blick erkennen lassen. Die Geschichte dieser Entdeckung beginnt an dem Tag, da der Physiker Röntgen eine normale Untersuchung von Kathodenstrahlen unterbrach, weil er bemerkt hatte, daß ein Barium-Platinzyanür-Schirm in einiger Entfernung von seinem abgeschirmten Apparat aufleuchtete, als die Entladung im Gange war. […] Röntgens Entdeckung begann mit der Erkenntnis, daß sein Schirm leuchtete, als er es gar nicht sollte. In beiden Fällen spielte die Wahrnehmung einer Anomalie – eines Phänomens also, auf welches das Paradigma den Forscher nicht vorbereitet hatte – eine wesentliche Rolle als Wegbereiter für die Wahrnehmung einer Neuheit. Aber in beiden Fällen war die Wahrnehmung, daß etwas falsch gelaufen war, nur die Einleitung zu einer Entdeckung. […] An welchem Punkt von Röntgens Untersuchungen können wir sagen, daß die Röntgenstrahlen tatsächlich entdeckt worden sind? Auf keinen Fall im ersten Augenblick, als alles, was bemerkt wurde, ein leuchtender Schirm war. Mindestens ein anderer Forscher hatte das Leuchten ebenfalls gesehen und, zu seinem späteren Ärger, überhaupt nichts entdeckt. […] Wir können nur sagen, daß die Röntgenstrahlen in Würzburg in der Zeit zwischen dem 8. November und dem 28. Dezember 1895 entdeckt wurden.“12
Interessant ist, dass Kuhn den realen Forschungsbetrieb in die Nähe der Evolution rückt. „Die Verifikation gleicht der natürlichen Auslese: sie wählt in einer bestimmten geschichtlichen Situation unter den gegebenen Möglichkeiten die lebensfähigste aus. Ob diese Wahl auch die beste ist, die hätte getroffen werden können, falls noch andere Alternativen vorhanden oder die Daten anders geartet gewesen wären, ist eine Frage, die nicht sinnvoll gestellt werden kann.“13 Wissenschaft setzt sich zum Ziel, Rätsel zu lösen. Dies kann nur asymptotisch geschehen und Kuhn weiß, dass keine Theorie jemals im Stande ist, alle Rätsel zu lösen. „Im Gegenteil, gerade die Unvollständigkeit und Unvollkommenheit der jeweiligen Übereinstimmung von Daten und Theorien definieren viele der Rätsel, welche die normale Wissenschaft charakterisieren. Wenn jede einzelne Nichtübereinstimmung ein Grund für die Ablehnung einer Theorie wäre, müßten alle Theorien allezeit abgelehnt werden.“14
In einem Postskriptum das Jahres 1969, in das bereits eine Reihe von Diskussionen eingegangen sind, versucht Kuhn seinen Paradigmenbegriff präziser zu fassen. Er unterscheidet zwischen einer eher soziologisch und einer eher philosophisch orientierten Sicht. Im ersten Fall steht der Begriff „für die ganze Konstellation voll Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden. Andererseits bezeichnet er ein Element in dieser Konstellation, die konkreten Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispiele gebraucht, explizite Regeln als Basis für die Lösung der übrigen Probleme der ‚normalen Wissenschaft‘ ersetzen können.“15 Die zweite Bedeutung ist für Kuhn die „tiefere“, gleichzeitig jedoch auch umstrittenere Begriffsverwendung. Zudem muss Kuhn eine zirkuläre Form der Begriffsverwendung koinzidieren: „Paradigma ist das, was den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft gemeinsam ist, und umgekehrt besteht eine wissenschaftliche Gemeinschaft aus Menschen, die ein Paradigma teilen.“16
Kuhn bestimmt Paradigmen als „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen“, „die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten Modelle und Lösungen liefern“.17 Gleichzeitig bietet Kuhn eine Periodisierung der Wissenschaftsgeschichte an: in einer vorparadigmatischen Phase herrscht unter den Wissenschaftlern Uneinigkeit über grundsätzliche Fragen und Orientierungen. Verschiedene Projekte und Methoden konkurrieren miteinander und gegeneinander. Die zweite Phase wird von ihm als die wissenschaftstheoretisch normale Phase bezeichnet. In ihr dominieren die allgemein anerkannten Beispiele der wissenschaftlichen Praxis. Schließlich – dritte Phase – treten nach Kuhn Anomalien auf. Es gibt Probleme, die innerhalb des geltenden Paradigmas nicht lösbar sind. Diese Krise führe zu einer wissenschaftlichen Revolution, also einem Paradigmenwechsel. Das alte Paradigma wird durch ein neues ersetzt. Regeln würden im Lauf der Wissenschaftsgeschichte erst dann in Diskussion gestellt, wenn Zweifel an deren Geltung aufgekommen sind. Mit einer vernünftigen Entwicklung der sich ablösenden Paradigmen könne jedoch nicht gerechnet werden; damit droht die Möglichkeit einer rationalen Beurteilung von wissenschaftlichem Fortschritt abhandenzukommen. Sehr prägnant beschreibt Werner Simon den Paradigmenbegriff bei Kuhn: „In einem allgemeineren, philosophisch-historischen Sinn drückt der Paradigmabegriff die metatheoretische Einsicht aus, daß auch die Wissenschaft Elemente enthält, die unbegründet bleiben müssen und nicht weiter hinterfragt werden. Ein Paradigmawechsel kann somit als Einsetzung eines neuen Glaubenssystems beziehungsweise Weltbildes in den wissenschaftlichen Betrieb beschrieben werden, das selbst nicht auf wissenschaftlicher Erfahrung beruht, sondern zur Grundlage derselben wird.“18
Nun werden wir im Lauf unserer Beschäftigung mit der Geschichte der Theologie trotz der einenden Voraussetzung des christlichen Glaubens sehr unterschiedliche Auffassungen zu Gesicht bekommen, wie Theologie betrieben werden kann, wie sie zur Wissenschaft ihrer Zeit in Beziehung gesetzt werden kann und welcher gesellschaftliche Stellenwert ihr zukommt. Ich gebe dafür ein Beispiel: Thomas von Aquin konnte in seinem Versuch, das Schema der aristotelischen Philosophie auf die Theologie anzuwenden, unter den Bedingungen seiner Zeit davon ausgehen, dass das oberste Axiom der Theologie, das schlichtweg vorausgesetzt und als unhinterfragbar angesehen wird, die „scientia dei et sanctorum“ ist. An diesem „Wissen Gottes und der Heiligen“ partizipiert die gesamte Theologie in einer Art Nachvollzug dieses göttlichen Wissens. Dieses Axiom hat nun ganz bestimmte Zeitumstände zu seiner Voraussetzung: ein selbstverständlicher und durch und durch vernünftiger Glaube an Gott und eine prinzipiell positive Einstellung zur Wirklichkeit und zur Möglichkeit ihrer rationalen Durchdringung. Zur Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert hatten sich diese Voraussetzungen radikal geändert. Luther spottete über den „Gaukelspieler Aristoteles“ und nannte die Vernunft eine „Hure“, so fragwürdig war ihm die Möglichkeit einer rationalen Orientierung in seiner Welt geworden. Er sah sich in aller Radikalität auf seine eigene Existenz zurückgeworfen und von keiner gesellschaftlichen oder kirchlichen Struktur mehr getragen. Unter diesen Voraussetzungen stellte er seine berühmte Frage: „Wie finde ich einen gnädigen Gott?“ Dieser Gott war für ihn durch keine metaphysische Spekulation in irgendeiner Weise evident oder absicherbar geworden. Allein im Glauben konnte er sich auf ihn werfen und sich rückhaltlos auf Leben und Sterben ihm anvertrauen.
Ein zweites Beispiel eines solchen Paradigmenwechsels in der Theologie ist die so genannte „anthropologische Wende“, die Karl Rahner (1904–1984) vollzog. Rahner verstand sich als römisch-katholischer Theologe in der vollen Verpflichtung, mit seinem theologischen Denken in die Tradition der Kirche einbezogen zu sein, aber die Voraussetzungen der so genannten neuscholastischen Theologie schienen ihm nicht mehr tragfähig zu sein. Die gesellschaftlich gegebene Evidenz einer Einteilung der Wirklichkeit in eine schöpfungsmäßig gegebene Natur und eine gnadenhaft erhobene Übernatur erschien ihm nicht mehr gegeben. Darum entschied sich Rahner für einen Ansatz der Theologie vom Menschen und von seinem Selbstverständnis her, wobei er sich insbesondere auf die existentialistische Philosophie bezog, wie er sie von dem Philosophen Martin Heidegger und seiner Erschließung der Wirklichkeit kennen gelernt hatte. Um klar zu stellen: Es handelt sich in keiner Weise um eine Reduktion des Gegenstandsbereichs der Theologie, dass etwa in erster Linie nur mehr vom Menschen und nur in einem entfernten Sinne von Gott die Rede sei. Die alles entscheidende Frage nach Gott und seinem Wirken in der Welt wird vielmehr über den Menschen und sein Selbstverständnis vermittelt. Paradigmen sind also, insbesondere auch in der Theologie, allgemein anerkannte Rahmenbedingungen, die zur Lösung von Fragestellungen hilfreich erscheinen und auf einem breiten Konsens der Forscher*innen beruhen.
2)Die Wurzeln des christlichen Glaubens im Spätjudentum und die Entstehung der christlichen Gemeinde
Jesus selbst lebt in und mit der Glaubenswelt seines Volkes. Ohne die Wurzeln Israels kann und können die Intentionen seines Auftretens nicht verstanden werden. Nun beruhen die Anschauungen des Spätjudentums auf Traditionen sehr unterschiedlicher Herkunft. Zur Zeit Jesu war es zu erheblichen Spannungen in der Einschätzung dieser Traditionen gekommen. Dies wird an den scharf voneinander abgegrenzten Gruppen der Sadduzäer, der Pharisäer, der Zeloten, der Essener und anderer Gruppierungen deutlich. Diese Situation weckte den theologischen Wunsch nach einer einenden Form eines gemeinsamen jüdischen Bekenntnisses, um zu einer gemeinsamen Lehre zu kommen. Lehrbildungen im Spätjudentum haben ihren Ursprung in dem Versuch, die Verschiedenartigkeit der Traditionen denkerisch zu bewältigen und in der Integration der sehr unterschiedlichen Elemente eine höhere Einheit zu finden. Eine erste Sammlung solcher Lehren findet sich in den so genannten „Vätersprüchen“1. Sie beginnen mit dem Namen des Hohenpriesters Simon II. des Gerechten, der gegen 200 v. Chr. gelebt hat. Die spätere christliche Theologie, insbesondere die Dogmenentwicklung, hat hier ihre Wurzeln. So war für Israel der Monotheismus zentral. Das wird in dem hervorgehobenen Wort von Dt 6,4 deutlich: „Höre Israel! JHWE ist unser Gott. JHWH ist einzig.“ Dieses berühmte Wort wird auch nach seinem ersten Wort „Sch[e]ma“ („Höre!“) genannt und gilt als Kern der prophetischen Botschaft des Mose. Der Glaubenssatz verkörpert ein heiliges Recht mit unverbrüchlicher Geltung.
Zusammen mit Dtn 6,5–9, Dtn 11,13–21 und Num 15,37–41 wurde es täglich zweimal im Tempel rezitiert.2 Zu Beginn des Morgengebets rief der diensttuende Priester das Sch[e]ma dem Volke zu, das in die heiligen Worte einstimmte. Es wurde ebenso zuhause gebetet. Am Abend wiederholte sich dieses Ritual. Es wurde im Spätjudentum auch mit dem Wort bezeichnet: „die Gottesherrschaft auf sich nehmen“. Es handelt sich um ein fundamentales Bekenntnis, das gegen die kanaanäische Aufspaltung der Gottheit in die Bipolarität der Geschlechtlichkeit an der unaufspaltbaren Einheit Gottes festhielt. Insofern es sich um eine fundamentale Voraussetzung der jüdischen Identität handelt, kann dieser Lehrsatz rezitiert, bekannt und gelehrt, aber nicht rational bewiesen werden. Die jeweils obersten Prinzipien sperren sich gegenüber einer rationalen Deduktion. Im Grunde haben wir mit dem „Schma Jisrael“ das einzige Dogma des Judentums vor uns. Die übrigen Lehren können als eine Ausgestaltung dieses zentralen Bekenntnisses begriffen werden.
Seine entscheidende Formung hat der jüdische Glaube in der Zeit des Exils erhalten, als die Propheten wie Deutero-Jesaja die Tradition der Väter und Mütter festzuhalten suchten, den Abrahamsbund, den Mosebund, die Gottesoffenbarung der Propheten. Neu ist, dass der Gott Israels als Gott aller Völker verstanden wird und der jüdische Glaube an diesem universalen Anspruch festhält. Der Spruch über Kyros (Jes 41,1–7) macht diesen Anspruch deutlich: „Ich, JHWH, und es gibt keinen sonst, außer mir gibt es keinen Gott, – der gebildet das Licht und geschaffen die Finsternis, der da wirkt das Heil und das Unheil schafft, ich, JHWH, der alles dies wirkt.“3 Mit dem Thema Licht und Finsternis wird der latente Dualismus der persischen Religion angesprochen. JHWHs Herrschaft beschränkt sich nicht nur auf die Dimension des Lichtes; sie wird ausgedehnt auf die Finsternis, also auf das Totenreich, alles, was der Schöpfung feindlich gesinnt ist, und auf das Böse. Gottes unsichtbare Macht waltet in allem und steht hinter allen Dingen. Wenn JHWH als JHWH sebaoth als „Führer der kämpfenden Sternenheere“ bezeichnet wird, ist an die Fixsterne gedacht, die unterhalb des Horizonts in die Dunkelheit eintauchen und nach dem Kampf gegen die Mächte der Unterwelt siegreich wieder emporsteigen. Auch Esra 6,9 („Gott des Himmels“) und Neh 9,6 („das himmlische Heer“) belegen den Eingang dieser babylonischen Vorstellungen in die jüdische Gedankenwelt.
Spekulationen über das Wesen Gottes steht die tiefe Ehrfurcht vor seinem Geheimnis entgegen. Der Name Gottes durfte nur einmal im Jahr am Versöhnungsfest im Allerheiligsten vom Hohenpriester ausgesprochen werden. Sonst wurde er durch den Namen Adonai („Herr“) ersetzt, im Griechischen dann durch den kyrios-Begriff. Die Gottesvorstellung war weitgehend mit jener des „deus absconditus“ (des unbekannten Gottes) verbunden. Man stellte sich vor, Gott habe einen Schleier vor sein Angesicht gezogen, so dass zwar er die Welt, die Welt jedoch nicht ihn sehen konnte. Der Gedanke der Unnahbarkeit Gottes macht auch verständlich, warum es zur Kommunikation des Himmlischen mit dem Irdischen Zwischenwesen in der Gestalt der Engel bedarf, die die unmittelbar nicht mögliche Verbindung aufrechterhalten.
Dass sich an den Indikativ des monotheistischen Bekenntnisses der Imperativ des Gebotes „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen“ anschließt, hat seine Logik darin, dass Israel und sein Gott auf Grund des geschlossenen Bundes untrennbar zusammengehören. Aus diesem Bundesgedanken erklärt sich auch die Heilsgewissheit, dass Gott die Wege seines Volkes zu einem sicheren Ende führen werde. Das Gesetz ist die Lebensordnung Israels; es ist ihm die entscheidende Weisung, die es durch alle Irrwege und Wirrnisse zu seinem Ziel führt. Man muss sich das Gesetz wie eine notwendige Abgrenzung vorstellen, die um den Bereich des Heiligen gelegt ist und dessen Unversehrtheit garantiert. Man kann im Vergleich von Israel und der Kirche sagen: was dem neutestamentlichen Gottesvolk das Evangelium, das ist für Israel das Gesetz. In jedem Fall war Dtn 6,4, das Sche[m]a Israel, das höchste Gebot. Man darf annehmen, dass die Schlussfolgerung entsprechend der Frage der Schriftgelehrten Mk 12,28 („Welches Gebot ist das erste von allen?), erst zur Zeit Jesu gezogen worden ist.
Mittelpunkt der Gemeinschaft des Bundesvolkes war der Tempel in Jerusalem. Seine Bedeutung ging über die einer bloßen Kultstätte weit hinaus. Der Tempel repräsentierte die geheimnisvolle Gegenwart Gottes in seinem Volk. In ihm versammelte sich die Gemeinde des Gotteslobes. Die Septuaginta wird später den Begriff „edah“ (meist gleichbedeutend mit dem Begriff „kahal“) mit „ekklesia“ übersetzen. Für die Priesterschaft des Tempels galten: Waschungen, Einhaltungen von bestimmten Speisevorschriften u. a. In vorchristlicher Zeit finden sich bestimmte Sondergruppen, die eine besondere Nähe zu Gott anstreben und die Vorschriften der Tempelpriesterschaft weitgehend nachahmen. Sie nannten sich „die sich Absondernden“ und wurden später Pharisäer genannt. Diese Gruppe sah sich als eine geistliche Priesterschaft, die dem großen Gottesvolk Israel noch einmal gegenüberstand. Die rein rituelle Geltung der Tempelgesetze wurde von der Gruppe der Sadduzäer, also der herrschenden Tempelpriesterschaft, aufrechterhalten. Sie lehnten die von den Pharisäern praktizierte Vergeistigung der rituellen Vorschriften ab und sperrten sich gleichzeitig gegen neue Anschauungen, wie die Auferstehung des einzelnen Menschen nach seinem Tod. Die Jesusbewegung führt in bestimmter Weise die Tendenz der Vergeistigung, für die die Pharisäer standen, weiter, während sie zu der Welt der Sadduzäer – bereits aus soziologischen Gründen – keine Verbindung hat.
Höhepunkt des Tempelkultes waren die großen Jahresfeste, an denen sich das Bundesvolk in der Form, wie sie bei Wallfahrtsfesten üblich ist, um den Tempel versammelte. Das Passah-Fest war die Erinnerung an die Frühzeit Israels und seine Befreiung aus Ägypten. Das Versöhnungsfest verband sich im Herbst mit Neujahr und Laubhüttenzeit. Es ging um die Erneuerung des Bundes und die erhoffte Wiederherstellung des Urzustandes. Aus den Festen entwickelte sich der Gedanke einer Naherwartung des Kommens des Messias. So blieben beim Passahfest die Türen des Tempels geöffnet, weil der erwartete Erlöser in jedem Augenblick eintreten konnte. Diese Naherwartung wurde nahezu nahtlos von der jungen christlichen Gemeinde übernommen und auf die Gestalt Jesu Christi und sein in allernächster Zeit erwartetes Wiederkommen übertragen. Die Form dieser Naherwartung prägte einen ganz eigenen und für Israel typischen offenen Geschichtsbegriff, der sich sehr grundsätzlich von den Anschauungen des griechischen Denkens unterschied. In griechischer Sicht gehörte die Geschichte nicht zum Wesen der Welt, die philosophisch in festen Formen einer Seinslehre entfaltet wurde. Für das griechische Verständnis der Welt gehörte die geschichtliche Veränderbarkeit nicht zum ursprünglichen Wesen der Dinge. Besonders die platonische Ideenlehre verankert das Wesen der Dinge in der göttlichen Unveränderlichkeit. Ganz anders in Israel: Israel verstand die Geschichte als den Vorgang der Erwählung durch Gott, als ein Geschehen, das sich zwischen Gott und seinem Volk abspielte und von höchster Bedeutung war. Daher hatte die Geschichtserzählung in Israel immer auch eine religiöse Konnotation. Wenn Gottes Taten verkündet wurden, dann wurde auch gleichzeitig Geschichte erzählt. Voraussetzung dieses Geschichtsverständnisses waren war der Bund Gottes mit Israel und das Festhalten an ihm. So wuchs in Israel die Auffassung, die Welt sei um Israels willen geschaffen worden. Israel sah sich als Verkörperung der wahren Menschheit. Ursprung und Ziel standen in diesem Geschichtsdenken in engem Zusammenhang. Wenn die Welt um Israels willen geschaffen worden war, dann sollte Israel am Ende der Tage auch die Weltherrschaft antreten. Der einzelne fromme Israelit zog für sich daraus die Konsequenz, dass er diesen Erwählungsgedanken auch auf sich anwenden könne. So konnte auch in der Mischna gesagt werden: „Jeder Einzelne soll sich sagen: um meinetwillen ist die Welt geschaffen worden.“ Das Ganze kann im Typus der göttlichen Idee des Menschen erkannt werden. Daniel 7,13 beschreibt diesen Gedanken in der Form des himmlischen Menschen.4 Die Kehrseite dieses Erwählungsgedankens betrifft die Gesetzeslosen, die das Gericht nicht bestehen werden. Mit dem Entstehen der Sinai-Tradition geschieht eine Teilung der Menschheit in die Erwählten und die Verworfenen. Die Verbreitung dieser Tradition führt zu erheblichen theologischen Konsequenzen.
Werden diese Grundgedanken auf die Erfahrung der Gegenwart übertragen, dann ist leicht ersichtlich, wie die Apokalyptik entstehen konnte. Erwartet wird eine Erfüllung dieser heilsgeschichtlichen Aussagen noch im eigenen Lebenszeitraum. Die Apokalyptik kann als jene Form des Ernstnehmens der heilsgeschichtlichen Aussagen beschrieben werden, die für die Identität Israels stehen. Ideengeschichtlich stellt die Apokalyptik sowohl den Boden für die Jesusbewegung wie andererseits auch die Gnosis mit ihren scharfen Gegenüberstellungen: Licht – Finsternis, gut – böse, erkennend – nicht erkennend, zum Heil gelangend – verworfen dar. Besonders im Buch Henoch ist die eigenartige Verschmelzung von Kosmologie, Astrologie, Engellehre und Apokalyptik zu finden.5 Dieses Buch wurde zwar viel gelesen, war aber dennoch nicht für das palästinensische Judentum zur Zeit Jesu prägend, da seine Anschauungen nur innerhalb kleiner Kreise tatsächlich rezipiert wurden. Wesentlich prägender für das palästinensische Judentum zur Zeit Jesu war die Tendenz zu einer Verinnerlichung des Gesetzesverständnisses, wie sie insbesondere durch die Pharisäer praktiziert wurde.
Um die äußerst differenzierte geistige Welt des Spätjudentums besser verstehen zu können, muss kurz auf das Diasporajudentum hingewiesen werden. Gemeint ist nicht die Zerstreuung des Judentums nach dem Fall Jerusalems im Jahr 70 nach Chr., sondern bereits jene über Jahrhunderte v. Chr. sich erstreckende Kontaminierung jüdischer Kreise mit den geistigen Strömungen Ägyptens, Babyloniens, Persiens und der gesamten Welt des Orients.
Wie war es zu dieser kulturellen Kontaminierung gekommen? Nach der Herrschaft Salomons6 zerfiel das jüdische Reich in ein Nordreich Israel (mit seinem politischen Zentrum in Samaria) und in ein Südreich Juda (mit seinem politischen Zentrum in Jerusalem). Das Nordreich war in besonderem Maß mit der kanaanäischen Tradition verbunden. Dies lässt sich an dem massiven prophetischen Widerstand gegen solche Einflüsse verdeutlichen. Besonderen Niederschlag haben diese Auseinandersetzungen in den Elia- und Elischa-Geschichten und in der Theologie des Propheten Hosea gefunden. Besonders die so genannte eloistische Tradition wird mit dem Nordreich verbunden. „Elohim“ ist die Bezeichnung der Gottheit, die in der Schöpfung waltet; JHWH dagegen bezeichnet den Gott des Sinai, der mit Mose einen Bund geschlossen hatte. Im Jahr 733 v. Chr. wurde das Nordreich von Assur besiegt; 722 v. Chr. kam es zu seiner gänzlichen Vernichtung. Die regierende Schicht wurde umgesiedelt und innerhalb des assyrischen Großreiches gegen eine andere Klasse ausgetauscht. Es vollzieht sich ein gewaltsamer Austausch der Bevölkerung, wie er bis in die jüngste Geschichte zu beobachten ist. Nach Samaria kamen medische, elamitische und parthische Herren. Umgekehrt wurde die Oberschicht des Nordreiches in Medien, Elam und Persien angesiedelt. Nachdem sie dort Rahmenbedingungen vorfanden, die ihnen zunehmenden Wohlstand, Reichtum und auch den Zugang zur politischen Macht eröffneten, war der Gedanke einer möglichen Rückkehr in ihr ursprüngliches Land bald aufgegeben. Dennoch verschmolz dieses Diasporajudentum nicht vollständig mit seiner neuen Umgebung, sondern bildete eine eigene Kaste, die an ihrer religiösen Tradition festhielt. Vollkommen anders stellte sich die Exilierung des Südreiches dar. Als im Jahr 587 v. Chr. nach dem Fall Jerusalems die Oberschicht Judas in Babylonische Gefangenschaft kam, wurden die Besiegten in einem geschlossenen Bereich am Fluss Chabur, einem linken, östlichen Nebenfluss des Tigris, an dessen Unterlauf, angesiedelt. Hier waren die Bedingungen so erniedrigend, dass sich der Gedanke an eine Rückkehr niemals verlor. Tatsächlich zogen zwei und drei Generationen später unter der Herrschaft des Persers Kyros im Jahr 520 v. Chr., und später noch im Jahr 458 v. Chr., die gesamte jüdische Bevölkerung geschlossen nach Juda zurück. Die alten Traditionen waren streng bewahrt worden. Als Zeichen der Repräsentation des gesamten Bundesvolkes wurden zwölf Stammesführer bestellt. Zusätzlich kamen nochmals je sechs, also insgesamt 72, Unterführer.
Zwar hat die exilierte Bevölkerung Nordisraels diese Ereignisse durchaus zur Kenntnis genommen und Kontakt zu halten versucht. Gleichwohl schloss sich die allergrößte Mehrheit dem Appell zur Rückkehr nicht an. Religiös nahm bei ihnen ein heterodoxes Judentum, das sich vielen Einflüssen seiner Umgebung öffnete, eine immer deutlichere Gestalt an. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Auf der Insel Elefantine bei Assuan in Oberägypten ist seit 525 eine jüdische Militärkolonie bezeugt. Der persische König Kambyses II.7 bestätigte den dort von der Exilsgemeinde gebauten Jahwe-Tempel. Ausdruck des Synkretismus ist, dass dort neben JHWH auch die weibliche Gottheit Anat-Jahu (also die Anat des JHWH), die Anat-Betel hieß, angebetet wurde. Es handelt sich hier genau um die Religion Isebels, gegen die Elias so fanatisch gekämpft hatte. Diese Religion stand in Verbindung mit dem persischen Anahita-Kult.8
Dieses synkretistische Diasporajudentum wurde natürlich vom orthodoxen Judentum der Schriftgelehrten Jerusalems als heterodox betrachtet, ähnlich dem ungebildeten Volk („am haaretz“), das vom Gesetz keine Kenntnis hatte und deswegen dauernd dagegen verstoßen musste. Tatsächlich haben sich breite Kreise des Diasporajudentums gnostischen Gedanken geöffnet. Auf weiten Strecken stehen die gnostischen Grundgedanken mit ihrer Leibfeindlichkeit und ihrem Dualismus der Tradition des alten Israel diametral entgegen. Die Gnosis ist von einer tiefen Skepsis gegenüber der erfahrbaren Wirklichkeit geprägt und sucht nach einem Weg der Erlösung des Menschen aus dem Bereich der finsteren Welt. Dieser Weg ist der Aufstieg der Seele zur ewigen Heimat im Himmel des Lichtes. Der spirituelle Gedanke eines Aufstiegs der Seele verband sich in der jüdischen Gemeinde mit dem Heimweh nach dem Gelobten Land und wurde in diesen Gedankengängen vergeistigt. Das Gesetzeswissen verwandelte sich in das Wissen von der göttlichen Welt, zu der die Seele befreit werden müsse.
Wie sehr auch die grundlegend optimistische Sicht des griechischen Denkens im gnostischen Bereich verändert wurde, sei an einem Beispiel demonstriert: Das bekannte griechische Wort „gnothi seauton“ (Erkenne dich selbst!) hat in Delphi, dem bedeutendsten Wallfahrtsort Griechenlands, die Bedeutung: Erkenne, o Mensch, dass du nicht zu den Göttern gehörst! Es weist den Menschen also auf seine Begrenztheit und Sterblichkeit hin. Bei der Übertragung ins Aramäische im Orient bekam der Spruch nun eine ganz neue Bedeutung, nämlich: Erkenne deine eigene Seele! Mit der Verabsolutierung der Seele ist der ursprüngliche Sinn damit in sein Gegenteil verkehrt: er weist den Menschen nicht mehr auf seine Begrenztheit und Sterblichkeit hin, sondern auf seine göttliche Natur, die er in sich trägt. Gemeint ist hier also: Erkenne, dass deine Seele, unsterblicher, nämlich göttlicher Natur ist!
Wo sind die entscheidenden Wurzeln des christlichen Denkens zu suchen? Zunächst ganz unbestritten im orthodoxen Judentum Jerusalems. Das Gottesbild Jesu steht ganz in seinem Kontext. Das christliche Dogma ist geprägt von der Übertragung des Kyrios-Begriffs der Septuaginta auf die Vorstellung der Gottessohnschaft Jesu. In der christlichen Gemeinde wird also die Tradition Israels konsequent auf die neuen Rahmenbedingungen des Glaubens an Jesus als den Christus organisiert. Wenn der liberale Theologe Adolf von Harnack (1851–1930), auf den noch einzugehen ist, die Entstehung des christlichen Dogmas so charakterisiert: „Das Dogma ist in seiner Konzeption und in seinem Ausbau ein Werk des griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums“, dann suggeriert diese Aussage eine Form der Überfremdung der Tradition Israels, bei der die schöpferische Leistung der frühen christlichen Theologie diffamiert wird, nämlich eine Brücke zu schlagen zwischen den Traditionen Israels, der Glaubenserfahrung mit Jesus, der als der Christus bekannt wird, und dem gegenwärtigen geistigen Horizont der griechischen Philosophie. Dass die Form des Dogmas von den Sprach- und Ausdrucksformen des griechischen Denkens bestimmt ist, steht außer Frage. Dass sich in dieser geistigen Auseinandersetzung auch das gnostische Denken deutlich bemerkbar macht, kann bei Johannes, aber auch bei Paulus gezeigt werden. Teils wird gegen dieses Denken ausdrücklich Stellung bezogen und dagegen polemisiert, teils werden jedoch auch Kategorien und Denkweisen übernommen. Bestimmende Denkweisen, die in der zeitgenössischen Gesellschaft prägend waren und dezidiert abgelehnt werden, hinterlassen immer auch Spuren! Deutlich wird dies etwa im Bild des Abstiegs des Erlösers aus der Lichtwelt in die Finsternis der Erde. Insbesondere sein schlussendlicher Aufstieg zurück in die Lichtwelt verdankt sich ganz und gar einer gnostischen Vorstellungswelt. Auch die Menschensohntradition von Ez 1,26 und Dan 7,13 verwies in eine vergleichbare Richtung. Das christliche Denken bot zudem die Basis, beide Strömungen des Judentums, das orthodoxe, das seinen Mittelpunkt im Tempel von Jerusalem sah, und das in der Diaspora zerstreute, das sich synkretistischen Tendenzen öffnete, die möglicherweise auch in Galiläa anzutreffen waren, in gleicher Weise zu begegnen und für entsprechende Vorstellungen anschlussfähig zu werden.
Im Rahmen dieses so skizzierten Kontextes muss nun die Verkündigung Jesu gedacht werden. Nach damaliger Auffassung wurde Jesus als ein Rabbi angesprochen, der in Lebensgemeinschaft mit einer Gruppe von Jüngern (und Jüngerinnen) durch Palästina zog. Von Jesus selbst gibt es keine schriftlichen Quellen. Da jedoch die damalige Gesellschaft auf Grund einer sehr gut eingeübten mündlichen Weitergabe der Tradition in der Lage war, Lehren sachgemäß weiterzugeben, kann davon ausgegangen werden, dass die frühe apostolische Weitergabe der Tradition recht zuverlässig ist. Die Tatsache, dass Jesus seine Lehre nicht aufzeichnete, ist im Rahmen der damaligen rabbinischen Tradition keineswegs unüblich. Zudem machte die apokalyptisch geprägte Naherwartung den Gedanken, eine Lehre für lange Zeit fixieren zu müssen, überflüssig.
Dass Jesus zum Kreis Johannes’ des Täufers gehört hat, kann auf Grund der Quellen als gesichert vorausgesetzt werden. Auch der Täufer lebte in der Erwartung des nahen Endes der Welt. Die Zeichenhandlung seiner Taufe sollte die Menschen, die bußfertig waren, angesichts des nahen Endes in die Schar der Auserwählten aufnehmen, die Gottes Gericht bestehen werden. Modell für die Taufe des Johannes war der Reinigungsakt der Priester am Tempel in Jerusalem. Das Reinigungsbad sollte einen Priester, bevor er den Kult vollzieht, aus dem Stand der Unreinheit heben und für den Bereich des Heiligen rüsten. Die Taufe des Johannes wurde keineswegs magisch verstanden; sie blieb an die korrekte Einhaltung des Gesetzes gebunden. Die Reinigungstaufe allein, ohne die Beachtung des Gesetzes, ist in den Augen des Täufers zu nichts nütze. Die Heiligkeit wurde zeichenhaft auf den „heiligen Rest“ übertragen, der angesichts der bevorstehenden kosmischen Katastrophe bestehen sollte. Nun macht das Wort Jesu, Johannes sei der Größte der bisherigen Geschichte Israels, der Kleinste im Himmelreich aber sei größer als er, den Beginn eines neuen Äons deutlich.9 Dieser neue Äon bricht mit Jesus an. Für Jesus war dieses neue endzeitlich erwartete Reich bereits angebrochen. Er machte es in seiner Verkündigung und in seinen Zeichenhandlungen deutlich. Damit ist ein besonderes Vollmachtsbewusstsein verbunden. Er versteht das Wort des Täufers „Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahegekommen“ in einem neuen Sinn. Das Herannahen der Gottesherrschaft ist für sein Verständnis in seiner eigenen Person Wirklichkeit geworden. Er verstand sich nicht nur als Bote dieser neuen Ära, sondern als deren Bevollmächtigter, der dieses neue Reich auch verkörperte. Sein Jüngerkreis partizipierte an seiner Sendung. Unabhängig von der Frage, welche Hoheitstitel Jesus selbst für sich gebraucht hat, wird aus seiner Handlungsweise deutlich, dass er sich in der messianischen Tradition Israels sieht als der, mit dem Gottes heilshaftes Handeln endzeitliche Gültigkeit schafft. Tatsächlich wurde dieser außerordentliche Anspruch Jesu vom Synedrium in Jerusalem präzise verstanden. Ohne diesen Anspruch wäre das Todesurteil Jesu eine Willkürhandlung und eine Rechtsbeugung. Die Erzählung seines Wüstenaufenthaltes (im NT „Versuchungsgeschichten“ genannt) deuten die Zeit der inneren Reifung und Bewusstwerdung seiner Sendung aus: die Absage an äußere Wundertaten als Zeichen der Beglaubigung seiner Botschaft, die Ablehnung eines Personenkultes, der um ihn aufgebaut wird, und die Ablehnung der Errichtung eines handgreiflich sichtbaren Reiches Gottes auf Erden, das den Menschen die Arbeit und tägliche Mühe um ihr Brot und die Plage, die Bedürfnisse zu stillen, auf wunderbare Weise abnimmt.
Die Bergpredigt wird zur entscheidenden hoheitlichen Verkündigung, in der der Vollmachtsanspruch Jesu in voller Deutlichkeit zum Ausdruck kommt: „Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt worden ist … ich aber sage euch …“ Das alte Gesetz ist damit – wie besonders Matthäus in seinem Evangelium deutlich macht – keineswegs aufgehoben, sondern es wird vollendet.10 Mit den Zwölfen werden zeichenhaft die Führer des neuen Gottesvolkes ernannt. Tatsächlich sollte damit das alte Israel nicht abgeschafft werden, sondern zur Erfüllung des Gesetzes und zur Öffnung auf Gottes Heilshandeln hin aufgerufen werden. Die alten Strukturen Israels, so auch der Tempelkult, wurden keineswegs für desolat erklärt, sondern ganz selbstverständlich bejaht. Die Jesusbewegung als radikale Absage an die Tradition Israels zu verstehen, wäre eine große Fehleinschätzung. Die Jüngergemeinde war der Sammelpunkt des neuen Gottesvolkes, keine Nachfolgeorganisation des bisherigen alttestamentlichen Gottesvolkes. Jesu Selbstbewusstsein und seine Botschaft sind also nur auf dem Hintergrund der Tradition Israels zu entschlüsseln. Die Gleichnisse Jesu entstammen keineswegs einer gnostischen Tradition, sondern sind vollkommen selbständig. Wo gnostisierende Züge erkennbar werden, sind diese in einer späteren Überarbeitung hinzugefügt worden. Der Schlüssel zum Selbstbewusstsein Jesu ist in seiner ganz einmaligen Beziehung zu Gott, den er seinen Vater nennt und den er mit dem Kosenamen „abba“ anspricht, zu sehen. Tatsächlich ist die christologische Beschreibung Jesu als „o monogenes“ (der einziggeborene, der einzigartige Sohn), wie wir ihn zwei Generationen später im Johannesevangelium finden, keine Überfremdung, sondern hat seinen Grund in dieser einzigartigen Gottesbeziehung Jesu. Für Jesus ist Gott in einem eminenten Sinn Vater. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte.11 Zugleich wird die Grenze zwischen ihm und Gott nicht verwischt. So nahe Jesus Gott steht, steht er diesem doch gegenüber und bezeichnet sich als Sohn bzw. wird von der christlichen Gemeinde als solcher tituliert. Das monotheistische Bekenntnis von Deuteronomium 6 wird also in vollem Maße aufrechterhalten und auch die spätere Dogmenentwicklung der Kirche sucht diesem Tatbestand gerecht zu werden.12 Der Gehorsam gegenüber dem Vater, den Jesus einfordert, wird allererst auch von ihm selbst praktiziert bis in die Situation seines Leidens und Sterbens hinein.
Es gehört zu den Grundlagen des fundamentaltheologischen Diskurses, deutlich zu machen, dass zwischen der Jesuanität und der Christologie kein Bruch entsteht. D. h., es gilt zu verdeutlichen, dass der christliche Glaube keine Schöpfung der Urgemeinde oder genialer Theologen, wie etwa des Paulus, ist, sondern die sachgerechte Explikation dessen, was die Menschen, die mit Jesus gelebt und die ihn erfahren haben, also im eminenten Sinn die Apostel, erfahren haben und im Licht des Glaubens an Jesus den Christus deuten. Gelingt es nicht, diese Brücke zu schlagen von der Verkündigung Jesu, seinen Intentionen, seinem Leben und seinem Handeln und schließlich seinem Tod zu dem Glauben der Urgemeinde, dann hängt dieser ohne sachliche Legitimation in der Luft. Er mag als noch so kunstvolle Konstruktion bezeichnet und angesehen werden, aber er kann sich nicht mehr auf Jesus als die entscheidende Grundlage berufen und beziehen. Der Schnittpunkt zwischen der Zeit Jesu und dem Entstehen der Urgemeinde liegt im Geschehen von Tod und Auferstehung Jesu. Wenn wir beides sprachlich nebeneinanderstellen, so muss doch deutlich sein, dass es sich um zwei vollkommen verschiedene Sinnebenen handelt: in einem Fall geht es um ein empirisch Fassbares, im anderen Fall (in der Rede von der Auferstehung) um eine metasprachliche Bewertung dessen, was geschehen ist. Würde das Geschehen der Auferstehung in einem handgreiflich-naiven Sinn als Geschehen dieser Welt gefasst, so wäre nichts gewonnen. Jesus wäre nach seinem Tod wieder in die Welt zurückgekehrt. Tatsächlich aber meint die theologische Aussage etwas ganz anderes, nämlich die Bestätigung und Legitimation seines Leidens- und Todesgeschickes durch Gott, der ihn der Totenwelt entreißt und – extreme Steigerung – zum endzeitlichen Richter der Lebenden und der Toten einsetzt.
Wie konstituiert sich die Urgemeinde in Jerusalem? In der Apostelgeschichte, die aus dem zeitlichen Abstand einer Generation die Entwicklung zu rekonstruieren sucht, beginnen die Anfänge der Gemeinde mit der Erscheinung des Auferstandenen. Symbolisch ist die Zahl der 40 Tage zu verstehen, in denen diese Erscheinungen stattfinden. Sie werden mit der Himmelfahrt Jesu abgeschlossen (Apg 1,9–11). Als das zentrale Geschehen wird das Ereignis des Pfingstfestes genannt (Apg 1,8) mit der Gabe des Geistes an die Gläubigen. Besonders sorgfältig ist im Vorfeld des Festes das Warten auf den Heiligen Geist während zehn Tagen der Zusammenkunft und des Betens gestaltet. Das Zusammensein von Maria, die in der Apostelgeschichte ausdrücklich genannt wird, mit den elf Jüngern darf als Traditionsgut angesehen werden. Voraussetzung des Pfingstfestes ist die Vervollständigung des Zwölferkreises. Erst der Vollzahl der Zwölf wird der Geist gegeben. Gemeint ist damit: Die Verkündigung des Gekreuzigten und Auferstandenen wendet sich an das ganze Volk Israel, für das die Zwölferzahl steht. Die Verkündigung richtet sich also ausdrücklich nicht an eine kleine Sondergemeinde (wie z. B. bei den Essenern). Die endzeitliche Heilsverkündigung richtet sich an das ganze Volk, wie auch die Pfingstpredigt des Petrus deutlich macht (Apg 2,36.39). Nach der Apostelgeschichte hat diese Predigt eine enorme Wirkung und viele lassen sich zum Glauben an Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, taufen. Um zu verdeutlichen, was Gemeinde besagt, seien mit dem Neutestamentler Ulrich Wilckens13 vier Elemente des Gemeindelebens genannt: Das erste Element ist als einendes Band und Grund des Glaubens die Lehre der Apostel. Gemeint ist die Überlieferung der Worte und Taten des Herrn, die von den Zwölfen als den autorisierten Zeugen der Botschaft Jesu bezeugt wird. Der Austausch darüber und die katechetische Weitervermittlung geschah noch in keinen festen organisierten Formen, sondern in loser Runde. Die Zwölf als die entscheidenden Zeugen des Lebens und der Auferstehung Jesu bilden die Mitte der Gemeinde, die sich um sie herum gruppiert. Die Funktion der Zwölf übernimmt dann im 2. Jahrhundert der Kanon der heiligen Schriften, die als autoritativ und verlässlich angesehen und in der Gemeinde rezitiert werden.
Als zweites Element ist die koinonia, die Gemeinschaft, zu nennen. Die Praxis des Zusammenlebens als diakonische Teilhabe und Teilnahme aller bildet ein entscheidendes Element. Schon sehr früh wird die Sorge um die Armen genannt, die es in der Gemeinde Jesu nicht geben dürfe bzw. für die ganz besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist. Schon frühzeitig bilden sich entsprechende Organisationsformen heraus, die sich mit den sozialen Dimensionen in der Gemeinde befassen. Es gibt bereits in der Urgemeinde leuchtende Beispiele für engagierten sozialen Einsatz (Barnabas wird genannt), aber auch abschreckende Beispiele.14 Das entscheidende Motiv für soziales Handeln war offensichtlich Jesu eigene rigorose Auslegung der „Liebeswerke“ als Konsequenz der Annahme der Gottesherrschaft.
Als drittes Element ist nach der Apg 2,42 das Brotbrechen zu nennen.15 Die täglichen Mahlzeiten wurden zum Teil in der Form gemeindlicher Mahlgemeinschaften durchgeführt, an denen insbesondere auch mittellose Gemeindemitglieder teilnahmen. Diese Mähler wurden dann aber auch als eucharistische Mähler mit dem Nachvollzug der Brot- und Weinhandlung Jesu beim letzten Abendmahl gehalten. Als viertes Element lässt sich schließlich, entsprechend der jüdischen Tradition mit ihren drei Gebetszeiten, das gemeinsame Beten nennen, das im Gebet Jesu, dem „Vaterunser“ seine besondere Prägung gefunden hat. Der auferstandene Herr hat im Glauben seiner Gemeinde bereits seinen himmlischen Ort zur Rechten Gottes eingenommen. Nach jüdischer Tradition bedeutet der Tempel in Jerusalem die Verbindung mit dem himmlischen Tempel. Der tägliche Lobpreis der Jünger im Tempel in Jerusalem hatte also eschatologischen Charakter.
Nun wird von der frühen urchristlichen Gemeinde der Vollmachtsanspruch Jesu in die Theologie der Auferstehung mit einbezogen. Was Gott an Jesus vollzogen hat, legitimiert Jesu Vollmacht und Sendung. Der Versuch, die Glaubensinhalte der Urgemeinde als deren ureigene Schöpfung zu rekonstruieren, führt zu unhaltbaren Aporien. Demgegenüber hat die Urgemeinde das klare Bewusstsein, sich nicht eine Botschaft selber ersonnen zu haben, sondern mit ihrer Verkündigung die Jesusgeschichte authentisch weiterzuführen. Sie ist der festen Überzeugung: Was sie glaubt, hat sie von Jesus, dem Christus, empfangen und gibt diesen Glauben zukünftigen Generationen weiter.
Als früheste Formen einer literarischen Fixierung dieser Verkündigung haben wir die paulinischen Briefe vor uns. Auch sie verstehen sich als sachgerechte Zusammenfassung und Bezeugung des Glaubens der Jerusalemer Urgemeinde. So führt etwa Paulus als einen entscheidenden Punkt der Verkündigung in 1 Kor 15,3 ff. an: „dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist; und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er erschienen ist dem Kephas, danach den Zwölfen.“ Der Kern des Glaubensbekenntnisses scheint im Namen Jesus Christus auf: Dieser Jesus von Nazareth aus Galiläa ist der Christus, d. h. der verheißene König des Gottesreiches der Endzeit. Die Auferstehung wird zunächst noch nicht als Jesu eigene Machttat gedeutet, sondern als Gottes Machttat am Gekreuzigten.
Ein zweites wichtiges Element, das Paulus von der Jerusalemer Urgemeinde übernimmt, ist die Feier der Eucharistie und ihr Einsetzungsbericht. Es heißt in 1 Kor 11,23–25: „Denn ich habe vom Herrn her empfangen, was ich euch auch weitergegeben habe: dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten ward, das Brot nahm, und nachdem er Dank gesagt hatte, es brach und sagte: Das ist mein Leib, der für euch (bestimmt) ist: das tut zu meinem Gedächtnis. In gleicher Weise auch den Kelch nach dem Mahle, mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis.“ Das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus ist in besonderer Weise im Römerbrief formuliert. Im Römerbrief 1,3–5 findet sich die Aussage, das Evangelium handle „über seinen [d. h. Gottes] Sohn, der aus dem Samen Davids gezeugt ist nach dem Fleische, und anerkannt als Sohn Gottes durch Machterweis und durch heiligen Geist, der auferstanden ist aus dem Bereich der Toten als unser Herr Jesus Christus“16. In dreifacher Weise wird die Würdebezeichnung „Jesus Christus“ begründet: einmal muss der messianische König aus dem Geschlecht Davids stammen; dann ist – zweitens – Jesus nach Psalm 2,7 in der Taufe von Gott als Sohn anerkannt und er darf als der Herr der Gemeinde den Kyriostitel tragen. Schließlich – drittens – ist er von Gott eingesetzt durch die Auferstehung. Wir haben in dieser triadisch konzipierten Formel das Ergebnis einer frühen theologischen Reflexion der Urgemeinde vor uns. Im Römerbrief 10,8–9 heißt es: „dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen: Wenn du bekennst mit deinem Munde: ‚Jesus ist Christus‘ und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn auferweckte aus den Toten, wirst du gerettet werden.“ Die Formel Kyrios Jesus darf als eine der ältesten des urchristlichen Glaubensbekenntnisses bezeichnet werden. Sie besagt: Jesus wurde durch die Auferstehung zu Gott erhöht und darf darum dem alttestamentlichen Gottesnamen Kyrios tragen.