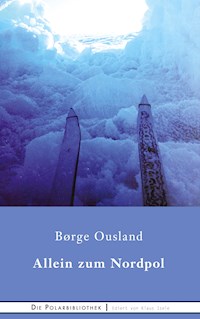Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Die Polarbibliothek
- Sprache: Deutsch
Der fesselnde Bericht über die erste Solodurchquerung der Arktis - von Sibirien über den Nordpol bis nach Ostkanada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Durst
Bæskan Lari
Enttäuschung
Am Boden
Wieder auf den Beinen
13 Tage im März
Lehrjunge des Eisbären
Panzertage
Schimmer eines Flügels
Kuchen
Barneo
Geburtsort der Giganten
Gefrorene Äpfel
Die alten Haudegen
Nach Süden
Weiße Tage
Ein hartes Leben
13 Tage im Mai
Allein
Waken
Land in Sicht
Abschied vom Polarmeer
Anhang
: Liste der Ausrüstungsgegenstände
VORWORT VON REINHOLD MESSNER
Alleine ans Ende der Welt
1995 wollte und musste ich zum Nordpol. Als gäbe es auf meinem privaten Globus keinen wichtigeren Ort. Exakt hundert Jahre nachdem der Mensch zum ersten Mal seinen Fuß auf das antarktische Festland gesetzt hatte; hundert Jahre die Norweger Nansen und Johansen ihren dramatischen Versuch unternommen hatten, den Nordpol zu erreichen, hundert Jahre nachdem Mummery am Nanga Parbat verschwunden war.
1995 – das Jahr war nicht allein in Erinnerung an die Fram-Expedition gewählt, eine der kühnsten und aufregendsten Reisen, die Menschen je unternommen haben, das Jahr 1895 scheint mir generell ein Schlüsseldatum für die Poleroberung zu sein. Obwohl keiner der Wagemutigen damals sein Ziel erreichen konnte – der Norweger Carsten Borchgrevink stand nur am Rande eines Kontinents, von dessen Innerem er nichts wusste, mehr als 2000 Kilometer vom Südpol entfernt. Fridtjof Nansen kam, nachdem er sein driftendes Schiff »Fram« verlassen hatte, mit seinen Hundeschlitten auf dem Weg zum Nordpol so langsam voran, dass er den halsbrecherischen Rückzug über dasselbe Packeis antrat, über das er nur unter großen Anstrengungen und Gefahren vorwärtsgekommen war. Albert Frederick Mummery, vielleicht der beste Bergsteiger seiner Zeit, verschwand spurlos, nachdem er versucht hatte, den Achttausender Nanga Parbat zu besteigen. Es fehlte damals an Erfahrung, Wissen und Daten über die Enden der Welt. Die Ausrüstung war mehr als dürftig, wenn wir sie mit der unseren vergleichen.
Trotzdem frage ich mich, ob einer der drei, mit viel Glück vielleicht, zum Ziel hätte kommen können. Nansen vielleicht, wenn er nur bis zum Pol gemusst hätte. Aber wer hätte ihn dort holen können? Die Reise zum Pol, hin und zurück, wenn auch von der künstlichen Insel eines driftenden Schiffes im Eismeer startend, war 1895 unmöglich. Mummery hätte am Nanga Parbat die größte Chance gehabt, wenn er nur mehr über die sauerstoffarme Luft in der »Todeszone« gewusst hätte. Klettertechnisch war er den Schwierigkeiten in der Diamirflanke des Berges gewachsen, seine Ausdauer hätte für den Aufstieg gereicht. Aber wie wäre er ohne Absicherung vom Gipfel wieder heruntergekommen? Am weitesten weg lag der Pol für Borchgrevink. Undenkbar weit weg. 1895 war der Südpol unerreichbar für den Menschen.
Trotzdem, dieser Südpol sollte als erster erreicht werden. Und so wie Amundsen mit seinen Schlittenhunden – ohne Unterstützung aus der Luft – sollte es 100 Jahre lang niemand mehr schaffen, vom Meer zum Pol und wieder zurück zu kommen. Der Nordpol sollte nachweislich erst 1995, also erst 100 Jahre nach Nansen, erstmals aus eigener Kraft erreicht werden, die Achttausender im Himalaja und Karakorum, die im Mount Everest gipfeln, ein halbes Jahrhundert nach Mummerys Verschwinden.
Inzwischen sind die Achttausender alle und häufig bestiegen worden, am Südpol steht eine vom Flugzeug aus versorgte Forschungsstation, und bis zum Nordpol kann man mit dem Luxusschiff reisen. Jahr für Jahr brechen sich mit Atomkraft angetriebene Eisbrecher eine Rinne durchs sommerliche Packeis – bis zum Pol. Wer nur zu den Polen will – Südpol, Mount Everest, Nordpol – , kann heute also eine Flug-, Trekking- oder Schiffsreise buchen und sich zum Ziel seiner Sehnsucht fliegen, führen oder fahren lassen. »Mit dem Eisbrecher zum Nordpol«, »Im Flugzeug zum Südpol«, »Mount Everest – der Traum ist das Ziel« sind Werbeslogans, die auf diese ungewöhnlichen Reisemöglichkeiten hinweisen sollen. »Auch im Zeitalter des intensiven Bergtourismus, Extremtrekkings und der Achttausender von der Stange hat das Erlebnis Berg nichts von seiner ursprünglichen Faszination verloren« lügen die Werbetexter und verkaufen »abenteuerliche« Reisen wie »Zum Gipfel der Welt mit Familie und Freunden«, als wären Peary, Amundsen oder Hillary Reiseleiter. So verkauft sogar der angesehene Explorers Club in New York ein Programm zum Nordpol, das weder mit Forschung noch mit Abenteuer zu tun hat: Mit ein paar Zitaten von Fridtjof Nansen, George L. Mallory und Captain Scott, Schlagworten wie »Herausforderung«, »Wage das Unmögliche« oder »Auf den Spuren der Wikinger« wird die Vorstellung suggeriert, »die weißen Flecken auf der Landkarte« lägen immer noch draußen – im Polarmeer, auf dem Eis oder oben am Gipfel – und nicht in uns drinnen. Als hätte es diese 100 Jahre Wildnisvernichtung und die dazugehörenden Weltreisenden – Vagabunden, Abenteurer, Seeräuber, Aussteiger, Piraten, Freibeuter, Schelme, Narren, Gauner, Banditen, Schwindler – nicht gegeben. Als hätten diese Schausteller, die allesamt nur ihre Kirmes an den »Enden der Welt« veranstalteten, nichts zerstört außer ihr Leben. Der Zirkus um die äußersten Pole der Erde, gestern ausschließlich von den Akteuren selbst veranstaltet, wird jetzt von Reiseveranstaltern inszeniert, um teure Passagen dorthin zu verkaufen. Und Tausende bezahlen für den »Kampf um den Südpol«, den »Verlorenen Horizont«, den »Ruf des Nordens«. Auch weil sie glauben, auf dem Segelkutter von Ice Sail, im Flieger von Adventure Network oder am Seil des Bergführers zu erleben, was Cook, Amundsen oder Hillary erlebt haben.
Diesen Pseudoabenteuern stehen die Reisen von ein paar Grenzgängern gegenüber, die mit großem Können, viel Ausdauer und einer guten Portion Frechheit weiterhin die »Eroberung des Nutzlosen« wagen. Allen voran Børge Ousland, der mit seinen Solo-Traversen von Antarktis und Arktis die große Tradition von Nansen und Amundsen fortsetzt. Was diese Norweger im Eis nicht alles geleistet haben!
Ich kenne das arktische Packeis, zog monatelang meinen Schlitten über den siebten Kontinent, und deshalb kann ich nachvollziehen, was Børge 2001 gewagt und geleistet hat: zwischen Cape Arktichesky in Sibirien und Ward Hunt Island in Kanada, zwischen dem 3. März und dem 23. Mai, zwischen - 3° und - 41° C: Immer in Gefahr, immer unterwegs, immer unter miserablen Umständen. Er hat nicht nur das schier Unmögliche gewagt, er hat die herkömmlichen Regeln gebrochen und allein geschafft, was »solo« nicht machbar schien. Und er setzt damit die Tradition der großen Norweger an den Polen fort. Sicher, die Engländer sind und bleiben großartig in unserem Spiel zu den »Fluchtpunkten der Eitelkeit« auf dieser Erde – Amundsen oder Nansen und heute Ousland war und sind uns heute in Taktik, Können und Kühnheit dabei überlegen. Also: »Lhagyelo«, tibetisch für »die Götter werden siegen«.
Reinhold Messner, September 2001
DURST
Das Arktische Kap, am russischen Kap Arktichesky, hätte den Namen »Kap der Einsamkeit« verdient. Näher als auf dieser nackten und menschenfeindlichen Landspitze kann man dem Arktischen Ozean in Sibirien nicht kommen. Ich hasste diesen Ort von ganzem Herzen, allein der Name ließ mir kalte Schauer über den Rücken laufen. 1994 hatte ich zum ersten Mal dort gestanden, auch damals allein. Der Beginn meiner ersten großen Soloexpedition war mit einer enormen Anstrengung verbunden, alles war neu und furchterregend. Der junge Mann, der sich da ins Treibeis aufmachte, war alles andere als fröhlich.
Nie zuvor hatte ich im Winter allein in einem Zelt übernachtet. Nun war ich ins kalte Wasser gesprungen, und der Schock war dementsprechend groß. In der ersten Nacht weinte ich Tränen der Verzweiflung. Warum bist du nicht einfach zu Hause geblieben, du Idiot, fragte ich mich. Wie war ich nur auf die Idee verfallen, ausgerechnet zum Nordpol zu wandern, noch dazu mutterseelenallein? Die Antwort kam Schritt für Schritt. Die Schwierigkeiten vom Anfang verwandelten sich in Stärke; allmählich stellten sich Harmonie und Freude ein. Ich erreichte mein Ziel und brachte die Tour erfolgreich zu Ende. Das Arktische Kap jedoch ist in meiner Erinnerung ein Albtraum geblieben. Nie wieder Polarmeer, hatte ich mir gesagt. Und damals war ich lediglich bis zum Nordpol gewandert. Nun hatte ich einen mehr als doppelt so langen Weg vor mir.
Trotzdem erfüllten mich vor dieser Tour andere Gefühle. Ich war inzwischen viel erfahrener, mental besser vorbereitet und wusste mehr oder weniger, was auf mich zukam. Seit 1994 war ich allein zum Südpol gegangen und hatte die Antarktis überquert. Die Einsamkeit machte mir keine Angst mehr. Im Gegenteil, auf diesen Aspekt der Expedition freute ich mich sogar. Meine Touren in der Antarktis hatten mich gelehrt, das Alleinsein zu genießen. Es kann ein Glück sein, nicht nur die eigene, sondern auch die Tiefe der reinen, unverfälschten Natur auszuloten. Nun würde ich wieder die äußersten Grenzen des Lebens berühren dürfen, wenn auch unter größten Entbehrungen. Was wollte ich eigentlich herausfinden? Alles und nichts. Wer dort draußen gewesen ist, erweitert seinen Horizont und seine Perspektive. Man gewinnt eine Kraft, die einem nichts und niemand mehr nehmen kann.
Der Wind fegte über das Kap. Er kam von Nordosten, was für den Start günstig war, weil das Eis ins Landesinnere gepresst wurde. Der Helikopter hatte eine Runde gedreht, damit ich mir einen Eindruck von den Verhältnissen verschaffen konnte. Ich sah, wie das Eis sich öffnete und wieder schloss, als wäre es lebendig. Wind und Strömung verleihen dem Eis eine enorme Energie, besonders vor dem Kap, wo Meer und Land aufeinandertreffen. Für einen Skiläufer mit schwerem Schlitten ist diese Zone besonders gefährlich, daher musste sie unbedingt im Laufe des ersten Tages überquert werden, vor Anbruch der Dunkelheit.
Mit dem Kompass peilte ich einen Übergang leicht östlich vom Kap an. Hier hatten sich einige Eisschollen verkantet und eine Brücke zwischen nur oberflächlich zugefrorenen Stellen, den sogenannten Waken, gebildet. Der Helikopter landete, und die Besatzung öffnete die große Tür im hinteren Teil. Die gesamte Ausrüstung war bereits in Kisten verpackt, und ich belud den Schlitten im Windschatten des großen fliegenden Traktors. Es kam eine ansehnliche Last zusammen, rund 170 Kilo Gepäck, ausreichend Versorgung für drei Monate. Die russischen Piloten standen andächtig da und sahen mir zu. Geli, der Chefpilot, erwies mir seinen Respekt, indem er ein Glas Wodka ausgab. Wir stießen auf traditionelle Weise an, alles wurde in einem Zug hinuntergekippt. Mit dem süßen, leicht ekligen Geschmack russischen Wodkas auf der Zunge setzte ich den Schlitten mit einem Ruck in Bewegung. Kjell Ove war der Einzige, der mich ein Stück begleiten durfte, das war so abgesprochen.
Kjell Ove sah meinen Rücken nicht zum ersten Mal in der großen weißen Weite verschwinden. Bei jeder meiner Soloexpeditionen war er hinter mir zurückgeblieben – ein Moment, auf den wir gemeinsam hingearbeitet hatten. Jetzt brauchten wir keine Vorbereitungen mehr zu treffen, nun kam es nur noch auf mich an. In solchen Augenblicken sind nicht viele Worte nötig. Gedanken und Blicke genügen uns. Wenn man sich verabschiedet, schneidet man die Verbindungen zur Welt ab. Alles Bekannte und Vertraute bleibt hinter einer unsichtbaren Wand zurück. Langsam bewegte ich mich hinein in ein anderes Universum.
Ein solcher Augenblick ist so ähnlich wie eine Geburt; schmerzhaft, aber auch befreiend. Endlich unterwegs. Ein sehr emotionaler Moment, und so soll es auch sein. Man muss loslassen, um Neuland zu betreten. Ich hatte keine Ahnung, worin das Neue bestehen und wie ich damit umgehen würde. Ich wusste nur, dass ich mir eine neue Welt erschaffen und mich verwandeln musste, um allmählich mit dem Eis zu verschmelzen. Alles andere würde ich hinter mir lassen. Ich musste lernen, mich heimisch zu fühlen, wenn ich mein Zelt aufschlug. Ich musste den Schlitten, die Skier und Stöcke als Verlängerung meines Körpers betrachten. Wenn mir das gelang, würde ich auch die dreimonatige Einsamkeit überstehen. Diese große weiße und beängstigende Weite musste meine einzige Wirklichkeit werden.
Ein offener Blick und offene Sinne waren das Rezept. Allmählich würde ich die vielen Schichten der Zivilisation abstreifen. Mein Ziel war es, wie ein Tier zu werden, das schon immer hier gelebt hat. Erfahrungsgemäß dauert es drei, vier Wochen, bis man so weit ist. Du wachst auf, blinzelst verschlafen in die Sonne, schnupperst am Nordwind und findest automatisch den besten Weg und die sichersten Lagerplätze. Die täglichen Handgriffe laufen routinemäßig ab. 1994 wusste ich das noch nicht, und die Begegnung mit der extremen arktischen Natur in Kombination mit der Einsamkeit war ein zu heftiger Schock für mich. Diesmal fühlte ich mich vollkommen anders. Ich hatte den besten Start meines Lebens gehabt und war frohen Mutes.
Die ersten hundert Meter ging es über flaches, dünnes Eis. Ich überquerte mehrere Waken, bevor ich an einen Spalt im Eis kam. Kräftiges Packeis versperrte den Weg nach Westen, und im Osten lag das offene Meer. Das Eis war in starker Bewegung und drückte gegen die Eisscholle, auf der ich stand. Ich beschloss, in Richtung Nordosten zu gehen – auch vom Helikopter hatte dieser Weg den besten Eindruck gemacht. Das Packeis war jung, nur dreißig bis vierzig Zentimeter dick, und die Blöcke hatten sich zu niedrigen Haufen gestapelt.
Die Zeit drängte, doch mit dem schweren Schlitten kam ich nur langsam voran. Noch ein wenig größere Höhenunterschiede, und ich würde mich mit ganzer Kraft in den Gurt hängen und ziehen müssen. Die Skier hatte ich längst auf den Schlitten gelegt, weil die Presseisrücken so dicht nebeneinanderlagen, dass ich zu Fuß gehen musste. Langsam senkte sich die Polarnacht auf mich herab. Es war ein schöner Abend, der Himmel war dunkelblau, und aus den Waken stieg schwarzer Eisnebel auf. Die ersten Sterne glitzerten zu mir herunter. Bald würde es zu dunkel sein, um weiterzugehen, und ich befand mich noch immer auf sehr instabilem Eis, knapp zwei Kilometer vom Festland entfernt. Zum Schluss wurde das Vorankommen schwierig, und als ich zu einer kleinen Eisscholle kam, die etwas dicker wirkte, rund 50 Zentimeter, schlug ich mein Lager auf. Es war ruhiger geworden, vom Eis waren keine Geräusche zu hören, und schmale Streifen Nordlicht verliehen der Stille eine eigene kalte Schönheit.
Bald tauchte das erste große Problem auf, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Das Eis in diesem Gebiet ist salzig, und da es seit einigen Tagen nicht geschneit hatte, konnte ich mir schlicht und einfach nicht genügend Trinkwasser beschaffen. In einer meiner Thermosflaschen hatte ich zum Glück noch einen Liter, aber der würde kaum für das Essen reichen. Lange suchte ich mit der Stirnlampe nach ein wenig altem Eis, aus dem das Salz herausgepresst worden war. Mit dem Messer hackte ich Stücke heraus und kostete sie, aber es schmeckte alles nach widerlichem, ungenießbarem Meerwasser. Das war wirklich kritisch. Ich hatte zwar in Landnähe ältere Blöcke gesehen, aber jetzt dorthin zu gehen, wäre lebensgefährlich gewesen. Waken hätten mir den Weg abschneiden können, und die Chance, in der Dunkelheit mein Lager wiederzufinden, war zu gering.
Durstig und besorgt legte ich mich ins Zelt. Bei Tagesanbruch musste ich unbedingt Schnee finden, denn ohne Flüssigkeitszufuhr konnte ich diesen Schlitten nicht ziehen, und das ganze Unternehmen hätte in einer Katastrophe geendet. Um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen, legte ich mich schlafen.
Mitten in der Nacht hörte ich plötzlich Geräusche. Das Eis war wieder in Bewegung geraten und presste sich zusammen. Die Geräusche kamen immer näher, es waren klagende, schneidende Laute brechenden Eises, die aus östlicher Richtung kamen. Nach einer kleinen Pause hörte ich dann ein tieferes Brummen von dem Eis auf der Westseite. Schließlich staute sich das Eis überall. Ich saß komplett angezogen in dem kleinen Zelt und erwartete jeden Moment, dass die Eisblöcke auf mein Lager stürzen würden. Mehrmals ging ich nach draußen und hielt Ausschau. Das Eis arbeitete mit unverminderter Kraft und türmte rings um meine kleine Scholle einen Haufen Packeis nach dem anderen auf. Von gewöhnlichen Presseisrücken konnte nicht die Rede sein. Da das Eis so dünn war, wurde meine gesamte Umgebung zusammengepresst.
Etwas ähnlich Grauenhaftes habe ich selten erlebt. Die Angst schnürte mir die Kehle zu. Ausgetrocknet lag ich wach und lauschte den Verwüstungen des Eises. Die Geräusche lassen sich kaum beschreiben; es ist ein Katastrophenklang wie etwas Großes, das außer Kontrolle gerät.
Was sollte ich retten, wenn das Eis sich über mich wälzte?
Schlafsack, Notpeilsender, Argos-Sender und Kochzubehör. Viel mehr würde ich nicht mitnehmen können. Wenn die Scholle aufbrach, würde der Rest der Ausrüstung wahrscheinlich verlorengehen oder zerquetscht werden. Bei Dunkelheit würden meine Rettungschancen von meiner Schnelligkeit abhängen. Wieder und wieder rekapitulierte ich, was getan werden musste. Alles, was ich brauchte, musste ich in den Schlafsack stopfen; den konnte ich mitschleppen, wenn das Eis unter meinen Füßen zermahlen würde.
Bei anbrechendem Tageslicht kam das Eis zur Ruhe, und es senkte sich wieder Stille über das Polarmeer. Die Landschaft hatte sich komplett verändert. Kompaktes Packeis, vollständig verwüstet, stapelte sich in allen Richtungen. Das Eis wird immer zuerst am schwächsten Punkt zusammengepresst, und da meine Scholle etwas dicker war als das übrige Eis, hatte sie erstaunlicherweise standgehalten. Am schlimmsten war es hinter mir, auf der Landseite. Der Lagerplatz war der einzige unberührte Fleck.
Ich drehte eine Runde und sah mich um. Da das Packeis nach kurzer Zeit die Sicht auf mein Zelt verdeckte, stellte ich einen Ski auf und befestigte eine kleine Plastiktüte an der Spitze, damit ich zum Lager zurückfinden würde. Der Wind kam noch immer aus Nordost, und der Druck in Richtung Land war wohl der Grund dafür gewesen, dass das Eis mit solcher Macht zusammengepresst wurde. Die tief stehende Sonne glühte mir ins Gesicht, und ich konnte nicht umhin, ihren Anblick zu genießen, aber zunächst musste ich Schnee finden.
Nach einer Stunde setzte ich mich auf einen Eisblock. Ich fand weder altes Eis noch Schnee. Panik stieg in mir auf. Wie lange konnte ich ohne Wasser überleben, und wie viele Stunden sollte ich warten, bis ich den Helikopter rief? Wahrscheinlich war er schon nach Chatanga zurückgekehrt, und es würde rund 24 Stunden dauern, bis man mich aufsammeln konnte. Dass die Expedition womöglich jetzt schon abgebrochen werden musste, kam mir vollkommen absurd vor. Ein gebrochenes Bein oder eine beschädigte Ausrüstung wären ja plausible Gründe gewesen, aber Wassermangel? Undenkbar. Es musste einen Ausweg geben.
Während ich dort saß und grübelte, bemerkte ich einige Eiskristalle, die sich auf einem der Blöcke gebildet hatten. Ich probierte sie und stellte zu meiner großen Freude fest, dass sie nicht salzig waren. Der Eisnebel aus den Waken musste das frische Eis mit einer Reifschicht überzogen haben. Ich hockte mich auf die Knie und schabte mit dem Spaten vorsichtig über das Eis. Mit jedem Strich gewann ich eine winzige Menge Reif, den ich in eine Tüte schüttete. Im Schutz der Eisblöcke, wo der Wind zum Erliegen gekommen war, lag noch mehr Reif. Nach einer weiteren Stunde hatte ich genug beisammen, um einen Kochtopf zu füllen. Fröhlich wie ein Kind eilte ich zurück zum Lager und zündete den Primuskocher an.
Nachdem ich gierig getrunken und eine meiner Thermosflaschen gefüllt hatte, packte ich meine Sachen und machte mich auf den Weg. Um keinen Preis wollte ich eine weitere Nacht an diesem grauenhaften Ort verbringen. Im Süden war das Kap bedrohlich nah. Ich musste weiter hinaus zu Schnee und festerem Eis.
Ich hatte das Gefühl, 170 Kilo über ein Geröllfeld ziehen zu müssen. Die Eisschollen waren höchstens vier bis fünf Meter breit, der Rest war voller messerscharfer, steinharter Kanten. Um den leichtesten Weg zu finden, war ich vorher ohne Schlitten auf Erkundungstour gegangen. Wie erwartet ging es langsam voran, und wie erwartet wurde der Schlitten stark beansprucht. Er hatte schon am Tag zuvor Anzeichen von Schäden aufgewiesen, doch erst als er kopfüber auf einem Eisrücken lag, sah ich zu meinem Schrecken, dass an beiden Längsseiten die Verschalung beschädigt war. Durch die Risse leuchtete die gelbe Farbe der Innenwanne. Doch das Schlimmste war, dass die Innenverkleidung auch an der Unterseite des Schlittens hervorblitzte. Der Albtraum hatte mich wieder eingeholt.
BÆSKAN LARI
Wir hatten den Schlitten auf den Namen »Bæskan Lari« getauft. Ein verwegener nordnorwegischer Ausdruck. Er bedeutet ungefähr »Hol’s der Teufel«. Kjell Ove Storvik und ich hatten intensiv an dem Schlitten gearbeitet. Design, Konstruktion, Tests. Wir wussten, was wir wollten, und zeichneten im Maßstab 1:1. Wir fertigten die Skizzen auf riesigen Pappen an, um die Proportionen und Linien in realistischem Format vor uns zu sehen. Frühere Schlitten waren gerade und kantig gewesen und wiesen nicht die Wendigkeit auf, die wir uns wünschten. Wir hatten ein Nordlandboot vor Augen, das unerschütterlich durch die Wellen glitt und sich geschmeidig der See anpasste. Da ich immer ein persönliches Verhältnis zu meinem Schlitten habe, bekam er diesen nicht ganz ernst gemeinten Namen. Dass er, der mein bester Freund hätte werden sollen, sich zu meinem ärgsten Feind entwickeln würde, hatte keiner von uns erwartet.
Der erste Schock kam auf Golomjannyi Island in Sibirien. Wir waren mit dem Helikopter von Chatanga, dem nördlichsten Außenposten der sibirischen Zivilisation, fünf Stunden in Richtung Norden geflogen. Nach dem ersten Training im Packeis merkten wir, dass mit dem Schlitten etwas nicht stimmte. Kleine, unbedeutende Dellen an beiden Seiten, als hätte jemand mit einem Hammer auf den Rumpf eingeschlagen. Zuerst glaubten wir, der Transport hätte den Schlitten zu stark beansprucht, doch nach einer Weile bekamen wir eine eindeutige Antwort. Das scharfkantige Eis musste die Schäden verursacht haben. Obwohl es nicht weiter schlimm wirkte, machten wir uns Sorgen. Ich hatte die wahrscheinlich schwierigste Expedition meines Lebens vor mir. Jeder Gegenstand ist wichtig, aber der Schlitten ist das Herzstück der Ausrüstung. Wollte ich allein das Polarmeer überqueren, musste zumindest er halten.
Mit Hilfe von Digitalkamera und Satellitentelefon schickten wir Fotos von den Schäden an den Hersteller. »Versucht Klebstoff hineinzusprühen, das sind wahrscheinlich nur vereinzelte Bereiche mit Luftbläschen«, antwortete man uns. Wir konnten trotzdem nicht verstehen, dass der Rumpf beschädigt war; hier musste einfach ein Fehler vorliegen. Ich hatte dasselbe Schlittenmodell getestet, indem ich es, beladen mit 170 Kilo, aus drei Metern Höhe hinabstürzte. Das Resultat war überzeugend gewesen, besser als erwartet. Handelte es sich lediglich um Luftbläschen, die keine größeren Probleme verursachen würden, oder hatten wir es mit einem durchgehenden Produktionsfehler zu tun?
Der Schlitten war nach der »Sandwich-Methode« gegossen worden, ein Schaumstoffkern mit Kevlar und Karbonfasern auf beiden Seiten. Das ergibt einen vollkommen steifen Rumpf, leicht und stabil – so wie er auch für Whitbread-Boote verwendet wird. Früher hatte ich eine Schicht aus reinem Kevlar verwendet, der weicher ist und Energie aufnimmt, indem er sich anpasst. Der »Sandwich-Methode« stand ich zunächst skeptisch gegenüber. Ich wollte ein möglichst haltbares Material und bat um einen Schlitten aus reinem Kevlar. Der Hersteller war anderer Ansicht, er meinte, »Sandwich« wäre eindeutig vorzuziehen.
Im Jahr zuvor hatte dieselbe Firma Schlitten an Rune Gjeldnes und Torry Larsen geliefert, die das Polarmeer von Sibirien bis Kanada überquert hatten – dieselbe Route, die ich nehmen wollte. Beide waren hellauf begeistert von ihren Schlitten, sie hatten ihnen treue Dienste geleistet, und wenn sie zufrieden waren, warum sollte ich mich dann nicht für dasselbe Produkt entscheiden? Auch meine eigenen Tests brachten meine ursprüngliche Entscheidung ins Wanken. Schließlich war ich überzeugt. Mein neuer Schlitten sollte nach der »Sandwich-Methode« gegossen werden, mit ebenso vielen Schichten wie bei den Modellen von Torry und Rune.
Jetzt zweifelte ich doch daran, die richtige Wahl getroffen zu haben. Doch warum mein Schlitten Schäden davongetragen hatte, während die von Torry und Rune gehalten hatten, war mir noch immer ein Rätsel. Man konnte fast den Eindruck bekommen, mein Schlitten habe eine dünnere Außenhaut und wäre somit anfälliger für Stöße. Doch ausgerechnet das konnte nun nicht mehr geändert werden, wir mussten uns stattdessen auf die Möglichkeiten konzentrieren, die uns hier und jetzt blieben.
Die Zeit war knapp. In zwei Tagen sollte ich vom Arktischen Kap starten, der äußersten Landspitze im Norden Sibiriens. Anfang März reicht das Eis für gewöhnlich bis zum Kap. Später entfernt es sich vom Festland, und wenn ich noch länger wartete, konnte es unter Umständen unmöglich werden, das Eis zu erreichen. Einen neuen Schlitten zu gießen und hierher zu transportieren hätte zu lange gedauert. Wir mussten den vorhandenen Schlitten verstärken und das Beste aus der Situation machen.
Zum Glück war die Werkstatt auf Golomjannyi relativ gut ausgestattet. Der Chef der Basis, Tolja, war sowohl Meteorologe als auch Mechaniker. Er verfügte über eine Blechschere und Aluminium, und ich besaß Nägel und eine Zange. Wenn man sich abseits der Landstraßen bewegt, lohnt es sich, das eine oder andere Extra mitzunehmen; und da ich ein bisschen Erfahrung hatte, war ich, was das Werkzeug anbetraf, gut vorbereitet. Daher waren wir optimistisch, dieses Problem in den Griff zu kriegen.
Draußen herrschte klirrende Kälte, aber in dem beheizten Raum, in dem Kjell Ove und ich arbeiteten, rann uns der Schweiß hinunter. Wir schnitten zwei längliche Aluminiumverkleidungen zu, die wir rechts und links an den Schlittenrumpf nagelten. Mit einer Spritze aus dem Erste-Hilfe-Kasten füllten wir die Ritzen mit Klebstoff. Das Resultat machte einen guten Eindruck; wir waren zufrieden mit dem, was wir in der kurzen Zeit zustande gebracht hatten. Das hatten wir nicht zuletzt Tolja zu verdanken, der sein Möglichstes tat, um uns zu helfen, und natürlich der Tatsache, dass wir vorausschauend genug gewesen waren, Nägel und eigenes Werkzeug mitzunehmen.
Der Sinn der Verstärkung bestand darin, den Rumpf in der Längsrichtung zu stabilisieren, damit sich die Schäden nicht weiter nach oben in Richtung Öffnung ausbreiten und den ganzen Schlitten untauglich machen konnten. Auf diese Weise waren kleinere Schäden in der Außenhülle tolerierbar, ohne dass der ganze Schlitten auseinanderbrach. Die Unterseite war zum Glück intakt, sie hatte zwecks besserer Gleiteigenschaften eine Plastikabdeckung.
Nun blieb nur noch ein Tag. Obwohl ich mich ein gutes Jahr auf diese Expedition vorbereitet hatte, mussten noch unglaublich viele Details erledigt werden. Wir hatten bis zum letzten Augenblick zu tun. Erst als alles verpackt und fertig war, kam ich einige Stunden zur Ruhe.
Die Insel Golomjannyi liegt auf dem 80. Breitengrad und ist eine der nördlichsten Wetterstationen der Erde. Anfang März herrschte dort noch immer die Polarnacht. Der vormittägliche Besuch eines Eisbären machte uns deutlich, wie verlassen dieser Ort war. Abgesehen von dem Militärstützpunkt Sredny, Dutzende Kilometer westlich von hier, waren die Einwohner die meiste Zeit des Jahres von der Umwelt vollkommen abgeschnitten. Die Station wurde von einem Ehepaar betrieben, das sich hier schon seit über zwanzig Jahren aufhielt. Ihr Sohn Sascha, ein schmächtiger kleiner Bursche von acht Jahren, schlich bescheiden um uns herum, und war froh, dass endlich einmal etwas passierte. Die Russen sind in der Regel lange fort, wenn sie irgendwohin versetzt werden, und es ist üblich, dass sie ihre Frauen mitnehmen, selbst an die unwirtlichsten Orte. Diese Familienidylle trug dazu bei, dass Golomjannyi wahrscheinlich eine der gemütlichsten Polarstationen in der Arktis ist.
Während draußen Kälte und Dunkelheit herrschten, war es drinnen umso gemütlicher. Von innen sah die Wohnung aus wie jedes andere russische Zuhause. Sascha hatte sein gesamtes achtjähriges Leben hier verbracht. Außer den Kindern, die er in den Sommerferien traf, hatte er nie Spielkameraden. Im Sommer fuhr die Familie immer an die Schwarz meerküste, um Sonne, Wärme und die Gesellschaft anderer Menschen zu genießen. Wenn man nur wenige Spielsachen hat und die Mutter Lehrerin ist, kann einem leicht langweilig werden. Da war es schon besser, mit dem Vater unterwegs zu sein, entweder zum Militärstützpunkt oder auf der Jagd nach Robben und Füchsen.
Unser Besuch war ein spannendes Ereignis für ihn. Sascha war ein fröhlicher und aufgeschlossener Junge, der strahlte, als wir endlich Zeit hatten, ihm ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Mit einem aufgequollenen Ball spielten wir im Schnee Fußball. Dieses einfache, elementare Spiel und die Freude im Gesicht des Jungen waren nach Tagen voller Stress und Sorgen ein befreiendes Erlebnis.
Um Punkt sechs Uhr morgens kam am nächsten Tag der Helikopter vom Militärstützpunkt, um uns abzuholen. Wir luden unsere Ausrüstung ein und verabschiedeten uns von Golomjannyi. In niedriger Höhe flogen wir in nördlicher Richtung über die Insel Ostrava Semlja. An der Spitze dieser Insel liegt Kap Arktichesky, der Ort, von dem aus ich starten sollte.
ENTTÄUSCHUNG
Die Dramatik der ersten 24 Stunden hatte mich die Probleme mit dem Schlitten vergessen lassen. Nun leuchtete mir seine gelbe Farbe entgegen. Doch für eine Weile sollten andere Sorgen im Vordergrund stehen.
Wieder brach die Dunkelheit viel zu früh an, und noch einmal musste ich mein Lager im Packeis aufschlagen. Das Eis war zwar etwas dicker und die Presseisrücken sahen vertrauenerweckender aus, aber es gab noch immer keinen Schnee. Ich holte einige kleinere Blöcke und sicherte das Zelt. Ich würde wahrscheinlich eine Zeit lang hier bleiben und überlegen müssen, was zu tun war.
Ich hatte bereits einige Spuren von Eisbären gesehen und brachte vorsichtshalber rings um das Zelt einen Stolperdraht an. Dieser war mit vier Leuchtraketen verbunden, die an je einem Stab befestigt waren. Wenn sie aktiviert wurden, leuchteten sie intensiv und gaben einen kräftigen Knall von sich, der von einem Heulen gefolgt wurde. Im Dunkeln sah ich den Draht nicht, und als ich ein bisschen übertrieb, indem ich einen der Stäbe mit einem weiteren Eisblock abstützen wollte, schaffte ich es sage und schreibe, den Block so auf den Draht zu legen, dass zwei Leuchtraketen gleichzeitig losgingen. Wie ein Idiot stand ich da im gleißenden Licht, während das Heulkonzert in Stereo übers Eis schallte. Das kalte, weiße Phosphorlicht ließ das Eis in erschreckender Schärfe erstrahlen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis die Leuchtraketen abgebrannt waren; jeder Eisbär im Umkreis von zehn Kilometern muss sie gesehen haben. Ich hoffte nur, dass sie das Schauspiel genauso beängstigend fanden wie ich und es nicht als Einladung auffassten, zum Fressen zu kommen.
Nachdem ich den Schock überwunden hatte, verkroch ich mich in meinem Zelt, um ein bisschen nachzudenken. Ich hatte soeben eine dreimonatige kräftezehrende Expedition begonnen. Es war die meiste Zeit des Tages dunkel. Das Gebiet war extrem gefährlich, und die Eisplatten konnten sich jeden Augenblick zusammenschieben. Ich war mutterseelenallein an einer schroffen und menschenleeren Küste. Sogar im Zelt machte mir die Kälte bei jedem Atemzug zu schaffen. Und zu allem Übel war das geschehen, was ich befürchtet hatte: Der Schlitten bewährte sich nicht. Er war an beiden Seiten schwer beschädigt. Meine Stimmung war nicht gerade auf dem Höhepunkt, aber man konnte auch nicht behaupten, ich wäre tief deprimiert gewesen. Glücklicherweise bin ich ein optimistischer und lösungsorientierter Mensch. Anstatt den Kopf hängen zu lassen, überlegte ich, was ich tun konnte.