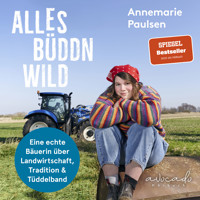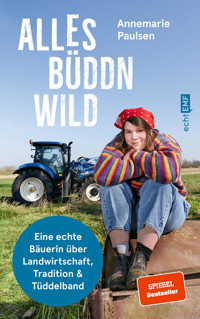
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Michael Fischer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Grüne Wiesen, süße Kälbchen, der Käse, wie er immer schon war, und ein naturnahes Leben – das ist die Landidylle aus TV-Serien. 5-Tonner mit 300 PS, viele Stunden harte Arbeit, jede Menge Lärm und Matsch und der ewige Kampf mit der EU-Bürokratie – das ist die Realität für über 250.000 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Annemarie Paulsen sieht und kennt beide Seiten, zieht aus beidem den Witz und nimmt ihre Follower mit in die Milchkammer, auf die Weide, in den Alltag einer Bäuerin. Neben bester Unterhaltung und jeder Menge Humor fragt sie aber auch ganz ernsthaft: Wo wollen wir eigentlich hin mit unseren Traditionen, ist da genug Raum für uns junge Landwirte?
„Annemarie Paulsen ist der Till Eulenspiegel unter den Agri Influencern, und sie bringt mit ihrem Humor alle zum Lachen.“ Aus der Laudatio zum Newcomer Influencer Award der Agritech 2023
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alles büddn WiLd
Eine echte Bäuerin über Landwirtschaft, Tradition & Tüddelband
Annemarie Paulsen
mit Alexander Bayer
Impressum
Alle in diesem Buch veröffentlichten Aussagen und Ratschläge wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden, ebenso ist die Haftung der Autorin bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Für die Inhalte der in dieser Publikation enthaltenen Links auf die Webseiten Dritter übernehmen wir keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage leider nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Die Ereignisse in diesem Buch sind größtenteils so geschehen wie hier wiedergegeben. Für den dramatischen Effekt und aus Gründen des Personenschutzes sind jedoch einige Namen und Ereignisse so verfremdet worden, dass die darin handelnden Personen nicht erkennbar sind.
Bei der Verwendung im Unterricht ist auf dieses Buch hinzuweisen.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
echtEMF ist eine Marke der Edition Michael Fischer
1. Auflage
Originalausgabe
© 2024 Edition Michael Fischer GmbH, Donnersbergstr. 7, 86859 Igling
Covergestaltung: Luca Feigs, Foto: Julia Merkel
Illustrationen im Innenteil: s. Bildnachweis S. 255
Layout und Satz: Luca Feigs
Herstellung: Marlene Weber
ISBN 978-3-7459-2468-8
www.emf-verlag.de
Widmung
Für Karsten
Inhalt
Bäuerin schlägt Bauer
Mit sechs älteren Brüdern zur Wrestling-Weltmeisterin
Bauer sucht Frau — Mein Weg zum neuen Hof
Kinder, Rinder und Maschinen
Eine DönerFrauenrolle zum Mitnehmen, bitte
„Du kommst vom Land? Oh, das tut mir leid!“
Landmütter haben zwölf PS — Über Dorftraditionen, Werte und die Gemeinschaft
Der Altbauer wird eher vegan, bevor er Gewohntes aufgibt
Mein Papa hat den größten Bauch ist mein größter Fan
Selbst wenn es auf der Sonne brennt — der Hof muss laufen
Heimat ist, wo man melkt
Ist das, was ich mache, überhaupt alles richtig?
Unter jedem Dach ein Ach — Die Dorfgerüchteküche brodelt
„Eine Influenzarin? Wat is dat denn?“
2052 n. Chr. — oder Wie geht es weiter mit der Landwirtschaft?
Ja, genau für dich schreib ich hier!
Jetzt habe ich tatsächlich ein Buch geschrieben und kann es selbst noch kaum glauben! Mit vielen tollen Wörtern, arabischen Seitenzahlen (ja, Mathe kann ich mehrsprachig!), ganz viel vom Landleben, einer Menge Humor und auch ein bisschen von mir. Ich erzähle euch darin aus meiner kämpferischen Vergangenheit im Dorf (ich bin mit sechs älteren Brüdern aufgewachsen), unserer wuseligen Gegenwart auf dem Land mit über dreihundert Kindern und Rindern (grob zusammengerechnet), von der Wichtigkeit der Gemeinschaft, von der Wertevermittlung und dem Erhalt der wichtigsten Traditionen beziehungsweise deren Modernisierung.
„Du musst den Leuten noch erklären, dass du das alles anhand von lustigen Anekdoten berichtest, Annemarie. Sonst denken die noch, das ist so ein trockenes wissenschaftliches Fachbuch.“ Ach ja, das hier ist mein Mann Martin. Und ich liebe ihn, auch wenn er jeden geschriebenen Content von mir überprüft und mein mit Abstand härtester Kritiker ist. Aber er hat recht – das Buch ist voll mit ganz vielen Beispielen aus dem Leben, meinen und den Erfahrungen anderer und konstruktiven Gedanken zu den Themen, die uns alle bewegen.
Ursprünglich wollte ich einfach nur mein komplettes Instagram oder meine TED-Talk-Auftritte abschreiben, denn dort erzähle ich bereits seit Jahren über das Landleben. Aber dann hätte ich mich niemals so wunderbar in die Themen hineingesteigert, und massenhaft Anekdoten ausm Dorf wären für immer in der Versenkung geblieben. Also habe ich meinen umfunktionierten Agrarbloggerinnenaward-Stiftehalter zur Seite geschoben, das Stuhlbein repariert und mich gewissenhaft in meiner süßen Stallbüroecke an den schönen weißen, eher improvisierten Schreibtisch gesetzt. Dabei herausgekommen sind Storys über die besten und gleichzeitig anstrengendsten Geschwister der Welt, die neugierigsten und geschwätzigsten Nachbarn im Dorf, die intelligentesten Kühe im Stall, den langweiligsten Pfarrer in der Gemeinde, die härtesten Männer im Ort, „Bauer Helmut“ und die stursten Altbauern von Norddeutschland, die hässlichsten Schultüten auf dem Markt, Berichte über das große Glück nach jeder gelungenen Ernte, die muffeligsten Treckersitze im Sommer, die aufregendsten Auslandssemester, den erfrischendsten Geheimsee der Uckermark, die erstaunlichsten Futterpflanzen und den (un)wilden Osten und dessen Mentalität. Aber auch über die betrunkenste Landjugend Europas, den ältesten DJ im Dorf (arbeitet mit Kassetten), Ratlosigkeit und ein bisschen Wut über das gesellschaftliche Standing der Bauern, Tipps und Tricks zur Modernisierung von Traditionen und Bräuchen sowie Geschichten über fliegende Kühe. Ach ja, natürlich auch über den nicht vorhandenen Urlaub in unserem Job, die unantastbarste Stunde des Tages, Hackbratenkuchen, Trauer, Landleben-Sorgen und Zukunftsängste und natürlich Geschichten über das Melken – die eine Aufgabe, die mich immer wieder zur Ruhe bringt, mich als einzige erdet und mich glücklich sein lässt.
Früher war ich nur Bauerntochter, Wrestling-Versuchsopfer meiner Brüder und festivalerprobter Metal-Fan. Heute bin ich Ehefrau, Mutter, Landfrau, Bäuerin, Agrarinfluencerin und Inka-Bause-Double mit längeren Haaren (zumindest verkupple ich seit Neuestem aufm Land nicht nur Rinder). Ich erzähle, schreibe und filme, und zwar über das, was mich täglich umgibt und bewegt. Am meisten darüber, worüber die Menschen vor Generationen noch ehrenvoll sprachen. Und am Ende will ich mit meiner Arbeit eigentlich nur zwei Dinge erreichen: Menschen unterhalten, sie zusammenbringen und ein authentisches Bild über das Landleben und die Landwirtschaft zeigen, gerne auch denjenigen, die uns Bauern nur aus bebilderten Kinderbüchern kennen. Aus Kinderbüchern, in denen Kühe den ganzen Tag lächelnd „Muh“ machen, Hunde über die Wiese tollen, der Hof offenbar noch nicht schließen musste und wo das Wort „Bürokratie“ gar nicht vorkommt. Und auch mit denjenigen, die das Landleben so oder so ähnlich wie ich erlebt haben oder es immer noch tun, will ich gemeinsam lachen und auch mal kopfschüttelnd mit den Augen rollen: über unsere geliebten Altbauern und die teilweise absurd festgefahrenen Strukturen auf dem Land. Über diese Strukturen wie auch grundsätzlich über Traditionen, Gemeinschaft und Werte will ich auch mal hart diskutieren. Ach ja, und auch meine Follower kommen natürlich auf ihre Kosten, weil sich so ein Buch wesentlich länger anschauen lässt als ein 30-Sekunden-Video auf Instagram.
Natürlich sind auch alle Stadtbewohner dazu eingeladen, sich über mit uns Landmenschen zu amüsieren und Konzepte weiterzudenken, die nicht nur unsere Bräuche erhalten sollen. Ja, auch ihr lebt – bemerkt oder unbemerkt - bestimmte Traditionen weiter, und, wenn wir ehrlich sind, sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen uns und euch ist, dass ihr fast nie nach Kuh riecht. Okay, das waren jetzt offenbar mehr als zwei Dinge, die ich mit diesem Buch aufgreifen wollte … Aber, liebe Leserinnen und Leser: Habt Spaß, und wir sehen uns wieder auf Seite 249 (siehe „Woas?! Du bist immer noch hier?“)!
Bäuerin schlägt Bauer
Kennt ihr das, wenn man gerade das Abitur hinter sich hat, einen neuen Job sucht und erst nach dreihundert Versuchen endlich auf die Idee kommt, es dort zu probieren, wo man sich eh schon wie ein melkender Fisch im Wasser fühlt? Eines Tages war es auch bei mir so weit, und da stehen wir also, in einem Melkstand, zu dritt – der junge Bauer, der alte Bauer und ich. Der junge hat mich hierhin eingeladen, denn er wird den Hof ja bald leiten. Den alten sehe ich zum ersten Mal. Und er auch mich. Ich bin die Anwärterin für den neuen Job. Für meinen neuen Job. Den Job davor habe ich aufgegeben, weil ich den Eigentümer der Pizzen, die ich zu backen und packen hatte, so langsam satthatte. Ich bin ja auch keine gebürtige Pizzabäckerin. Das hier ist was anderes. Ein Milchviehstall. Und mit Milch kenne ich mich hervorragend aus. Ich melke Kühe auf unserem Bauernhof, seit ich zehn bin, und das fast für lau. Aber jetzt reicht das Taschengeld nicht mehr aus, daher der zusätzliche Job auf einem fremden Hof.
Der alte Bauer schaut argwöhnisch auf jeden Handgriff, während ich das Geschirr der Melkmaschine ansetze und zu melken beginne. Auf die Art, wie ich es bereits seit acht Jahren tue. Auf meine Art. An einem fremden Melkstand sofort zu überzeugen ist nicht so leicht. Die Ställe sind alle unterschiedlich ausgestattet, nicht mit jedem kommt man gleich klar. Da gibt es die Side-by-side-Stände, welche im Tandem, im Karussell oder auch die weitverbreiteten fischgrätenförmigen Stände. Allein von letzteren existieren noch mal zig Unterkategorien. Und als junges Mädchen bin ich in den Augen eines traditionellen Hofbesitzers ohnehin in vielfacher Bringschuld, selbst wenn ich mich gut anstelle. Ich kann den alten Bauern geradezu denken sehen: Frau im Stall, und dann auch noch so jung – wie soll‘n dat funktionieren? Er schüttelt den Kopf. Er schwitzt, und seine grauen Haare zucken leicht hin und her – so angestrengt denkt er darüber nach, ob ich allein durch das Frausein seinen Melkstand mit falscher Handhabung zur Explosion bringen könnte. Bis er es nicht mehr aushält, entschlossen einen Schritt nach vorne macht und mich mit seinem Bauernbauch zur Seite schubst.
Ich erstarre. Was bildet der sich ein? Nein, Freundchen. Ich habe mich nicht all die Jahre gegen sechs ältere Brüder durchgesetzt, nicht meinen Vater als Dreizehnjährige davon überzeugt, dass ich sehr wohl weiß, wo sich Gaspedale auf roten Rasenmäher-Treckern befinden, und nicht deinen eigenen Sohn – den Jungbauern – bereits nach gefühlten zwölf Sekunden am Doppelsechser** melktechnisch beeindruckt, um von dir hier – vor den Augen dieser 180 Kühe – gemaßregelt zu werden! Das sage ich nicht – das denke ich nur. Und schubse zurück.Mein Körpereinsatz zeigt Wirkung: Der Bauer schwankt – und trottet zu seinem Ausgangspunkt. Wie eine Kugel, die in ihre Mulde zurückrollt. Er starrt mich an. Unendliche Sekunden lang erwidere ich seinen Blick. Ich beginne zu zweifeln: Habe ich den Nebenjob, den ich so dringend brauche, gerade fahrlässig zerschubst? Was wird dann mit meinen Festivals, Partys und dem Trecker-Diesel, wenn ich nicht im Stall arbeiten kann? Was wird aus dem kostspieligen Duftwasser, das mir dabei helfen soll, den Stallgeruch loszuwerden? Ich habe mich doch bloß gewehrt, denn ich bin im Recht. Ich kann melken!
Ich schaue, jetzt ein bisschen vorsichtiger, aber nicht minder entschlossen, den Bauern durch meine rechte Augenbraue an, mein Kinn klebt abwartend am Hals. Und er sagt nichts. Er verlässt nur schweigend den Stall. Ich atme tief ein und aus und frage mich, ob ich morgen erneut schubsen muss. Jenen Mann, der in den kommenden Monaten lernen wird, wie gut ich in meiner Arbeit tatsächlich bin, wie hervorragend meine feministische Ausmistpolitik funktioniert, und der eine Menge Gefallen an unseren gegenseitigen Neckereien finden wird.
** Variante eines Fischgräten-Melkstands, bei dem sich jeweils sechs Kühe leicht versetzt gegenüberstehen
Mit sechs älteren Brüdern zur Wrestling-Weltmeisterin
Als letzter Spross einer Bauernfamilie erblickte ich in den frühen Neunzigerjahren die schleswig-holsteinische Welt und wuchs dort mit sechs Brüdern, einer Schwester, Millionen Grashalmen und ganz vielen Kühen auf. Ich habe früh gelernt, mich zu behaupten, alles zu teilen, zu streiten und solch wichtige Dinge wie Traditionen, Werte und schnelles Fliehen aufs Zimmer zu schätzen. Und wir hatten im alten, riesigen Bauernhaus mit seinen drei Stockwerken eine ganze Menge davon. Ich habe sie nie gezählt, aber weil wir ja so viele waren, hatten wir das gesamte Haus, überall, wo es möglich war, ausgebaut. Spannend war auf jeden Fall, dass man aus jedem der Zimmer in einen Stall gucken konnte – bei mir zum Beispiel zu den Bullen und zu den Schweinen zugleich. Ob unser Vater, der sich für extrem lustig hält, das extra so geplant hat, um uns zu ärgern (er pflegte zu sagen, so könnten wir uns die Spiegel im Zimmer sparen und bräuchten nur ausm Fenster gucken), weiß ich nicht. Zuzutrauen wäre es Bauer Helmut jedoch.
Ganz unten hatten wir eine riesige Diele, die nur zwei winzige Fenster hatte, aber direkt durch eine schwere Tür mit dem Kuhstall verbunden war. Schwere Türen hatten wir überall, vermutlich, damit sie nicht so schnell durch die vielen kleinen Kinderhände, die permanent durch die Flure jagten und Türen schlugen, abgenutzt wurden. Die Türen haben die Heuer-Brut auch wunderbar überlebt, die Türgriffe allerdings nicht. Diese waren nach Jahren und millionenfachen Berührungen dermaßen abgenutzt, dass die meisten von ihnen gar keine Klinken mehr hatten. Aber ich schweife ab. Jedenfalls hatte jeder von uns ein eigenes Zimmer und ich somit sieben hinter Türen verborgene Hoffnungen auf einen täglichen Spielkameraden.
„Claas, darf ich heute mit dir spielen?“ Ich klopfte an die Tür meines viertältesten Bruders, der gerade seine Pubertät erreicht hatte und sich für eine Fünfjährige wie mich weniger interessierte als für sein zweites, eben erst gesprossenes Achselhaar.
„Sorry, Annemarie, heute nicht. Ich muss gleich noch den Stall ausmisten, und danach wollte ich lesen. Viel lesen.“ Claas war damals nicht nur für mich ein Mysterium. Er ist dieser Bruder, der schon immer ganz viel gelesen, geschrieben und nachgedacht hat. Er hat so viel gelesen, dass er irgendwann ausreichend Informationen im Hippocampus zusammengetragen hat, um daraus eine Dissertation inklusive einer selbst programmierten Software zum Thema Kuhgenetik rauszuhauen. Dieses Buch hier schreibe ich nicht zuletzt, um ihm unter die Nase zu reiben, dass seine Schwester auch wunderbar publizieren kann oder wie immer das heißt. Wenn auch ohne Doktortitel in quantitativer Genetik, aber dafür mit dem eigenen Gesicht aufm Cover – ha!
Wie auch meine übrigen Geschwister liebe ich Claas, denn neben der Leidenschaft für Schachtelsätze, deren Ursprung ich nicht genau verorten kann, obwohl ich das doch so gerne würde und auch immer wieder herauszufinden versuche, aber es klappt einfach nicht, und einst demselben Professor an einst derselben Uni teilen wir bis heute die Liebe zu Kühen. Ich trage den Duft von Kuh an meinen Klamotten, er in seinem Herzen. Genauso wie Knud, der mittlerweile den Hof unserer Eltern übernommen hat und ihn bis heute führt. In ihm, auch wenn er mein zweitältester Bruder mit zehn Jahren Abstand ist (der älteste ist nur ein Jahr älter als er), fand ich stets einen dankbaren Spielkameraden. Zumindest durfte ich immer sein Zimmer aufräumen, und das sogar komplett kostenlos. Wie nett von ihm. Die anderen waren spieltechnisch alle irgendwie immer mit ihrem eigenen Kram beschäftigt. Ja, selbst die nächstälteren, die nur ein oder vier Jahre älter waren als ich.
Zu Unterhaltungszwecken wurde ich als jüngstes Heuer-Kind (hey, mein Mädchenname hat denselben Wortstamm wie getrocknete Pflanzenmasse!) von meinen Geschwistern aber oft und gerne eingesetzt, mit hauptsächlich einseitigem Kosten-Nutzen-Verhältnis.
„Annemarie, hilfst du mir mal beim Kühe-Reinholen? Ohne dich bin ich verloren!“, war einer der Sätze, der mich kleine Schwester aufspringen ließ. Ich stiefelte dann durch den Matsch und sammelte unzählige Kühe ein, während der lieblistige Bruder bei der gesamten Unternehmung bloß das Tor schließen musste, nachdem ich mit der Arbeit fertig war. Dennoch war ich nach einer solchen Aktion bis zum verschwitzten Scheitel nicht nur voller Matsch, sondern auch Stolz. Denn ich – die kleine Annemarie – hatte meinem großen Bruder geholfen! Und ist das neben Denunzieren und Haare-Ziehen nicht genau die Funktion von den Kleineren?
Unzählige Male wurde ich schon als lütte Deern von meinen Geschwistern aufs Feld mitgenommen, wo ich dann lustige Geschichten erzählen und viel ungezwungenen Quatsch machen konnte. Während sie also die geschossenen Rüben mit der Hacke herauspulten – was wirklich harte Arbeit ist – oder die Zaunpfähle reinschlugen, hüpfte ich um sie herum und erzählte die neuesten Witze aus der „Bravo“. Also fast so, wie ich es heute auf Instagram mache. Das war eine Win-win-Situation, denn meine Brüder freuten sich über die Unterhaltung, und ich freute mich, weil es mir gelang, die anderen zum Lachen zu bringen. Und so transportierte ich quasi ungeplant meine Leichtigkeit, um ihnen ihren schweren Arbeitspart zu erleichtern. Auch heute möchte ich vor allem Freude, Sorglosigkeit und Zuversicht verbreiten (und hin und wieder einfach nur ein bisschen Quatsch erzählen), und ich hoffe, das gelingt mir bisher.
Es gab mit den vielen Brüdern aber auch echt krasse Momente, denn wir trugen unsere Konflikte grundsätzlich laut und effektvoll aus. Wenn etwa unklar war, wer den knusprigen Pfannkuchen meiner Mutter direkt von der Pfanne abernten durfte, gab es immer erst einmal lautes Geschrei: „Ich!“, „Nein, ich!“, „Du hattest schon den letzten!“ usw. Das brachte außer Stress für unsere Mutter gar nichts. Also wurde das Problem, welches wir nicht auf zivilisierte Art – zum Beispiel durch Gebrüll – beseitigen konnten oder wollten, sportlich gelöst. Beim Billard etwa. Der Billardtisch, der auf unserem Spieleboden von schlauen Experten in der Nähe einer Glastür platziert worden war, deren Lebensdauer, soweit ich mich erinnern kann, nie mehr als zwei Wochen betrug, war dafür bestens geeignet. Einen Queue habe ich in meinem Leben noch keine drei Male benutzt, das war für unser Problemlösebillard aber auch nicht nötig. Mit Wucht und lautstarken Begleitrufen schossen wir die Kugeln über den Tisch, während wir uns mit den Händen an den Banden festhielten. Ich frage mich bis heute, ob das andere Landkinder auch so machten, aber so waren bei uns die Regeln. Der Schmerz in den Fingern der Rundenverlierer sollte uns damals schon vorwarnen, wie es im späteren Bauernleben im Melkstand zugehen würde. Meine Mutter zum Beispiel hatte mit den ganzen tretenden und schlagenden Kühen sich schon so ziemlich jeden Finger ihrer melkerfahrenen Hände gebrochen.
Billard war aber nicht die einzige Variante, Geschwister-Streitigkeiten auf sportliche Art beizulegen. Auch beim Basketball, Wettsprinten, Radfahren oder an der Tischtennisplatte gaben wir vier Kleinen stets unser Bestes, um am Ende doch zu verlieren und das kleinere Schnitzel abzubekommen oder ein paar Teller mehr abzuwaschen, je nach Wetteinsatz. Die Großen, auf deren Mist solche Ideen gewachsen waren, fanden diese Lösungen demokratisch, wir Kleinen nicht. Und dennoch haben wir jedes Mal vor Aufregung gequietscht und voller Euphorie mitgemacht. Manchmal beschwerten wir uns auch und zweifelten die Rechtmäßigkeit solcher Streitlösungen an, aber das Angebot der Großen, auch dieses Missverständnis bei einer Partie Billardkugelschleudern oder einem Wrestling-Match zu entscheiden, lehnten wir, noch von den vorherigen Runden gebeutelt, meist dankend ab.
Eine der wenigen Möglichkeiten für uns Kleinere, uns gegen die Übermacht der Großen zu wehren, war Petzen, was ich einige Zeit lang oft und gezielt einsetzte. Als Henning, mein elf Jahre älterer Bruder, ungeschickterweise eine mit leckerer Käsesoße beschmierte Nudel auf den Wohnzimmerteppich fallen ließ, empfand ich es als kleine Schwester als meine heilige Pflicht, ihn sofort zu melden, auch wenn niemand danach gefragt hatte. Keine zwei Sekunden später schob er seinen Teller beiseite und rannte mir, die ich bereits in weiser Voraussicht aufgesprungen und in Richtung Kinderzimmer geflohen war, hinterher, um mich mit einem Tritt in den Allerwertesten über mein eigenes und am Morgen fein gemachtes Bett zu befördern. Auf diese Weise lernte ich nicht nur, ähnlich wie unsere Hofhühner, ein paar Meter weit zu fliegen, sondern auch, dass ältere Brüder selbst gegen das Petzen über geeignete Mittel verfügen. Als Tipp für diejenigen, die mehrere Geschwister haben, kann ich im Übrigen immer empfehlen, das älteste am meisten zu ärgern. Denn am besten lernt man immer von den Stärksten, wie mein heutiger Ehemann Martin solche Anekdoten aus meiner Kindheit zu kommentieren pflegt.
Mit Witz durch die Wand
Mein Mann ist im Gegensatz zu mir nicht mit sechs älteren Brüdern aufgewachsen und hat nicht diesen ausufernden Geschwisterkonkurrenzkampf erlebt, bei dem man sich ständig beweisen musste. Zudem habe ich selten eine solche gleichberechtigte Hofführung wie die meiner Schwiegereltern beobachtet. Wahrscheinlich ist er auch deshalb so ausgeglichen und ein derart geeigneter Ruhepol für meinen übersprudelnden Eifer in sämtlichen Bereichen. Warum meine Eltern sich damals dafür entschieden haben, sechs Söhne und nur zwei Töchter zu bekommen, ist mir bis heute ein Rätsel. Vielleicht, damit ich mit sechs Schwestern und nur einem Bruder nicht die langweiligste ruhigste Person von ganz Deutschland geworden wäre? Nein? Ja, vermutlich eher, weil sie dachten, die Ernte würde mit so vielen männlichen Kindern ein bisschen einfacher werden. Aber das wurde sie nicht. Denn der jährliche Höhepunkt einer Hofarbeit ist für alle Beteiligten ein anstrengender Job, besonders für diejenigen, die gerade Ferien haben oder zwischen den Mathematik- und Deutschhausaufgaben auch noch melken dürfen.
Ich habe diesem Umstand und auch meinen älteren Geschwistern viel zu verdanken. Das alles hat mich geprägt, der permanente Konkurrenzkampf hat mich stark gemacht. Hat mir beigebracht, dass es in diesem Leben nichts umsonst geben wird. All das hat meinen Umgang mit Geld, mein Durchsetzungsvermögen, meine Arbeitsmoral definiert, die mein heutiges Leben voller unterschiedlicher Aufgaben noch immer bestimmt. Als Bäuerin, als Ehefrau, als Mutter, als Agrarinfluencerin, als Vorträge haltende Botschafterin und als – sollte ich es tatsächlich durchziehen, dieses Buch zu vollenden – glückliche Buchautorin. All das, was ich heute nicht ohne Anstrengungen, aber routiniert leiste, ist auf meine Kindheit zurückzuführen. Um als kleines langhaariges Mädchen unter sieben älteren Geschwistern, einer starken, aber gerechten Mutter und einem liebevollen, aber permanent Sprüche klopfenden Vater am Mittagstisch gehört zu werden, habe ich schon früh nicht nur auf Lautstärke und schnelles Sprechen gesetzt, sondern auch auf Humor. Auf viel Humor. Schon als Sechsjährige habe ich unter anderem dank der „Bravo“ gelernt, welche Witze wo, wie, wann am besten zünden, und so meine aufgrund meines Alters und Größe quantitativen Defizite innerhalb der Familie durch astreine Qualität ausgeglichen. Ich lernte mich zu behaupten, ohne wie meine älteren Brüder Wrestling-Fähigkeiten einzusetzen. Nein, ich tat es auf humorige Art. Und das ist auch gut so, denn sonst würde ich heute, anstatt lustige Sketche zu produzieren, vermutlich Arschtritt-Seminare an der Kieler Volkshochschule anbieten. Dass ich in der Grundschule als eines der sportlichsten Mädchen galt und die Jungs noch im fünften Schuljahr auf dem Gymnasium bei der Klassenlehrerin reklamierten, dass ich sie in Streitfragen zu oft verprügelte, könnte allerdings ein Hinweis darauf sein, dass ich es vielleicht auch anders geschafft hätte, meiner Stimme Nachdruck zu verleihen. Aber ich wählte den Witz.
Ja, so in etwa, und das ist nur ein kleiner Auszug, bin ich mit sechs älteren Brüdern aufgewachsen. In einem Verbund, in dem nicht nur Hof-typische, Dorf-typische und modifiziert christliche, sondern auch in gewisser Form strukturiert konservative Traditionen vorherrschten. Sie bestimmten alters- und geschlechtsunabhängig nicht nur unser aller damaliges Leben, sondern formten uns dermaßen, dass sie bis zum heutigen Tage größten Einfluss auf unsere wichtigen und weniger wichtigen Entscheidungen nehmen. Auch in unserer Kindheit haben wir, selbst als kleine heranwachsende Hirne, nicht nur blind drauflosgestritten, sondern immer die Fairness gesucht und diese, sooft es ging, dem verrückten Entscheidungswettstreit beim Billard, Tischtennis, Basketball und Wrestling vorgezogen – das haben unsere Eltern uns so beigebracht. Beispielsweise durfte immer der- oder diejenige die neue Couch fürs eigene Zimmer zuerst aussuchen, der oder die das kleinste Zimmer bewohnte. Derjenige, der an dem Tag den härtesten Job auf dem Hof übernommen hatte, durfte das größte Schnitzel essen. Und diejenige durfte die coolen Sticker aus der „Bravo“ mopsen, die am lautesten nerven konnte. Das war dann meistens ich. Nur wenn es keine äußeren Umstände gab, die Einfluss auf die Verteilung gehabt hätten, wählten wir Billardkugelschleudern und Co.
Eine Leidenschaft ist besser als 3000 Jobs
Für unsere Mitarbeit auf dem Hof, im Garten oder beim Scheren der Angorakaninchen, dem Lieblingshobby meiner Mutter, bekamen wir Kleinen eine Ausgabe der „Bravo“ geschenkt, die uns nicht nur in Sachen Arbeitslohn aufklärte. Später kam dann tatsächliche Bezahlung für Hofarbeit hinzu. Wir durften, wie man es aus Erzählungen der Stadtkinder kannte, deren Eltern in Großraumbüros arbeiteten, Stundenzettel ausfüllen und fünf Euro pro Stunde kassieren. Weil wir aber ein gewöhnlicher Landwirtschaftsbetrieb waren, der neben unzähligen Kühen auch noch etwas weniger unzählige Kinder durchzufüttern hatte, war das bezahlte Stundenkontingent streng limitiert. Wir hatten also eine maximale Anzahl von Arbeitseinheiten, die wir den kapitalistischen Bauern – meinen lieben Eltern – in Rechnung stellen durften. Anfangs war das toll und eine ausgesprochen gut funktionierende Motivation für die anstrengende Hofarbeit, aber irgendwann, als die ersten Konzerte, Festivals und weite, kostspielige Autofahrten anstanden, suchte ich externe Jobs. Ich arbeitete bei IKEA, in einer Pizzeria und später auch auf anderen Höfen. Bei IKEA in der Lagerlogistik konnte ich meinen zu Hause erlernten Umgang mit einer Männerdomäne hervorragend einsetzen. Bereits nach wenigen Tagen war ich mit der nahezu ausnahmslos männlichen Belegschaft per Du, nicht nur wörtlich, sondern auch im Geiste. So sehr, dass mich die Lagerleitung nach meiner späteren Kündigung nicht gehen lassen wollte und mit einem attraktiven Angebot lockte. Aber mich zog es doch immer wieder zu den Kühen. Und da mein IKEA es zumindest zu meinen Lebzeiten nicht vorhatte, einen Melkstand in die Produktionsprozesse aufzunehmen, blieb mir nichts anderes übrig, als dort hinzuschmeißen.
In der Pizzeria, in der ich stattdessen fast fünf Jahre lang arbeitete, wurde auch nicht gemolken, und so landete ich schließlich auf dem Hof bei Bauer Heinz. Jenem Bauern, der im Schubsen noch schlechter war als darin, bei unserer ersten Begegnung sein seit Jahrzehnten vorherrschendes Rollenbild auf dem Hof aufzugeben. Obwohl ich meinen Job an einem mir fremden Melkstand sehr gut machte, und das direkt von Anfang an.
Ich verstehe Bauer Heinz aber gut. Besonders im fortgeschrittenen Alter fällt es Menschen nicht leicht, sich mit – für sie vielleicht im ersten Moment alarmierenden – Veränderungen zu konfrontieren. Menschen, die ihr Leben lang, ohne es wertend zu meinen, strukturell festgefahren gelebt, den Hof über Jahrzehnte hinweg immer auf dieselbe, für sie funktionale Weise geführt und die Gebräuche, die Traditionen von ihren Vorvätern übernommen haben. Und wer bitte sind wir, dass wir uns einbilden wollen, schlauer zu sein als die zig Generationen vor uns? Aber, und das ist ein gewichtiges Aber: Es gibt Möglichkeiten, sowohl die Traditionen unserer Ahnen zu erhalten als auch unsere Modifikationen darin einzuweben. Mehr noch: In vielen Fällen ist diese Metamorphose sogar überlebensnotwendig. Denn auch wenn wir Menschen im Allgemeinen uns nicht essenziell verändert haben mögen und unsere Grundbedürfnisse noch dieselben wie die unserer Ururgroßmütter sind, haben mindestens der technische Fortschritt und das gesamtgesellschaftliche Upgrade Rahmen geschaffen, in die teils jahrhundertealte Traditionen gepresst werden müssen. Nicht, um sie bis zur Unkenntlichkeit zu verändern und sie somit in die Irrelevanz abzuschieben. Nein, ganz im Gegenteil: um sie zu erhalten. Wir müssen also etwas ändern, wenn wir wichtige Traditionen behalten wollen.
Bauer sucht Frau — Mein Weg zum neuen Hof
Martin habe ich während meines Studiums der Agrarwissenschaften kennengelernt, natürlich auf einem Hof, wo auch sonst? Er machte seine Ausbildung in dem Betrieb, in dem ich nebenher jobbte. Und wenn man ein halbes Jahr am selben Melkstand verbracht hat, ist eine daraus entstehende Liebesbeziehung nur noch eine Frage der Zeit, lautet eine Bauernweisheit, die ich soeben erfunden habe. Das passierte dann auch uns, gegen Ende meines Studiums, und es war diese eine glückliche Schicksalswendung, die mich von einem Bauernhof auf den nächsten katapultierte. Denn das Studium selbst hatte ich schnell und mächtig satt. Aber dazu später mehr.
All das war nicht ganz so vorhersehbar, wie es sich heute anhört. Bevor ich Martin traf, hatte ich über Jahre gezweifelt, ob das, was ich bis dahin studiert, gedacht und gehofft hatte, überhaupt das Richtige wäre. Dass ich den Hof meiner Eltern nicht übernehmen würde, war von Anfang an klar, da hatte ich mir nie Illusionen gemacht. Als Jüngste hätte ich sieben Menschen bestechen müssen, um den Hof zu erben. Das waren drei Familienmitglieder mehr, als es bei Prinz Harry sein müssten, wollte er den Thron heute besteigen. Wer soll denn das bitte schaffen? Also stand es vollkommen in den Sternen, ob ich jemals einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten würde. Zudem war mein damaliger Freund ebenfalls angehender Akademiker und konnte sich seine Zukunft auf einem Bauernhof nur dann vorstellen, wenn er irgendwann als Kuh wiedergeboren würde.
Wozu studierte ich dann überhaupt, was ich studierte? Der Gedanke machte mich fertig, und ich zweifelte, ob es überhaupt eine gute Idee gewesen war, diesen Fachbereich gewählt zu haben. In meiner Hilflosigkeit rieten mir meine Eltern sogar, auf die Fachhochschule zu wechseln, weil es dort, wie sie fanden, praktischer orientierte Studierende gäbe, die einen Bauernhof auch schon mal von innen gesehen haben dürften. Ich bedankte mich für den Ratschlag, blieb jedoch an der Uni. Hoffte aber bei jedem Heimatbesuch am Mittagstisch, wenn mein Vater mal wieder zu einem längeren Monolog ansetzte, dass er mir nun nicht verklickern wollte, mich bei „Bauer sucht Frau“ angemeldet zu haben.
Solche Sendungen gibt es immerhin nicht umsonst. Hoferbe, Nachfolge und ähnliche Fragen haben für Bauern eine ganz besondere Bedeutung. Und das liegt nicht zuletzt an den traditionellen Strukturen, die solche Regelungen seit Generationen bestimmt haben. Noch bis vor Kurzem wäre es undenkbar gewesen, seinen Hof einer Tochter zu überlassen oder einem Sohn, der, sagen wir mal, in wilder Ehe lebte oder so. Blieb man als Bauernsohn zu lange Single, wurde man nicht nur von den übrigen Dorfbewohnern kritisch beäugt, sondern auch von den eigenen Eltern, die mit schöner Regelmäßigkeit auf den Missstand hinwiesen. Dann wurde ein unverheirateter dreißigjähriger Bauernspross von den Eltern schon mal gezwungen, auf fremden Hochzeiten wenigstens den Strauß zu fangen, um mal einen Anfang zu machen. Zu groß war die Sorge der Eltern, den Hof in den nachfolgenden Generationen zu verlieren. Dieser gesellschaftlichen Schande wollte man sich als stolzer Landwirt nicht aussetzen.
Heute sieht man das Ganze entspannter, und bei mir ist ja damals alles gut ausgegangen. Ich hatte meinen Martin samt Heiratsplänen noch vor dem Uni-Abschluss in der Tasche.
Und obwohl wir beide denselben Studiengang absolviert haben, gehört der Hof offiziell meinem Mann. Ja, so ungerecht ist die Bauernhof-Genderverteilung in Deutschland, wenn der eigene Mann der Sohn seines Vaters ist. Genauer gesagt wurde der Hof in der Uckermark erst dieses Jahr von seinem Vater auf meinen Mann überschrieben. Eine Tradition – eine männliche Tradition, wenn man so will. Aber auf die Rollenverteilung auf dem Bauernhof komme ich später noch ausführlicher zu sprechen.
Die schöne Uckermark
Als Martin mir damals erzählte, dass Merkel und er aus der Uckermark kämen, wusste ich überhaupt nicht, was er damit meinte.
„Das Wort hast du doch gerade erfunden, oder?“
„Was, ‚Uckermark‘? Nein, die gibt es wirklich. Es ist eine historische Region im Nordosten Deutschlands, die sich hauptsächlich im Bundesland Brandenburg erstreckt. Die Uckermark war im Mittelalter umkämpft und wechselte mehrfach die Herrschaft zwischen den Markgrafen von Brandenb…“
„Halt!“
„Was?“
„Wieso hörst du dich bitte an wie Wikipedia? Willst du mich beeindrucken oder was?“
„Ja.“
„Brauchste nicht. Ich find dich auch so gut.“
„Okay.“
Martin und ich lernten uns ja im Melkstand kennen. Bei dem Betrieb, bei dem ich neben dem Studium arbeitete und er sein erstes Lehrjahr machte. Mehr noch: Martin war sogar mein Lehrling damals. Jeden Nachmittag haben wir zusammen gemolken und täglich drei Stunden geschnackt. Nach einem halben Jahr – ihr ahnt es schon – kam dann die Liebe. Wie in einem guten bis sehr guten Schnulzendrehbuch, nicht wahr? Na ja, und dann sind wir irgendwann natürlich auch seine Familie besuchen gefahren.
Kennengelernt habe ich die beiden Schwiegereltern schon vorher – auf einer Rinderschau, wo sonst. Das ist so eine Art Schönheitswettbewerb, nur mit Kühen. Die werden da alle gestriegelt, gewaschen, gekämmt und zum Betrachten zur Schau gestellt. Fast so, wie es bei den Menschen abläuft, nur ohne Wettbewerbe mit nassen T-Shirts. Obwohl ja genug an Eutern vorhanden wäre. Rinderschau – Sachen gibt es …
Jedenfalls fand ich das damals ziemlich passend. Denn mich konnten seine Eltern gleich mal schön mit betrachten. Und als wir dann zum ersten Mal in der Uckermark ankamen – das war mitten in der Nacht (wegen der Zeitverschiebung Richtung Osten; Spaß, wir haben einfach aus Zeitnot so geplant) –, konnte ich den Hof da im Dunkeln nur ein bisschen erahnen. Aber das war schon beeindruckend. Am nächsten Morgen kriegte ich meinen Mund kaum noch zu, denn da sah ich erst den gesamten Hof. Als alte Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG), ein Begriff aus DDR-Zeiten, war das für meine Verhältnisse ein Riesengelände. Man konnte nicht einmal das Wohnhaus zwischen den Ställen erkennen, weil es ursprünglich auch gar nicht als Wohnhaus geplant war. Das war anfangs seltsam, kannte ich aus Schleswig-Holstein doch nur diese süßen, teilweise chaotisch nach links, rechts, oben und unten ausgebauten Bauernhäuser mit den Ställen daneben. Hier wirkte alles geordnet. Hier wirkte alles geplant. Als hätte hier jemand Planlandwirtschaft betrieben, haha.
Alle Bauten standen in eine Himmelsrichtung ausgerichtet, überall war ganz viel Beton und nicht ein einziger Backstein, die ich seltsamerweise viel doller vermisste als nötig, denn mein Geburtsbauernhaus war voll davon. Die Größe des Betriebs haute mich ziemlich um, und ich erahnte, wie immens die Strukturen in der DDR gewesen sein müssen. Hier hätten wir massenhaft Platz für alles – das hätte ich gedacht, wenn ich damals schon gewusst hätte, dass wir diesen Hof eines Tages mal übernehmen würden. Und dass es mit Martin und mir immer ernster werden würde. Die alten Hofstrukturen kann man übrigens im ganzen Dorf noch erkennen, doch die meisten wurden bereits längst zu irgendetwas anderem umfunktioniert.
Den allerersten Tag in der Uckermark begann ich damit, mir die Umgebung ein bisschen genauer anzuschauen (man weiß ja nie, ne?), und endete Reifen schleppend am Silo. Davon war ich selbst total überrascht, aber jetzt wurde mir auch klar, warum Martin mir vorher gesagt hatte, ich solle ein paar Arbeitsklamotten einpacken. Offenbar ist es im Osten Tradition, die künftige Braut des Sohnes noch vor dem allerersten Abendessen auf ihre Reifenschleppfähigkeiten zu testen. Das war schon ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, aber irgendwie auch in Ordnung. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn meine älteste Tochter eines Tages ihren ersten ernsten Macker anschleppt, werde ich ihn direkt zwingen, ‘ne Kuh zu besamen. Auch wenn er aus der Stadt kommen sollte. Boah, war das jetzt doppeldeutig. Also, ihr wisst, wie ich das meine.
Jedenfalls war ich geschockt von der Schönheit der Gegend. Der riesige Hof. Die weiten Wiesen, alle voll mit Kühen. Der Ort ist ein wenig höher gelegen, und so konnte ich vom Hof aus den Uckersee sehen. Und das Wasser reflektierte die Sonne, sodass sie mir direkt ins Gesicht schien. Wahnsinn. Auch dieses Klima. Ganz anders. Ich weiß, das klingt jetzt bescheuert, aber die Wolken sahen irgendwie … dreidimensionaler aus. So plastisch.
Das mit dem Klima sagen selbst meine Eltern, wenn sie uns heute besuchen kommen. Mein Vater meint dann immer, es würde sich hier gar nicht lohnen zu rauchen. So gut ist die Luft, dass man jeden Atemzug horten sollte. Es ist heißer hier und auch trockener als in Schleswig-Holstein. Daher bauen wir auch Luzerne an, als Grünfutter für unsere Kühe. Wir haben zwar auch Weidegras von der Stange, aber das würde wegen der Trockenheit niemals über den Winter reichen. Und wir sind so dankbar für diese Luzerne. Sie ist für unsere Zwecke eine Wunderpflanze, und dann ist es auch noch eine Leguminose dazu. Also eine Hülsenfrüchtlerin quasi. Das heißt, sie bindet den Stickstoff aus der Luft und fixiert ihn im Boden, wodurch er wesentlich fruchtbarer wird. Das ist für einen Biohof wie geschaffen. Eine geniale Erfindung von Gott. Oder halt von Darwin. Je nach Glaubensrichtung.
’n Abend, Mädchen, wer bist’n du?
Jetzt lebe ich schon seit 2021 in der Uckermark und fühle mich angekommen. Zwar bin ich noch vollkommen orientierungslos und frage mich permanent nach dem Weg durch (also hauptsächlich bei Google), aber ich fühle mich hier zu Hause. Das erste Jahr allerdings war richtig schwer. Ich hatte noch häufig Heimweh und war einfach traurig, dass ausgerechnet Martins Eltern einen Hof in der Uckermark haben mussten. Ich wette, Joachim Sauer, Angela Merkels Ehemann, hätte ähnlich empfunden, hätte er die Ex-Kanzlerin im Melkstand kennengelernt und wäre zu ihr in die Kirche gezogen. Ihr Vater war, glaube ich, Pastor, oder? Die leben ja vermutlich in Kirchen.