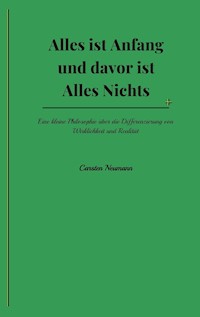
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist immer ein Suchender. Und hat er all das Banale, das Streben nach Glück und Verwirklichung erst einmal abgestreift, so bleibt die Suche nach Wahrheit, die ihm übergeordneten Sinn verspricht. Und so lange es Menschen gibt und solange Menschen frei denken können und so lange Menschen denken wollen, solange werden sie suchen nach Erzählungen, nach Glauben, nach Lehren und Weisheiten, die diese Wahrheit darlegen. So ist auch dieses Buch ein Weg zur Wahrheit, der, wenn er begangen wird, denjenigen den Schmerz lindert, die noch immer nicht gefunden haben. Die sich in ihrem Werden unberührt vergehen sehen, da sie überzeugt sind, noch nicht das Wesentliche erkannt zu haben. Das, was den Suchenden in diesem Buch gereicht wird, ist die Tiefe einer neuen Metaphysik, eines Versuchs, näher an den Grund unserer Existenz zu gelangen. Die Grundthese darin ist verblüffend, denn sie betrifft eine Begrifflichkeit, die uns in unserer Unterscheidungsfähigkeit zweifeln lässt, nämlich, es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit, zwischen dem Unbestimmten und dem Konkreten, dem "Ohne Selbst sein" und dem Selbst. In der geistigen Nische erst wird das Selbst mit den unbestimmten Bezügen, den noch nicht festgelegten Möglichkeiten von Realität, bekannt gemacht, um daraus neue Wirklichkeit zu schöpfen. Begriffe wie Energie, Raum und Zeit haben auf diese Weise eine Bedeutung nur für unsere Existenz, genauso wie Geburt, Leben und Tod. Aber auch Vielfalt und freie Gedanken können Grundlagen neuer Wirklichkeitsmodelle werden, die uns und die Anderen in die Zukunft entwickeln. In eine Zukunft, die immer aus Realität heraus gestaltet werden kann, aber nicht muss, denn Bedeutung erlangt Zukunft erst in unserer Wirklichkeit für das, was wir darin Leben nennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Wirklichkeit und der Widerspruch zum Fremden
Ein Versuch zur Beschreibung von Realität
Der Zugang zu Realität
Die geistige Nische oder Wie der Mensch sich seine Zukunft denkt
Über die Praxisrelevanz des Wirklichmachens von Welt
Die Bedeutung von Vielfalt auf Erden
Philosophische Betrachtungen zum Werden und Vergehene
Die anderen Leben im Anblick von Realität
Die Ahnung vom Mehrsein
Ausklang
Prolog
- Ich sehe zuerst. Danach begreife ich schnell. Ich will im Dunkeln erinnern, als wäre es hell. -
Nun hatte es mich endlich eingeholt, das Grollen im Himmel, dessen Echo im Rauschen eines fernen Windes widerhallte und sich zu mir am Boden erweiterte, als malten die Töne an den Bildern eines aufkommenden Sturmes für mich, der da weilte am Grunde einer warmen Sommernacht. Über mir flackerten helle Lichter hinter dunklen Wolken. Alles wurde unruhig. Die Nacht ward in laute Bewegung versetzt. Ich saß unter dem kleinen Dach auf der Treppe vor unserem Haus und blickte geradeaus über die Mauer, die unseren Besitz begrenzte, auf die dahinter liegende Dunkelheit. Und während das Spektakel hinter mir aufzog, sich über mir stärkte, aus der Umgebung den Donner formte, um sich schließlich in das weite Dunkel hinter der Mauer kraftvoll einzuschreiben, blieb ich sitzen und blickte gespannt hinein in diese Szene, deren aufgeregte Veränderungen mich mit hinaustrugen. Es ist merkwürdig: Das, was wir unser Werden nennen, die unzähligen lebendigen Bewegungen an unseren Orten und die kleinen Ereignisse in den vielen Augenblicken unserer Zeit, entzieht sich leicht der Aufmerksamkeit, geht vorüber, läuft einfach ab in starren Bildern aus bekannten Zusammenhängen und erinnerten Erwartungen, als könnten die Bilder auch ohne uns sein. Als könnten sie eine ewige Geschichte erzählen, in der wir auftauchen und vergehen, so wie wir uns schon immer daran erinnerten. Nur wenn wir plötzlich innehalten, unseren Lauf unterbrechen, uns weigern, zusammen mit unseren Bildern zu vergehen, wenn wir heraustreten aus der eigenen Szene, ja, dann können wir getragen werden, hinaus aus unserer Geschichte. Wir können unsere Zeit nach außen fokussieren, in einem Augenblick mit ihr hinausgehen, ohne uns zurückdenken zu müssen, und trotzdem sein, in einer Szene, in der es keine Erwartungen mehr gibt, weil wir nicht mehr mit unseren Bildern fortlaufen, sondern nebenherlaufen, als ungebundene, sich selbst vergessene Einsicht. Dann, wenn wir weggetragen wurden, sind wir in einem „Davor“, wurde Einsicht vor uns ausgelöst, bevor wir Anfang wurden und bevor wir einen Bezug herstellten, zu uns und unseren Erwartungen, die wir aus alten Bildern erinnern. Es scheint, dass immer nur das Alltägliche, das Bekannte, Gewollte und Gemusste einfach und erwartbar mit uns abläuft. Dass wir zwar einem Schauspiel beiwohnen, dieses aber oberflächlich für uns ist, da wir stets aus bekannten Bildern schöpfen. Und jedes Leben könnte ganz einfach immer nur aus den vorüberziehenden Bildern aufgebaut sein, aus Erwartungen und fernen Hoffnungen, ohne je eigene Tiefe zu erlangen. Ohne je seiner Existenz etwas Schärfe hinzuzufügen. Ja, dieses Leben wäre dann ein individuelles Leben, das vergeht, ohne sich der Welt jemals vorgestellt zu haben. Wenn wir nicht merken, wie der Himmel mit uns vorüberzieht, während wir uns aus dem alltäglichen Bilde formen, dann werden wir nicht mitgenommen. Dann ist die Welt immer nur das, was wir von ihr erwarten. Wir existieren dann einzig als die zurückgebliebene Instanz unserer Geschichte, als diese erzählbare Persönlichkeit vom Anfang bis zum Ende eines, nämlich unseres Lebens. Eines Lebens, das sich selbst veranschaulicht hat. Doch Leben scheint nicht für den Vorübergehenden gemacht. Leben scheint geradezu zu warten auf einen gelösten Blick hinein ins Leben und für das Leben, weil die vielen Szenen der anderen Leben die Erkenntnis von Leben bereithalten, und zwar für den losgelösten Beobachter, der Leben entblößt, in einem Augenblick gänzlich freistellt, in dem sich das Leben dann bereitwillig in lebendiger Fülle mitteilt. Die einzige Forderung hierfür scheint dieser freie Blick zu sein, frei von den Bedingungen des Beobachters, seinem Werden und seinen Erwartungen, und frei für die Aufmerksamkeit des Innehaltens. Daher soll die Aufforderung für die Werdenden heißen: „Verweilt in den Augenblicken, schaut hinein, lasst euch mitnehmen und erkennt eure Bezüge aus den Anfängen erst, aus dem, was sich tatsächlich vor euch befindet. Es ist nicht der Weg, der euch führt, nicht die Allee, die euer Gehen in bekannten Grenzen einrahmt, und auch nicht der Wind, der euch dabei entgegensteht. Es ist das Blatt, das just zu Boden fällt, sich am Wegesrand verfängt, um Teil einer kleineren Welt zu werden, einer Welt, die auch beobachtet werden kann und sich ungezwungen zu euch neigt, wenn Ihr euren Blick nach ihr richtet.“ Wer lange verweilt und damit bereit ist, seinen Blick vom Alltäglichen abzuwenden, seine Erwartungen – wenn auch nur kurz – aufgibt, wird Aufmerksamkeit gewinnen, Aufmerksamkeit für das Lebendige um sich herum, als dessen Teil man seine Hand ausstreckt, weil man es berühren kann. Er wird überrascht von den vielen unbekannten Gedanken, die dann aus Leben an das eigene Leben herangetragen werden. Derjenige, der aufmerksam verharrt, wartend seiner Umgebung beiwohnt, wird plötzlich mehr erkennen als den täglichen Ablauf seiner bekannten Bilder. Ein langer, ruhiger Blick in weiter Aufmerksamkeit erzeugt Offenheit für neue Vorstellungen, die selbst genau dort zu erwarten sind, wo schon tausende Male zuvor geschaut wurde. Und ich frage mich, ob es die verborgenen Erscheinungen sind, die um uns herum existieren und die wir erst aus neuer Offenheit erblicken, sie für uns entdecken können und dadurch erst zu tiefen Einsichten gelangen. Oder ob da, an den Augenblicken neuer Aufmerksamkeit, zuerst freie, ungebundene Gedanken sind, die wir aus fremden Szenen einfangen, da sie zu uns als lebendige Strukturen in großer Vielfalt streben, wenn wir die Erwartungen an unsere Bilder aufgegeben haben?
So sah ich plötzlich, wie sich das Flackern zwischen den Wolken in feine Verästelungen aufgliederte. Ich sah, wie Licht, Bäumen gleich, am Himmel wuchs, sich ausbreitete, in kleinen hellen Verzweigungen sich immer feiner erweiterte, bevor es wieder dunkel wurde. Und plötzlich erkannte ich Konturen am Horizont. Ich sah dunkle Schatten von Bäumen und jede Verästelung in den Wolken führte nun zu neuen Gestalten in der Weite hinter unserer Mauer. Es gab da formlose Schatten und bekannte Muster. Dann, unvermittelt, leuchtete der Himmel noch einmal heller auf als zuvor. Ein neuer Himmelsbaum füllte das gesamte Firmament, so weit ich blicken konnte, und warf einen hellen Schein über den weiten Erdenausschnitt, der zuvor für mich in der Nacht verborgen gelegen hatte. Und was ich sah, kannte ich. Gelbe Felder, auf denen Ballen abgeernteten Strohs lagen, verteilt in kleinen Paketen in den Hügeln des Hintergrundes. Grüne Baumkronen, in einer Reihe den Horizont querend, wohl einer Straße folgend. Darüber der aufgewühlte Himmel aus grauen Wolken, deren Bewegungen sich niederließen, die Felder zu ertasten schienen, um den Rahmen einer ländlichen Szenerie von oben ständig neu zu definieren. Jeder Himmelsbaum durchbrach die stürmische Nacht und schuf die heißen Sommerfelder des Tages, die für einen kurzen Moment ganz leise in der Szene ruhten. Hinter der Mauer, da lag beides ohne mich im Wandel des Lichtes, in den mannigfaltigen Abstufungen der Himmelsbäume, den hellen und dunklen Erscheinungen, getrieben vom Donner und in kurzer Ruhe der knisternden Tageshitze. So akzeptierte ich erst auf der Treppe, als ich bei mir war, dass ich mich an meinen farbigen Tag in der Nacht erinnerte und dass es so sein muss, dass das Eine vor dem Anderen kam.
Ich glaube nicht daran, dass die Welt das Eine oder das Andere ist. Dass der Tag aus Nacht erwächst und sich darin niederlegt. Ich glaube nicht daran, dass die Welt aus Erinnerungen besteht. Dass Gesehenes in der Nacht von Wahrheit zeugt, in bekannten Bildern unsere Geschichte erzählt. Es gibt einen Grund für das, was wir den Tag und die Nacht nennen. Einen Grund, der ohne uns ist. Der unsere Szenen entstehen lässt und zurückbleibt, wenn wir als Menschen wirken, um sie auszumalen. Es ist der Anfang, der eine erste Verbindung zum Inhalt fremder Szenen und dann zu uns als Beobachter herstellt. Denn wir alle haben diesen anfänglichen Bezug zu dem „Davor sein“, bevor wir uns als Werdende verstehen. Und wir werden dunkel, egal wie farbenprächtig wir uns auch erinnern mögen, denn wir haben ein Bedürfnis, uns nach Wahrheit aufzulösen, aus dem Erinnern endlich herauszukommen, um auch Anfang zu sein. Es also der Existenz gleichzutun, nämlich bedingungslos und in allem, was ist, zu wirken, und das immer und viele Male nicht aus Erinnerungen, sondern aus den Anfängen heraus. Nach nichts anderem strebt ein Selbst, wenn es nach Wahrheit sucht. Es ist nicht der kurze Sinn in bekannten Bildern, die im Licht erscheinen. Nicht die hellen Eigenschaften des Selbst, nicht die Beziehungen, die es eingeht und die daraus folgenden Abläufe aus erfüllten und unerfüllten Erwartungen. Die Ereignisse des Lebens selbst sind bedeutungslos, die Erscheinungen beliebig und die in uns errungenen Stimmungen irrelevant. Sie wollen sich uns im Wechsel der Zeiten vorstellen. Es sind die Konsequenzen von Leben! Doch das wahre Selbst strebt nach Erkenntnis darüber hinaus, nach den Anfängen, den neuen Bildern und vergessenen Augenblicken. Das wahre Selbst sucht nicht nach den Konsequenzen seiner Existenz. Es braucht keine Entwicklungen, um sich darin zu erkennen. Keinen Verlauf bekannter Bilder, um eine Geschichte zu sein. Das wahre Selbst sucht nach dem Grund seiner Existenz. Nach den Brücken, die Tag und Nacht vereinen. Nach den Möglichkeiten, im Dunklen zu sein, ohne sich an Bilder erinnern zu müssen. Und ich vertraue darauf, dass unsere Suche einen Sinn hat. Dass wir verstehen können, auch für uns, obwohl wir zuerst ohne uns sein müssen. Wir können die vielen Moment dort draußen erfahren, ohne sie allzu wichtig zu nehmen, ohne uns selbst immer wieder an Bilder zu binden, ohne damit unsere Geschichte erzählen zu müssen, ohne uns immer nur zwischen Anfang und Ende zu denken. Ich will mitgenommen werden, mich nicht trennen von den dunklen Erscheinungen. Ich will den Anfang stimmen, ihn schwingen lassen am Grund unseres Seins, schon vor dem Licht den Donner erkennen. Will verstehen, wie wir Bilder malen, bevor wir daran glauben, denn nur wenn wir es wollen, dann erst werden wir wirken und uns daran erinnern, an die vielen farbigen Landschaften im gewittrigen Schein der Himmelsbäume in den lauen Sommernächten unseres Daseins. Davor aber müssen wir Anfang sein, unbeschrieben und frei, von uns gehen können, damit es ein „Zurück“ geben kann, dorthin, wo wir einst saßen, den Himmel über uns beobachteten und uns verloren in der bewegten Nacht.
Wirklichkeit und der Widerspruch zum Fremden
- Ein Bild verändert dich. Es hat dich erkannt. Später einmal, in anderem Licht, ist’s dir bekannt. –
Ich möchte eine Unterscheidung vornehmen zwischen Wirklichkeit und Realität, denn Dinge, die wir außerhalb von uns berühren, und Vorstellungen, die wir in uns denken, sind wirklich. Sie sind jedoch nicht real, denn Realität ist unbestimmt und daher weder fassbares Ding noch denkbare Innerlichkeit. Realität existiert unabhängig von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist dann auch nur ein Begriff, den der Mensch in seiner ganz eigenen Existenz neben sich schaffen konnte. Realität aber existiert überall und kann daher nie als Begriff oder gar Ort gedacht werden. Trotzdem ziehen wir die Erkenntnis über Wirklichkeit aus der Realität. Wir können Wirklichkeit beschreiben. Und diese Wirklichkeitsbeschreibung hat einen Ursprung, eine Grundlage, die nicht wir sind und die auch nicht das ist, was wir beschreiben. Woraus wir sind und wohin wir gehen, war nie wirklich gewesen. Das Woraus und das Wohin beschreiben keine wirklichen Orte, sie beschreiben etwas Singuläres, das sich auf Realität bezieht. Die Wirklichkeit jedoch existiert als vorstellbarer Ort außerhalb des Menschen, als Ort der Erscheinungen. Als diese sichtbare Interaktion, in die der Mensch eintritt, wenn er Erfahrung an sich erlebt und den Impuls wahrnimmt, Vorstellung in sich aufzubauen. Wirklichkeit ist auch der Ort, der Mensch selbst ist. Es ist dieses „In etwas sein“ oder „An etwas geschehen“, dieses Etwas, das der eine Teil von Interaktion ist. Dieses Etwas ist Mensch und daher begrifflich in Eigenschaften des Menschseins gedacht. Und da der Mensch sich nun in Begriffen nennt und Begriffe Wirklichkeit sind, so ist der Mensch auch wirklich. Wir können daher sagen, der Mensch ist in Wirklichkeit. Oder, der Mensch wird aus Wirklichkeit gebaut und denkt dann darüber nach. In diesem Falle ist Wirklichkeit spezifisch. Sie kennzeichnet den Menschen und sich selbst über erst einmal scheinbar eindeutige Entitäten, die wir begrifflich fassen. Wirklichkeit koexistiert also mit dem Menschen. Aus dieser Existenzform folgt eine erweiterte Erkenntnismöglichkeit. Der Mensch kann nun alles über Wirklichkeit erkennen, denn er ist auch selbst Wirklichkeit. Nicht etwa bloß als unvollständiger Teil einer Welt aus anderen wirklichen Dingen. Nein, der Mensch ist das, was er beschreibt. Er muss aus genau denjenigen Konzepten bestehen, die Begriffe in ihm hervorrufen, denn zuerst muss sich der Mensch als Mensch von einem Außen trennen, sich über die äußeren Mittel konzipieren, ja, passend gemacht werden. Und erst danach kann das verinnerlichte Äußere, das dann Mensch heißt, weitere Begriffe des Außen aufstellen. Der Mensch ist also nicht unbestimmt. Er ist dieser Ort, der zuerst im Außen war, bevor eine Innerlichkeit entstehen konnte. Der Mensch ist bereits als diejenige Wirklichkeit gedacht, die er später beschreiben wird. Er beschreibt also sich. Zumindest kann er eine vollständige Erkenntnis über die ihn umgebende Wirklichkeit erwarten, denn so wie er ist und so wie er beschreibt, so muss es die Dinge geben, die ihn beschreiben lassen, aus denen er also aufgebaut ist. Hier tritt der Mensch immer gleichzeitig als Subjekt und Objekt auf. Es braucht keine sekundäre Instanz, keine Gemeinsamkeit wie Wille oder Geist, um eine tiefere Verbindung zwischen dem Beobachter und dem Ding herzustellen. Beides ist bereits als Teilaspekt einer gemeinsamen Form der Weltwahrnehmung, nämlich der Wirklichkeit, vorhanden. Wirklichkeit umfasst denjenigen, der beobachtet und gleichzeitig das Beobachtete erst als wirklich beschreibt. Sie ist die eigentliche Verbindung, die es braucht, um unserem Selbst eine tiefe Vorstellung vom Anderen zu geben, wobei auch das Andere diese Verbindung teilt und als Beziehung auf uns zurückwirft. Ich erkenne erst, wenn auch etwas auf mich zurückgeworfen wird und mich dadurch in Beziehung zum Anderen stellt. Da das Andere in diesem Falle jedoch immer meiner Definition von Wirklichkeit entspricht, der auch ich entspringe, habe ich die Vermutung, dass ich im Anderen nichts generell Unbekanntes erblicken kann, sondern immer den Teil von mir, der in Beziehung tritt, in Beziehung zur Welt, von der die Vermutung besteht, dass sie uns umgibt. Wirklichkeit besteht also nicht bloß als Vorstellung von etwas da draußen in uns, sondern ist der Blick von uns in uns zurück. Alles, was wir erblicken, ist genauso aufgebaut wie wir. Was ich betrachte, kann daher immer auch ein Teil von mir sein. Das kommt nicht etwa daher, weil eine grundlegende mich umgebende Realität so aufgebaut ist wie ich, sondern weil ich mich selbst zuerst aus Wirklichkeit denken muss, bevor ich mich und das, was ich beobachte, beschreiben kann. Mein Denken ist Wirklichkeitsdenken. Es hallt in den Beziehungen von Wirklichkeit und wird ständig zwischen mir und den Anderen reflektiert. Es gehört zu mir, genauso, wie auch ich zur Wirklichkeit gehöre.
Nun aber kann dieses Verhältnis vom Selbst im Wirklichkeitssein tatsächlich über bleibende Beziehungen aufgelöst werden, nämlich dann, wenn wir uns in den vielen Pfaden der Reflexionen verlieren und nicht mehr wissen, wer denkt und wer das Ziel von Gedanken war. Genauso wie sich der Mensch zuerst in diese Wirklichkeit denken musste, um von sich ausgehend seine Weltbeschreibung zu entwerfen, sein Wirklichkeitsmodell weiter zu konzipieren, so kann das Selbst mit dem Sein darin wieder aufgelöst werden, denn Selbst und Sein bedingen sich gegenseitig über ebendiese Wirklichkeitsanschauungen, die als Modelle, Beschreibungen oder Beobachtungen ausgedrückt werden können. Diesbezüglich können wir also feststellen: Wirklichkeit ist nicht neutral. Ein Ort beispielsweise wird in Wirklichkeit immer durch die Beziehungen seiner Kompartimente ausgedrückt. Somit stehen in dem, was wir bis jetzt kennen, zwischen den Selbsten und den Dingen und zwischen den Dingen Beziehungen. Sie stellen verbundene Interaktionen in Wirklichkeit her. Diese erheben sich über die Kristallisation von Selbst und Sein hinaus und definieren Wirklichkeit als gegenseitige Bedeutungszuschreibung in einem Beziehungsgeflecht. Wenn ich beispielsweise in einer Landschaft wandele, dann existieren nicht Selbst und die Landschaft einzig als Teilaspekte von Wirklichkeit nebeneinander. Das, was wirklich ist, ist die Beziehung von mir zur Landschaft und umgekehrt. Ich muss mich also auf etwas beziehen können, das auf mich zurückwirft. Nun kann ich dieses Verhältnis aus meiner Perspektive leicht erkennen. Landschaft kann Weite, Freiheit, Halt, aber auch Gefahr und Härte auf mich projizieren oder in mir als Vorstellung auslösen. Sie kann mich hinauslassen wollen oder aber auch auf mich drücken, mir in ihrer gefährlichen Rauheit Enge erteilen. All das bin ich, die Landschaft und die Beziehungen dazwischen, und all das ist Teil von Wirklichkeit. Diese Teile sind nicht konstruiert. Sie sind einmal da, so wie auch ich einmal erschienen bin und mich fortan zu etwas verhalten kann. So wie mich ein leichter Wind hinaus in die Freiheit trägt, so kann mich das Unbekannte am Horizont erschrecken, mich zurückweisen, an meinem Ort des Blickes einschränken. Und alles ist augenblicklich wahr, und wenn ich mich und die Landschaft vergesse, so werden die Beziehungen bleiben und so werde ich mich erinnern können an die Freiheit oder die Angst, an ein Gefühl, das mir einst diese Beziehung hinterließ. Aber auch die Landschaft wird sich an mich erinnern. Jeder Fußabdruck verändert den Ausdruck und die Zukunft von Landschaft. Jede Bewegung von mir hinterließ tausende von verwirbelten Molekülen, die etwas veränderten, die sich forttrugen an Orte, wo sie Nahrung und Keim und somit eine ewig währende Erinnerung bedeuteten. Ein nächster Besuch wird diese veränderte Landschaft betrachten und daher in mir, aber auch in der Landschaft, neue Beziehungen generieren. Und das, was ich nun hier beschrieben habe, ich als veränderbarer Beobachter von Landschaft, und die Landschaft mit ihren veränderbaren Bestandteilen, die ich mir dachte, als ich ihren Begriff entwarf und unsere Beziehungen, die mich Gefühle erinnern ließen, die mir Bedeutung gaben, all das ist lediglich Ausdruck von Wirklichkeit, von meiner Beschreibung von Welt und wie ich sie erscheinen lasse aus den Wörtern dieses Textes. Und diese Wirklichkeit beruht immer auf diesem Dreiklang, der zum einen geschlossen ist, da seine Bestandteile aus derselben Wirklichkeit kommen, und der zum anderen nie ursprünglich ist, denn für seinen Ausdruck benötige ich stets etwas Bestimmtes. Ich benötige Begriffe und Beobachtungen, Beschreibungen und Modelle, und in letzter Instanz immer auch mich, um einen Anfang zu denken, der wie an einer Triangel einen Anschlag stimmt, um aus Schwingungen lebendige Beziehungen erklingen zu lassen. Doch im Hintergrund denke ich an mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich nie alle Wörter für die Beziehungen zu meiner Landschaft finden werde. Dass Veränderungen nie endlich sind und ich daher doch nie alles über mich aus Landschaft erfahren kann. Und, dass es keine Zeit und keine Richtung geben muss, in der ich Beziehungen ausdrücken und den Gedanken vor das Wort stellen kann. Ich ahne, dass es mehr geben muss als meine Wirklichkeit, als den kurzen Dreiklang meiner Existenz, denn ich kann immer auch frei sein, um etwas Neuem Ausdruck zu verleihen. Um aus dem Nichts zu schöpfen, entweder etwas von mir oder meine Beziehungen zu etwas Fremdem.
Könnte eine Ahnung vom Mehr hinter einer Wirklichkeit überhaupt aus der Vernunft heraus geboren werden? Auch die Vernunft kennzeichnet bereits einen Teil von Wirklichkeit, aus dem der Mensch selbst aufgebaut ist. Sie repräsentiert einen Teil der Struktur von Wirklichkeit, den zu beschreiben ich denken kann. Vernunft bezieht sich dabei auf einen konkreten Vorgang, der noch unbekannte Konsequenzen unseres Daseins für Wirklichkeit aufgreift. Wenn wir als Wesen aus Wirklichkeit nachdenken, dann entstehen Konsequenzen. Zum Beispiel begreifen wir uns als existent im Raum und als Abschnitt einer Zeit. Über beide Wirklichkeiten können wir weitere Bezüge zu uns und den Dingen herstellen. Unser Nachdenken schafft unser Selbst als Teil von und in Beziehung zu Wirklichkeit. Wenn wir also in Wirklichkeit existieren, dann so, wie wir darüber nachgedacht haben, also als Konsequenz vernünftiger Grundlagen und Gründe. Vernunft erfindet uns nicht mal als Sternenregen, mal als Sonnenschein, sondern als Teil bekannter Erzählungen, als Kinder von Müttern und Vätern. Wir erfinden uns auch nicht in jedem Gedanken neu, denn wir haben Gestalt, Verhalten und Eigenarten für uns und für das Gegenüber, das so ist wie wir, als bereits existent anerkannt. Ein jeder von uns, in unserer gemeinsamen Zeit, in der wir uns immer wieder darüber erzählen und uns dabei so ansprechen, wie wir erdacht sind. Wir existieren als Konsequenz der Art und Weise unseres Nachdenkens. Wir sind nicht unbedingt die Folge einer festgehaltenen Erzählung. Wir sind die Geschichte unserer eigenen Gedanken. Das Erwartbare ist die Konsistenz dieser Geschichte, ist die Plausibilität der daraus folgenden Ereignisse. Unser stetes Gegenprüfen ist das, was wir Vernunft nennen können. Nun, wir können darüber hinaus erkennen, dass es weitere Konsequenzen in einer Existenz geben kann, die noch nicht ausgedrückt sein müssen. Genauso wie Wirklichkeit immer unvollständig für uns ist, da wir immer mehr von ihr erzeugt haben und wir sie dadurch über Modelle, also gedachte Annäherungen, beschreiben, so sind auch wir noch nicht vollständig erzählt. Weder von unserem eigenen Selbst noch von Anderen in deren Wirklichkeitserzählungen. Es gibt dieses Selbst noch nicht, das neue Konsequenzen über sich denken kann. Es muss sich erst konzipiert haben, um vernünftig über sich nachdenken zu können. Jede Konsequenz von Selbst schafft Selbst und damit erst die Strukturen eines denkenden Wesens. Die unbekannten Konsequenzen sind zwar noch nicht begrifflich gedacht, also als Vorstellung in uns festgehalten, doch sie müssen den Wesen aus Wirklichkeit zugrunde liegen, weil sie irgendwann wirklich werden können. Allein die Möglichkeit einer unausgedrückten Konsequenz eines Selbst eröffnet die Option eines noch unentdeckten Selbst. Vernunft ist dann genau dieser Vorgang, der das Selbst zur richtigen Zeit erweitert, immer dann, wenn ein Teil davon gerade in eine bestehende Wirklichkeit passt. Sie führt dabei zu Schlüssen, die nicht unmittelbar aus einer Erfahrung gelernt werden, da sie bereits im Spiegel des Selbst wirkt. Sie kann daher intuitiv gültige Aspekte von Wirklichkeit erklären, immer dann, wenn freie Gedanken ein Selbst ergänzen und wir darüber nachdenken und feststellen, dass wir bereits mehr geworden sind aus einem unbewussten Hintergrund, der wir bereits davor waren oder der davor unbestimmt war. Und hier entsteht nun der erste Bruch, denn Vernunft ist wirklich, sie macht wirklich und sie denkt das Selbst wirklich. Sie wirkt im Spiegel eines Selbst, das über sich vernünftig denken will, sich eingeordnet sehen will in eine Entwicklung, die sich im Augenblick stets plausibel ergänzt. Doch sie erklärt nicht, ob alles davor bereits ist und wir uns daher kennen oder ob ein Davor frei ist und wir uns erst machen, so wie wir uns danach erkennen werden. Denn Vernunft beinhaltet keinen Anfang. Sie ist der rückblickende Teil individueller Erzählungen und zieht dabei Wirklichkeit in den Strom einer verbundenen Geschichte. Vernünftiges Denken geht nur soweit zurück, bis die anfänglichen Bedingungen, aus denen sich ein denkendes Selbst mit den äußeren Geschichten verbindet, erkennbar werden und dieses Selbst sich aufgebaut sieht, ohne sich wirklich davor vollständig gesehen haben zu müssen. Das Denken und das Selbst steigen aus diesen ersten Bedingungen hervor, indem sie wirkliche Konsequenzen erzeugen. Sie wachsen gemeinsam und lassen uns ahnen, dass es weitere vernünftige Gründe hinter unserer Wirklichkeit geben kann, die weder endlich noch erschöpflich sind. Das Mehr hinter unserer Vernunft ist nicht die Entdeckung weiterer Konsequenzen. Das Mehr ist die Frage nach den Anfängen unserer Bedingungen, nach den freien Gedanken, die das Sein bereits vor dem Selbst preisgeben können.
Hier müssen wir nun noch einen kleinen Einschub über weitere Schlussfolgerungen wagen: Es wird weithin angenommen, dass die Wirklichkeit als Vorstellung in uns auf Grundlage unserer Sinneswahrnehmung angelegt ist. Doch Vorstellung worin denn? Was ist das Gefäß, in das wir Vorstellung projizieren können? Was ist die Grenze, über die hinaus wir uns erheben müssen, um als Beobachter aufzutreten? Ich benötige zuerst ein Konzept meiner selbst, bevor ich Beziehungen zur Welt aufbauen kann. Auch basiert die Vorstellung von Welt in mir auf einer Vorstellung von mir aus Welt! Was war aber zuerst da, die Welt oder die Vorstellung? Gab es also einen ersten Gedanken, eine erste Idee des Menschen, die dann fortwährend weitererzählt und von jedem neuen Individuum gelernt werden konnte, um einen Kontakt zur Welt herzustellen? Dieses Argument folgt den menschlichen Schöpfungsmythen, aus dem einfachen Bedürfnis heraus, die Frage zu beantworten, was uns gemacht hat. Wir ahnen nämlich wiederum, dass wir noch so viel lernen und Vorstellung in uns anhäufen können und doch keine Erkenntnis von der Beschaffenheit der Welt erlangen, wenn wir nicht erkennen, wie wir zuallererst, also im Anfang, in Beziehung zur Welt kamen. Wir brauchen dafür diesen Anfang, der uns als Gefäß definiert, uns nur einmal einen absoluten Kristallisationspunkt gibt, von dem aus wir alles, was kam und kommen wird, beobachten können. Wir verlangen lediglich nach diesem einen Anfang, nach diesem ersten Gedanken, der uns in Wirklichkeit setzte. Alles ist für uns Anfang! Und so streben wir weiter nach einer Entwicklung, nach einer Erzählung, die unsere Geschichte sein muss. Nicht etwa, weil wir jedes Detail unseres Weges zu erkennen suchen. Nein, wir streben immer zurück zu einer konsistenten Erzählung aus plausiblen Gedanken, die uns an den Anfang stellt. Die uns im Hier und Jetzt erklärt, warum wir die Welt beobachten können. Das ist die wahre Frage, die beantwortet, was uns von der Substanz einst wegdachte, was uns ihr gegenüberstellte, denn nur dann, wenn dies einmal geschah, konnten wir erfahren, dass Beziehungen zu uns und der Welt immer das Selbst und das Sein gegenüberstellen. Und das ist auch der Grund, warum es einfach ist, eine dritte Instanz in Schöpfungserzählungen zu kreieren. Eine Instanz der Intention, den Menschen zu schaffen. Diese dritte Intention nimmt uns nämlich den ersten Gedanken und gibt das Anfangsdilemma damit weiter. Was wäre, wenn nun aber alle drei Formen von Wirklichkeit, die wir jetzt beobachten, das Selbst, das Sein und die Beziehung dazwischen, nicht einzig als Vorstellung in uns existieren? Sich nicht einzig aus einem festen Gefäß heraus beschreiben lassen, denn wir können sehen, dass auch dieses Gefäß, das Selbst, sich über ungedachte Konsequenzen immer weiter konzipiert. Wenn das Selbst, das Sein und die Beziehung dazwischen demnach auch nicht als Konstrukt aus uns heraus, sondern lediglich als Teilaspekte einer Wirklichkeit in Erscheinung treten, dann gibt es keinen Grund, warum das eine vor dem anderen gedacht werden sollte. Es ist keine zwingend notwendige Bedingung, denn es gibt nur die eine Wirklichkeit, die Mensch, Ding und das Dazwischen ist. Dann ist es plausibel, dass alle drei gleichzeitig sind. Dass ein Dazwischen auch sein kann und dass der Mensch einem Dazwischen auch ohne Ding begegnen kann, da das Sein und das Selbst keine Beziehungsrichtung aufweisen müssen. Da das eine nicht ausschließlich das andere beschreibt, da freie Gedanken bereits Beschreibungen implizieren können, ohne dass da jemand wäre, der sich ihre Existenz zum Anfang einmal vollständig vorstellte. Nein, wir brauchen keinen Schöpfer, der alles schon bereits vordachte außer sich selbst. Die Vernunft kann immer dann nach freien Gedanken greifen, sobald jemand da ist, der sie gebraucht, der Gedanken in eine Wirklichkeit zur Beschreibung einer ganz persönlichen Existenz einbauen möchte, sich selbst plausibel machen will. Nur dann, wenn dieses vernunftbegabte Wesen sich zeigt, als ein Teil von Wirklichkeit, dann können wir behaupten, dass Wirklichkeit in uns als Vorstellung gilt. Dann entsteht eine scheinbare Unterscheidung zwischen den Orten von Vorstellung und den Zeiten, in denen sich irgendwann etwas vorstellen ließ. Irgendwann, als die Zeit mit uns gedacht wurde, als sie unsere Voraussetzung wurde. Wir versuchen, in dieser Zeit nun eine wahrnehmbare Wirklichkeit zu beobachten und sie gleichzeitig, als Teil von ihr, mit ihren eigenen Mitteln zu beschreiben. Genau hier kann aber Erkenntnis in Zweifel gezogen werden. Immer dann, wenn der Mensch sich denkt und dann beobachtet, entwirft er eine andere Beziehung. Er wird aber niemals eine neue Beziehung entdecken, denn sein Denken, sein Beobachten und seine Beziehung beruhen auf nur einer einzigen Wirklichkeit, die bereits seine Gedanken enthält und sich daher lediglich reproduziert. Letztendlich wird sich der Mensch im Leben fortwährend spiegeln. Er greift auf die Strukturen seiner eigenen Existenz zurück, wenn er glaubt, aus Wirklichkeit geschaffen worden zu sein. Wir beschreiben uns selbst, wenn wir die Wirklichkeit über Vorstellung und Vernunft fassen wollen. Wir werden Strukturen erkennen und beschreiben, die schon immer in uns angelegt waren. Denn das machen wir mit freien Gedanken. Wir holen sie zu uns und wir entwerfen damit Wirklichkeit nach unserem Abbild und noch viel weiter, wir versuchen uns darin einzurichten. Hat sich der Mensch erst einmal über gut kalibrierte Wirklichkeitsmodelle eine passende Weltanschauung gebaut, so wird diese fortwährend aufgegriffen und entwickelt, ohne jedoch die Grundfesten seiner Beziehung zur Welt selbst infrage zu stellen. Diese Grundfesten jedoch können in der Auflösung jener Dreifaltigkeit von Wirklichkeit fallen, die uns als denkende Wesen erst in den Wirklichkeitsbezug stellen. Es ist dann die Aufgabe des Vernünftigen, die Abkehr von der Plausibilität unserer eigenen Geschichte, die uns eine neue Richtungslosigkeit ohne Anfang, ohne Selbst aufzeigt. Erst wenn wir Unbestimmtheit nach Auflösung akzeptieren lernen, also nicht Teil des Dreiecks sind, sondern Dreiklang werden, können wir mehr erfahren von einer Realität, dem Ursprung unserer Wirklichkeit und der Konsequenz einer Vereinigung von Selbst und Sein und dessen Beziehungen. Und hier tritt auch die Ahnung vom Mehr aus der Vernunft heraus, dann, wenn nämlich auch akzeptiert werden kann, dass ein Gedanke vor dem Selbst existiert. Und dass dieser Gedanke zwar vorher in einer Welt lag, jedoch unspezifisch und frei, unabhängig von den Strukturen von Wirklichkeit. Dann können wir ahnen, dass wir es sind, die diesen Gedanken wirklich machen werden und ihm somit Bedeutung verleihen.





























