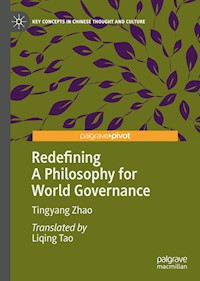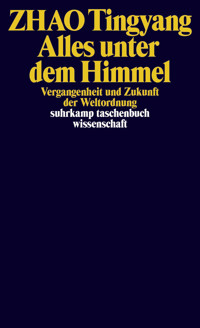
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zhao Tingyang gilt als einer der bedeutendsten chinesischen Philosophen der Gegenwart. Mit diesem Hauptwerk liegen nun seine Überlegungen zu einer neuen politischen Weltordnung erstmals in deutscher Übersetzung vor. Sie basieren auf dem alten chinesischen Prinzip des tianxia – der Inklusion aller unter einem Himmel. In Auseinandersetzung mit okzidentalen Theorien des Staates und des Friedens von Hobbes über Kant bis Habermas sowie unter Rückgriff auf die Geschichtswissenschaft, die Ökonomie und die Spieltheorie eröffnet uns Zhao einen höchst originellen Blick auf die Konzeption der Universalität. Ein wegweisendes Buch, auch um Chinas aktuelles weltpolitisches Denken zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3ZHAO Tingyang
Alles unter dem Himmel
Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung
Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Anmerkung des Übersetzers
Vorwort
Einführung Die Neudefinition des Politischen durch das Tianxia
1. Die Welt als politisches Subjekt
2. Die schlechteste und die beste aller möglichen Welten
3. Entitäten des Politischen
4. Die Inklusion der Welt und die Souveränität der Welt
5. Relationale Rationalität
6. Ein neuer Ausgangspunkt des Politischen
1. Kapitel Die Geschichte des Tianxia-Konzepts
1. Die Welt als Ausgangspunkt der Politik
2. Die dreifach geschichtete Welt des Tianxia
3. Übereinstimmung mit dem Himmel
4. Die Institutionen des Tianxia-Systems
5. Allumfassenheit
6. Der Isomorphismus von Sippe und Tianxia
7. Das Mandat des Himmels
8. Tugend und Kompatibilität
9. Warum können gute Ordnungen zusammenbrechen?
10. Das Tianxia als Methodologie
2. Kapitel Das in China verborgene Tianxia
1. Das Mahlstrom-Modell
2. Die Miniaturausgabe des Tianxia
3. Der Kampf um die Herrschaft über die Zentralebene: Die »Jagd auf den Hirschen«
4. Sein durch Veränderung
3. Kapitel Gegenwart und Zukunft des Tianxia
1. Die Weltgeschichte hat noch nicht begonnen
2. Die Frage Kants und die Frage Huntingtons
3. Zwei Arten der Externalität: die natürliche und die konstruierte
4. Grenzen und Allumfassenheit
5. Die materiellen Voraussetzungen eines neuen Tianxia
6. Ein Wörterbuch des neuen Tianxia
Anmerkungen
Namenregister
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
7Anmerkung des Übersetzers
Der Begriff »Tianxia« (天下, Aussprache: Tiänchia), wörtlich übersetzt »Unterm Himmel«, ist einer der zentralen Begriffe der klassischen chinesischen Philosophie, insbesondere der politischen Philosophie. Genauer ist er zu übersetzen mit »Alles unter dem Himmel«. Aus zwei Gründen habe ich mich entschieden, statt einer Übersetzung im deutschen Text das chinesische Original beizubehalten. Erstens wegen der mit einer Übersetzung verbundenen sprachlichen Unbeholfenheit, die vier Worte statt zwei Silben benötigt, und zweitens, um irreführende Assoziationen zu vermeiden. Der Begriff »Tian«, lexikalisch je nach Kontext mit »Himmel« oder »Tag« zu übersetzen, unterscheidet sich von unserem, von jüdisch-christlicher Tradition geprägten Begriff des Himmels signifikant. Nur in zwingenden Fällen wird die deutsche Übersetzung verwendet.
Analog wird mit einem anderen grundlegenden Begriff der chinesischen Philosophie verfahren, dem »Dao« (道), für den es keinen adäquaten Begriff im Deutschen gibt. Jede lexikalische Übersetzung bedeutet eine irreführende Einschränkung bzw. einseitige Interpretation. Das »Dao« (lexikalische Übersetzung: »Weg«) ist die bewegende und regulierende Kraft alles Seins. Je nach philosophischer Orientierung wird diese Kraft unterschiedlich interpretiert, im Konfuzianismus eher als moralische, im Daoismus als natürliche Kraft. Im chinesischen Buddhismus steht es oft für das Dharma. Das mit dieser Kraft übereinstimmende richtige Verhalten wird im Konfuzianismus als »Da Yi« (大义) bezeichnet. Auch hier habe ich mich entschieden, den chinesischen Begriff zu verwenden.
Der mit chinesischer Geschichte und Philosophie weniger vertraute Leser sei zudem auf den letzten Abschnitt des 3. Kapitels »Ein Wörterbuch des neuen Tianxia« verwiesen, wo der Autor eine Begriffsklärung einiger zentraler Begriffe seiner Darstellung des Tianxia vornimmt.
Die schwierige und zeitraubende Recherche nach vorhandenen Übersetzungen bzw. die Neuübersetzung der Zitate aus antiken chinesischen philosophischen oder historiographischen Quellen 8hat der Sinologe Philipp Schiederer übernommen, dem ich an dieser Stelle von ganzem Herzen danken möchte. Für den größten Teil der vom Autor zitierten Texte liegen keine deutschsprachigen Übersetzungen vor. Vorhandene Übersetzungen, etwa ins Englische, aber auch solche ins moderne Chinesisch, weichen häufig sprachlich, aber auch inhaltlich stark voneinander ab. Die Übersetzung der Zitate wurde daher, wo erforderlich, in Absprache mit dem Autor entsprechend dessen Textverständnis überarbeitet.
Familiennamen werden im Chinesischen dem Vornamen vorangestellt, sie werden der Klarheit halber in Großbuchstaben geschrieben.
Die in Klammern gesetzten englischen Begriffe wurden aus dem Originaltext übernommen.
9Vorwort
Das Konzept des Tianxia umfasste im alten China zahlreiche spirituelle Aspekte, etwa die zwischenmenschlichen spirituellen Beziehungen und die spirituellen Beziehungen zwischen dem »Dao des Menschen« und dem »Dao des Himmels«. Der spirituelle Gehalt des Tianxia ist mit dem Himmel selbst nahezu identisch. Ich fühle mich nicht imstande, ihn zu beschreiben, und werde mich daher in dieser Hinsicht kurzhalten. Tianxia ist aber auch das politische Ideal einer Weltordnung. Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, das idealistische Konzept des Tianxia realistisch darzustellen und die Differenz zwischen dem Dao des Tianxia und seiner Implementierung, zwischen Idealität und Realität, zwischen Geschichte und Zukunft, deutlich werden zu lassen. Tianxia ist zudem eine Methodologie, und ich versuche zu zeigen, wie das Konzept des Tianxia zu einem neuen Verständnis der Geschichte, von Institutionen und politischen Räumen, ja sogar zu einer Neudefinition des Politischen schlechthin führt.
Das Konzept des Tianxia ist unerschöpflich und wirft eine Unmenge von Fragen auf. Das nötigt mich, eine Methode zu finden, die dem Konzept möglichst gerecht wird. Die Methode, deren sich das Buch bedient, könnte man als »kombinierte Synthese« bezeichnen. Ein Gegenstand ist eine Gesamtheit, versuchen wir ihn im Detail zu verstehen, müssen wir seine unterschiedlichen Aspekte analysieren, etwa seine politischen, ökonomischen, ethischen, ästhetischen, sozialen, historischen usw. Wir müssen die Gesamtheit des Gegenstandes in Elemente zerlegen, die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen zuzuordnen sind, jede dieser Disziplinen richtet jeweils ihre spezifischen Fragen an den Gegenstand. Doch ist die jeweilige Disziplin nicht immer in der Lage, die von ihr gestellten Fragen zu beantworten, da Antworten auf manche Fragen auf dem Gebiet anderer Disziplinen zu suchen sind. So finden sich z. B. die Antworten auf manche politische Fragen im Bereich der Ökonomie, umgekehrt Antworten auf ökonomische Fragen im Bereich des Politischen, die Lösung gewisser ethischer Probleme liegt in politischen Fragen, umgekehrt sind gewisse Grundlagen politischer Systeme ethischer Natur. Die Gründe mancher politischer 10Entscheidungen ergeben sich nicht aus der Politik, sondern aus der Geschichte, bei manchen historischen Narrativen handelt es sich in Wahrheit um Theologie. Das ließe sich beliebig fortsetzen. Die sogenannte »kombinierte Synthese« ist der Versuch, die Gesamtheit des Gegenstandes wiederherzustellen, die unterschiedlichen an den Gegenstand gerichteten Fragen sollen sich wechselseitig konfrontieren, das Wissen unterschiedlicher Disziplinen zu ihrer Klärung beitragen. Diese Methode ist eine philosophische, bei der Untersuchung des Tianxia dient die Philosophie dazu, die Gesamtheit des Gegenstandes wiederherzustellen. Die Antworten auf die gestellten Fragen werde ich deshalb ebenso aus der Geschichtswissenschaft wie aus der Politischen Wissenschaft, den Wirtschaftswissenschaften, der Spieltheorie oder der Theologie beziehen. Ich erhoffe mir, dass dieses synthetische Vorgehen der Fülle des Tianxia-Konzepts gerecht wird.
Der Begriff des Tianxia selbst ist mit Emotion aufgeladen, er ist besetzt mit Chinas Geschichte, seinen Traditionen, seinen Erfahrungen und seiner Spiritualität. Meine Absicht ist es, die Darstellung der Philosophie des Tianxia auf eine rationale Erläuterung zu reduzieren und jedes emotionale Narrativ und jede antizipierende Wertung so weit als möglich zu vermeiden. Nur die Geisteshaltung einer von Emotion ungetrübten, »unbarmherzigen« Darlegung kann beweisen, dass diese Philosophie tatsächlich universell gültig ist. So spielen zum Beispiel die Bemühungen des Konfuzianismus bei der Konstruktion des Tianxia eine herausragende Rolle, aber das bedeutet nicht, dass die konfuzianische Konstruktion hinreichend ist. Eine der Schwächen des Konfuzianismus besteht darin, dass er unfähig ist, das »Problem des Fremden«1 zu erklären. Die Konfuzianer haben versucht, diesen Umstand zu rechtfertigen, aber ich bin der Meinung, dass eine Verteidigung, die emotionale Begründungen enthält, nicht hinreicht, den Schwierigkeiten des Problems gerecht zu werden. Ich möchte hier noch einmal mein Verständnis einer »unparteiischen« Analyse erläutern: Unparteiische Analyse meint, auf jede sich auf einen Wertekanon berufende Erklärung, Kritik oder Narration zu verzichten und sich auf eine emotionsfreie, »unbarmherzige« ontologische Analyse zu beschränken: ob nämlich eine Existenz in der Lage ist, auf eine ihr gemäße Art erfolgreich fortzuexistieren. Das heißt, ohne Rücksicht auf emotionale oder weltanschauliche Wertungen allein zu prüfen, ob 11eine Handlungslogik Bestand hat, und das unter allen Bedingungen. Das ist eine Voraussetzung. Die Existenz ist den Werten vorangestellt, erst die Fähigkeit fortzuexistieren, ermöglicht ihre Vervollkommnung. Weder kann die Vernunft dazu dienen, Emotion zu widerlegen, noch dient Emotion der Widerlegung der Vernunft. Ich vermute, dass die Mehrzahl der Menschen der Meinung ist, Frieden sei dem Krieg vorzuziehen, dennoch gibt es innerhalb der Ethik den Skandal, dass sie, von ein paar politisch korrekten Gemeinplätzen abgesehen, bis heute die Gültigkeit des Satzes, dass der Schwächere vom Stärkeren gefressen wird, nicht widerlegen kann. Daher kann der Versuch zu beweisen, dass die Logik der Hegemonie fehlerhaft sei, sich nicht auf die Ethik stützen. Hingegen kann die Spieltheorie demonstrieren, dass die Logik der Hegemonie langfristig der Revanche ausgeliefert ist und am Ende das Schicksal der »Tragödie der Nachahmung« erleidet.
Bei der Auswahl der von mir verwendeten Quellen stütze ich mich, was die vorschriftliche Epoche betrifft, auf archäologische Zeugnisse. Für die Zeit nach dem Vorliegen schriftlicher Dokumente halte ich mich vor allem an Texte, die im Lauf der Geschichte die »Bildung des menschlichen Geistes« beeinflusst haben. So stehen zum Beispiel bei der Beschreibung des Tianxia der Zhou-Dynastie (1046-256 v. Chr.) Dokumente aus dieser Zeit zwar an erster Stelle, doch schließe ich Texte aus der Qin- (221-207 v. Chr.) und der Han-Zeit (202 v. Chr.-220 n. Chr.) nicht aus. Obwohl sich darunter einige erwiesenermaßen fälschlich der Zhou-Zeit zugeschriebene Texte befinden, sind die darin enthaltenen Geschichten in den dauerhaften Vorstellungsraum der Menschen eingegangen, d. h., es handelt sich um kollektive Imaginationen mit praktischen Auswirkungen.
Meine früheren Untersuchungen zum System des Tianxia habe ich gesammelt im 2005 erschienenen Buch Das System des Tianxia dargelegt,2 das erfreulicherweise in der Fachwelt Aufmerksamkeit gefunden und Kritik und Diskussionen ausgelöst hat. Aber es war nur der erste Schritt einer Untersuchung des Tianxia-Systems. Heute, zehn Jahre später, finden sich zwar in Alles unter dem Himmel sowohl in Hinsicht auf die behandelten Fragen als auch in Hinblick auf Beweisführung und Narrative erhebliche Unterschiede zu Das System des Tianxia, doch bleibt die Grundidee dieselbe. Hinzu kommt, dass es sich bei Das System des Tianxia um die Rück12übersetzung und Bearbeitung zweier im Jahr 2000 auf Englisch verfasster Aufsätze handelt, worin ich aufgrund unzureichender sprachlicher Kenntnisse zahlreiche schwer zu übersetzende klassische Quellen vernachlässigt habe. Dieser Mangel wird bis zu einem gewissen Grad in Alles unter dem Himmel behoben. Ich habe allerdings zahlreiche einander inhaltlich ähnliche antike Quellen nicht zitiert, da es sich letztendlich um kein geschichtswissenschaftliches Werk handelt. Ich bitte die Historiker um Nachsicht.
Die Untersuchungen zum System des Tianxia wurden fortlaufend durch Kritik und Anregungen von Freunden und Lesern befördert. An erster Stelle möchte ich Alain Le Pichon danken, der mich 2000 dazu gedrängt hat, meine Überlegungen zum Konzept des Tianxia auf Englisch zu Papier zu bringen. Mein Dank gilt des Weiteren QING Yaqing, TANG Yijie, YUE Daiyun, TONG Shijun, HUANG Ping, WANG Mingming, William Callahan, Fred Dallmayr, Luca M. Scarantino und Peter J. Katzenstein. Sie haben von Beginn an meine Untersuchungen unterstützt und wertvolle Anregungen gegeben. Ebenso danke ich Stephen C. Angle, Regis Debray, Prasenjit Duara, GAN Chunsong, ZHANG Feng, XU Xin, WANG Yiwei, GAO Shangtao, ZHOU Fangyin, Elena Barabantseva, Anthony Carty, Sundeep Waslekar, Nicole Lapierre, BAI Tongdong, ZHOU Chicheng, ZHOU Lian, SUN Shu, ZHANG Shuguang, XU Jianxin und JIANG Xiyuan, ihre Kommentare haben viel zur Klärung und Vertiefung unklarer und strittiger Fragen des Themas beigetragen. Zugleich möchte ich all den Freunden danken, die mich mit Fragen und Hilfestellungen unterstützt haben: Jean Paul Tchang, Hans Boller, Elizabeth Perry, Rainer Forst, Joshua Ramo, Francesco Sisci, ZHANG Yuyan, HAN Dongyu, CI Xiwei, LÜ Xiang, LI He, CHENG Guangyun, ZHANG Dun, GUAN Kai, ZHAO Tao, LU Ding, QIAO Liang, WANG Xiangsui, PAN Wei, YAN Xuetong, YUAN Zhengqing, SHENG Hong, ZHAO Quansheng, WANG Jianyu, Enno Rudolph, Philippe Brunozzi, Daniel Binswanger, Evgeny Grachikov, Joel Thoraval, Michael Pillsbury, Iain Johnston, Jean-Marc Coicaud, In-suk Cha, Moon Chung-in, Han Sang-jin, Mark Siemons, John G. Blair, CHEN Ping, die Stiftung Kunst & Kultur e. V., Zijuan Zaft und Public Space (China) Limited.
ZHAO Tingyang
18. August 2015
13Einführung Die Neudefinition des Politischen durch das Tianxia
Fragestellungen, Voraussetzungen und Methoden
1. Die Welt als politisches Subjekt
China ist eine Erzählung, Tianxia dagegen eine Theorie.
Wohin man auch blickt, ergreift die Globalisierung alle Bereiche sämtlicher Weltregionen und gestattet keine Räume für eine unbeschwerte Existenz außerhalb. Vernachlässigen wir diesen neuen politischen Kontext, sind wir schwerlich in der Lage, Aussagen über die Gegenwart zu treffen. Die Globalisierung bringt nicht nur Veränderungen in politischer Hinsicht mit sich, sondern Veränderungen im Existenz-Modus der Welt. Bei der Vorausschau auf die zukünftige Welt benötigen wir eine ihr entsprechende Daseinsordnung (order of being), eine Ordnung, welche die Inklusion der Welt realisiert. Das ist es, was ich als das System des »Alles unter dem Himmel« (Tianxia) bezeichne. Ohne Frage ist Tianxia ein Begriff der chinesischen Antike, aber kein Begriff, der sich speziell auf China bezieht, die darin aufgeworfenen Fragen reichen weit über China hinaus, es sind universelle Fragen der gesamten Welt. Tianxia verweist auf eine »Welt der Weltheit« (a world of worldness). Begreift man Tianxia als einen dynamischen Prozess, dann bedeutet er die »Verweltlichung der Welt« (the worldlization of the world). Das Zhou-zeitliche System des Tianxia gehört der Vergangenheit an, der bis heute lebendige Begriff des Tianxia dagegen ist eine Idee für die Zukunft der Welt. Auch wenn wir die Zukunft nicht kennen, dürfen wir nicht schweigen, was bedeutet, dass wir uns über eine universell positive Weltordnung Gedanken machen müssen.
Das Konzept internationaler Politik, definiert durch die Modelle des Nationalstaaten-Systems, des Imperialismus und des Hegemonialstrebens, gerät allmählich in Widerspruch zu den Tatsachen der Globalisierung. Falls es nicht zu einer Umkehrung der Globalisierung kommt, werden die Nationalstaaten als höchste Machtinstanz und die damit verbundenen Spiele der internationalen Politik früher oder später der Vergangenheit angehören. Die sich abzeichnende Zukunft wird einer die Moderne hinter sich las14senden globalen Macht der Netzwerke und einer globalen Politik gehören.
Das Konzept des Tianxia zielt auf eine Weltordnung, worin die Welt als Ganzes zum Subjekt der Politik wird, auf eine Ordnung der Koexistenz (order of coexistence), welche die ganze Welt als eine politische Entität betrachtet. Die Welt unter dem Aspekt des Tianxia zu begreifen, bedeutet, die Welt als Ganzes zum gedanklichen Ausgangspunkt der Analyse zu machen, um eine der Realität der Globalisierung adäquate politische Ordnung entwerfen zu können. Die vergangene und gegenwärtig fortbestehende Dominierung der Welt durch Imperialmächte beruht auf dem Konzept des Staates und des nationalen Interesses. Diese Mächte hoffen auf den Fortbestand einer vom Imperialismus dominierten Welt und betrachten alles, was sich nicht an deren Aufteilung beteiligt, als zu dominierenden »Rest der Welt« (the rest of the world ). Die imperialistische Weltanschauung betrachtet die Welt als Objekt der Unterwerfung, Beherrschung und Ausbeutung und keinesfalls als politisches Subjekt. »Die Welt zu reflektieren« und »ausgehend von der Welt zu reflektieren«, sind zwei völlig konträre Grammatiken des Denkens, erstere begreift die Welt als Objekt, letztere als Subjekt. Für die politische Frage der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, »als Welt zu existieren« (to be or not to be a world ), ist das entscheidend. Ausgangspunkt der Methodologie des Tianxia ist es, die Welt als politisches Subjekt zu betrachten. Diese Methodologie findet sich sowohl im Guanzi (管子) als auch bei Laozi (老子, 571-471 v. Chr.): »Behandle die Welt (Tianxia), wie es sich für die Welt (Tianxia) geziemt« (Guanzi),1 bzw. »Nach dem Charakter der Welt (Tianxia) beurteile die Welt (Tianxia)« (Laozi).2 Das bedeutet, Weltpolitik muss unter einem größeren Gesichtswinkel als dem des Staates verstanden werden, die Welt als Ganzes muss als Maßstab der Definition politischer Ordnung und politischer Legitimität dienen.
Die Welt als Maßstab für das Verstehen der Welt als einer Gesamtheit politischer Existenz ist das Prinzip des »Tianxia kennt kein Außen«,3 was bedeutet, dass das Tianxia die größte denkbare, jede Art politischer Existenz einschließende politische Welt bezeichnet. Das Prinzip des »Tianxia ohne Außen« stützt sich auf folgende metaphysische Begründung: Da der Himmel die Gesamtheit alles Existierenden umfasst, muss auch »Alles unter dem Himmel« die Gesamtheit des Existierenden umfassen, nur so entspricht es 15dem Himmel. Das ist mit dem Satz: »Der Himmel beschirmt alles gleichermaßen ohne eigennützige Bevorzugung, die Erde trägt alles gleichermaßen ohne eigennützige Bevorzugung«4 gemeint. Das Prinzip des »Tianxia kennt kein Außen« setzt apriorisch (transcendentally) die Welt als politisch Ganzes voraus, das System des Tianxia kennt daher nur ein Innen und kein Außen und lässt damit die Begriffe des »außenstehenden Fremden« und »Feindes« verschwinden: Keine Person kann als untolerierbarer Außenstehender, kein Staat, keine Nationalität und keine Kultur als antagonistischer Feind angesehen werden. Alle Staaten und Gebiete, die sich noch nicht dem System des Tianxia angeschlossen haben, sind eingeladen, der Ordnung der Koexistenz des Tianxia beizutreten. Theoretisch betrachtet, umschließt das Konzept des Tianxia apriorisch die Welt als Ganzes, in der Praxis existiert es noch nicht. Das Tianxia-System der Zhou-Dynastie vor 3000 Jahren war zwar nur ein regional begrenztes Experiment, doch demonstrierte es als Praxismodell, wie das Konzept des Tianxia Äußeres in Inneres umwandelt. Darin besteht das wichtigste Erbe des antiken Tianxia.
Wenn nun das Konzept des Tianxia verspricht, alles Äußere in Inneres umzuwandeln, dann schließt es logischerweise die Konzepte des unversöhnbaren Todfeindes, des absoluten ideologischen bzw. spirituellen Gegners und damit auch das des Heidentums aus. Damit steht es im Gegensatz zu monotheistischen Denkmustern. Auch wenn das Christentum in Europa heute zu einer Art spirituellem Symbol regrediert ist und keine Lebensform mehr darstellt, beeinflusst das Konzept des Heidentums als verfestigtes Denkmuster noch immer die politischen und kulturellen Narrative. Das Fehlen von Abweichlern oder Feinden bedeutet für die westliche Politik offenbar den Kompassverlust, bis hin zum Verlust von Leidenschaft und Motivation. Carl Schmitt ist ein Vertreter dieses auf der klaren Unterscheidung von Freund und Feind und eines Lebens in ewig fortdauerndem Kampf beruhenden Konzepts des Politischen.5 Gleichgültig, ob es sich um den Kampf des Christentums gegen das Heidentum oder den innerchristlichen Kampf gegen Häresien, ob es sich um das Hobbes’sche »Gesetz des Dschungels« oder die marxistische Theorie des Klassenkampfes handelt, ob es sich um die auf dem System der Nationalstaaten beruhende Theorie internationaler Politik oder um Huntingtons »clash of civilisations« handelt, alle diese Auffassungen von Kampf stehen mit dem politischen 16Freund/Feind-Konzept in engem Zusammenhang. Im Gegensatz dazu beruht das Tianxia-Konzept auf der Annahme, dass es die Möglichkeit geben muss, auf irgend eine Art und Weise jeglichen Anderen in die Ordnung der Koexistenz zu integrieren und auf der Basis gegenseitigen Respekts zu koexistieren. Jede außenstehende Existenz wirft daher die Frage ihrer Integration auf, sie ist kein Objekt der Unterwerfung.
In der Gegenüberstellung der politischen Positionen des antagonistischen Kampfes und der Umwandlung des Äußeren in Inneres wird der philosophische Dissens zwischen zwei Konzepten des Politischen sichtbar. Ich versuche zu zeigen, dass das Konzept des antagonistischen Kampfes keineswegs Ausdruck wahrer Politik ist, sondern Konflikt und Krieg bedeutet. Konflikt und Kampf gehören zu den grundlegenden Fakten der Menschheit. Aber wenn Politik sich darin erschöpft, zu erforschen, wie man bis zur letzten Konsequenz kämpft, dann wird sie nicht nur unfähig, Konflikte zu lösen, sie wird im Gegenteil Konflikte verlängern und verstärken. Eine Theorie, die zu nichts anderem führt, als die Realität zu verschlechtern, ist überflüssig. Das Konzept des antagonistischen Kampfes wird die Probleme der Realität immer nur wiederholen, nie sie lösen. Es handelt sich dabei um einen »grammatikalischen Fehlschluss im Prozess der Theoriebildung« (grammatical fallacy in theorizing), ja sogar um einen ontologischen Fehlschluss (ontological fallacy), der Menschheitskatastrophen verschlimmert. Krieg oder Kampf sind Ausdruck politischer Ineffektivität, sogar des Scheiterns von Politik. Worin läge der Sinn von Politik, wenn sie nicht dazu diente, das Zusammenleben der Menschheit zu ermöglichen und eine friedliche Welt zu schaffen? Die Politik des Kampfes missachtet Menschheit und Welt gleichermaßen, daher ist es notwendig, Konzepte des Politischen, in deren Mittelpunkt der Kampf steht, in ihr Gegenteil zu verkehren, sie durch Konzepte des Politischen zu ersetzen, die Koexistenz zum Zentrum zu machen. Mit einem Wort: Politik muss Respekt vor der Welt haben.
172. Die schlechteste und die beste aller möglichen Welten
Ohne gemeinsames Leben gäbe es keine Politik. Um den genetischen Code der Politik zu analysieren, konstruierten die Philosophen das theoretische Experiment eines Ausgangspunktes der Politik, den sogenannten »Urzustand« (original situation).6 Wenn ein Urzustand die Kernelemente, die »Gene« des Politischen enthält, lassen sich die Geheimnisse der Politik entschlüsseln. Ein Urzustand, der universelles Erklärungspotential besitzt, muss in der Lage sein, sämtliche denkbaren Möglichkeiten abzudecken, er kann daher nicht John Rawls’ Annahme eines »Schleiers des Nichtwissens« (veil of ignorance) oder ähnliche Annahmen verwenden, weil der Schleier des Nichtwissens die schlechteste Möglichkeit ausblendet (z. B. den Hobbes’schen Urzustand), damit die Bedingung von Politik abschwächt und keine universelle Geltung besitzt. Rawls’ Annahme ist bestenfalls auf die Frage von Vertragsverhältnissen beschränkt.7 Wirklich universelles Erklärungspotential eines Urzustands haben nur die Hypothesen von Hobbes und von Xunzi (荀子, 313-238 v. Chr.). Hobbes’ Annahme eines Naturzustands entspricht zwar nicht der Realität, aber sie enthält einige der wichtigsten Elemente von Politik:
Der Begriff des Politischen muss die Möglichkeit des Schlimmsten mitbedenken, andernfalls besitzt er kein universelles Erklärungspotential;
Sicherheit ist die erste Notwendigkeit, und
keinem Anderen ist völlig zu trauen.
Der Vorzug der Hobbes’schen Annahme besteht darin, dass sie das Extrem der schlechtesten aller Welten aufzeigt. Ihre Schwäche besteht darin, dass sie das Gen der Kooperation ausschließt und damit dem Übergang der Menschheit vom Konflikt zur Kooperation die notwendige Basis entzieht. Hobbes’ Lösungsvorstellung, dass der Verbund der Starken Ordnung herstellt, ist nach wie vor ein Fehlschluss: Der Verbund der Starken, der die Kraft besitzt, Ordnung herzustellen, ist notwendigerweise ein interner Zusammenschluss. Aber wie soll innerhalb eines solchen Verbunds Kooperation zustande kommen? Wie soll, folgt man der Hobbes’schen Hypothese, dass der Mensch des Menschen Feind sei, ein Verbund der Starken auf der Basis gegenseitigen Vertrauens entstehen? Offensichtlich kann Konflikt sich nicht automatisch in Kooperation 18verkehren, es sei denn, es existiert von Beginn an irgendein Grundelement, ein Gen der Kooperation. Darin besteht die von Hobbes vernachlässigte Möglichkeit der Umwandlung des Konflikts in Kooperation.
Möglicherweise als Erster, nahezu zweitausend Jahre vor Hobbes, diskutierte Xunzi die Frage des Urzustands. Anders als Hobbes sah Xunzis Urzustand ein Grundelement, ein Gen der Kooperation vor, er nahm nämlich die Gruppe als dem Individuum vorangehend an. Er wies darauf hin, dass die Fähigkeiten des Einzelnen schwächer seien als selbst die von Ochsen und Pferden, und daher Kooperation innerhalb der Gruppe für den Einzelnen eine Voraussetzung des Überlebens bildet. Daher geht die Kooperation notwendigerweise dem Konflikt voraus: »Die Existenz des Menschen bedarf der Gruppe.«8 Ich entwickle aus dieser Annahme ein ontologisches Prinzip: Die Koexistenz geht der Existenz voran, mit anderen Worten, die Koexistenz ist die Voraussetzung der Existenz. Ausgehend von der Ökonomie analysierte Xunzi die Formierung politischer Ordnung: »Von Geburt an sind den Menschen Begierden gegeben. Werden sie nicht erfüllt, dann können die Menschen nicht anders, als nach deren Befriedigung zu streben. Ist dieses Streben ohne Maß und Grenzen, dann geraten sie notwendig in Streit. Streit führt zu Unordnung, und Unordnung führt zu Armut. Die früheren Könige hassten solche Unordnung, daher führten sie Riten und Prinzipien der Rechtschaffenheit ein, um die Güter zu verteilen.«9 Xunzi entdeckte ein anscheinend paradoxes Phänomen: Die Kooperation führt zum Konflikt. Kooperation schafft erhöhtes Einkommen, daraus entwickelt sich ungerechte Verteilung und diese führt zum Konflikt. Die Umsetzung von Kooperation in stabiles Vertrauen erfordert, dass sich das Grundelement, das Gen der Kooperation, zu einem System entwickelt. Xunzi nahm ein Gen der Kooperation an und vermied auf diese Weise Hobbes’ Schwierigkeit. Dennoch ist Xunzis Hypothese nicht in der Lage, das Hobbes’sche Problem zur Gänze abzudecken. Die Hobbes’sche Hypothese ist zwar nicht in der Lage, die Voraussetzung interner Kooperation zu erklären, aber sie liefert eine brillante Erklärung des Problems von Konflikten in anarchischen Zuständen. Daher liefert erst eine sich gegenseitig ergänzende Verbindung von Hobbes und Xunzi eine vollständige Theorie des Urzustands, welche die Frage des Politischen formuliert. Man könnte sie als die Xunzi-Hobbes-Hypothese bezeichnen, 19nämlich als Urzustand eines Zusammenschlusses der Gruppe nach innen und des Kampfes nach außen.
Der Geltungsbereich des Politischen ist definiert durch den Raum zwischen den Extremen der schlechtesten und der besten aller möglichen Welten. Hobbes lieferte bereits eine Definition der schlechtesten aller möglichen Welten. Was also wäre die beste aller möglichen Welten? Wenn die Hobbes’sche Definition das eine Ende der Reihe aller möglichen Welten (the set of possible worlds) beschreibt, dann müsste nach dem symmetrischen Prinzip das andere Ende der Reihe aus einer exakt entgegengesetzten Welt bestehen, nämlich einer Welt, die Unsicherheit, Misstrauen, Nicht-Kooperation, Mangel und Einsamkeit ausschließt. Beachtenswert ist, dass in der menschlichen Phantasie die beste aller möglichen Welten häufig jedoch keineswegs einfach dem Gegenbild der schlechtesten aller möglichen Welten entspricht. In ihrer Gier sehnen sich die Menschen nach einer Welt, in der sämtliche guten Dinge verwirklicht sind, wie zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit, Güte, Frieden, größtmöglicher materieller Reichtum, Fehlen von Ausbeutung und Unterdrückung, Klassenlosigkeit, Selbstverwirklichung, Abwesenheit von Entfremdung und das Glück eines jeden. Diese märchenhafte Welt benötigt zur Verstärkung die geschichtsphilosophischen Märchenerzählungen der modernen Fortschrittstheorien. Das Problem ist nur, dass diese perfekte Welt keine mögliche ist, und daher die Frage nach der besten aller möglichen Welten ungeklärt bleibt.
Die Freiheit des Menschen ist beschränkt durch die Grenzen der menschlichen Empfindung. Nach Konfuzius (551-479 v. Chr.) bildet die menschliche Empfindung das »Feld der Weisen Herrscher«10 (圣王之田), das nur innerhalb des Bereichs menschlicher Empfindung und Vernunft kultiviert11 und nicht in eine unmögliche, menschliche Empfindung und Vernunft überschreitende Welt umgewandelt werden kann. Das Feld der Kultivierung menschlicher Empfindung lässt deren Regulierung nur so weit zu, wie diese selbst es zulässt, und erlaubt keine Verstöße dagegen. Konfuzius war Realist, in seinen Augen war die beste aller möglichen Welten eine Welt der »Großen Eintracht«, d. h. eine extrem sichere Welt des gegenseitigen Vertrauens und der Solidarität. Vor allem eine friedliche Welt, in der Konkurrenz und Intrige wirkungslos bleiben: »Als man gemäß dem großen Dao handelte, war alles un20ter dem Himmel gemeinschaftlicher Besitz [the world as common property], die Würdigen und Fähigen wurden [in Ämter] berufen [hier nähert er sich in gewisser Weise den Vorstellungen Platons], ihre Worte waren aufrichtig und ihr Umgang untereinander harmonisch [ein dem Hobbes’schen Dschungel entgegengesetzter Zustand der Sicherheit]. In jener Zeit behandelte man nicht nur die eigenen Eltern wie seine Eltern und nicht nur die eigenen Kinder wie seine Kinder. Man kümmerte sich darum, dass für die Alten bis ans Lebensende gesorgt war, die Kräftigen Verwendung fanden und die Jungen heranwachsen konnten. Man zeigte Mitgefühl mit den Verwitweten, Waisen, Kinderlosen, Verstoßenen und Kranken, so dass für sie alle gesorgt wurde. Die Männer hatten angemessene Arbeit und die Frauen hatten ein Heim, um das sie sich kümmerten. Sie verschmähten es, Güter wegzuwerfen, jedoch nicht, um sie für sich zu horten. Sie verachteten es, nicht hart zu arbeiten, jedoch nicht um des Eigennutzes willen. Es gab keinen Platz für Intrigen und Komplotte und sie fanden keinen Nährboden [dies ist ein zentraler Punkt, wenn eine Daseinsordnung dazu führt, dass Konkurrenz und Komplott wirkungslos bleiben, handelt es sich notwendigerweise um eine friedliche Welt], es gab weder Diebstahl noch Verrat, und die Türen wurden nicht verschlossen. Das bezeichnet man als [die Epoche] der großen ›Gemeinschaft‹.«12 Obwohl diese beste aller möglichen Welten nie wirklich bestand, ist sie dennoch realistisch und keineswegs unerreichbar. Die Überlegungen einer Welt der großen Gemeinschaft drehen sich ausschließlich um die Existenzbedingungen für Sicherheit, Frieden, gegenseitiges Vertrauen und Solidarität, sie verlangt jedoch nicht Vereinheitlichung von Kultur oder Religion. Das bedeutet, dass die Welt des Konfuzius Diversität der Lebensformen anerkannte, er forderte lediglich Kompatibilität, nicht aber Gleichschaltung. Wie es im Buch der Mitte formuliert wird: »Man kann es vergleichen mit Himmel und Erde, die alle gleichermaßen tragen und beschirmen… Alle Wesen werden gleichermaßen genährt, ohne einander zu schaden. Alles geht gleichermaßen seinen Weg, ohne sich in die Quere zu kommen.«13 Gemeint ist damit, dass die Gesellschaft kompatible, jedoch unterschiedliche Lebensformen toleriert, wie auf einem Feld kompatible, doch unterschiedliche Pflanzen gedeihen. Hier dokumentiert sich eine metaphysische Annahme: Das Feld stellt den begrenzten Bereich aller Möglichkeiten dar und zugleich den 21Maßstab, an dem man sich zu orientieren hat. Da auf dem Feld die Toleranz des Kompatiblen herrscht, muss auch unter dem Himmel die Toleranz des Kompatiblen herrschen. Das kommt Leibniz’ Vorstellung einer göttlichen Richtschnur sehr nahe. Leibniz folgert »logisch«, dass die göttliche Richtschnur für die Welt die Möglichkeit des Miteinanders (compossibility) der unterschiedlichen Wesen der Schöpfung ist.14
Das von mir imaginierte Tianxia-System der Zukunft erfüllt im Wesentlichen die konfuzianische Norm der Toleranz des Kompatiblen oder Leibniz’ Richtschnur der Möglichkeit des Miteinanders. Das System des Tianxia ist keine idealistische Illusion, es verspricht nicht die Glückseligkeit jedes Einzelnen, es ist lediglich ein System, das Garantien für Frieden und Sicherheit in Aussicht stellt. Sein Dreh- und Angelpunkt liegt in der Nutzlosigkeit von Konkurrenz und antagonistischen Taktiken, genauer gesagt, in der Nutzlosigkeit von Aktionen, die darauf abzielen, andere zu vernichten, und es ist daher in der Lage, Koexistenz als Voraussetzung von Existenz zu sichern. Einfach gesagt, die Erwartung an das Tianxia-System besteht darin, dass es eine Daseinsordnung der Welt darstellt, deren Prinzip die Koexistenz ist.
3. Entitäten des Politischen
Politische Fragen werden durch die Entitäten politischer Existenz (political units) entschieden. Politische Entitäten (Systeme oder Institutionen) definieren das Innen und das Außen des Politischen, sie entscheiden über den Umfang politischer Probleme, über die Art und Weise der Interessenabwägung wie auch über die Operationsweise der Macht. So ist z. B. das Individuum die kleinste politische Entität, sie definiert den individuellen Nutzen, die individuellen Machtmöglichkeiten, die Art und Weise, andere vom Nutzen auszuschließen, sowie die damit verbundenen politischen Probleme. Mehrschichtige politische Entitäten formen einen politischen Rahmen, definieren den politischen Raum und entscheiden darüber, welche politischen Aktionen und Probleme denkbar sind und welche nicht.
Innerhalb des Rahmens der traditionellen politischen Philosophie Chinas existierten politische Entitäten auf drei Ebenen: Ti22anxia – Staat – Sippe. Der Einzelne war lediglich eine biologische Entität, bis zu einem gewissen Grad auch eine wirtschaftliche Rechnungseinheit, jedoch keine politische Entität. Die Fragen politischer Freiheit und individueller Menschenrechte waren daher im alten China nicht Teil der Agenda.15 Erst mit dem neuzeitlichen Import des westlichen Individualitätsbegriffs nach China wurde das Individuum zu einer politischen Entität. Innerhalb des Rahmens von Tianxia – Staat – Sippe war das Tianxia nicht nur die umfangmäßig größte politische Entität, sondern bildete auch das letztgültige Erklärungsprinzip für den gesamten Rahmen. Das Tianxia definierte den gesamten semantischen Kontext der Politik, sämtliche politische Fragen wurden im Rahmen des Tianxia-Konzepts interpretiert. In diesem politischen Raum wurde die politische Interpretation geformt durch die inklusive Ordnung (inclusive order) der drei Ebenen Tianxia – Staat – Sippe, die ethische Interpretation dagegen nahm die Form einer extensiven Ordnung (extending order) Sippe – Staat – Tianxia an. Beide zusammen bildeten einen sich gegenseitig erklärenden internen Kreislauf.
Der Rahmen der modernen Politik wird durch die Struktur Individuum – Gemeinschaft – Nationalstaat definiert, bereits der Staat bildet darin die umfangmäßig größte Entität. Es gibt kein politisches Subjekt, das über dem Staat angesiedelt ist. Das Individuum bildet die Grundlage des Rahmens moderner Politik und bietet die letztgültige Erklärung für das Ganze der politischen Struktur, die damit dem Erklärungsmodell des Tianxia diametral entgegengesetzt ist. Die beiden politischen Systeme formen zusammen eine Art gegenseitig versetzter Zahnräder, die sich strukturell ergänzen. Die Ergänzung kann die Kapazität der politischen Welt erweitern und dazu beitragen, ein neues Konzept des Politischen zu schaffen. Fehlt nämlich die Ebene des »Individuums«, fehlt die politische Garantie individueller Autonomie. Fehlt die Ebene des »Tianxia«, dann hängt das Weltsystem in der Luft, die Überwindung des anarchischen Zustands und die Erreichung des Weltfriedens wird unmöglich. Wenn es nicht gelingt, eine angemessene Weltordnung zu schaffen, droht sich die globale Politik angesichts der Entstehung neuer Mächte, die im Zuge der Globalisierung allmählich die Politik der Staaten und deren Kontrollmöglichkeiten internationaler Politik hinter sich lassen, in ein Risikospiel des Kontrollverlustes zu verwandeln.
23Die Politik der Moderne produziert zwei Typen politischer Probleme: Die der nationalen Politik und die der internationalen Politik. Wesen, Ziele und Regeln nationaler Politik sind von höchster Klarheit, Wesen, Ziele und Regeln internationaler Politik sind dagegen nicht festgelegt und kaum festzulegen. Es ist nicht einmal klar, ob internationale Politik darauf abzielt, zwischenstaatliche Konflikte zu lösen oder zusätzliche Konflikte zu schaffen. Die internationale Politik verfügt über keine ihr innewohnenden Ziele und Ideale, sie ist vielmehr ein Derivat staatlicher Politik, sie dient der Außenpolitik im Interesse des Staates. Internationale Politik ist daher nur ein Anhängsel staatlicher Politik. Kant hat einst eine bewundernswerte Idee formuliert, als er erkannte, dass Krieg nicht in der Lage ist, Interessenkonflikte zwischen Staaten zu lösen, und es daher eines Plans für einen immerwährenden Frieden bedürfe. Aber Kants Vorstellung von einem »Bund freier Staaten« überstieg nie das Konzept einer auf Nationalstaaten beruhenden internationalen Politik, es ist nicht imstande, das später von Huntington aufgeworfene Problem des »clash of civilizations« zu lösen, ja es ist nicht einmal in der Lage, die Stabilität und Glaubwürdigkeit eines internationalen Bundes zu garantieren. Staaten, die nach exklusiver Nutzenmaximierung streben, unterliegen den gleichen Regeln wie Einzelpersonen, die nach Maximierung privaten Nutzens streben. Ohne einen auf stabiles Vertrauen gegründeten gemeinsamen Nutzen oder gegenseitige existenzielle Abhängigkeit sind selbst kulturell äußerst homogene Staatenbündnisse unzuverlässig und instabil. In der modernen Welt mit ihren höchst unterschiedlichen Niveaus im technologischen und wirtschaftlichen Bereich wird imperialistische Dominierung und Ausbeutung des »Restes der Welt« zwangsläufig zur vorherrschenden Strategie (dominating strategy) der mächtigen Staaten. Dennoch sind Ausbeutung und Unterdrückung nur vorübergehender Erfolg beschieden. Da der Imperialismus nicht in der Lage ist, Widerstand und die strategische Nachahmung durch Konkurrenten zu verhindern, ist ihm kein dauerhafter Erfolg beschert. Marx hat darauf hingewiesen, dass der Kapitalismus seine eigenen Totengräber heranzüchtet, offenbar gilt das ebenso für den Imperialismus. Aber der von Marx entsprechend seiner Klassentheorie erdachte »Internationalismus« ist gleichermaßen unzuverlässig. Im System konkurrierender Nationalstaaten übertreffen die Interessenkonflikte zwischen den proletarischen Klassen der jeweiligen 24Länder sogar die Interessenwidersprüche zwischen den nationalen Kapitalistenklassen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung der Proletarier aller Länder noch geringer als ein Zusammenschluss der Kapitalisten aller Länder. Ohne Veränderungen im Wesen der existenziellen Weltordnung sind internationale Widersprüche kaum effektiv zu lösen. Es ist sinnlos, darauf zu hoffen, dass die diversen Strategien internationaler Politik wie Dominanz, strategisches Gleichgewicht, Eindämmung, Sanktionen, Interventionen, sogar Krieg, Geopolitik oder kulturelle Hegemonie Konflikte lösen, sie vertiefen im Gegenteil die Widersprüche. Ebenso wenig dürfen wir Hoffnungen in die ethischen Vorstellungen des Kosmopolitismus oder Internationalismus setzen, moralische Utopien sind nicht in der Lage, interessengeleitete Entscheidungen von Menschen zu verändern, sie können lediglich die Absurditäten des Lebens noch deutlicher vor Augen führen. Wie soll es den Weltbürger geben, bevor eine Welt universeller Teilhabe existiert? Und wo soll er existieren? Wir müssen Vorstellungen der Zukunft entwickeln, aber wir können die Zukunft nicht vorwegnehmen.
Die internationale Politik ist nicht nur unfähig, internationale Konflikte zu lösen, sie ist im Gegenteil unaufhörlich damit beschäftigt, nach Strategien zu suchen, die dem Gegner Niederlagen zufügen. Das ist durchaus nachvollziehbar, da unter den Voraussetzungen des Nationalstaatensystems keine Rezepte der Konfliktlösung existieren, außer dem Kampf bis zum bitteren Ende. Die Strategien internationaler Politik sind keineswegs dumm, sie sind in Wirklichkeit nur allzu raffiniert. Und genau darin liegt das Problem: Warum sind wir trotz derart ausgeklügelter Theorien, Strategien und Erfahrungen hoffnungslos unfähig, die Probleme zu lösen? Die Fakten beweisen, dass die internationale Politik, abgesehen von einigen unbedeutenden Disputen, keinen einzigen ernsthaften Konflikt gelöst hat, wie z. B. den zwischen Israelis und Palästinensern, die Probleme des Mittleren Ostens, den Konflikt zwischen Russland und dem Westen oder die Gegensätze zwischen den USA und China. Politische Analysten sind immer gut darin, akzidentielle Ursachen für politisches Versagen zu finden, sie mögen bis zu einem gewissen Grad Recht haben, aber die wirklich entscheidende Ursache liegt darin, dass die Konkurrenten über gleich raffinierte Strategien verfügen, es gibt in strategischer Hinsicht sogar geteiltes Wissen (common knowledge), Pattsituationen sind daher 25unvermeidbar. Solange die Kontrahenten auf beiden Seiten gleich schlau und gnadenlos sind, führen auch die raffiniertesten Strategien nicht zum Ziel. Selbst wenn eine Seite vorübergehend die Oberhand gewinnt, führen strategische Nachahmung oder Gegenmaßnahmen der anderen Seite zu Niederlagen, wenn man glaubt, den Sieg bereits vor Augen zu haben. Strategien und Theorien der internationalen Politik sind bereits extrem elaboriert, und es ist durchaus denkbar, noch raffiniertere Strategien zu entwickeln, aber sie sind, gleichgültig, mit welcher strategischen Raffinesse die Kämpfe geführt werden, zum Scheitern verurteilt. Hierin liegt die Beschränktheit internationaler Politik, und sie macht deutlich, dass die Konzepte internationaler Politik allmählich versagen. Unter den Bedingungen der Globalisierung schrumpft die Theorie der internationalen Politik zu einer Theorie partikularer Kämpfe, sie ist unfähig, die politischen Fragen der Welt als Ganzes zu erklären.
Die Globalisierung verändert den Existenz-Modus der Welt und die Lebensweise der Menschheit; und sie verändert damit zwangsläufig auch die politischen Fragestellungen. Das Heraufkommen der Globalisierung enthüllt die Defizite der internationalen Politik, die unfähig ist, auf die durch die Globalisierung herbeigeführten neuen Fragestellungen zu reagieren, angesichts globaler Fragen zeigt sie sich sogar völlig hilf- und ratlos. Der Begriff des Zusammenlebens bezieht sich nicht mehr nur auf das Innere von Nationalstaaten oder Gemeinschaften, es geht zunehmend um das Zusammenleben im globalen Maßstab, und dies wirft die Frage einer über das System der Nationalstaaten hinausgehenden Machtausübung auf. Bei zunehmend enger werdender Interdependenz aller Staaten muss sich die Frage nach der Souveränität der Welt stellen. Neben staatlicher und internationaler Politik ist daher ein weiteres politisches Konzept erforderlich, das sich als »Globalpolitik« oder »Weltpolitik« bezeichnen ließe. Dieses politische Konzept betrachtet die gesamte Welt als größte Maßeinheit der Bedingungen des Zusammenlebens und versteht und interpretiert davon ausgehend die politischen Fragen in der Welt. Das bedeutet, dass die Kernfrage der globalen Politik die »Inklusion der Welt« ist, und genau das meint die Umwandlung der Welt gemäß dem »Alles unter dem Himmel«.
264. Die Inklusion der Welt und die Souveränität der Welt
Die Politik der Einzelstaaten hat zwar ihrer Logik folgend eine internationale Politik entwickelt, jedoch ist diese unfähig, sich zu einer Globalpolitik zu entwickeln. Internationale und globale Politik stehen gemäß politischer Logik im Widerspruch zueinander, daher kann internationale Politik nicht als Basis globaler Politik dienen. Daraus folgt, dass die politische Theorie sich auf die Suche nach einem anderen Ausgangspunkt machen muss. Die Spielregeln neuzeitlicher Politik werden im Wesentlichen durch das Individuum und den Nationalstaat bestimmt und der Anwendungsbereich des politischen Systems ist auf den Staat beschränkt. Die Welt außerhalb des Staates kennt nur Strategien und bildet kein System, daher enden Souveränität und Politik an den Grenzen des Staates. Sobald Politik sich nach außen wendet, verwandelt sie sich in Abwehr bis hin zum Krieg. Der Ausspruch, Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln (von Clausewitz) müsste eigentlich heißen, Krieg ist das Scheitern der Politik, ist ein Vabanquespiel der Politik, wenn sie nicht mehr weiterweiß. Nur weil die Welt als ein Äußeres angesehen wird, ist der wirkliche Gehalt internationaler Politik der als Politik camouflierte Krieg, sie ist in Wahrheit das Gegenteil von Politik. Die Abwehrlogik der modernen Politik macht jede Hoffnung zunichte, den anarchischen Zustand der Welt und die Konflikte zu beenden. Wie positiv die Ordnung innerhalb eines Staates auch sein mag, er wird durch die Unordnung der Welt als Ganzes bedroht, unter Umständen sogar in ein Chaos hineingezogen, aus dem er sich nicht mehr selbst befreien kann. Sobald im Zuge der Globalisierung Politik zu einer Angelegenheit im Weltmaßstab wird, verlieren internationale Strategien ihre Wirkungskraft.
Einige moderne Philosophen haben bereits früh die in der modernen Politik lauernden Gefahren erkannt. Kant war der Ansicht, man müsse das internationale Recht zu einem kosmopolitischen Recht (cosmopolitan law) entwickeln, worin jeder Mensch nicht nur die bürgerlichen Rechte seines eigenen Staates, sondern zugleich die Bürgerrechte einer kosmopolitischen Föderation (cosmopolitan commonwealth) besäße und damit zum Weltbürger würde. Jedoch, wie bereits erwähnt, bleibt der »Weltbürger« ein leeres Wort, solange die Welt nicht eine Welt gemeinsamer Teilhabe geworden ist. Unter heutigen Umständen ist die Idee des Weltbürgers eine Vor27wegnahme der Zukunft. Kant selbst entdeckte, dass die Idee des Völkerbundes nicht trägt (bzw. zur Tyrannei führen kann), deshalb hielt er am Ende die »Föderation freier und souveräner Staaten« für die bessere Lösung. Auch Habermas vertritt die Auffassung, dass die Vereinten Nationen das internationale Recht in ein kosmopolitisches Recht umwandeln sollten, als dessen grundlegende Prinzipien er die Menschenrechte betrachtet. Aber all diese Bemühungen haben eine gemeinsame Schwäche: Sie berücksichtigen nicht die »schlechteste aller Möglichkeiten«, dass sie nämlich der Herausforderung durch tiefgreifende Interessen- oder kulturelle Konflikte nicht standhalten. Außerdem enthalten sie einen impliziten Widerspruch: Während sie danach streben, die Beschränktheit moderner Politik zu überwinden, halten sie an der Logik moderner Politik fest. Kants Ideal mag auf kulturell hochgradig homogene Regionen anwendbar sein (z. B. Europa), aber es fehlt ihm die Fähigkeit, globale Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Zivilisationskonflikte, Finanzkriege und Hegemonialherrschaft. Es ist nicht einmal in der Lage, längerfristig die Stabilität und Zuverlässigkeit der Kooperation innerhalb eines Staatenbundes zu garantieren (wie das Beispiel der Zwistigkeiten innerhalb der EU praktisch zeigt). Habermas’ Verweis auf die Prinzipien der Menschenrechte ist ein heutzutage noch gängigeres Phänomen, aber das Konzept der Menschenrechte impliziert zahlreiche unlösbare »ethische Dilemmas«.16 Wenn jedes der Menschenrechte unantastbar ist, wie steht es dann bei Konflikten zwischen den Menschenrechten? Wenn die Menschenrechte jedes Individuums absolute Autorität besitzen, wie steht es dann bei Konflikten zwischen Menschenrechen von Individuen? Oder bei Konflikten zwischen den Menschenrechten verschiedener Regionen? Wie soll in solchen Zwickmühlen entschieden werden? Sind Entscheidungen möglich, verlangt das Prinzipien, die den Menschenrechten übergeordnet sind. Lassen sie sich nicht entscheiden, bergen die Menschenrechte in sich ein Paradox. Ohne Frage sind die Menschenrechte eine großartige Sache, das Problem ist, dass die Theorie der Menschenrechte noch immer unvollkommen ist und Widersprüche in sich trägt, weshalb sie zur Konfliktlösung nicht ausreicht. Daneben versucht die moderne Politik, Probleme durch Verhandlung, Feilschen und den Abschluss von Verträgen zu lösen. Nicht allein, dass sich internationale Abkommen nicht wirklich als zuverlässig erwiesen haben, entscheidender ist, was geschieht, wenn 28Interessen- und Machtkonflikte oder religiöse und kulturelle Auseinandersetzungen nicht verhandelbar sind, keine Toleranz zulassen und sich darüber keine vertraglichen Vereinbarungen erzielen lassen? Obwohl sich in Huntingtons Analyse der gegenwärtigen Weltsituation zahlreiche Fehlurteile finden, besitzt die von ihm aufgeworfene Frage hinreichende Überzeugungskraft, weder Kant noch Rawls und Habermas können die von Huntington aufgeworfene Frage des »clash of civilisations« beantworten.
Moderne Politik beruht auf der Grundidee des Aufteilens (dividing), sie setzt allerlei Arten von Grenzen: Die individuellen Menschenrechte sind die Grenze des Individuums, die Souveränität bezeichnet die Grenze des Staates, das ist jedoch zugleich eine die Welt spaltende Logik. Aus diesem impliziten Widerspruch kann sie sich nie befreien. Um all die Grenzen zu schützen, konzentriert sich die moderne Politik auf die Suche nach äußeren Feinden, gibt es keine, müssen welche definiert werden. Diese Politik der Spaltung lässt sich überall beobachten. Vom Heidentum bis zum Rassismus, vom heißen Krieg bis zum Kalten Krieg, vom Kolonialismus bis zur Intervention zum Schutz der Menschenrechte, von der wirtschaftlichen und militärischen bis zur finanziellen, technologischen und kulturellen Hegemonie, selbst in den Phantasien der interplanetarischen Kriege findet sich das Motiv der Suche nach dem Feind. Der klare Trennungsstrich zwischen sich und dem anderen produziert Gegensätze, wo ursprünglich keine vorhanden waren. Eine solche Politik ist unfähig, zu erkennen, dass die Inklusion der Welt das eigentliche politische Problem darstellt, sie ist unfähig, die Welt als politisches Subjekt zu begreifen und Weltinteressen zu definieren, noch weniger ist sie fähig, die Notwendigkeit einer Weltsouveränität zu erkennen. Ist die Politik des Spaltens daher mit der Schwierigkeit wechselseitiger Konflikte konfrontiert, besteht der einzige Friedensplan, über den sie verfügt, im »Zusammenbasteln« aller möglichen internationalen Allianzen oder Lager. Aber die Welt lässt sich nicht zusammenbasteln, weil die Gegenstände, die miteinander im Konflikt liegen, sich nicht zusammenbasteln lassen. Die Hobbes’sche Tradition der Betonung des Kampfes bzw. die Locke’sche Tradition der Betonung der Konkurrenz ebenso wie die Kantische Tradition der Suche nach Friedensabkommen sind sich zwar alle der Gefahr von Konflikten bewusst, aber weil sie alle apriorisch von der Annahme des Anderen als Äußeren ausgehen, 29sind sie unfähig, Spannungen und Konflikte zwischen den Subjekten (intersubjective) aufzulösen.
Entscheidend ist die Tatsache, dass die Globalisierung den Existenz-Modus und das Wesen des Politischen verändert und die moderne Politik die Fähigkeit verloren hat, die neuen politischen Fragen zu verstehen und zu interpretieren. Der Versuch, ihre Konzepte hier und da zu korrigieren, muss trotz aller Bemühungen scheitern, sie muss eingestehen, dass die moderne politische Philosophie keine brauchbare politische Theorie zustande gebracht hat. Ohne das Prinzip der Inklusion der Welt lässt sich die Legitimität politischen Handelns außerhalb staatlicher Politik nicht verstehen und erklären. Die von der politischen Philosophie der Moderne determinierten politischen Konzepte sind, was allgemeine Praktikabilität und universelle Legitimität angeht, in vielerlei Hinsicht fragwürdig. So geht die moderne Politik zum Beispiel davon aus, dass die Demokratie universelle Gültigkeit besitzt, würde man allerdings nationalstaatliche Demokratie zu einer Weltdemokratie aufwerten, wären vermutlich sämtliche entwickelten Länder dagegen (Rawls z. B. lehnt trotz seiner Begeisterung für Demokratie eine globale Demokratie ab). Auch der Gerechtigkeit wird universelle Geltung zugestanden, aber weder die entwickelten Staaten noch die Staaten mit reichen natürlichen Ressourcen würden globale Gerechtigkeit akzeptieren. Würde eine große Zahl von Menschen im Namen des Weltbürgertums und der globalen Freiheit das Recht auf freie Migration fordern, würden diese Staaten vermutlich ebenso wenig zustimmen usw. Die von der politischen Philosophie der Moderne propagierten Werte und Systeme gelten nur für die diskriminierenden Bedingungen der Nationalstaaten, ihre Übertragung auf ein globales System hätte katastrophale Auswirkungen. Die moderne politische Philosophie basiert nicht auf einer politischen Theorie von universeller Geltung, sie ist eine ausschließlich nationalstaatliche Theorie. Wir müssen einen neuen Ausgangspunkt für das Politische finden.
Vor allem benötigen wir das Prinzip der Inklusion der Welt. Eine Spielregel des politischen Spiels hat nur dann universelle Geltung, wenn sie auf die gesamte Welt anwendbar ist. Solange es auch nur einzelne politische Räume gibt, die nicht kooperieren können oder ausgeschlossen werden, haben die politischen Spielregeln keine universelle Geltung, dann existiert notwendigerweise ein nicht zu 30beseitigendes negatives Äußeres, und genau darin liegt die Wurzel von Konflikten. Universell geltende politische Spielregeln müssen daher die gesamte Welt und alle Ebenen der Politik durchdringen (transitivity) und systematische Kohärenz (coherence) besitzen. Das heißt, eine politische Spielregel muss auf sämtliche Gebiete (Länder und Regionen) sowie auf sämtliche Beziehungen (zwischen Individuen wie zwischen Staaten) anwendbar sein und darf keinem Gebiet und keinem Menschen Schaden zufügen, andernfalls entstehen zwangsläufig unauflösbare Konflikte. Es steht außer Frage, dass es auf der Welt immer Konflikte geben wird, sie sind Teil des menschlichen Lebens, eine vollständig »harmonische Welt« wird es nie geben. Die universelle Geltung einer politischen Spielregel liegt in ihrer Fähigkeit, stets aufs Neue auftretende Konflikte zu lösen, nicht darin, ihr Auftreten zu verhindern. Die Erwartung an das Tianxia-System besteht darin, dass es politische Kompatibilität erzielt. Das Konzept des »Miteinanders (der Kompatibilität) der zehntausend Völker« entstammt sprachlich dem Buch der Urkunden (尚书),17 einer uralten Sammlung politischer Texte. Kompatibilität meint die Möglichkeit, aus einem Feind einen Freund zu machen und mittels Kompatibilität eine Politik des Friedens zu garantieren. Grundsätzlich gilt: Politik, die nicht Koexistenz (coexistence) zu ihrer ontologischen Grundannahme macht, ist unfähig, die Inklusion der Welt zu denken. Gemäß einer koexistenziellen Ontologie ist ein wohltätiger Kreislauf von Koexistenz dann möglich, wenn zwischen unterschiedlichen Existenzen notwendige und nicht zufällige Interdependenzen entstehen. Die entscheidende Frage der Inklusion der Welt ist die Möglichkeit stabiler und auf Vertrauen basierender Koexistenz.
Die konfuzianische Philosophie wählte die Sippe als Grundeinheit der Koexistenz, sie hoffte, die Koexistenzialität der Sippe Stufe um Stufe auf größere Einheiten der Koexistenz zu übertragen, um am Ende das »Alles unter dem Himmel« zu formen, das sie als »eine Sippe innerhalb der vier Meere« beschreibt. FEI Xiaotong (费孝通) bezweifelt diese konfuzianische Wunschvorstellung: »Überträgt man familiäre Verhältnisse auf Außenstehende, schwächt sich das Gen der Familiarität immer weiter ab, bis es endlich seine Wirkung verliert.«18 Familiarität stellt zwar den Idealzustand der Inklusivität dar, ist aber in der realen Welt nur schwer zu erreichen. Daher sind die drei Stufen 31Tianxia – Staat – Sippe untereinander nur partiell isomorph. Laozi bedient sich einer Methodologie, die der Realität näherkommt: »Nach dem (Charakter des) Einzelnen beurteile den Einzelnen; nach dem (Charakter des) Dorfes beurteile das Dorf, nach dem (Charakter des) Staates beurteile den Staat, nach dem (Charakter der) Welt (Tianxia) beurteile die Welt (Tianxia). Wie weiß ich, dass die Welt (Tianxia) so ist? Durch dieses.«19 Damit ist gemeint, dass man x nur verstehen kann, wenn man dabei von x ausgeht. Übernimmt man den Standpunkt Laozis, lässt sich das Prinzip der Inklusion der Welt noch rationaler verstehen und erklären. Es bewirkt, dass die Welt zum alles in sich einschließenden (all-in-clusive) Tianxia wird, ein Tianxia, das »kein Außen« kennt. Als Ergebnis besteht die Welt nur aus einem Innen und besitzt kein unmöglich zu überwindendes Außen mehr. Der Andere wird nicht mehr als Abweichler begriffen, mit dem Koexistenz unmöglich ist, unterschiedliche Wertvorstellungen werden nicht mehr als inakzeptables Heidentum definiert. Das wäre die notwendige Voraussetzung für ewigen Frieden, allgemeine Sicherheit bis hin zu universeller Kooperation. Das konfuzianische Ideal der »einen Sippe zwischen den vier Meeren« ist durch die Internalisierung der Welt vermutlich nicht zu verwirklichen, aber es ist eine real erreichbare mögliche Welt. Eine inklusive Welt, die ohne Außen existiert, bewirkt, dass die Attraktion von Koexistenz und Kooperation stärker ist als die von Feindschaft. Damit erst sind Stabilität und Zuverlässigkeit von Frieden und Sicherheit gewährleistet.
Eine von der Inklusion der Welt getragene globale Sicherheit ist offenkundig zuverlässiger als eine durch internationale Abkommen oder durch ein Gleichgewicht der Mächte garantierte internationale Sicherheit. Die beiden wichtigsten Friedensstrategien der internationalen Politik sind in Wahrheit sehr unzuverlässig:
Der Frieden unter hegemonialer Herrschaft. Dominanz-Systeme dieser Art sind nie in der Lage, die Welt vollständig zu kontrollieren und das Aufkommen neuer Kräfte zu verhindern, die sie ersetzen (die Geschichte ist voll von Beispielen). Unterdrückung und Ausbeutung durch hegemoniale Systeme führen stets zu Widerstand und Kooperationsverweigerung (wo es Unterdrückung gibt, gibt es Widerstand), die zur Zersetzung des Systems führen.
32