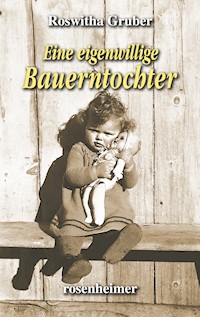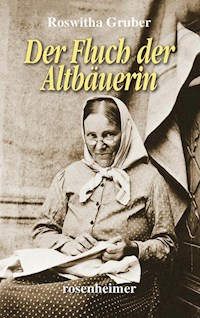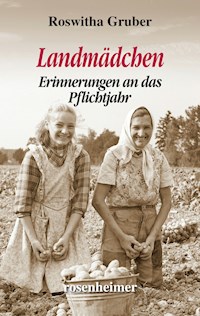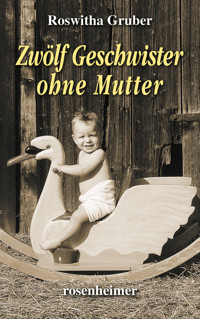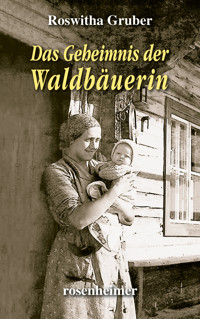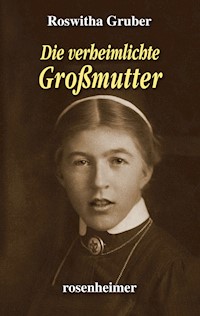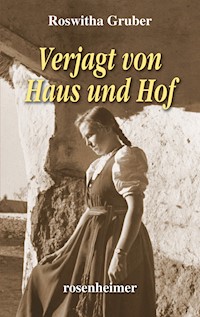16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Kreißsaal einer kleinen Münchner Klinik liegen zwei Frauen in den Wehen. Bei beiden kündigt sich eine komplizierte Geburt an, bei der es um Leben und Tod geht. Die Hebamme Aloisia fühlt sich überfordert. Doch da die herbeigerufenen Ärzte nicht rechtzeitig eintreffen, sieht sie sich, ganz auf sich selbst gestellt, zum Handeln gezwungen … Doch ihre eigenmächtige Entscheidung, mit der sie schicksalhaft in das Leben zweier Familien eingreift, wird für lange Zeit ihr Gewissen belasten. Erst als sie 94 Jahre alt ist, kommt die Wahrheit durch einen sonderbaren Zufall ans Licht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelbild: getty images, Fox Photos
Lektorat: Gisela Faller, Stuttgart
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54375-3 (epub)
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Aloisia
Eine Hebamme spielt Schicksal
Im Kreißsaal einer kleinen Münchner Klinik liegen zwei Frauen in den Wehen. Bei beiden kündigt sich eine komplizierte Geburt an, bei der es um Leben und Tod geht. Die Hebamme Aloisia fühlt sich überfordert. Doch da die herbeigerufenen Ärzte nicht rechtzeitig eintreffen, sieht sie sich, ganz auf sich allein gestellt, zum Handeln gezwungen …
Doch ihre eigenmächtige Entscheidung, mit der sie schicksalhaft in das Leben zweier Familien eingreift, wird für lange Zeit ihr Gewissen belasten. Erst als sie 94 Jahre alt ist, kommt die Wahrheit durch einen sonderbaren Zufall ans Licht.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Kapitel 1
Auf dem stattlichen Einödhof des Gumperbauern wachte die Bäuerin Kreszentia Moosberger in der Nacht zum 3. Februar 1965 kurz vor Mitternacht auf. Mit einer Hand tastete sie hinüber zum Bauern.
»Du, Blasi, ich glaub, es geht los«, sagte sie halblaut zu ihm, als er ein unwilliges Knurren vernehmen ließ. »Lass den Girgl anspannen, damit er die Aloisia herholt.«
»Bist du sicher?«, murmelte ihr Mann, immer noch im Halbschlaf. »Es ist doch noch gar nicht an der Zeit.«
»Das hab ich auch gedacht, als die Schmerzen vor einer Stunde das erste Mal kamen«, gab die Bäuerin zurück. »Aber jetzt kommen sie schon alle zwanzig Minuten. Das ist ganz eindeutig, Blasi. Damit sollte ich mich wohl auskennen.«
Als Mutter von sechs Kindern war sie zu dieser Feststellung durchaus berechtigt. Der Bauer war plötzlich hellwach, sprang mit einem Satz aus dem Bett und tastete im Dunkeln nach seiner Hose.
»Das überlass ich nicht dem Girgl. Da fahr ich schon selber, wo ich eh wach bin. Soll ich dir die Magd schicken?«
»Ja, sie soll hier schon mal einheizen und Wasser aufsetzen.«
Auch wenn es im nahen München schon üblich war, die Kinder im Krankenhaus zur Welt zu bringen, auf dem Dorf hatte sich das noch nicht durchgesetzt, und für die Hebamme Aloisia Gaßlmaier gehörte es zum Alltag, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit bereitzuhalten. Natürlich wusste sie immer, bei welchen Müttern aus dem Umkreis es demnächst so weit sein würde, aber mit Zenta Moosberger hatte sie eigentlich erst Anfang März gerechnet. Das Kind kam also zu früh.
Ein eigenes Telefon war zu jener Zeit noch nicht so sehr verbreitet, aber die Hebamme hatte natürlich eines. Der Gumperhof freilich nicht, und so musste der Bauer die Aloisia dennoch aus dem Bett herausklingeln. Aber sie hatte schon von Berufs wegen einen leichten Schlaf und das Nötige immer griffbereit, und so dauerte es nicht lange, bis sie losfahren konnten.
Auch ein Auto hatte Aloisia Gaßlmaier schon, anders als die meisten Bauern in der Umgebung. Doch am Abend hatte es noch einmal kräftig geschneit. Mit dem Auto wäre die Fahrt zum abgelegenen Gumperhof hinauf deshalb viel mühsamer gewesen als mit dem Pferdeschlitten. Also setzte sie sich zum Moosberger in den Schlitten und ließ sich von ihm hinaufbringen.
Auf dem Gumperhof war die Hebamme schon oft zu Gast gewesen, aber dennoch wusste sie, dass es kein Routinebesuch sein würde. Nicht nur deshalb, weil es immer ein Alarmzeichen war, wenn eine Geburt zu früh einsetzte, sondern auch, weil sie genau wusste, was die Bäuerin auszustehen haben würde, falls das Kind wieder ein Mädchen sein sollte. Sechs gesunde Kinder hatte die Zenta bereits geboren, aber der Sohn und Hoferbe, den sich der Bauer so sehr wünschte, stand immer noch aus. Der Moosberger war deshalb fast schon am Verzweifeln.
Seine Zenta hatte er einstmals, fast schon zwanzig Jahre war das her, aus Liebe geheiratet, was für damalige Verhältnisse ein bisschen ungewöhnlich gewesen war. Aber bei diesem Paar schienen die Gefühle wirklich einmal zwei miteinander verbunden zu haben, die perfekt zueinander passten: Sie war die Tochter des reichsten Bauern aus dem Nachbardorf und damit eine sehr passende Bäuerin für den stattlichen Gumperhof, dazu noch jung und blitzsauber.
Die damalige Gumperbäuerin hatte zwar eigentlich eine andere als Schwiegertochter im Auge gehabt, doch unter solchen Umständen leistete sie gegen die Wahl ihres Sohnes keinen allzu großen Widerstand. Zenta hatte dazu noch immerhin vier Brüder. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dass ausgerechnet sie keinen Hoferben zur Welt bringen könnte.
Der Bauer musste sich im Dorf viel Spott gefallen lassen mit seiner Mädchenschar. Nach der Geburt der jüngsten Tochter hatte ein ganz Unverschämter am Stammtisch sogar angeboten: »Es müsst halt mal ein andrer Gockel auf den Mist. Soll ich vielleicht aushelfen?«
Alle Anwesenden bogen sich vor Lachen, und dem Moosberger blieb nichts anders übrig, als mitzulachen, obwohl er diesem Lackl, der es gewagt hatte, seine Männlichkeit anzuzweifeln, am liebsten seinen Maßkrug über den Schädel gezogen hätte. Seine Wut und Enttäuschung ließ er danach an seiner Frau aus. »Was bist du denn für eine Henne, die nur Hühner ausbrütet?«, warf er ihr vor, was auch nicht weniger ungerecht war als der Spott, den er selbst am Stammtisch einzustecken gehabt hatte.
Es war aber nicht nur das Geschwätz der Stammtischbrüder, das den Bauern und die Bäuerin vom Gumperhof unter Druck setzte. Auch die alte Moosbergerin lag ihm nach jeder Entbindung von Neuem wieder in den Ohren: »Ich hab ja gleich gesagt, die Zenta ist nicht die Richtige für dich, aber du hast sie ja unbedingt haben müssen! Hättest du nur auf mich gehört und die Hinterhuber Christl genommen! Drei Buben hat sie schon. Die Zenta ist doch gar nicht robust genug, um einen Buben auf die Welt zu bringen.«
»Ach geh, hör mir auf mit der Christl!«, schnitt er ihr dann das Wort ab. »So ein fettes, unförmiges Trumm, wie die geworden ist. Und streitsüchtig noch dazu! Nein, mit dem Lenzbauern möchte ich nicht tauschen. Und der Bub wird schon noch kommen.«
»Ja, aber wann? Wenn du gleich einen Buben gekriegt hättest, wäre er jetzt schon groß genug, dass du eine Hilfe hättest.«
»Ach, Mutter, gib eine Ruh!«
So ähnlich verliefen diese Gespräche jedes Mal. Was ihm noch mehr als die Reden seiner Mutter zusetzte: Er saß immerhin auf dem jahrhundertealten Gumperhof, auf dem seit dem Dreißigjährigen Krieg immer ein männlicher Erbe dagewesen war. Sein Vater war sehr stolz darauf gewesen und hatte sogar einen Stammbaum malen lassen, dessen knorrige Wurzeln bis ins Jahr 1627 hinabreichten. Ohne Unterbrechung folgte auf ihm ein Moosbergersohn dem anderen, und als Letzten hatte er den Namen seines eigenen Sohnes einzeichnen lassen: Blasius Moosberger, geboren 1914.
In der Region war es üblich, dass der Erstgeborene immer den Vornamen des Vaters bekam. Im Stammbaum wechselte der Vorname aber manchmal, und das ließ darauf schließen, dass es nicht immer der Älteste gewesen war, der den Hof übernommen hatte. Krieg oder Krankheit mochten manchmal den Erstgeborenen dahingerafft haben. Aber einen männlichen Erben hatte es dennoch immer gegeben. Sollte er nun der letzte Trieb an diesem Baum bleiben?
»Aloisia, schau, dass du den Buben diesmal herbringst«, sagte er zu der Hebamme, während sie durch die Nacht dem Hof zu fuhren.
»An mir soll’s nicht liegen«, gab sie im selben, nur scheinbar scherzhaften Ton zurück. »Ich kann ja nur rausholen, was drin ist. Aber wenn der Herrgott es will, dann sollte es schon klappen.«
»Hör mir bloß auf mit dem Herrgott!«, brauste der Gumperbauer da auf. »Wenn’s diesmal wieder kein Bub wird, dann ist er für mich erledigt. Dann sieht der mich in seiner Kirche nimmer.«
»Aber geh, Blasi, wie kannst du nur so gottlos daherreden«, tadelte ihn Aloisia. »Erpressen lässt sich der Herrgott doch nicht! Überleg lieber, wie viel du ihm verdankst. Sechs gesunde Kinder!«
»Was nützt mir das?«, fragte er zurück. »Ich brauch doch einen Erben für den Hof.«
»Ein Madl kann den Hof ebenso gut übernehmen. Woanders kommt das ja auch vor.«
»Woanders, woanders! Was interessiert mich das? Bei uns hat’s immer einen männlichen Hoferben gegeben. Brauchst nur auf unseren Stammbaum zu schauen, der im Hausgang hängt.«
»Ich weiß, ich weiß. Das letzte Mal hast du ihn mir von oben nach unten vorgelesen.« Sie musste ein Kichern unterdrücken. »Ein bisschen langweilig ist mir dabei ja schon geworden. Ein Blasius Moosberger nach dem anderen, dann ein paar Severin Moosbergers, dann wieder lauter Blasiusse und noch ein paar Severine! Und einmal war noch ein Johannes dazwischen, glaub ich.«
»Da siehst du doch, dass ich unbedingt einen Sohn brauche!«, ereiferte sich der Bauer. »Immer ist der Hof vom Vater auf den Sohn übergegangen. Und ich hab meinem Vater noch auf dem Sterbebett versprechen müssen, dass ich so lang weitermache, bis ich den Sohn auch hab. Aber wenn es diesmal kein Bub wird, wann dann? Mein Weib wird bald vierundvierzig.«
Das Versprechen, das Blasius Moosberger seinem Vater gegeben hatte, lastete wie ein Albdruck auf dem Hof, das war der Hebamme Aloisia Gaßlmaier bewusst. Wie hat sich die hübsche, lebensfrohe Kreszentia in den letzten Jahren verändert! Und auch die Töchter hatten zu leiden, denn ihr Vater nörgelte immer nur an ihnen herum. Dabei waren sie alle gesund, hübsch und gescheit, und die Älteren von ihnen erledigten fast schon ein Pensum an täglicher Arbeit wie eine vollwertige Arbeitskraft. Es war nicht recht, dass er seine Enttäuschung über den fehlenden Hoferben an ihnen ausließ.
»Gut, dass du kommst«, begrüßte die Bäuerin die Geburtshelferin. »Es beruhigt mich immer, wenn du da bist.«
Die Hebamme wärmte ihre Hände am Ofen auf, dann untersuchte sie die Gebärende. Es war alles in Ordnung, aber die Abstände der Wehen zeigten, dass es wohl noch einige Zeit dauern würde.
Der Bauer schritt unterdessen ruhelos in der Schlafkammer auf und ab.
»Geh, Blasi, magst du dich nicht in der Stube drunten aufs Kanapee legen? Du kannst jetzt doch nicht helfen. Und morgen in der Früh musst du wieder zeitig hinaus in den Stall«, ermahnte ihn seine Frau.
»Nein, Weiberl, schlafen könnt ich jetzt eh nicht. Da kann ich auch hier auf- und abgehen. Oder stört’s dich, Aloisia?«
Die Hebamme wusste genau, dass die Bäuerin froh gewesen wäre, durch seine Anwesenheit nicht noch zusätzlich nervös gemacht zu werden, aber sie hätte es nicht übers Herz gebracht, ihn jetzt schon fortzuschicken. Schließlich lastete der Druck auch auf ihm.
»Im Moment nicht«, sagte sie. »Du kannst dich aber hersetzen und einen Kaffee trinken. Die Vroni hat sicher genug gemacht.« Sie selbst hatte nach ihrer Ankunft sofort von der Magd eine Tasse hingestellt bekommen.
»Nein, keinen Kaffee«, wehrte der Moosberger ab. »Das ist doch Weiberzeug. Was ich jetzt vertragen könnte, wäre ein Enzian. Geh, Vroni, hol doch mal einen her.«
Träge verrann die Zeit, doch die Wehen wurden einfach nicht häufiger, und als sie sogar schwächer zu werden schienen, begann Aloisia, sich Sorgen zu machen. Zenta war bereits so abgekämpft, dass sie eine erneute Untersuchung fast teilnahmslos über sich ergehen ließ.
»Wir müssen ins Krankenhaus!«, sagte die Hebamme endlich zum Bauern gewandt, denn die Wehen hatten sich inzwischen sogar ganz eingestellt. »Lass so schnell wie möglich anspannen.«
Blasius Moosberger hatte schon gemerkt, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. »Wäre es nicht gescheiter, wenn ich unseren Doktor herhole?«, fragte er erschrocken.
»Das bringt gar nichts. Hier kann er nicht helfen, jedenfalls nicht ohne die Mittel, die er im Krankenhaus hat.«
»Was meinst du damit?«
»Der Muttermund öffnet sich nicht weiter. Man muss womöglich einen Kaiserschnitt machen oder das Kind mit der Zange holen.«
»Und was ist mit dem Kind?«
»Die Herztöne sind noch normal, aber wir müssen uns beeilen; das kann sich rasch genug ändern, wenn es mit der Geburt noch lange nicht vorwärtsgeht. Nimm ein paar Wolldecken mit. Vroni, füll eine Wärmflasche mit heißem Wasser.«
Für die Bäuerin war es in ihrem Zustand eine furchtbare Strapaze, in der Eiseskälte bis zum Haus der Hebamme auf dem Schlitten transportiert zu werden, obwohl der Bauer vorsichtig kutschierte und sie außerdem mit mehreren Decken warm eingepackt war. Im Dorf angekommen, drückte Aloisia dem Moosberger ihren Autoschlüssel in die Hand.
»Schaff du die Zenta ins Auto«, wies sie ihn an. »Ich ruf den Doktor an, dass er sich gleich auf den Weg ins Krankenhaus macht.«
»Und ich? Soll ich mitkommen zum Krankenhaus?«
»Dein Ross muss zurück in den Stall. Und helfen kannst du eh nicht«, erinnerte die Hebamme. »Fahr lieber wieder heim.«
Das tat er dann auch, nachdem sie wenige Minuten später wieder aus dem Haus herauskam. Dass sie den Arzt nicht direkt erreicht hatte, sagte sie ihm aber lieber nicht. Gerade erst kurz vor dem Anruf war er zu einem Sterbenden geholt worden, hatte seine Frau am Telefon gesagt, jedoch versprochen, sie werde ihn zum Krankenhaus schicken, sobald er wieder da sei.
Normalerweise wären die beiden Frauen schon nach einer Viertelstunde am Stadtrand von München angelangt, wo sich das kleine Belegkrankenhaus befand, in dem Dr. Fischer einige Betten hatte. Aber Aloisia musste vorsichtig fahren, denn obwohl der Schneepflug am späten Abend noch einmal unterwegs gewesen sein musste, befand sich schon wieder eine weiche Schneeschicht auf der festgefahrenen Schneedecke, und in all dem Weiß musste man aufpassen, dass man nicht von der Straße abkam. So kamen sie nur langsam vorwärts.
»Wieso ist es zu einem Geburtsstillstand gekommen?«, fragte Zenta auf einmal mit schwacher Stimme vom Rücksitz. »Von so was habe ich noch nie gehört.«
»Das kommt auch nur ganz selten vor«, erklärte die Hebamme, ohne den Blick von der Fahrbahn abzuwenden. »Es kann daran liegen, dass es in eurer Kammer noch zu kalt war. Deine Angst kann aber auch die Ursache sein.«
»Wieso Angst?«, fragte Zenta. »Sechs Kinder habe ich schon zur Welt gebracht, da werde ich doch beim siebten nicht auf einmal Angst bekommen.«
»Weil du denkst, diesmal müsse es unbedingt ein Bub sein«, gab Aloisia ganz unverblümt zur Antwort. »Du hast Angst vor dem Moment, wenn das Kind herauskommt, weil es dann vielleicht ja doch wieder ein Madl ist. Dein Körper hat sich möglicherweise deshalb verkrampft.«
»Das kann schon sein«, gab sie zaghaft zu. »Du weißt ja, wie viel dem Blasi daran liegt. Er ist vorhin auch so unruhig auf- und abgegangen, dass ich den Gedanken gar nicht aus dem Kopf herausbringen konnte, was er nur machen wird, wenn’s wieder kein Bub ist …«
»Du darfst dich nicht verrückt machen!«, mahnte Aloisia. »Schließlich kannst du nichts dafür.«
»Du hast gut reden«, seufzte Zenta. »Meine Schwiegermutter hat mir gestern Abend noch vorgehalten, dass es ganz allein an mir liegt. Sie sagte, ich sei zu nichts gut und hätte ihren Buben unglücklich gemacht, und sie sei von Anfang an dagegen gewesen, dass der Blasi mich nimmt und nicht die Christl.«
»Kein Wunder, dass die Wehen bei dir zu früh eingesetzt haben!« Die Hebamme spürte Erbitterung gegen die alte Moosbergerin in sich aufsteigen, die doch im Grunde auch keine böse Frau war, aber mit ihrem dummen Geschwätz alles nur noch schlimmer gemacht hatte.
Aloisia Gaßlmaier hatte sich mit der Gumperbäuerin in den letzten Jahren über jede neue Schwangerschaft gefreut, mit ihr auf einen Sohn gehofft und mit ihr gelitten, wenn es wieder kein Bub gewesen war, den sie ihr in den Arm legen konnte.
»Aloisia, gibt’s denn kein Mittel, dass es gewiss ein Bub wird?«, hatte sie nach der letzten Entbindung geradezu verzweifelt gefragt.
»Nein, Zenta, ich wüsste keines«, versicherte die Hebamme.
»Aber man hört die Leute doch allerlei darüber reden. Die einen sagen, wenn man’s vor dem Vollmond macht, wäre es gut, und die anderen sagen, danach wär’s besser, und manche meinen gar, bei Neumond würde es ein Bub.«
»Das sind doch alles Ammenmärchen«, rief Aloisia sie mit strengem Blick zur Ordnung. »Davon darfst du nichts, aber auch wirklich gar nichts glauben. Der Herrgott allein hat es in der Hand, was für ein Kind er einem schenken will. Und wer sechs gesunde Kinder hat, der hat allen Grund, Gott zu danken. Es kommen genug kranke oder behinderte Kinder zur Welt, Zenta!«
»Ob Beten vielleicht helfen kann?«, fragte die Moosberger-Bäuerin. »Aber ich hab doch schon beim letzten Mal so viel gebetet, und dann ist es doch wieder kein Bub gewesen!«
»Dann hat Gott das so gewollt. Aber bete ruhig, schaden kann es auf keinen Fall«, versicherte ihr die Geburtshelferin tröstend.
An dieses Gespräch erinnerte sich die Bäuerin jetzt. »Ich habe viel gebetet, Aloisia. Und ich mein fast, der Herrgott hat mich erhört. Diesmal war es nämlich ganz anders als bisher. Das Kind war viel lebhafter als die anderen. Es hat sich ständig herumgedreht.«
»Das kann schon sein«, sagte die Hebamme vorsichtig abwägend. »Viele Mütter sagen, dass ihre Buben viel wilder gewesen seien.«
Ein allzu sicheres Zeichen war das freilich nicht. Aber das sprach sie nicht aus. Wenn die Bäuerin optimistisch war, konnte das für den Verlauf der Geburt ja nur gut sein.
An der Pforte des Krankenhauses erlebte Aloisia einen unerwartet freudigen Empfang.
»Gott sei Dank, dass Sie endlich da sind, Frau Gaßlmaier«, rief die junge Ordensschwester, die in jener Nacht dort Dienst tat. »Hier wartet Arbeit auf Sie.«
Die Hebamme begriff nicht auf der Stelle. »Wieso das, Schwester Bilhildis? Ich hab mir doch selbst meine Arbeit mitgebracht.«
»Ich weiß. Aber ich habe vor einer halben Stunde bei Ihnen angerufen und von Ihrem Mann erfahren, dass Sie bereits nach hier unterwegs sind. Vorhin ist nämlich eine werdende Mutter von ihrem Mann eingeliefert worden. Die macht einen ziemlichen Aufstand. Ihr Arzt, Dr. Herbst, ist zwar schon verständigt, aber vor allem braucht sie erst mal eine Hebamme. Ihre Kollegin Kleinhuber, die eigentlich Bereitschaftsdienst hat, ist krank geworden, deshalb muss ich Sie bitten, den Fall mit zu übernehmen.«
Aloisia ergab sich in ihr Schicksal. »Ist gut, Schwester Bilhildis. Wo ist die Schwangere?«
»In Kreißsaal 1.«
»Dann bringe ich meine Patientin in Kreißsaal 2 und versuche, die aufständische Dame so lange mitzubetreuen, bis ihr Arzt kommt.«
»Das kann allerdings noch dauern«, warnte die Schwester. »Ich habe nur mit seiner Haushälterin gesprochen, die sagte mir, dass die Herrschaften auf einer Faschingsveranstaltung seien. Sobald der Herr Doktor nach Hause komme, werde sie ihn herschicken.«
»Gut, dass du da bist!«, empfing Schwester Anna, die Nachtwache hatte, die Hebamme. Sie winkte Aloisia aus dem Kreißsaal heraus, kaum dass sie Zenta dort ins Entbindungsbett geholfen hatte. »Wir haben einen Neuzugang, nicht mehr ganz jung, erstes Kind, Privatpatientin von Dr. Herbst. Die macht mich schon seit Stunden verrückt. Bei jeder Wehe läutet sie nach mir und jammert: ›Jetzt kommt’s, jetzt kommt’s!‹ Ich weiß gar nicht, wo ihr Arzt bleibt, aber helfen kann ich ihr ja auch nicht. Schau sie dir doch bitte mal an.«
»Wie oft kommen denn die Wehen?«
»Im Abstand von zehn Minuten.«
»Danke, Anna, ich geh sofort hinüber.«
Als Erstes horchte die Hebamme aber Zenta noch einmal ab. Die Herztöne des Kindes kamen ihr nun ein wenig schwächer vor, und auch die Wehen hatten nicht wieder eingesetzt. Das gefiel ihr ganz und gar nicht.
»Zenta, ich lass dich für einen Moment allein.« Aloisia bemühte sich, Zuversicht auszustrahlen. »Nebenan wartet noch jemand auf mich, das hast du ja gehört. Die Tür lass ich offen. Wenn sich irgendetwas tut, dann ruf nach mir, ich bin dann auf der Stelle bei dir. Atme immer schön gleichmäßig.«
Das sagte sie eigentlich nur, damit Zenta während der Wartezeit irgendwie beschäftigt war. Außerdem konnte das die Sauerstoffzufuhr für das Ungeborene nur verbessern.
Im Kreißsaal 1 fand die Hebamme die andere Frau auf dem Entbindungsbett vor.
»Sind Sie die Hebamme?«, fragte die Patientin, noch bevor sie richtig durch die Tür gekommen war.
»Ja, das bin ich. Mein Name ist Aloisia Gaßlmaier, und wer sind Sie?«
»Ich heiße Krautwald. Luise Krautwald. Mein Mann ist Assessor am Ludwigs-Gymnasium. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört?«
Aloisia war nicht ganz klar, ob sie nun den Namen des Gymnasiums oder den Namen des Assessors schon mal gehört haben sollte.
»Nein, leider nicht«, gab sie zur Antwort. »Wenn die Kinder ins Gymnasium kommen, ist meine Arbeit ja schon längst zu Ende. Aber jetzt wollen wir einmal schauen, wie weit es bei Ihnen schon ist.«
Sie schlug die Decke zurück, um die Patientin zu untersuchen, und im selben Moment verzog Frau Krautwald schmerzlich das Gesicht, bäumte sich auf und schrie: »Au, au! Das halte ich einfach nicht mehr aus. Es muss doch endlich einmal kommen. So tun Sie doch irgendwas!«
»Tief einatmen«, kommandierte Aloisia. »Und ebenso tief wieder ausatmen. Das erleichtert Ihnen die Entbindung. Sehr schön – konzentrieren Sie sich ganz darauf, immer tief ein- und auszuatmen. Gut machen Sie das!«
Das Lob brachte die Patientin nun doch ein wenig zum Lächeln, und gehorsam atmete sie in tiefen Zügen ein und wieder aus, während die Hebamme die Untersuchung fortsetzte.
»Es hat schon noch ein bisschen Zeit bei Ihnen. Der Muttermund ist noch längst nicht weit genug geöffnet.«
»Soll das etwa heißen, dass diese Tortur noch länger anhalten wird?« Frau Krautwalds Stimme klang entsetzt.
»Leider ja. Es ist Ihre erste Entbindung, da kann es schon ein Weilchen dauern. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Ihrem Kind geht es gut. Es hat einen sehr kräftigen Herzschlag. Erstaunlich kräftig sogar, wenn Sie mich fragen …«
Sie zögerte einen Moment.
»Sagen Sie mal, hat Ihr Arzt keine Andeutung gemacht?«
»Was für eine Andeutung?«
»Nun, dass Sie vielleicht Zwillinge erwarten.«
»Um Gottes willen, nein!« Der Blick der Patientin weitete sich. »Wie kommen Sie denn darauf?«
»Der Herzschlag ist so auffallend kräftig«, erklärte Aloisia. »Es könnten auch zwei Kinder sein, deren Herzen im gleichen Takt schlagen.«
»Nein, nein, es dürfen keine zwei sein. Das wäre ja entsetzlich. Mit zwei Kindern, das geht doch gar nicht.«
Ihre Stimme kippte bei den letzten Worten über.
»Nun, regen Sie sich nicht auf, Frau Krautwald«, versuchte die Hebamme sie zu beruhigen. »Vielleicht irre ich mich ja auch. Warten Sie einen Moment, ich muss rasch nach meiner anderen Patientin schauen.«
Gleichmäßig atmend lag Zenta auf ihrem Bett, die Augen geschlossen. Sie schien eingeschlafen zu sein. Demnach hatte sich bei ihr nichts getan. Aloisia hörte sie noch einmal ab, und ihre Sorgen verschlimmerten sich, denn wieder hatte sie den Eindruck, dass die Herztöne schwächer waren, als sie sein sollten.
»Zenta, ich spritz dir jetzt ein wehenförderndes Mittel«, sagte sie endlich kurz entschlossen. »Vielleicht hilft es.«
Eigentlich durfte sie das gar nicht, jedenfalls nicht, solange kein Arzt da war. Aber dass Doktor Fischer diese Maßnahme billigen würde, davon war sie überzeugt.
»Es wird eine Weile dauern, bis sie wirkt«, sagte sie anschließend zu der Bäuerin. »Derweil schaue ich jetzt am besten noch mal nach Frau Krautwald. Wenn die Wehen einsetzen, rufst du mich gleich.«
Im Kreißsaal 1 wurde sie von einer völlig aufgelösten Frau Krautwald mit den Worten empfangen: »Nein, nein, Aloisia, ich habe mir das überlegt. Mit zwei Kindern, das schaffe ich einfach nicht!«
Die Hebamme atmete tief durch und bemühte sich, verständnisvoll zu bleiben. »Frau Krautwald, Sie tun ja gerade so, als ob ich es in der Hand hätte, ob Sie ein Kind bekommen oder zwei. Aber erstens habe ich überhaupt keinen Einfluss darauf, und zweitens habe ich Ihnen doch gesagt, dass es noch gar nicht sicher ist. Und wenn es Zwillinge werden, dann werden Sie damit auch fertig, glauben Sie mir. Andere Mütter haben das auch geschafft.«
»Aber ich schaffe es nicht!«, brach es aus ihr heraus. »Nie im Leben! Wir haben doch nur eine winzige Wohnung, wir konnten schon das Bett für ein Kind nur mit Mühe im Schlafzimmer mit unterbringen!«
»Dann müssen Sie es halt wie andere Familien machen und die Kinderbetten ins Wohnzimmer stellen«, schlug Aloisia vor.
Die Frau des Assessors war von diesem Vorschlag wenig angetan. »Ausgeschlossen!«, fauchte sie. »Das geht auf gar keinen Fall. Dort muss mein Mann doch arbeiten. Was meinen Sie, was der für die Schule alles zu tun hat: Unterrichtsvorbereitungen, Hefte korrigieren, Zeugnisse schreiben, Arbeitspläne erstellen und Schülerbeurteilungen machen. Außerdem muss er sich als angehender Studienrat auch selbst auf Prüfungen vorbereiten. Dazu braucht er äußerste Ruhe. Seine berufliche Zukunft hängt doch davon ab. Au … au … au …«
Die nächste Wehe unterbrach ihren Redeschwall. Aber gleich danach fuhr sie fort, und Aloisia ließ sie reden, denn immerhin hielt es sie davon ab, dauernd über ihre Schmerzen nachzudenken.
»Bei der herrschenden Wohnungsknappheit haben wir nichts Größeres gefunden, und uns fehlt einfach ein Arbeitszimmer. Wenn wir die Wahl gehabt hätten, dann hätte ich mir ja vorgestellt …«
In diesem Moment rief es aus dem angrenzenden Raum: »Aloisia! Aloisia!«
Mit einem Satz war die Hebamme an der Verbindungstür, und die Frau Assessor rief ihr in heller Empörung hinterher: »Aber Aloisia, Sie können mich doch jetzt nicht allein lassen!«
»Ich komme ja gleich wieder, Frau Krautwald«, rief sie über die Schulter zurück, bevor sie im angrenzenden Raum verschwand.
»Eben habe ich wieder eine Wehe gehabt«, konnte Zenta berichten. Aloisia stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.
»Wirklich? Das ist eine gute Neuigkeit. Fest atmen, Zenta. Vielleicht ersparen wir uns ja doch noch den Kaiserschnitt.« Ihr Blick glitt auf die große Uhr, die neben der Tür hing. Nun war es schon fast drei Uhr nachts. Und keine Spur von einem Arzt, weder von Doktor Fischer noch von Doktor Herbst.
Ein lautes Wehgeschrei aus Kreißsaal 1 ließ sie wieder dort hinüberhasten, obwohl sie für Frau Krautwald, die sich vor Schmerzen krümmte, nichts weiter tun konnte, als ihr mit einer Windel die Schweißtropfen von der Stirn zu tupfen. »So ist es brav«, ermunterte sie die Patientin. »Immer kräftig atmen. Das ist gut für Mutter und Kind.«
»Wozu müssen denn diese schrecklichen Wehen nur sein?«, japste die werdende Mutter, kaum dass die Wehe abgeklungen war. »Das Kind soll endlich kommen und damit fertig.«
»Das würde kaum gehen«, sagte die Geburtshelferin. »Durch die Wehen öffnet sich der Muttermund, damit das Kind überhaupt einen Ausgang hat.«
Frau Krautwald blickte einen Moment lang ratlos, und Aloisia wurde klar, dass sie wahrhaftig keine Ahnung gehabt hatte, was sie bei der Geburt eines Kindes erwarten würde.
Offenbar war es ihr peinlich, bei so viel Unwissenheit ertappt worden zu sein. Deshalb wechselte sie schnell das Thema: »Mein Arzt müsste doch längst hier sein. Es ist eine Ungeheuerlichkeit von ihm, eine Privatpatientin so lange warten zu lassen. Ich bin nämlich Privatpatientin bei Dr. Herbst, müssen Sie wissen. Er hat mir ausdrücklich zugesichert, dass er bei meiner Entbindung zugegen sein wird. Die Schwester hat ihn doch wohl angerufen?«
»Selbstverständlich hat sie das. Das hat sie mir schon bei meiner Ankunft versichert.«
»Könnten Sie mal nachschauen? Vielleicht hat er sich bei der Pfortenschwester festgeplaudert.«
Ihre Stimme klang hoffnungsvoll.
»Aber nein, Frau Krautwald. Das würde er sicher niemals tun«, versicherte die Hebamme und konnte einen ironischen Zusatz nicht unterdrücken. »Und schon gar nicht bei einer Privatpatientin!«
Wieder hörte sie von nebenan Zenta nach ihr rufen. Sie hatte eine weitere Wehe, eine, die stärker war als die vorhergehende.
Aloisia Gaßlmaier nickte befriedigt. »Es sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir es auch ohne Doktor.«
Dummerweise ging es ausgerechnet nun aber auch bei Frau Krautwald richtig los, und da sich bei beiden der Muttermund nun stetig öffnete, war die Hebamme gezwungen, ständig zwischen den beiden Kreißsälen hin- und herzuhasten. Rasch war abzusehen, dass beide etwa zur selben Zeit entbinden würden.
Erneut horchte Aloisia den Bauch der Bäuerin ab und bekam einen Schrecken, denn die Herztöne des Kindes waren nun nur noch ganz schwach. Wenn ein Arzt dagewesen wäre, hätte sofort ein Kaiserschnitt durchgeführt werden müssen, und wenn es dieser Doktor Herbst gewesen und seine Patientin darüber hysterisch geworden wäre. Doch weit und breit war keiner der beiden Mediziner in Sicht.
Aus dem anderen Kreißsaal kam ein lauter Schrei. Insgeheim froh, dass sie dort wenigstens etwas tun konnte, anstatt so hilflos abwarten zu müssen, hastete die Hebamme wieder zu Frau Krautwald hinüber und erkannte, dass die Ausstoßphase unmittelbar bevorstand.
»Wo bleibt denn nur mein Arzt? Wo bleibt denn nur mein Arzt?«, jammerte Frau Krautwald ein ums andere Mal.
»Machen Sie sich deswegen keine Sorgen«, versuchte Aloisia sie zu beruhigen. »Wir beide schaffen das auch allein. Sie haben alles bisher so gut gemacht, dass gar nichts passieren kann. Machen Sie weiter genau das, was ich Ihnen sage, und es ist bald vorbei. Und wenn Ihnen danach ist, dann schreien Sie einfach laut.«
Danach war sie zunächst nur noch damit beschäftigt, Luise Krautwald die nötigen Kommandos zu geben. »Pressen! Pressen! Hecheln! Hecheln! …«
Endlich war es so weit. Die Patientin stieß einen so markerschütternden Schrei aus, als das Kind aus ihr herausglitt, dass sein sehr kräftiger Ankunftsschrei völlig unterging.
Hastig nabelte die Hebamme das Neugeborene ab, schlug es in das bereitliegende Tuch ein und legte es ungewaschen auf dem Wickeltisch unter der Wärmelampe ab, denn nun galt es herauszufinden, ob ihr Verdacht auf Zwillinge berechtigt gewesen war. Dass dies der Fall war, konnte sie schon beim Abtasten des Bauches feststellen. Um ganz sicherzugehen, horchte sie die junge Mutter aber auch noch einmal ab.
»Luise, Sie bekommen noch ein zweites Kind!«
»Nein, das kann nicht sein. Schauen Sie doch nur, wie flach mein Bauch geworden ist.«
Die frisch gebackene Mutter fuhr mit der freien Hand über den Leib, der sich tatsächlich viel weniger wölbte als vorher.
»Sie irren sich bestimmt. Horchen Sie mich doch noch mal ab.«
Resigniert setzte Aloisia das Stethoskop noch einmal an, obwohl sie viel lieber endlich wieder nach Zenta geschaut hätte.
»Kein Zweifel, ich höre weitere Herztöne.«
»Das ist mein eigener Herzschlag, den Sie hören!«, behauptete Luise Krautwald. »Ich spüre es doch selbst, mein Herz schlägt wie verrückt.«
»Das kommt von der Anstrengung, die Sie hinter sich haben, und davon, dass Sie sich so aufregen. Sie können ganz sicher sein, dass ich das unterscheiden kann. Außer Ihrem Herzschlag höre ich ganz deutlich kindliche Herztöne. Außerdem habe ich das zweite Kind beim Abtasten deutlich gefühlt.«
»Ich will aber kein zweites Kind«, schrie die Wöchnerin hysterisch auf.
»Da werden Sie leider nicht gefragt. Was drin ist, muss auch raus. Ich kann’s doch nicht drin lassen, nur weil Sie es nicht haben wollen.«
Aloisia Gaßlmaier war an die Grenzen ihrer Geduld gelangt. Nebenan lag eine Frau, deren Kind in Lebensgefahr war, und diese Person machte ein solches Theater um eine Sache, die nicht zu ändern war – und über die Zenta an ihrer Stelle vermutlich überglücklich gewesen wäre. Denn das erste Kind jedenfalls war ein Junge.
»Aber wie soll das gehen, mit zwei Säuglingen? Das schaffe ich nicht!«, jammerte Luise Krautwald.
»Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich bin sicher, die eine oder andere stolze Großmutter wird Ihnen in der ersten Zeit gerne zur Seite stehen.«
»Auf die Großmütter können wir nicht zählen«, versicherte Frau Krautwald.
»Das tut mir leid für Sie. Aber der junge Vater ist ja auch noch da. Er wird Ihnen sicher zur Hand gehen.«
»Um Gottes willen, nein! Damit kann ich ihn nicht belasten. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er angehender Studienrat ist. Nein, nein, es ist undenkbar, dass ich ihm etwas von seiner Zeit stehle, die er doch gerade jetzt so nötig für sich braucht. Und bedenken Sie das Geschrei! Wenn der eine Säugling damit fertig ist, fängt der andere an. Wie soll mein Mann da denn arbeiten?«
Sie begann laut zu schluchzen. Die Hebamme zählte in Gedanken langsam bis zehn, bevor sie versicherte: »Das werden Sie schon schaffen. Andere Mütter haben das auch geschafft.«
Plötzlich verzog Frau Krautwald erneut das Gesicht und machte sich ganz steif. »Ich glaube, Sie haben doch recht«, stöhnte sie mit schmerzverzerrter Stimme. »Es geht wieder los. Nein, das überlebe ich nicht! Noch eine Geburt halte ich nicht aus.«
»Natürlich halten Sie das aus. Das haben schon unzählige Mütter ausgehalten.«
»Ich will das aber nicht aushalten. Das habe ich gar nicht nötig. Schließlich bin ich keine Zweite-Klasse-Patientin.«
Die Hebamme lachte auf. »Meinen Sie, die Natur macht da Unterschiede?«
»Die Natur nicht. Aber Sie könnten Unterschiede machen. Sie können mir doch etwas zur Betäubung geben.«
»Nein, das kann ich nicht. So etwas darf nur ein Arzt machen.«
Unabsichtlich hatte sie ihr damit ein Stichwort geliefert.
»Ja, der Arzt. Wo bleibt er nur? Hätte ich geahnt, dass er so unzuverlässig ist, hätte ich einen anderen genommen!«
»Regen Sie sich nicht auf, Frau Krautwald. Dr. Herbst ist ein sehr zuverlässiger Arzt. Es muss etwas vorgefallen sein, sonst wäre er schon längst da. Aber Sie können ganz beruhigt sein, auch er würde Ihnen nichts Betäubendes geben. Das kann schädlich für das Kind sein, und man macht es nur dann, wenn es wirklich unvermeidlich ist.«
Trotzig beharrte die Gebärende: »Wäre er doch nur rechtzeitig hier gewesen! Dann hätte er gleich einen Kaiserschnitt machen können, und mir wäre die ganze Quälerei erspart geblieben.«
»Das hätte er in Ihrem Fall mit Sicherheit nicht gemacht«, widersprach die Geburtshelferin. »Dazu lag bei Ihnen keine Indikation vor.«
»Dazu brauche ich keine Indikation! Wenn ich einen Kaiserschnitt wünsche, dann hat er ihn zu machen!«
Aloisia wusste nicht mehr, ob sie lachen oder sich ärgern sollte.
»Das stellen Sie sich ein bisschen zu einfach vor, meine liebe Frau Krautwald. Einen Kaiserschnitt macht man nur im Notfall. Denn eine solche Operation birgt immer ein Risiko in sich. Außerdem, sie würde Ihnen jetzt zwar die Geburtsschmerzen ersparen. Aber nachher hätten Sie tagelang unter den Operationsschmerzen zu leiden. Fänden Sie das wirklich besser?«
»Au, au, aua!«, schrie die Wöchnerin im gleichen Moment auf. »So tun Sie doch etwas!«
Aloisia, die nun wirklich genug von Luise Krautwald und außerdem Dringenderes zu tun hatte, entschied sich, ihr Lachgas zu geben, damit sie endlich nach Zenta schauen konnte. Sie drückte der Patientin die Maske in die Hand mit den Worten: »Halten Sie die vor die Nase, und atmen Sie tief ein.«
Damit würde sie erst einmal beschäftigt sein.
»Mehr kann ich im Moment wirklich nicht für Sie tun«, versicherte sie. »Wir können jetzt nur noch abwarten, bis das Kind kommt.« Von nebenan hörte sie ein Geräusch, das wie leises Wehklagen klang.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie hastig. »Ich muss jetzt auf der Stelle nach der anderen Mutter schauen. Bei Ihnen dauert es eh noch ein paar Minuten.«
Es war allerhöchste Zeit gewesen, denn der Kopf des Kindes war schon sichtbar, als die Hebamme hereinkam. Sie hatte nicht mehr viele Anweisungen zu geben, und die erfahrene und vernünftige Gumperbäuerin befolgte sie auch, ohne viel Theater zu machen. Nach wenigen Sekunden war die schwierigste Phase schon geschafft, und der Kopf war ausgetreten.
Freilich, für die erschöpfte Bäuerin war es eine ungeheure Anstrengung gewesen. Unter Aufbietung all ihrer Kräfte entließ sie das Kind in die Freiheit. Dann sank sie ermattet in ihre Kissen und schloss die Augen, ohne auch nur wissen zu wollen, ob sie denn den ersehnten Sohn zur Welt gebracht hatte.
Dafür konnte Aloisia dem Himmel nur danken, denn im ersten Moment hätte sie nicht gewusst, wie sie Zenta Moosberger hätte vermitteln sollen, dass ihr erster Sohn nicht mehr lebte. Das Kind hatte die Nabelschnur fest um den Hals geschlungen, und während des Geburtsvorgangs war ihm die Luftzufuhr abgedrückt worden. Jede Hilfe kam zu spät, das sah die erfahrene Geburtshelferin auf der Stelle.
Für einige Momente war Aloisia wie betäubt und verrichtete mechanisch alle nötigen Handgriffe, um das tote Kind abzunabeln. Geradezu mit Erleichterung vernahm sie dann aus dem angrenzenden Kreißsaal den Schrei: »Hilfe! Hilfe! Aloisia, schnell, schnell, es kommt.«
Sie rannte nach nebenan und begriff erst, als sie schon dort war, dass sie Zentas tot geborenes Kind noch in der Hand hatte. Hastig legte sie es neben dem Erstgeborenen von Frau Krautwald ab, dann beeilte sie sich, der Gebärenden zu helfen, die trotz Lachgasmaske nun laut schrie. Dann endlich hatte auch Luises zweiter Sohn sich seinen Weg in die Welt gebahnt.
»Sie haben das Schlimmste überstanden. Jetzt kommt nur noch die Nachgeburt, das machen wir mit links«, versicherte ihr die Hebamme, während sie sich um das leise wimmernde Kind kümmerte, es in ein weißes Frotteetuch einhüllte und neben seinen schlafenden Bruder legte.
Nun lagen alle drei Kinder nebeneinander, die in dieser Nacht zur Welt gekommen waren: die Zwillinge von Luise Krautwald und der leblose kleine Körper des tot geborenen Sohns der Gumperbäuerin. Aloisia streckte die Hand nach dem toten Kind aus, um es in den Raum zurückzubringen, in dem seine Mutter lag, doch dann zog sie sie wieder zurück und sah sich die drei Kinder noch einmal an.
Wie ähnlich sie sich alle drei sahen! Eigentlich hätte Zentas Bub größer sein müssen als die Zwillinge, denn die hatten im Bauch der Mutter ja viel weniger Platz gehabt – doch er war ja ein paar Wochen zu früh dran. Man hätte alle drei für Geschwister halten können.
Dann durchzuckte sie ein Gedanke, der völlig verrückt war: »Was, wenn ich Zenta einen von den lebenden Buben bringe?«
Nachdem der Hebamme dieser Gedanke erst einmal gekommen war, schien es ihr mit einem Mal ganz logisch, ihn auch auszuführen: War es nicht Fügung, dass hier drei Knaben vor ihr lagen, die sich so auffallend ähnlich sahen? Auch, dass beide herbeigerufenen Ärzte nicht rechtzeitig gekommen waren, schien wie von einer höheren Macht geplant. Und sogar der Mutter der beiden Buben würde damit ein Gefallen erwiesen werden – so – heftig, wie sie sich gegen ein zweites Kind gesträubt hatte.
Wieder streckte Aloisia die Hand aus, doch statt nach Zentas tot geborenem Sohn griff sie nach dem zweitgeborenen Zwilling von Luise Krautwald, trat in den angrenzenden Raum, legte das Kind dort auf den Wickeltisch und kam gerade rechtzeitig an Zentas Bett, um die Nachgeburt in einer Schüssel aufzufangen. Wie ferngelenkt ging sie anschließend wieder zu Frau Krautwald zurück, bei der auch gerade die Nachgeburt kam, kümmerte sich auch darum und trat dann an den Wickeltisch, wo zwei Kinder lagen, ein lebendiges und eine totes.
»Frau Krautwald, leider muss ich Ihnen eine traurige Mitteilung machen«, hörte sie sich selbst endlich wie aus weiter Ferne sagen. »Ihr zweites Kind hat seine Geburt nicht überlebt. Wenn es Ihnen recht ist, möchte ich ihm wenigstens die Nottaufe geben. Welchen Namen haben Sie ihm zugedacht?«
Die junge Mutter war noch kaum wieder bei Sinnen: »Nennen Sie es Franz-Josef, nach meinem Mann«, sagte sie mit schwacher Stimme.
Aloisia goss von dem bereitstehenden Weihwasser ein wenig über das Köpfchen und sprach die Worte: »Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf den Namen Franz-Josef.«
Es folgten noch einige weitere vertraute Verrichtungen, die sie ganz mechanisch vornahm: Sie wusch beide Kinder, legte das lebende, in ein frisches Frotteetuch eingeschlagen, in das bereitstehende Bettchen, damit der Arzt es später untersuchen konnte. Das tote Kind ließ sie auf dem Wickeltisch liegen, nachdem sie es verhüllt hatte. Dann füllte sie die entsprechenden Papiere aus und ging wieder hinüber in den anderen Kreißsaal, um den jüngeren Zwilling ebenfalls zu versorgen. Gerade, als sie auch ihn in sein Bettchen legen wollte, hörte sie nebenan die Tür gehen und dann eine Männerstimme, die Frau Krautwald ansprach.
Die Hebamme kam gerade rechtzeitig hinüber, um zu hören, wie sich der Arzt entschuldigte und erklärte, dass es auf seiner Fahrt zum Krankenhaus einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben habe. »Ich musste erste Hilfe leisten und bei ihnen bleiben, bis sich der Krankenwagen bei dem einsetzenden Berufsverkehr durchgekämpft hatte.«
Einsetzender Berufsverkehr? Aloisias Blick glitt unwillkürlich zur Uhr hin, und sie sah, dass es bereits Morgen geworden war.
»Guten Morgen, Herr Doktor«, begrüßte sie ihn. »Ihre Patientin hat Zwillinge geboren, von denen leider einer tot zur Welt kam. Er hatte die Nabelschnur um den Hals geschlungen.«
Der Arzt untersuchte beide Kinder, erst das lebende und dann das tote. Er bestätigte die Diagnose und stellte den Totenschein aus. Dann trat er ans Bett seiner Patientin und sprach ihr mit warmen Worten sein Beileid aus.
»Aber das andere Kind, ist das völlig in Ordnung?«, wollte Frau Krautwald wissen. »Besteht für es keine Gefahr?«
»Nach menschlichem Ermessen nicht, gnädige Frau. Das Kerlchen macht einen durchaus gesunden Eindruck. Der Tod Ihres zweiten Kindes war ein tragischer Unglücksfall, den auch ich nicht hätte verhindern können.«
Frau Krautwald gab sich damit ohne weiteres Nachfragen zufrieden, und so konnte die Hebamme sie nun endlich dem Arzt überlassen und ging in den anderen Kreißsaal zu Zenta hinüber. Dort machte sie sich ans Ausfüllen der Papiere und ans Aufräumen. Noch während sie damit beschäftigt war, wurde die Tür, die vom Flur her in diesen Raum führte, aufgestoßen, und Dr. Fischer stürmte herein. Völlig außer Atem stieß er hervor: »Na, Zenta, wie schaut’s denn aus? Was gibt’s für mich zu tun?«
Wohl durch das ruckartige Öffnen der Tür und die Stimme des Arztes wurde die Bäuerin aus ihrem leichten Schlummer gerissen und öffnete die Augen.
»Gar nichts gibt es mehr für Sie zu tun, Herr Dr. Fischer«, antwortete Aloisia. »Obwohl ich zwischendurch heilfroh gewesen wäre, wenn ich Sie an meiner Seite gehabt hätte. Aber wir haben es am Ende doch alleine geschafft, die Zenta und ich. Da, schauen Sie nur. Da liegt er schon, Zentas Bub.«
»Ich hab einen Buben?«, fragte die Wöchnerin aufgeregt. »Aloisia, ist das gewiss wahr? Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt?«
»Du bist doch gleich eingeschlafen«, redete die Hebamme sich heraus. »Da wollte ich dir die kurze Erholungspause gönnen.«
Die Wöchnerin lächelte matt: »Ja, weißt du, für diese Nachricht hättest du mich schon aufwecken dürfen.«
»Das glaub ich dir gern. Aber du weißt doch, dass ich nebenan noch eine andere Frau zu versorgen hatte, und da war ich froh, dass ich gleich hinübergehen konnte. Zwischen Tür und Angel wollte ich dir eine so großartige Neuigkeit ja auch nicht mitteilen.«
Der Moosberger-Bäuerin liefen Freudentränen über die Wangen. Sie versuchte, sich aufzurichten, um ihr Kind endlich sehen zu können. »Wo ist er? Darf ich ihn jetzt mal haben, meinen kleinen Blasi?«
»Ei freilich«, verkündete der Doktor und beugte sich über das Bettchen. Mit einer Behutsamkeit, die man dem poltrigen, kräftigen Mannsbild nicht zugetraut hätte, hob er das Neugeborene aus den Kissen. So stolz, als ob er es selbst zur Welt gebracht oder zumindest die Entbindung geleitet hätte, legte er es der überglücklichen Mutter in die Arme.
»Blasi, mein Bub«, flüsterte sie zärtlich und streichelte ihm über die rosigen Wänglein. »Jetzt kann ich mich wieder auf dem Gumperhof sehen lassen! Ja, was wird der Blasius für eine Freud’ haben! Und dass sein Bub grad am Blasiustag geboren ist, das wird ihn noch mehr freuen.«
Nun, da beide Geburten überstanden waren, kamen in Aloisia Gaßlmaier Sorgen auf, an die sie in der Aufregung bislang gar nicht gedacht hatte: Die beiden Mütter durften keinesfalls im selben Zimmer Betten bekommen, sonst war gar nicht auszudenken, was geschehen konnte, wenn sie selbst oder ein Besucher bemerkten, wie ähnlich sich die beiden Neugeborenen sahen. Auch in der Säuglingsstation wären die beiden Kinder dann nebeneinander zu liegen gekommen, und die Ähnlichkeit hätte den Säuglingsschwestern auffallen können …
Aber sie hatte Glück: Frau Krautwalds Sachen waren, als sie mit ihrem Mann gekommen war, im ersten Zimmer auf dem langen Gang untergebracht worden, während Zenta Moosberger, die erst einige Stunden später hergebracht worden war, ins vorletzte Zimmer kommen sollte.
Ehe die Hebamme sich nach dieser ebenso anstrengenden wie aufregenden Nacht zur Ruhe begeben konnte, hatte sie noch einen wichtigen Auftrag zu erledigen, denn sie hatte Zenta versprechen müssen, ihrem Mann die freudige Nachricht umgehend persönlich zu überbringen. Sicherlich hatte er vor Sorge kein Auge zugetan. Es verstand sich von selbst, dass er so schnell wie möglich benachrichtigt werden musste.
So stellte Aloisia ihr Auto daheim am Haus ab und kämpfte sich mühsam durch den Schnee bis hinauf zum Gumperhof, und insgeheim war sie ganz froh, dass sie nur langsam vorwärtskam. Denn je mehr sie sich dem Hof näherte, desto schwerer fielen ihr die Schritte. Die freudige Botschaft, die sie überbringen sollte, beruhte nun einmal auf klarem Betrug. Nun, im Licht des neuen Tages, fühlte sie ihre Schuld erst wirklich.
Im Hof war die ganze Familie nebst Gesinde nach getaner Stallarbeit um den Frühstückstisch versammelt, und alles wirkte so normal, dass niemandem, der die Familie nicht kannte, das Fehlen der Bäuerin aufgefallen wäre. Die Magd Vroni und die älteren Töchter hatten den Haushalt gut im Griff. Der Bauer freilich schien über Nacht zehn Jahre gealtert zu sein. Bei Aloisias Anblick sprang er vom Tisch auf, als hätte ihn etwas gestochen.
»Was ist mit meiner Frau? Was ist mit dem Kind?«
»Herzlichen Glückwunsch, Blasius. Alles in Ordnung. Deiner Frau geht es gut und dem Bub auch.«
Dem Gumperbauern blieb für einen Moment der Mund offen stehen. »Dem Bub auch, sagst du? Dem Bub auch? Soll das heißen, ich hab …?«
Er schien es noch nicht zu wagen, eine solche Glücksbotschaft wirklich zu glauben.
Die Hebamme nickte und zwang sich zu einem besonders herzlichen Lächeln. »Meine besten Glückwünsche. Du hast deinen Sohn und Hoferben, Blasius.«
Der sonst so bedächtige Mann geriet völlig außer Fassung, weinte und lachte gleichzeitig, und ehe Aloisia sich versah, hatte er mit beiden Händen ihre Taille umfasst und schwenkte sie in der Küche herum, dass ihr schwindelig wurde. Beinahe wäre er dabei mit der Vroni zusammengestoßen, die gerade die große, blecherne Kaffeekanne vom Herd zum Küchentisch tragen wollte. Sie schrie vor Schreck auf und machte eine so heftige Ausweichbewegung, dass ein paar Spritzer des heißen Kaffees die Hebamme am Ärmel trafen. Doch was machte das schon in einem Moment, in dem sie eine solch ausgelassene Freude erleben durfte?
Alle Bedenken und Schuldgefühle schienen wie ausgelöscht, als Aloisia den Jubel erlebte, der im Gumperhof ausgebrochen war. Auch die Mädchen sprangen eins nach dem anderen auf und wirbelten durch die Stube. »Wir haben einen Bruder! Wir haben einen Bruder!« Nur die Großmutter, die am Tag vorher noch der Bäuerin so heftig zugesetzt hatte, blieb auf ihrem Stuhl sitzen, denn sie war längst aus dem Alter heraus, in dem man seiner Freude durch Tanzen Ausdruck verleiht. Stattdessen faltete sie die Hände und wandte den Blick zum Himmel: »Gelobt sei Jesus Christus, dass ich diesen Tag noch erleben durfte.«
Nach dem ersten Freudentaumel überschlug man sich fast, der Überbringerin der frohen Botschaft etwas Gutes zu tun, man bot ihr Kaffee an und lud sie ein, mit zu frühstücken. Doch sie lehnte ab mit dem Hinweis, dass sie nur noch Sehnsucht nach ihrem Bett verspüre. »Ich wäre ja gar nicht mehr hergekommen, wenn ich hätte anrufen können«, erklärte sie. »Moosberger, ich bitte mir eines aus: Falls der Bub nicht euer letztes Kind bleibt, dann schaff dir ein Telefon an, bevor es das nächste Mal so weit ist. So, und jetzt geh ich heim und leg mich hin.«
»Ein Telefon brauchen wir jetzt auch nicht mehr«, versicherte der Moosberger. »Sieben Kinder sind ja wohl genug, und ansonsten sind wir ja immer ohne dieses neumodische Zeug ausgekommen auf dem Hof. Aber das kommt gar nicht in Frage, dass du den Weg noch mal zu Fuß machst. Ich spanne den Schlitten an und bring dich hinunter.«
Ausgerechnet mit dem Bauern herumzukutschieren, dem sie heute Nacht ein fremdes Kind als seinen Sohn untergeschoben hatte, war so ziemlich das Letzte, was Aloisia gebrauchen konnte. Deshalb widersprach sie: »Aber geh, Blasi, deshalb brauchst du dich doch nicht selbst bemühen. Der Girgl kann mich ebenso gut nach Hause kutschieren. Du solltest lieber auf der Stelle alles fertig machen, was pressiert, damit du heute noch nach München hineinfahren kannst, um deine Frau und deinen neugeborenen Sohn zu besuchen!«
Das leuchtete dem Bauern ein, und so blieb ihr diese Fahrt erspart.
So müde die Hebamme gewesen war, als sie endlich daheim in ihrem Bett war, so konnte sie lange keinen Schlaf finden. Wieder und wieder ging ihr die Situation im Krankenhaus durch den Kopf. Irgendwann schlief sie dann doch noch ein, aber schon nach kurzer Zeit schreckte sie aus einem wirren Traum hoch. An Einzelheiten konnte sie sich nicht erinnern, nur daran, dass jemand hinter ihr her gewesen war und sie sich durch Flucht zu retten versucht hatte. Schlagartig stand wieder vor ihrem Auge, was sie getan hatte.
›Was, wenn die Zwillinge eines Tages aufeinandertreffen?‹, ging es ihr durch den Kopf.
Aber wie sollte das geschehen? Der eine als Bauernsohn würde die Volksschule besuchen und dem Moosberger als Erbe auf dem Hof folgen, der andere mit Sicherheit ein Gymnasium durchlaufen, um, wie sein Vater, Studienrat zu werden. Der eine würde sich niemals in die Stadt verirren und der andere niemals in die Einöde des Gumperhofes. Die Sache konnte überhaupt nicht aufkommen, wenn sie nur selbst nichts darüber verlauten ließ. Das jedenfalls sagte sie sich immer wieder selbst vor.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Weitere E-Books von Roswitha Gruber
Nach mir kräht kein Schwein
Eine Bäuerin erzählt
eISBN 978-3-475-54326-5 (epub)
In einem kleinen Dorf wächst Helena in einer bäuerlichen Großfamilie auf. Schon früh ins Arbeitsleben eingespannt, kann sie sich nichts anderes vorstellen, als selbst Landwirtin zu werden. Trotz aller Widerstände erreicht sie ihr Ziel: sie durchläuft die gleiche Ausbildung wie ein Mann. Durch ihre frühe Heirat wird sie Bäuerin auf einem großen Hof, wo das Leben für sie viele Schicksalsschläge bereithält. Doch mit Humor und Tatkraft schafft sie immer wieder einen Neuanfang.
In diesem Buch beleuchtet Roswitha Gruber nicht nur psychologisch und sozial interessante Aspekte, sie gibt uns auch Einblick in die neueste Zeitgeschichte und die rasante Entwicklung, die die Landwirtschaft genommen hat.
Tagebuch einer Berghebamme
eISBN 978-3-475-54340-1 (epub)
Kindern auf die Welt zu helfen – keine leichte, aber eine wunderbare, berührende und hoch emotionale Aufgabe mit großer Verantwortung! In einer Zeit, da die Ausübung des Hebammenberufes durch zahlreiche Vorschriften und Einschränkungen immer schwieriger wird, sollten die enormen Leistungen jener Frauen uns allen wieder bewusster werden. Die Geschichten der Berghebamme Marianne hat Roswitha Gruber als einzigartiges Zeugnis eines ganz besonderen Berufsstandes für uns niedergeschrieben.
Hanni
Eine Schweizer Bergbäuerin
eISBN 978-3-475-54236-7 (epub)
Hanni, eine Magd aus dem Kanton Uri, heiratet den Witwer ihrer Schwester Maria, denn der Bergbauer braucht eine Mutter für sein Kind und eine Bäuerin für seinen Hof. Aus dieser anfänglichen Zweckgemeinschaft entwickelt sich eine tiefe Liebe, aus der im Laufe der Jahre zwölf Kinder hervorgehen, darunter vier Zwillingspaare. Das Leben der Familie ist von großer Armut, harter Arbeit und vielen Schicksalsschlägen geprägt. Doch unerschütterliches Gottvertrauen und die tiefe Zuneigung der Eheleute lassen sie alle Schwierigkeiten meistern.
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com