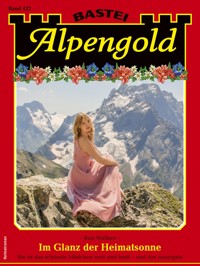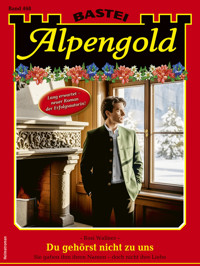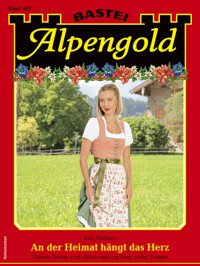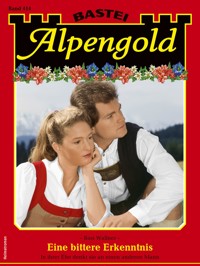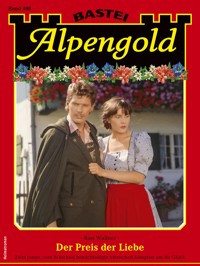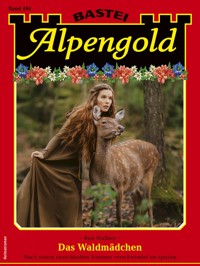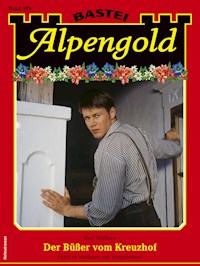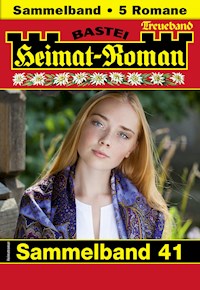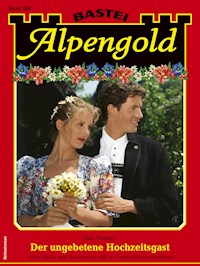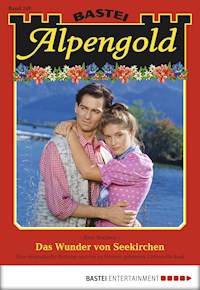
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alpengold
- Sprache: Deutsch
Nachdem der Rainbacher-Hof von einer Schneelawine vollkommen zerstört wurde, können die Hofbesitzer und die Großmutter nur noch tot geborgen werden. Allein der Hartnäckigkeit von Timon Brandner ist es zu verdanken, dass die Suchmannschaft nicht aufgibt und die Hoftochter schließlich lebend aus den Trümmern des Hauses gerettet werden kann. Verletzt an Körper und Seele, kämpft sich Beate mühsam ins Leben zurück.
Doch in was für ein Leben? Während man im Dorf das Wunder von Seekirchen feiert, muss Beate eine weitere bittere Wahrheit verkraften ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Das Wunder von Seekirchen
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Michael Wolf / Bastei Verlag
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5072-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Das Wunder von Seekirchen
Eine dramatische Rettung und ein zu Herzen gehendes Liebesschicksal
Von Rosi Wallner
Nachdem der Rainbacher-Hof von einer Schneelawine vollkommen zerstört wurde, können die Hofbesitzer und die Großmutter nur noch tot geborgen werden. Allein der Hartnäckigkeit von Timon Brandner ist es zu verdanken, dass die Suchmannschaft nicht aufgibt und die Hoftochter schließlich lebend aus den Trümmern des Hauses gerettet werden kann. Verletzt an Körper und Seele, kämpft sich Beate mühsam ins Leben zurück.
Doch in was für ein Leben? Während man im Dorf das Wunder von Seekirchen feiert, muss Beate eine weitere bittere Wahrheit verkraften …
»Kommt Sankt Vinzenz tief im Schnee, bringt das Jahr viel Heu und Klee.« So lautet eine alte Bauernregel für den 22. Januar.
Die Bewohner des kleinen Bergdorfs Seekirchen hatten demnach zwar keinen Grund, um ihre Heuernte zu bangen, aber sie fürchteten, dass sie wegen des starken Schneefalls bald völlig von der Außenwelt abgeschnitten sein würden. Seit Mitte Januar hatte es beinahe ununterbrochen geschneit, hohe Schneewälle säumten die Wege und Straßen, und es war keine Wetteränderung in Sicht.
Besonders bedrohlich war die Lage für die Bergbauern weit oben, wo die Wirtschaftswege schon unter den Schneemassen verschwunden waren, sodass es unmöglich war, zu der Landstraße zu gelangen, die durch Seekirchen führte.
Am höchsten gelegen war der Rainbacher-Hof. Hinter der Talmulde, wo ein Vorfahr des jetzigen Besitzers ihn im vorletzten Jahrhundert erbaut hatte, stiegen hinter einem schmalen Waldsaum die schiefergrauen Felsen eines gewaltigen Gebirgsmassivs empor.
Das stattliche Anwesen war bereits bis zu der Balustrade, die das erste Stockwerk umgab, im Schnee versunken. Der Hausbaum dahinter beugte sich so unter seiner Schneelast, dass zu befürchten war, dass er zusammenbrach. Nur der Hofplatz war freigeschaufelt, damit die Stallungen linker Hand erreichbar blieben.
Im Haus jedoch war es warm und anheimelnd. Der würzige Duft von Frischgebackenem durchzog die Räume, denn die Bäuerin ließ sich weder von Sturm noch Schneefall darin beirren, dass es zum Sonntag einen Kuchen geben musste. Und während sie in der Küche herumwirtschaftete, kümmerte sich ihr Mann um eine seiner Kühe, die erkrankt war.
Beate, die einzige Tochter der Rainbachers, war in der Wäschekammer und seufzte erleichtert auf, als das letzte Betttuch zusammengelegt war. Sie ging hinüber in die Stube, wo sie die Altbäuerin, liebevoll »Ahndl« genannt, auf der Ofenbank vorfand. Dort, eingehüllt von der Wärme des altertümlichen grünen Kachelofens, überwinterte sie, denn die Kälte machte ihr sehr zu schaffen.
»Geht es dir gut, Ahndl?«, fragte Beate besorgt, als die alte Frau, die merkwürdig verkrümmt dasaß, einen Schmerzenslaut von sich gab.
»Ach, du weißt schon, das Reißen. Wenn es wieder wärmer wird, dann tun die Knochen nimmer so weh. Wenn ich das nächste Frühjahr noch erleb«, fügte sie hinzu.
Ihre Enkelin lachte auf.
»Im Frühjahr bist du wieder munter und wühlst im Garten herum, wie jedes Jahr. Das weiß ich bestimmt.«
Die Züge der Altbäuerin nahmen einen seltsamen Ausdruck an.
»Das kann man nie wissen, was das Schicksal für einen bestimmt hat. Heut Nacht hab ich geträumt …«
»Träume haben nichts zu bedeuten. Sei doch net so abergläubisch«, fiel ihr Beate liebevoll ins Wort.
Da war Roswitha Rainbacher anderer Meinung. Aber sie schwieg und betrachtete stattdessen ihre Enkelin mit großem Wohlgefallen. Das Licht ihres Lebens, das war sie, und es genügte, sie anzusehen, um ihr beschwerliches Alter und die dunklen Stunden, die sie oft zu überwältigen drohten, zu vergessen.
Beate war ganz nach ihr geraten, nicht nach ihrer herben Mutter. In ihrer Jugend war Roswitha das schönste Madel im Tal gewesen, doch Beate übertraf sie noch. Denn sie war viel freier aufgewachsen als die Generation ihrer Großmutter, sodass sich ihr heiteres Wesen ganz entfalten konnte. Wenn sie lachte, leuchtete ihr schönes Gesicht mit den klaren grünblauen Augen, das von dichtem rotbraunem Lockenhaar umgeben war, geradezu.
Das Winterdirndl, über dem sie eine gestrickte Trachtenweste trug, umschloss eine schlanke, gut gewachsene Gestalt. Beate bewegte sich mit anmutiger Geschmeidigkeit und tanzte leidenschaftlich gern. Und sie würde einmal eine tüchtige Hofbäuerin abgeben, davon war ihre Großmutter überzeugt.
Roswitha erhob sich mühsam. Sie holte die letzte der schwarzen Wetterkerzen hervor, die auch schon ziemlich niedergebrannt war, und stellte sie in ein Glas am Fenster. Dann nahm sie ihren Platz auf der Ofenbank wieder ein.
»Bald ist Mariä Lichtmess, und neue Kerzen werden geweiht«, sagte sie, während sie ihren Rosenkranz hervorkramte.
Am zweiten Februar, wenn das bäuerliche Jahr begann und in früheren Jahren sich die Knechte und Mägde neu verdingten, erfolgte die feierliche Ausgabe dieser Kerzen. Sie sollten die Menschen vor den heftigen Unwettern schützen, die in dieser Gebirgsgegend nicht selten waren. Und gerade die Älteren im Dorf hingen diesem Glauben unerschütterlich an.
»Aber es kommt doch kein Wetter. Es schneit halt nur heftig«, meinte Beate, die nicht viel von derlei hielt.
»Der Wind ist stärker geworden, hörst du das net?«
Das stimmte. Die Fensterläden klapperten, und im Kamin brauste es, doch noch nicht so stark, dass das Haus sturmfest gemacht werden musste. Es klang fast schon, als ob der Frühling nahen würde.
»Es liegt etwas in der Luft, das spür ich in meinen Knochen«, sagte Roswitha, ihre Stimme war zu einem Flüstern herabgesunken.
Beate trat ans Fenster und sah hinaus. Wie eine weiße Wand versperrte der dichte Schneefall die Sicht. Nein, heute würde kein Durchkommen mehr sein, und unwillkürlich entschlüpfte ein trauriger Seufzer ihren Lippen.
Roswitha schien ihre Gedanken zu erahnen.
»Du hast dich heut mit dem Tobi treffen wollen«, sagte sie mitfühlend.
»Ja, aber daraus wird wohl nichts. Und ich hab Angst, dass das für längere Zeit so bleibt. Das wäre ja net das erste Mal, dass wir für längere Zeit völlig eingeschneit sind.«
Roswitha kicherte, es war ein ungewöhnlicher Laut.
»Da sagst du was! In meiner Kindheit gab es ja net diese großen Schneeraupen, und ich erinnere mich, wie wir mal wochenlang wie begraben unter dem Schnee auf unserem kleinen Gütl lagen. Aber wir hatten alles, was wir brauchten, daheim. Die Mutter, meine Schwestern und ich haben die alten Geschichten erzählt und gesungen, die älteste, unsere Therese, hat derweilen an ihrer Aussteuer gearbeitet. Denn sie wollt im Frühjahr heiraten. Ja, es war eine harte Zeit damals, aber es gab auch viel Schönes, das nie mehr wiederkehrt. Und du und der Tobi, ihr seid euch einig?«, fügte sie unvermittelt hinzu.
Beate hatte sich, als sie zu erzählen begann, ihr wieder zugewandt, und ein zartes Rot färbte ihre Wangen.
»Nach dem Dreikönigsschießen ist ja immer Tanz, und da hat er mich gefragt. Wir wollen mit der Hochzeit net lang warten.«
»Das ist net falsch.«
»Ich bin bis dahin mit der Landwirtschaftsschule fertig, und der Tobi arbeitet ja sowieso weiter bei der Gemeinde. Wir ziehen in den Anbau, und sonst bleibt alles beim Alten.«
»Da habt ihr euch aber in der kurzen Zeit schon alles genau überlegt. Warum auch net! Schließlich sind deine Eltern auch noch viel zu jung, um den Hof zu übergeben«, meinte die Ahndl.
»Die meisten Höfe werden inzwischen sowieso als eine Art Familienbetrieb bewirtschaftet. Oder im Nebenerwerb, denn sonst wären sie längst als unrentabel aufgegeben worden. Da hat sich vieles geändert.«
Die Großmutter seufzte wehmütig.
»Net nur zum Besseren. Aber sag mal, Madel, du hast mir eigentlich nie erzählt, wie ihr zusammengekommen seid, du und der Tobi. Das tät ich jetzt doch gern wissen, auch wenn du mich für neugierig hältst.«
Roswithas eingesunkene kleine Vogelaugen funkelten.
»Wo haben sich früher denn die Paare kennengelernt, Ahndl?«, fragte Beate neckend und legte den Kopf schief.
Roswitha zögerte keinen Augenblick mit der Antwort.
»Auf dem Tanzboden natürlich. Da hab ich auch meinen Mandl, deinen Großvater, zum ersten Mal gesehen, denn ich stamm ja aus einem der Nachbardörfer. Ich durft mit ein paar älteren Verwandten zum Tanz nach Seekirchen, und dort war es um mich geschehen. So ein fesches Mannsbild war er, dein Großvater, und tanzen konnt er …«
Sie stockte, und ein seliges Lächeln überzog ihre zerfurchten Züge und verlieh ihnen noch einmal den Abglanz früherer Schönheit.
»Und es hat net lang gedauert, bis er bei uns vor der Tür stand. Damals hat man erst die Eltern fragen müssen, wenn man heiraten wollt. Und bereut hab ich es keinen Augenblick, auch wenn er so früh hat von mir gehen müssen, mein Mandl.«
Sie bekreuzigte sich schnell und drängte die Tränen zurück.
»Siehst du, und so ist es auch mit dem Tobi gewesen. Zwar haben wir uns schon von Kind auf gekannt, das ist schließlich ein kleines Dorf, aber erst als wir zum ersten Mal miteinander getanzt haben, ist alles ganz anders geworden. Denn der Tobi hat Musik im Blut und kann tanzen wie kein anderer. Und das Gleiche hat er auch von mir gesagt, und danach konnten wir uns nimmer voneinander trennen. Wenn wir miteinand tanzen, dann stehen am End die anderen drum herum und klatschen.«
»Und für euer gemeinsames Leben wünsch ich euch von Herzen, dass ihr auch nie aus dem Tritt kommt.«
»Das hast du schön gesagt, Ahndl«, erwiderte Beate bewegt und ergriff die verarbeiteten Hände ihrer Großmutter.
Einen Augenblick saßen sie schweigend da, als plötzlich ein Zittern durch das Haus ging, ganz sacht, aber doch spürbar. Das Mädchen ließ sofort die Hände der Ahndl los, als habe es etwas gestreift.
»Ein Steinschlag, weit oben sicher. Das hat es schon öfters gegeben«, versuchte Roswitha die Enkelin zu beruhigen.
Doch ein eisiger Hauch schien durch die gemütliche Stube zu streichen, und Beate erschauerte und presste ihre Hand auf das Herz, das mit einem Mal wie wild schlug. Dann war es vorbei, und die Geborgenheit des Hauses umfing sie wieder.
»Und dann seid ihr euch beim Dreikönigsschießen einig geworden«, nahm Roswitha den Gesprächsfaden wieder auf.
»Ja. Obwohl das Fest gar net gut angefangen hat. Der Tobi ist nämlich mit dem Brandner-Timon beim Wettschießen aneinandergeraten, ich hab bis jetzt noch net verstanden, um was es eigentlich ging. Du weißt ja, wie die Brandners sind, und der Timon scheint der Schlimmste von allen zu sein.«
Die Ahndl gab ein kurzes, krächzendes Lachen von sich.
»Schon sein Großvater zu meiner Zeit war so und hat beinahe einen Rivalen gekragelt. Net zu zähmen und immer draußen in der freien Natur. Und wenn er bei einem Dorffest aufgetaucht ist, dann ging es immer hoch her, angriffslustig, wie er war. Kein Wunder, dass seine Frau ihn im Stich gelassen hat, als sein Bub alt genug war. Und der ist halt auch in die Fußstapfen seines Vaters getreten.«
»Soll er net ein Pascher gewesen sein, der Vater vom Timon? Man hört ja jetzt noch so allerhand über ihn«, fragte Beate dazwischen.
»Und ob! Aber er war schlau und gerissen genug, dass ihn kein Jäger gestellt hat und man ihm die Wilderei auch net nachweisen hat können. Geschäftstüchtig war er auch, denn er hat ein Stück Wald an sich gebracht mitsamt dem alten Forsthaus, das von der Gemeinde aufgegeben worden ist. Das hat niemandem geschmeckt, dass ausgerechnet er dort wohnt.«
»Das kann ich mir denken«, sagte Beate lachend.
»Wie schaut er denn aus, der Timon?«, fragte die Ahndl.
»Ziemlich verwildert, find ich. Ein rechter Naturbursche halt, wie die Städter so einen nennen. Aber so genau hab ich ihn mir net angeschaut«, meinte Beate und zuckte gleichgültig die Schultern.
»Sein Vater und sein Großvater waren aber stattliche Mannsbilder …«
»Kein es sein, dass dir sein Großvater gut gefallen hat?«, fragte Beate und sah ihre Großmutter neckend an.
»Ah geh«, wehrte Roswitha ab, »mein Mandl war alles für mich. Der Erste und auch der Letzte, so war das damals.«
»Ja«, sagte Beate, ernster werdend, »so soll es mit dem Tobias und mir auch werden. Dass ich keinen anderen mehr will.«
Beate sah wieder auf den Hofplatz hinaus, und Sehnsucht spiegelte sich auf ihren ebenmäßigen, schönen Zügen.
»Dir bleibt fei noch genug Zeit mit dem Tobi. Nur Geduld«, versuchte die Großmutter sie zu trösten.
Im gleichen Augenblick rief die Mutter laut nach Beate aus der Küche, und das Mädchen eilte sofort zu ihr.
»Soll ich dir helfen?«
Antonia Rainbacher wandte sich nach ihr um. Wie immer, wenn sie Beate ansah, konnte sie es kaum glauben, dass dieses schöne Mädchen ihre Tochter sein sollte. Im Gegensatz zu ihr hatte die Natur sie selbst eher stiefmütterlich bedacht, auch wenn sie zu ihrer Zeit nicht reizlos gewesen war und Franz Rainbacher Gefallen an ihr gefunden hatte. Aber Beate haftete etwas Helles, Strahlendes an.
»Kannst du mir vom Quellwasser aus dem Keller holen? Und ein paar Kartoffeln könnt ich auch noch gebrauchen.«
»Ja, ist recht.«
Wie die meisten alten Bauernhäuser verfügte der Rainbacher-Hof über einen weitläufigen Gewölbekeller. Dort wurden Winterkartoffeln, Eingemachtes und auf großen Regalen verschiedene Apfelsorten gelagert. In einer Ecke befand sich die Weinsammlung ihres Vaters.
Beate öffnete die Tür unter der Treppe, die zum Keller hinunterführte, und schaltete das trübe Licht an. Dann stieg sie vorsichtig die steilen Stufen hinab, wobei sie sich am Geländer festhielt.
Sie war schon beinahe unten, als plötzlich die Tür mit einem lauten Krachen zuschlug. Ein Dröhnen und Brausen erfüllte die Luft, alles um sie herum schwankte und bebte, und unwillkürlich löste sich ihr Griff.
Das war das Letzte, an das sie sich erinnern konnte.
***
Als Beate wieder zu sich kam, war sie in tiefe Dunkelheit gehüllt. Sie erzitterte in der eisigen Kälte, und ihr Kopf schmerzte zum Zerbersten. Als sie mit der Hand über ihre Stirn fuhr, spürte sie etwas Feuchtes, Klebriges, und sie zog sie schnell wieder zurück. Ihr Mund war merkwürdig trocken, als wäre er mit Staub angefüllt. Aber am meisten entsetzte sie, dass sie nicht wusste, wo sie sich befand, und sich in der Dunkelheit ausgeliefert und verloren fühlte.
Sie versuchte mühsam, sich aufzurichten, doch ihre Beine wollten ihr nicht gehorchen, und ein heftiges Schwindelgefühl ergriff von ihr Besitz, sodass sie wieder niedersank. Dann verlor sie wieder das Bewusstsein.
Beate wusste nicht, wie lange sie besinnungslos gewesen war, als sie erneut die Augen aufschlug. Wieder erfüllte sie lähmendes Entsetzen, dann versuchte sie zu schreien, doch sie brachte nur krächzende Laute hervor. Zuletzt weinte und wimmerte sie, rief nach ihrer Mutter, bis sie wieder im Vergessen versank. Als sie daraus auftauchte, waren ihre Tränen versiegt, ihr Selbsterhaltungstrieb hatte die Oberhand gewonnen.
Vorsichtig begann sie, ihre Umgebung abzutasten, sie spürte kalten Boden und grobes Mauerwerk zu ihrer Rechten. Dann fasste sie in Holzlatten und weiter höher in einen groben, fasrigen Stoff. Das mussten die Säcke sein, mit denen das Behältnis für die Winterkartoffeln abgedeckt war.
Und damit kehrte die Erinnerung zurück.
Sie war also im Gewölbekeller eingesperrt. Etwas Furchtbares musste geschehen sein, weil das Licht erloschen war und niemand sie herausgeholt hatte. Wieder brach Beate in Tränen aus, aber dann bezwang sie sich. Sie musste alle verbliebenen Kräfte aufbieten, um die rettende Treppe zum Ausgang zu finden.
Langsam kroch sie vorwärts, doch bald stieß sie gegen Hindernisse, die ihr den Weg versperrten, Regale waren vor ihr aufgetürmt und machten ein Durchkommen unmöglich. Auf dem Boden war nun alles verstreut, was als Vorrat dienen sollte.
Beate fand Äpfel, die herabgefallen waren, und eine unversehrte Flasche Quellwasser dazwischen. Es dauerte lange, bis sie mit ihren vor Kälte steifen Fingern den Verschluss geöffnet hatte, dann trank sie in durstigen Zügen. Mit ein paar Äpfeln und der Flasche bewegte sie sich wieder zurück.
Sie zerrte die Säcke von den Kartoffeln und legte einen Teil davon auf den Boden, mit den anderen deckte sie sich zu. Dann biss sie in einen der Äpfel, sie spürte jetzt erst, wie hungrig sie war.
Immer wieder versuchte Beate, wenigstens zu einem der Kellerfenster zu gelangen, doch es war vergebens. Schließlich blieb sie auf ihrem Platz, eine große Müdigkeit überkam sie, und sie verbrachte die Zeit halb schlafend, halb in wirren Halluzinationen. Manchmal betete sie, dann wieder sang sie eines der alten Lieder, denn es war so geisterhaft still in diesem schwarzen Verlies.
Danach versank sie wieder in ein barmherziges Dunkel.
***
Timon Brandner stand vor dem alten Forsthaus und starrte missgestimmt in das Schneetreiben. Er war an die harten Gebirgswinter gewöhnt und beklagte sich nie darüber, doch heute wurde er – wie viele Menschen, die sich von Kind an in der freien Natur aufhalten – von Vorahnungen geplagt.
So, als ob Unheil in der Luft liegen würde.