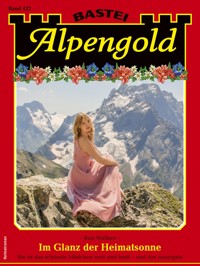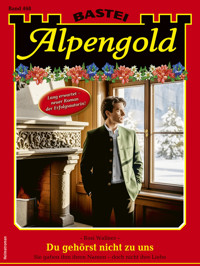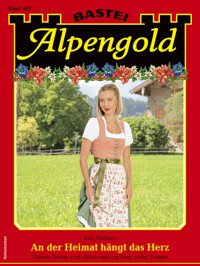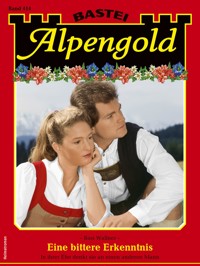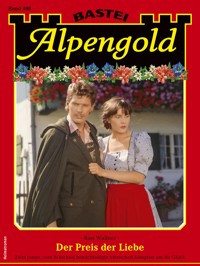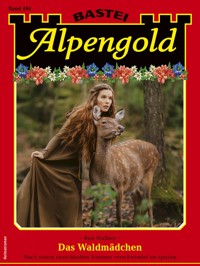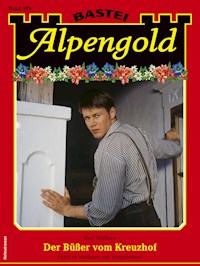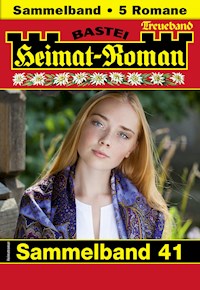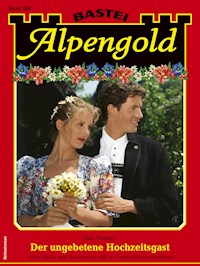5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimat-Roman Treueband
- Sprache: Deutsch
Lesen, was glücklich macht. Und das zum Sparpreis!
Seit Jahrzehnten erfreut sich das Genre des Heimat-Bergromans sehr großer Beliebtheit. Je hektischer unser Alltag ist, umso größer wird unsere Sehnsucht nach dem einfachen Leben, wo nur das Plätschern des Brunnens und der Gesang der Amsel die Feierabendstille unterbrechen.
Zwischenmenschliche Konflikte sind ebenso Thema wie Tradition, Bauernstolz und romantische heimliche Abenteuer. Ob es die schöne Magd ist oder der erfolgreiche Großbauer - die Liebe dieser Menschen wird von unseren beliebtesten und erfolgreichsten Autoren mit Gefühl und viel dramatischem Empfinden in Szene gesetzt.
Alle Geschichten werden mit solcher Intensität erzählt, dass sie niemanden unberührt lassen. Reisen Sie mit unseren Helden und Heldinnen in eine herrliche Bergwelt, die sich ihren Zauber bewahrt hat.
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Alpengold 249 - Das Wunder von Seekirchen
Alpengold 250 - Rosen und ein Lied zum Gruß
Der Bergdoktor 1837 - Bärbel Tannauers Irrweg
Der Bergdoktor 1838 - Dr. Burger und die Tochter des Wilderers
Das Berghotel 177 - Unser Bankerl am Wegesrand
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2017/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2026 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Bastei Verlag (unter Verwendung von KI-Software)
ISBN: 978-3-7517-9475-6
https://www.bastei.de
https://www.bastei-luebbe.de
https://www.lesejury.de
Heimat-Roman Treueband 82
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Alpengold 249
Das Wunder von Seekirchen
Alpengold 250
Rosen und ein Lied zum Gruß
Der Bergdoktor 1837
Bärbel Tannauers Irrweg
Der Bergdoktor 1838
Dr. Burger und die Tochter des Wilderers
Das Berghotel 177
Unser Bankerl am Wegesrand
Guide
Start Reading
Contents
Das Wunder von Seekirchen
Eine dramatische Rettung und ein zu Herzen gehendes Liebesschicksal
Von Rosi Wallner
Nachdem der Rainbacher-Hof von einer Schneelawine vollkommen zerstört wurde, können die Hofbesitzer und die Großmutter nur noch tot geborgen werden. Allein der Hartnäckigkeit von Timon Brandner ist es zu verdanken, dass die Suchmannschaft nicht aufgibt und die Hoftochter schließlich lebend aus den Trümmern des Hauses gerettet werden kann. Verletzt an Körper und Seele, kämpft sich Beate mühsam ins Leben zurück.
Doch in was für ein Leben? Während man im Dorf das Wunder von Seekirchen feiert, muss Beate eine weitere bittere Wahrheit verkraften …
»Kommt Sankt Vinzenz tief im Schnee, bringt das Jahr viel Heu und Klee.« So lautet eine alte Bauernregel für den 22. Januar.
Die Bewohner des kleinen Bergdorfs Seekirchen hatten demnach zwar keinen Grund, um ihre Heuernte zu bangen, aber sie fürchteten, dass sie wegen des starken Schneefalls bald völlig von der Außenwelt abgeschnitten sein würden. Seit Mitte Januar hatte es beinahe ununterbrochen geschneit, hohe Schneewälle säumten die Wege und Straßen, und es war keine Wetteränderung in Sicht.
Besonders bedrohlich war die Lage für die Bergbauern weit oben, wo die Wirtschaftswege schon unter den Schneemassen verschwunden waren, sodass es unmöglich war, zu der Landstraße zu gelangen, die durch Seekirchen führte.
Am höchsten gelegen war der Rainbacher-Hof. Hinter der Talmulde, wo ein Vorfahr des jetzigen Besitzers ihn im vorletzten Jahrhundert erbaut hatte, stiegen hinter einem schmalen Waldsaum die schiefergrauen Felsen eines gewaltigen Gebirgsmassivs empor.
Das stattliche Anwesen war bereits bis zu der Balustrade, die das erste Stockwerk umgab, im Schnee versunken. Der Hausbaum dahinter beugte sich so unter seiner Schneelast, dass zu befürchten war, dass er zusammenbrach. Nur der Hofplatz war freigeschaufelt, damit die Stallungen linker Hand erreichbar blieben.
Im Haus jedoch war es warm und anheimelnd. Der würzige Duft von Frischgebackenem durchzog die Räume, denn die Bäuerin ließ sich weder von Sturm noch Schneefall darin beirren, dass es zum Sonntag einen Kuchen geben musste. Und während sie in der Küche herumwirtschaftete, kümmerte sich ihr Mann um eine seiner Kühe, die erkrankt war.
Beate, die einzige Tochter der Rainbachers, war in der Wäschekammer und seufzte erleichtert auf, als das letzte Betttuch zusammengelegt war. Sie ging hinüber in die Stube, wo sie die Altbäuerin, liebevoll »Ahndl« genannt, auf der Ofenbank vorfand. Dort, eingehüllt von der Wärme des altertümlichen grünen Kachelofens, überwinterte sie, denn die Kälte machte ihr sehr zu schaffen.
»Geht es dir gut, Ahndl?«, fragte Beate besorgt, als die alte Frau, die merkwürdig verkrümmt dasaß, einen Schmerzenslaut von sich gab.
»Ach, du weißt schon, das Reißen. Wenn es wieder wärmer wird, dann tun die Knochen nimmer so weh. Wenn ich das nächste Frühjahr noch erleb«, fügte sie hinzu.
Ihre Enkelin lachte auf.
»Im Frühjahr bist du wieder munter und wühlst im Garten herum, wie jedes Jahr. Das weiß ich bestimmt.«
Die Züge der Altbäuerin nahmen einen seltsamen Ausdruck an.
»Das kann man nie wissen, was das Schicksal für einen bestimmt hat. Heut Nacht hab ich geträumt …«
»Träume haben nichts zu bedeuten. Sei doch net so abergläubisch«, fiel ihr Beate liebevoll ins Wort.
Da war Roswitha Rainbacher anderer Meinung. Aber sie schwieg und betrachtete stattdessen ihre Enkelin mit großem Wohlgefallen. Das Licht ihres Lebens, das war sie, und es genügte, sie anzusehen, um ihr beschwerliches Alter und die dunklen Stunden, die sie oft zu überwältigen drohten, zu vergessen.
Beate war ganz nach ihr geraten, nicht nach ihrer herben Mutter. In ihrer Jugend war Roswitha das schönste Madel im Tal gewesen, doch Beate übertraf sie noch. Denn sie war viel freier aufgewachsen als die Generation ihrer Großmutter, sodass sich ihr heiteres Wesen ganz entfalten konnte. Wenn sie lachte, leuchtete ihr schönes Gesicht mit den klaren grünblauen Augen, das von dichtem rotbraunem Lockenhaar umgeben war, geradezu.
Das Winterdirndl, über dem sie eine gestrickte Trachtenweste trug, umschloss eine schlanke, gut gewachsene Gestalt. Beate bewegte sich mit anmutiger Geschmeidigkeit und tanzte leidenschaftlich gern. Und sie würde einmal eine tüchtige Hofbäuerin abgeben, davon war ihre Großmutter überzeugt.
Roswitha erhob sich mühsam. Sie holte die letzte der schwarzen Wetterkerzen hervor, die auch schon ziemlich niedergebrannt war, und stellte sie in ein Glas am Fenster. Dann nahm sie ihren Platz auf der Ofenbank wieder ein.
»Bald ist Mariä Lichtmess, und neue Kerzen werden geweiht«, sagte sie, während sie ihren Rosenkranz hervorkramte.
Am zweiten Februar, wenn das bäuerliche Jahr begann und in früheren Jahren sich die Knechte und Mägde neu verdingten, erfolgte die feierliche Ausgabe dieser Kerzen. Sie sollten die Menschen vor den heftigen Unwettern schützen, die in dieser Gebirgsgegend nicht selten waren. Und gerade die Älteren im Dorf hingen diesem Glauben unerschütterlich an.
»Aber es kommt doch kein Wetter. Es schneit halt nur heftig«, meinte Beate, die nicht viel von derlei hielt.
»Der Wind ist stärker geworden, hörst du das net?«
Das stimmte. Die Fensterläden klapperten, und im Kamin brauste es, doch noch nicht so stark, dass das Haus sturmfest gemacht werden musste. Es klang fast schon, als ob der Frühling nahen würde.
»Es liegt etwas in der Luft, das spür ich in meinen Knochen«, sagte Roswitha, ihre Stimme war zu einem Flüstern herabgesunken.
Beate trat ans Fenster und sah hinaus. Wie eine weiße Wand versperrte der dichte Schneefall die Sicht. Nein, heute würde kein Durchkommen mehr sein, und unwillkürlich entschlüpfte ein trauriger Seufzer ihren Lippen.
Roswitha schien ihre Gedanken zu erahnen.
»Du hast dich heut mit dem Tobi treffen wollen«, sagte sie mitfühlend.
»Ja, aber daraus wird wohl nichts. Und ich hab Angst, dass das für längere Zeit so bleibt. Das wäre ja net das erste Mal, dass wir für längere Zeit völlig eingeschneit sind.«
Roswitha kicherte, es war ein ungewöhnlicher Laut.
»Da sagst du was! In meiner Kindheit gab es ja net diese großen Schneeraupen, und ich erinnere mich, wie wir mal wochenlang wie begraben unter dem Schnee auf unserem kleinen Gütl lagen. Aber wir hatten alles, was wir brauchten, daheim. Die Mutter, meine Schwestern und ich haben die alten Geschichten erzählt und gesungen, die älteste, unsere Therese, hat derweilen an ihrer Aussteuer gearbeitet. Denn sie wollt im Frühjahr heiraten. Ja, es war eine harte Zeit damals, aber es gab auch viel Schönes, das nie mehr wiederkehrt. Und du und der Tobi, ihr seid euch einig?«, fügte sie unvermittelt hinzu.
Beate hatte sich, als sie zu erzählen begann, ihr wieder zugewandt, und ein zartes Rot färbte ihre Wangen.
»Nach dem Dreikönigsschießen ist ja immer Tanz, und da hat er mich gefragt. Wir wollen mit der Hochzeit net lang warten.«
»Das ist net falsch.«
»Ich bin bis dahin mit der Landwirtschaftsschule fertig, und der Tobi arbeitet ja sowieso weiter bei der Gemeinde. Wir ziehen in den Anbau, und sonst bleibt alles beim Alten.«
»Da habt ihr euch aber in der kurzen Zeit schon alles genau überlegt. Warum auch net! Schließlich sind deine Eltern auch noch viel zu jung, um den Hof zu übergeben«, meinte die Ahndl.
»Die meisten Höfe werden inzwischen sowieso als eine Art Familienbetrieb bewirtschaftet. Oder im Nebenerwerb, denn sonst wären sie längst als unrentabel aufgegeben worden. Da hat sich vieles geändert.«
Die Großmutter seufzte wehmütig.
»Net nur zum Besseren. Aber sag mal, Madel, du hast mir eigentlich nie erzählt, wie ihr zusammengekommen seid, du und der Tobi. Das tät ich jetzt doch gern wissen, auch wenn du mich für neugierig hältst.«
Roswithas eingesunkene kleine Vogelaugen funkelten.
»Wo haben sich früher denn die Paare kennengelernt, Ahndl?«, fragte Beate neckend und legte den Kopf schief.
Roswitha zögerte keinen Augenblick mit der Antwort.
»Auf dem Tanzboden natürlich. Da hab ich auch meinen Mandl, deinen Großvater, zum ersten Mal gesehen, denn ich stamm ja aus einem der Nachbardörfer. Ich durft mit ein paar älteren Verwandten zum Tanz nach Seekirchen, und dort war es um mich geschehen. So ein fesches Mannsbild war er, dein Großvater, und tanzen konnt er …«
Sie stockte, und ein seliges Lächeln überzog ihre zerfurchten Züge und verlieh ihnen noch einmal den Abglanz früherer Schönheit.
»Und es hat net lang gedauert, bis er bei uns vor der Tür stand. Damals hat man erst die Eltern fragen müssen, wenn man heiraten wollt. Und bereut hab ich es keinen Augenblick, auch wenn er so früh hat von mir gehen müssen, mein Mandl.«
Sie bekreuzigte sich schnell und drängte die Tränen zurück.
»Siehst du, und so ist es auch mit dem Tobi gewesen. Zwar haben wir uns schon von Kind auf gekannt, das ist schließlich ein kleines Dorf, aber erst als wir zum ersten Mal miteinander getanzt haben, ist alles ganz anders geworden. Denn der Tobi hat Musik im Blut und kann tanzen wie kein anderer. Und das Gleiche hat er auch von mir gesagt, und danach konnten wir uns nimmer voneinander trennen. Wenn wir miteinand tanzen, dann stehen am End die anderen drum herum und klatschen.«
»Und für euer gemeinsames Leben wünsch ich euch von Herzen, dass ihr auch nie aus dem Tritt kommt.«
»Das hast du schön gesagt, Ahndl«, erwiderte Beate bewegt und ergriff die verarbeiteten Hände ihrer Großmutter.
Einen Augenblick saßen sie schweigend da, als plötzlich ein Zittern durch das Haus ging, ganz sacht, aber doch spürbar. Das Mädchen ließ sofort die Hände der Ahndl los, als habe es etwas gestreift.
»Ein Steinschlag, weit oben sicher. Das hat es schon öfters gegeben«, versuchte Roswitha die Enkelin zu beruhigen.
Doch ein eisiger Hauch schien durch die gemütliche Stube zu streichen, und Beate erschauerte und presste ihre Hand auf das Herz, das mit einem Mal wie wild schlug. Dann war es vorbei, und die Geborgenheit des Hauses umfing sie wieder.
»Und dann seid ihr euch beim Dreikönigsschießen einig geworden«, nahm Roswitha den Gesprächsfaden wieder auf.
»Ja. Obwohl das Fest gar net gut angefangen hat. Der Tobi ist nämlich mit dem Brandner-Timon beim Wettschießen aneinandergeraten, ich hab bis jetzt noch net verstanden, um was es eigentlich ging. Du weißt ja, wie die Brandners sind, und der Timon scheint der Schlimmste von allen zu sein.«
Die Ahndl gab ein kurzes, krächzendes Lachen von sich.
»Schon sein Großvater zu meiner Zeit war so und hat beinahe einen Rivalen gekragelt. Net zu zähmen und immer draußen in der freien Natur. Und wenn er bei einem Dorffest aufgetaucht ist, dann ging es immer hoch her, angriffslustig, wie er war. Kein Wunder, dass seine Frau ihn im Stich gelassen hat, als sein Bub alt genug war. Und der ist halt auch in die Fußstapfen seines Vaters getreten.«
»Soll er net ein Pascher gewesen sein, der Vater vom Timon? Man hört ja jetzt noch so allerhand über ihn«, fragte Beate dazwischen.
»Und ob! Aber er war schlau und gerissen genug, dass ihn kein Jäger gestellt hat und man ihm die Wilderei auch net nachweisen hat können. Geschäftstüchtig war er auch, denn er hat ein Stück Wald an sich gebracht mitsamt dem alten Forsthaus, das von der Gemeinde aufgegeben worden ist. Das hat niemandem geschmeckt, dass ausgerechnet er dort wohnt.«
»Das kann ich mir denken«, sagte Beate lachend.
»Wie schaut er denn aus, der Timon?«, fragte die Ahndl.
»Ziemlich verwildert, find ich. Ein rechter Naturbursche halt, wie die Städter so einen nennen. Aber so genau hab ich ihn mir net angeschaut«, meinte Beate und zuckte gleichgültig die Schultern.
»Sein Vater und sein Großvater waren aber stattliche Mannsbilder …«
»Kein es sein, dass dir sein Großvater gut gefallen hat?«, fragte Beate und sah ihre Großmutter neckend an.
»Ah geh«, wehrte Roswitha ab, »mein Mandl war alles für mich. Der Erste und auch der Letzte, so war das damals.«
»Ja«, sagte Beate, ernster werdend, »so soll es mit dem Tobias und mir auch werden. Dass ich keinen anderen mehr will.«
Beate sah wieder auf den Hofplatz hinaus, und Sehnsucht spiegelte sich auf ihren ebenmäßigen, schönen Zügen.
»Dir bleibt fei noch genug Zeit mit dem Tobi. Nur Geduld«, versuchte die Großmutter sie zu trösten.
Im gleichen Augenblick rief die Mutter laut nach Beate aus der Küche, und das Mädchen eilte sofort zu ihr.
»Soll ich dir helfen?«
Antonia Rainbacher wandte sich nach ihr um. Wie immer, wenn sie Beate ansah, konnte sie es kaum glauben, dass dieses schöne Mädchen ihre Tochter sein sollte. Im Gegensatz zu ihr hatte die Natur sie selbst eher stiefmütterlich bedacht, auch wenn sie zu ihrer Zeit nicht reizlos gewesen war und Franz Rainbacher Gefallen an ihr gefunden hatte. Aber Beate haftete etwas Helles, Strahlendes an.
»Kannst du mir vom Quellwasser aus dem Keller holen? Und ein paar Kartoffeln könnt ich auch noch gebrauchen.«
»Ja, ist recht.«
Wie die meisten alten Bauernhäuser verfügte der Rainbacher-Hof über einen weitläufigen Gewölbekeller. Dort wurden Winterkartoffeln, Eingemachtes und auf großen Regalen verschiedene Apfelsorten gelagert. In einer Ecke befand sich die Weinsammlung ihres Vaters.
Beate öffnete die Tür unter der Treppe, die zum Keller hinunterführte, und schaltete das trübe Licht an. Dann stieg sie vorsichtig die steilen Stufen hinab, wobei sie sich am Geländer festhielt.
Sie war schon beinahe unten, als plötzlich die Tür mit einem lauten Krachen zuschlug. Ein Dröhnen und Brausen erfüllte die Luft, alles um sie herum schwankte und bebte, und unwillkürlich löste sich ihr Griff.
Das war das Letzte, an das sie sich erinnern konnte.
***
Als Beate wieder zu sich kam, war sie in tiefe Dunkelheit gehüllt. Sie erzitterte in der eisigen Kälte, und ihr Kopf schmerzte zum Zerbersten. Als sie mit der Hand über ihre Stirn fuhr, spürte sie etwas Feuchtes, Klebriges, und sie zog sie schnell wieder zurück. Ihr Mund war merkwürdig trocken, als wäre er mit Staub angefüllt. Aber am meisten entsetzte sie, dass sie nicht wusste, wo sie sich befand, und sich in der Dunkelheit ausgeliefert und verloren fühlte.
Sie versuchte mühsam, sich aufzurichten, doch ihre Beine wollten ihr nicht gehorchen, und ein heftiges Schwindelgefühl ergriff von ihr Besitz, sodass sie wieder niedersank. Dann verlor sie wieder das Bewusstsein.
Beate wusste nicht, wie lange sie besinnungslos gewesen war, als sie erneut die Augen aufschlug. Wieder erfüllte sie lähmendes Entsetzen, dann versuchte sie zu schreien, doch sie brachte nur krächzende Laute hervor. Zuletzt weinte und wimmerte sie, rief nach ihrer Mutter, bis sie wieder im Vergessen versank. Als sie daraus auftauchte, waren ihre Tränen versiegt, ihr Selbsterhaltungstrieb hatte die Oberhand gewonnen.
Vorsichtig begann sie, ihre Umgebung abzutasten, sie spürte kalten Boden und grobes Mauerwerk zu ihrer Rechten. Dann fasste sie in Holzlatten und weiter höher in einen groben, fasrigen Stoff. Das mussten die Säcke sein, mit denen das Behältnis für die Winterkartoffeln abgedeckt war.
Und damit kehrte die Erinnerung zurück.
Sie war also im Gewölbekeller eingesperrt. Etwas Furchtbares musste geschehen sein, weil das Licht erloschen war und niemand sie herausgeholt hatte. Wieder brach Beate in Tränen aus, aber dann bezwang sie sich. Sie musste alle verbliebenen Kräfte aufbieten, um die rettende Treppe zum Ausgang zu finden.
Langsam kroch sie vorwärts, doch bald stieß sie gegen Hindernisse, die ihr den Weg versperrten, Regale waren vor ihr aufgetürmt und machten ein Durchkommen unmöglich. Auf dem Boden war nun alles verstreut, was als Vorrat dienen sollte.
Beate fand Äpfel, die herabgefallen waren, und eine unversehrte Flasche Quellwasser dazwischen. Es dauerte lange, bis sie mit ihren vor Kälte steifen Fingern den Verschluss geöffnet hatte, dann trank sie in durstigen Zügen. Mit ein paar Äpfeln und der Flasche bewegte sie sich wieder zurück.
Sie zerrte die Säcke von den Kartoffeln und legte einen Teil davon auf den Boden, mit den anderen deckte sie sich zu. Dann biss sie in einen der Äpfel, sie spürte jetzt erst, wie hungrig sie war.
Immer wieder versuchte Beate, wenigstens zu einem der Kellerfenster zu gelangen, doch es war vergebens. Schließlich blieb sie auf ihrem Platz, eine große Müdigkeit überkam sie, und sie verbrachte die Zeit halb schlafend, halb in wirren Halluzinationen. Manchmal betete sie, dann wieder sang sie eines der alten Lieder, denn es war so geisterhaft still in diesem schwarzen Verlies.
Danach versank sie wieder in ein barmherziges Dunkel.
***
Timon Brandner stand vor dem alten Forsthaus und starrte missgestimmt in das Schneetreiben. Er war an die harten Gebirgswinter gewöhnt und beklagte sich nie darüber, doch heute wurde er – wie viele Menschen, die sich von Kind an in der freien Natur aufhalten – von Vorahnungen geplagt.
So, als ob Unheil in der Luft liegen würde.
Und dafür gab es durchaus einen Grund. An einem der letzten Tage glaubte er, ein sonderbares unterirdisches Grollen und dann ein fast unmerkliches Erzittern der Erde wahrgenommen zu haben. Leichte Beben kamen öfters in dieser Gebirgsregion vor und boten keinen Grund zur Beunruhigung. Vielleicht war auch eine Mure niedergegangen, oder ein Schneebrett hatte sich gelöst, um diese Jahreszeit war der Berg immer in Bewegung.
Timon wandte sich wieder um und kehrte in sein Haus zurück, obwohl er es hasste, tagelang eingesperrt zu sein. Aber das Wetter ließ keinen längeren Gang zu, und er war erfahren genug, um zu wissen, welche Gefahren draußen auf ihn lauerten.
Wenigstens im Haus war es angenehm warm. Im Kamin prasselte ein Feuer, das sowohl die Stube, als auch die angrenzende kleine Küche erwärmte. Im oberen Stockwerk befanden sich noch zwei Kammern, doch Timon zog es bei der gerade vorherrschenden Kälte vor, auf dem ausladenden, gemütlichen Sofa in der Ecke zu schlafen.
Sein Blick fiel auf die Kredenz, wo das Hochzeitsbild seiner Eltern in einem schweren Silberrahmen stand. Er nahm es wie so oft in die Hand und betrachtete es gedankenvoll. Ein schönes Paar waren sie gewesen und glücklich dazu.
Die schöne Luzia schien seinen ungezügelten Vater gebändigt zu haben, denn nach der Heirat hatte er sich bemüht, sein Leben in neue Bahnen zu lenken. Das jedenfalls hatte er von Hochwürden erfahren, der sich seiner angenommen hatte, als Timon noch ein Kind war.
Dann jedoch war seine Mutter bei seiner Geburt gestorben, in einer furchtbaren Sturmnacht, die verhinderte, dass sich die Hebamme rechtzeitig einfand. Sein Vater war über diesen Verlust nie hinweggekommen, und es war danach schlimmer mit ihm geworden als je zuvor. Er wurde zu einem berüchtigten Pascher, unternahm halsbrecherische Klettertouren und hatte vor nichts und niemandem Respekt.
Es hatte ihn noch nicht einmal trösten können, dass er Vater eines Sohns geworden war, schien das Kind geradezu abzulehnen. Er übergab es einer ältlichen, kinderlosen Verwandten, die es reichlich lieblos aufzog.
In seinem zehnten Lebensjahr kam Timon zu seinem Vater, da die Tante krank geworden war und bald darauf starb.
Dann vollzog sich eine entscheidende Wende in seinem Leben. Der Pfarrer von Seekirchen hatte schnell erkannt, dass dieser vernachlässigte kleine Junge erstaunliche Talente besaß, und überredete den Vater, Timon in ein Klosterinternat zu geben, damit seine Fähigkeiten gefördert wurden.
Sein Vater war sofort damit einverstanden, wahrscheinlich sah er in ihm immer noch den Grund, dass seine geliebte Luzia hatte sterben müssen. Doch immerhin hielt er seinem Sohn eine Art Ansprache, bevor dieser aufbrach.
»Ich will net, dass du ein Priester wirst, das liegt uns net im Blut. Aber wenn du dort einen Abschluss machst, dann kannst du ein anderes Leben führen als ich. Und bleib auf dem rechten Weg.«
Er nahm den Jungen linkisch in die Arme, um ihn dann beinahe wieder von sich zu stoßen.
Das war die erste Art von Zuwendung, die er seinem Sohn angedeihen ließ, und sollte auch die letzte bleiben. In der Folgezeit besuchte er Timon nicht, und der Junge verbrachte die Ferien und Feiertage im Kloster. Kurz bevor Timon volljährig war, verschwand sein Vater spurlos, und es gab die widersprüchlichsten Erklärungen dafür.
Timon war davon überzeugt, dass sein Vater freiwillig den Tod gesucht hatte, um seiner quälenden Schwermut zu entgehen. Dafür sprach auch, dass er seine sämtlichen Besitztümer bereits an seinen Sohn überschrieben hatte, samt des alten Forsthauses, dessen Besitzer er inzwischen geworden war.
Für Timon war die Zeit im Kloster mit seinen strengen Regeln unerträglich gewesen, obwohl er leicht lernte und ihn die Brüder nicht schlecht behandelten. Aber wie seine Vorfahren beherrschte ihn ein unbändiger Freiheitsdrang, und nach den Prüfungen floh er geradezu aus den engen Mauern, als wäre das Kloster ein Gefängnis gewesen.
Zur Enttäuschung der Klosterbrüder schlug Timon nicht die geistliche Laufbahn ein, und noch zur größeren von Hochwürden machte er sich auch seine Begabung nicht zunutze. Er wollte nicht studieren oder irgendeine Ausbildung beginnen, sondern wie seine Vorväter in der freien Natur leben.
Nach seiner Rückkehr stellte Timon überrascht fest, dass sein Vater für ihn gesorgt hatte. Ihm wurde eine größere Lebensversicherung ausbezahlt, und in einem Bankschließfach fand sich eine beeindruckende Summe Geldes. Das stammte wohl aus den illegalen Geschäften seines Vaters, und Timon rührte es nicht an.
Er ließ das Haus herrichten, in dem er sich sehr wohlfühlte, und unternahm weite Wanderungen.
Und so fand er auch seine Berufung. Bald wurde er zu einem bekannten Kletterer und Bergsteiger, der selbst im Ausland Aufsehen erregte. Zudem schrieb er mehrere Bücher, in denen er seine Erfahrungen niederlegte.
Auch in seinem Heimatort stieg er in der Achtung der Dörfler, weil er der Bergwacht beitrat und auch lebensgefährliche Einsätze nicht scheute. Bis jetzt hatte er fast alle zu einem guten Abschluss gebracht, was ihn zutiefst befriedigte.
Timon schreckte zusammen, als ein schriller Klingelton erklang, offensichtlich war die telefonische Verbindung wiederhergestellt. Es war der Leiter der Bergwacht, Sigmund Moser, der mit großer Dringlichkeit auf ihn einsprach.
»Ein Einsatz, Timon. Mach dich sofort fertig. Eine Lawine, das schaut net gut aus. Der Hubschrauber kommt gleich, halt dich bereit.«
Nach einem halsbrecherischen Flug durch Schneegewirbel gelangten sie an ihrem Einsatzort an, und Timon sprang heraus, als der Hubschrauber niedrig genug über dem Boden schwebte. Seine Kameraden warteten schon in einer Gruppe auf ihn, und Moser empfing ihn aufgeregt.
»Wo sind wir hier eigentlich?«
»Wir sind vor dem Rainbacher-Hof oder besser gesagt dort, wo er früher einmal gestanden hat. Hoffentlich schafft es bald eine Schneeraupe nach heroben. Kommt, wir fangen schon mal an, wir können net auf die anderen Kameraden warten.«
»Der Rainbacher-Hof?«, stammelte Timon fassungslos.
Eine unüberschaubare Schneewüste tat sich vor ihm auf, untermischt mit entwurzelten Bäumen und Gesteinsbrocken. So als hätte der prächtige Hof nie existiert, den Timon auf seinen Berggängen immer bewundert hatte.
Timon hatte auch dann und wann Beate gesehen, die schöne Beate Rainbacher, deren Lachen so hell erklang.
»Was ist mit den Bewohnern?«, fragte Timon heiser.
»Sie waren alle zu Hause«, sagte Moser knapp und bedeutete ihm, zu einer der Schaufeln zu greifen.
Timons wahnwitzige Hoffnung, dass die Rainbachers und ihre Tochter vielleicht außer Haus gewesen wären, zerbrach. Stumm griff er nach der Schaufel und ging den anderen nach, die bereits im Begriff standen, einen Durchgang durch die Schneemassen zu schaffen.
Verbissen begann Timon zu schaufeln, sah nicht nach rechts und links. Endlich stießen sie auf Mauerreste, Ziegeln und zerschmetterte Fensterläden, dazwischen allerhand Habseligkeiten und Gerätschaften.
Mittlerweile hatte sich eine Schneeraupe über den Wirtschaftsweg nach oben durchgekämpft, weitere Helfer in ihrem Gefolge. Sie begannen sofort mit der Arbeit, kaum ein Wort fiel, so groß war das Entsetzen über das Unglück.
Es stellte sich allmählich heraus, dass die Wucht der Lawine das Haus ein großes Stück weit nach vorne geschoben hatte, ehe es vollständig zerschmettert worden war. Das Fundament mit dem Gewölbekeller lag unsichtbar unter dem Schnee begraben.
Die Männer arbeiteten wie besessen, denn es war seit dem Lawinenabgang viel Zeit vergangen. Nur durch Zufall hatte der Pilot eines Rettungshubschraubers bei seinem Einsatz entdeckt, dass der abgelegene Hof dem Erdboden gleichgemacht worden war, und hatte die Bergwacht alarmiert.
Es bestand immer noch die Hoffnung, dass Hohlräume entstanden waren, aus denen jemand lebend gerettet werden konnte. Aber mit jeder Minute verringerte sich diese Möglichkeit, denn selbst wenn einer der Rainbachers die Lawine überlebt hätte, so wäre er in der Zwischenzeit längst erfroren.
Wenig später kam auch Tobias Mitterer dazu, und beim Anblick der grauenhaften Verwüstung schwankte seine hochgewachsene Gestalt. Er war totenblass, seine Züge verzerrt vor tiefem Schmerz.
»Beate, meine Beate! Wo ist sie? So tut doch etwas …«, schrie er wie von Sinnen.
Timon sah kurz auf.
»Hör auf zu jammern und hilf mit«, forderte er ruppig und wies mit dem Kopf auf die Gerätschaften.
»Kann es Überlebende geben?«, fragte Tobias Sigmund Moser.
Der gab keine Antwort, und so griff Tobias schließlich nach einer Schaufel und begann, ungeschickt herumzugraben. Er machte sich heftige Selbstvorwürfe. Warum hatte er nicht geahnt, dass ein Unglück geschehen war, nachdem er so lange nichts von Beate gehört hatte? Doch augenblicklich waren fast die meisten Bergbauernhöfe von der Umwelt abgeschnitten, und selbst die Telefonverbindungen funktionierten nicht mehr.
Dabei lag sein geliebtes Mädchen schon lange unter dem Schnee begraben …
Schließlich, nach unendlichen Mühen, wurden drei Tote geborgen und aufgebahrt. Die beiden Frauen, die Großmutter und die Schwiegertochter, fand man eng beieinander, wahrscheinlich waren sie auf den Flur gelaufen, als die Erde zu beben begann.
Die Ahndl, die äußerlich fast unversehrt war, hielt noch ihren Rosenkranz in den verkrampften weißen Händen. Der Hofbauer wurde in den Überresten der Stallungen entdeckt. Er lag bei seinen Tieren, als hätte er zwischen ihren massigen Leibern Schutz gesucht.
Doch von Beate konnten sie keine Spur entdecken.
»Wo ist sie, wo ist meine Beate?«, schrie Tobias und sackte in sich zusammen.
Einer der Männer trat beiseite, ihm liefen die Tränen über die Wangen. Er hatte mit Rainbacher die Schulbank gedrückt, und danach waren sie Freunde geblieben. Bei dessen Hochzeit war er Trauzeuge gewesen, so wie Rainbacher bei seiner eigenen.
»Eine ganze Familie ausgelöscht, eine ganze Familie«, stammelte er immer wieder und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht.
Indessen war es zwischen Timon und Sigmund zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, denn Brandner bestand darauf, dass weiter nach Beate gesucht wurde.
»Hier kann sie nimmer sein. Wahrscheinlich ist sie aus dem Haus gelaufen und weggeschleudert worden, dann haben die Massen sie mit sich gerissen. Das kommt öfters vor, als man denkt. Unter Umständen findet man sie erst im Frühjahr wieder, wenn alles abgetaut ist«, versuchte Sigmund zu erklären.
»Den Keller, den dürfen wir net vergessen. Das Fundament existiert ja noch. Vielleicht hat sie im Keller Schutz gesucht. Es ist unsere Pflicht, jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen«, erwiderte Timon heftig.
Nun mischte sich auch Tobias ein, der wieder zu sich gekommen war.
»Stell dir nur vor, Moser, man tät die Beate später im Keller finden.«
Sigmund warf Tobias einen bösen Blick zu, gab aber nach. Auch die anderen beteiligten sich und bei Flutlicht, denn inzwischen war es dunkel geworden, suchten sie nach den Fundamenten des einstigen Anwesens.
Timon war völlig erschöpft, aber als sie schließlich gegen die Steinmauern stießen, belebte er sich wieder, und gemeinsam legten sie den Zugang zum Keller frei.
Vorsichtig stieg Timon hinunter und hielt seine große Stablampe vor sich. Das Erdbeben, durch das die Lawine ausgelöst worden war, hatte auch den Keller in Mitleidenschaft gezogen. Er sah sich zersplitterten Holzlatten und umgestürzten Regalen gegenüber, die verhinderten, dass er weiter in den Keller vordringen konnte.
Jeden erreichbaren Winkel leuchtete er aus, und plötzlich sah er es – der Strahl traf auf eine unförmige Anhäufung von Säcken, und etwas sprühte an einer Seite kupfern auf. So wie das Haar von Beate Rainbacher.
»Da ist etwas«, rief er aufgeregt, »ihr müsst mir helfen, die Trümmer wegzuräumen.«
Das geschah in großer Hast, und gleich darauf beugte er sich vor und schob die Säcke beiseite. In sich zusammengekrümmt lag dort Beate, kaum zu erkennen mit ihrem blutbeschmierten, beschmutzten Gesicht.
Sie war bewusstlos, doch als er sie sacht am Hals berührte, um zu prüfen, ob sie noch Lebenszeichen von sich gab, kam ein lang gezogenes Stöhnen von ihren bleichen Lippen.
»Sie lebt!«, rief Timon aus, und der Ruf pflanzte sich unter den Männern fort.
»Ein Wunder«, sagte Sigmund Moser heiser, und er bekreuzigte sich.
Die anderen folgten seinem Beispiel.
Timon trug sie nach oben, und Tobias stürzte auf ihn zu, als wollte er ihm das Mädchen entreißen. Doch Timon wich ihm geschickt aus, wehrte auch die abgerissenen Dankesworte ab, die über Tobis Lippen kamen.
Dann musste alles ganz schnell gehen. Nachdem Beate versorgt worden war, wurde sie in eine Unfallklinik geflogen, wo sie in besten Händen sein würde. Die abgekämpfte Mannschaft, die noch einen Augenblick zusammenstand, wünschte sich nichts mehr, als dass wenigstens dieses eine Leben gerettet worden konnte.
Dann bewegte sich ein trauriger Zug hinab ins Tal.
***
Als Beate Rainbacher aus dem Dunkel auftauchte, in das sie immer wieder zurücksank, und für längere Zeit die Augen öffnete, konnte sie sich nicht zurechtfinden. Sie glaubte, in einem Albtraum gefangen zu sein, und ihr Herz fing an, schmerzhaft zu klopfen.
Überhaupt verspürte sie plötzlich an allen möglichen Körperstellen Schmerzen. In ihrem Kopf pochte es, und wenn sie sich bewegte, fuhr ein unerträgliches Stechen in ihre Rippen. Als ihr Blick auf ihre Arme fiel, stellte sie fest, dass sie in Verbänden steckten.
Allmählich kam ihr zu Bewusstsein, dass sie in einem Krankenzimmer lag, und wieder brandete ein jähes Angstgefühl in ihr empor. Was war geschehen? Sie konnte sich an nichts erinnern, sosehr sie sich auch das Gehirn zermarterte. Außerdem verspürte sie ein brennendes Durstgefühl, ihr Mund war trocken, und ihre Kehle fühlte sich wie aufgerissen an.
Warum ließ man sie hier allein?
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen, und ein vierschrötiger Arzt kam mit wehendem Kittel herein, der sie eingehend ins Auge fasste.
»Sie sind ja schon früher wach, als wir dachten«, sagte er befriedigt und beugte sich über das Mädchen.
»Was ist mit mir?«, brachte Beate stockend hervor.
Der Arzt untersuchte sie zunächst eingehend und nickte ein paarmal, ehe er ihre Frage beantwortete.
»Sie haben eine Kopfverletzung erlitten, drei Ihrer Rippen sind gebrochen, und außerdem haben Sie mehrere Prellungen und Abschürfungen. Unterkühlt waren Sie auch, aber alles in allem werden Sie sich wieder völlig erholen. Sie haben eine starke Natur, das muss ich schon sagen«, fügte er hinzu.
»Wie ist es dazu gekommen?«
Nun trat ein forschender Ausdruck in die kühlen Augen des Arztes, und er ließ sich neben ihr auf den Besucherstuhl nieder.
»An was können Sie sich denn überhaupt noch erinnern?«, fragte er und sah die Patientin prüfend an.
Beate runzelte die Stirn, was sie sehr anstrengte und auch schmerzte, aber es tat sich nur eine große Leere in ihr auf.
»Dunkel, kalt«, drängte es sich plötzlich auf ihre Lippen, und sie begann am ganzen Körper zu zittern.
»Schon gut. Sie bekommen jetzt ein Schmerzmittel, und außerdem müssen Sie sich ausruhen. Dann kehrt die Erinnerung wieder zurück«, sagte der Arzt freundlich und erhob sich.
Anschließend gab er draußen den Assistenzärzten und den Schwestern in strengem Ton Anweisungen.
»Die Patientin darf keinen Besuch empfangen. Sie leidet unter Gedächtnisverlust, und wenn sie erfährt, dass ihre Familie bei dem Unglück umgekommen ist, kann das zu einem völligen Zusammenbruch führen.«
Und so dämmerte Beate unter dem Einfluss von Schmerz- und Beruhigungsmitteln vor sich hin. Hin und wieder, wenn die Wirkung nachließ, erfasste sie ein unerklärliches Angstgefühl, das sie aufschreien ließ.
So schnell sie sich körperlich erholte, so langwierig war der seelische Genesungsprozess. Allmählich stellten sich wieder Erinnerungsfetzen ein, und schließlich wagte es der Arzt, der für Fälle wie diesen geschult war, sie danach zu fragen, was ihr zuletzt im Gedächtnis haften geblieben war.
»Ich war mit meiner Ahndl in der Stube, und wir haben uns unterhalten. Sie hat mich getröstet, weil ich unglücklich darüber war, dass ich mich net mit dem Tobi, meinem Verlobten, treffen hab können, weil wir eingeschneit waren«, sagte sie überraschend flüssig.
»Und dann?«
»Die Mutter hat mich in die Küche gerufen, damit ich ihr etwas aus dem Keller hole. Kartoffeln, glaub ich …«
»Sind Sie in den Keller gegangen?«
»Ich weiß es nimmer. Ich hab Angst …«
»Das reicht für heute.«
Zu seiner Überraschung hielt Beate ihn zurück.
»Nein. Ich will wissen, was geschehen ist, sonst halte ich es nimmer aus. Hat es einen Steinschlag gegeben?«
»Ein leichtes Erdbeben hat eine Lawine ausgelöst …«
»Und die ist bei uns niedergegangen? Wie geht es meinen Eltern? Sie sind doch sicher auch gerettet worden«, fiel sie ihm hastig ins Wort.
Der Arzt schwieg.
»Sie sind …« Beate war nicht imstande, das Wort auszusprechen, ein unsäglicher Schmerz schien ihr das Herz zu zerreißen. »Die Ahndl hat es gespürt. Aber meine Eltern waren doch noch so jung, hatten doch fast noch das halbe Leben vor sich, denn die Rainbachers werden sehr alt«, stammelte sie.
Dann begann sie laut zu weinen und konnte nicht mehr aufhören.
Ihre Eltern hatten selten ihre Gefühle gezeigt, aber sie hatten gut zusammengelebt, und gemeinsam mit der Ahndl hatten sie Beate eine glückliche, unbeschwerte Kindheit beschert. In ihrer Liebe hatte sie sich geborgen gefühlt, und sie selbst hing mit großer töchterlicher Zuneigung an ihrer Familie.
Das sollte nun alles dahin sein durch die Unbarmherzigkeit der Natur? Es war ihr, als läge auch ihr Leben in Trümmern und als sei jede Zukunftshoffnung begraben. Schließlich erschlaffte Beate und ließ sich widerstandslos ein Beruhigungsmittel verabreichen. Dann versank sie in tröstliches Vergessen.
***
Beates Rettung aus dem Kellergrab sprach sich bald überall herum und wurde allgemein als das »Wunder von Seekirchen« bezeichnet. Es war selten, dass jemand so lange bei diesen Temperaturen überleben konnte. Der glückliche Umstand, dass sie genug Flüssigkeit zu sich nehmen und sich mit den Kartoffelsäcken schützen konnte, hatte dazu beigetragen. Vor allem aber waren es ihr zäher Wille und ihr Durchhaltevermögen gewesen, die sie letztendlich in der Dunkelheit am Leben erhalten hatten.
Diese Geschichte einer wundersamen Rettung fand auch in den Medien Eingang, und eine Zeit lang suchten Reporter die Berggemeinde Seekirchen heim, um weitere Einzelheiten zu erfahren, die die Leser anrühren würden. Vieles wurde dazu erfunden und so immer weiter ausgesponnen.
Davon ahnte Beate nichts, und wenn, so hätte sie es nur als quälend empfunden, denn sie war in Trauer und Verzweiflung gefangen. Ihr Gesundheitszustand hatte sich wieder verschlechtert, sie litt verstärkt unter Angstattacken und Erschöpfungszuständen, konnte aber keinen heilsamen Schlaf finden.
Zuletzt hatte sie keine Tränen mehr. Sie lag apathisch da und ließ alles über sich ergehen. Da man sich davon eine Aufmunterung versprach, wurde Tobias Mitterer endlich erlaubt, seine Verlobte zu besuchen.
Zaghaft, was überhaupt nicht seinem Wesen entsprach, betrat Tobi das Krankenzimmer, einen riesigen Blumenstrauß wie einen Schutzschild vor sich haltend. Dann fiel sein Blick auf das Krankenbett, und er erschrak.
Das, was da in den Kissen lag, konnte unmöglich seine strahlend schöne Beate sein, mit der er sich immer so gebrüstet hatte. Dieses Wesen war blass und abgehärmt, bläuliche Schatten schwammen unter den Augen.
Er empfand sogar jähen Ekel, als er die rasierte Stelle entdeckte, wo die Ärzte die Kopfwunde genäht hatten. Und das einst so üppige Lockenhaar wirkte verfilzt und ungepflegt, und zu allem Überfluss trug sie noch ein ausgewaschenes Krankenhaushemd. Gleich darauf kam ihm aber zu Bewusstsein, dass Beate alles, was sie besaß, verloren hatte, und ein Gefühl der Scham überkam ihn.
»Beate, Herzl«, brachte er hervor, wobei ihm das Kosewort nicht so leicht über die Lippen ging. »Endlich hat man mich zu dir vorgelassen.«
»Tobi«, war alles, was sie sagte.
In ihren Augen spiegelte sich keinerlei Wiedersehensfreude, ihr Blick war eigenartig abwesend und in die Ferne gerichtet. Sie würde doch keinen geistigen Schaden durch die Kopfverletzung erlitten haben, ging es ihm unwillkürlich durch den Sinn.
Bei dem Gedanken schauderte ihm.
»Ich hab dir Blumen mitgebracht. Deine Lieblingsblumen, schau«, versuchte er erneut, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
Beate wandte ihm langsam den Kopf zu, und ihr matter Blick streifte teilnahmslos das prächtige Gebinde.
»Die Schwester«, sagte sie tonlos.
Anscheinend war sie nicht mehr imstande, sich ihm in vollständigen Sätzen mitzuteilen, was Tobias noch mehr in Verwirrung stürzte. Er legte den Strauß auf einen Tisch am Fenster und setzte sich dann wieder auf den Besucherstuhl.
Weil er nicht wusste, was er mit ihr reden sollte, begann er zu schildern, wie er sich mit der Mannschaft der Bergwacht durch die Schneemassen gekämpft hatte. Timons Rolle bei ihrer dramatischen Rettung aus dem Gewölbekeller sparte er wohlweislich aus.
»Hör auf«, stieß Beate hervor und begann am ganzen Leib zu zittern.
Tobias verstummte erschrocken.
Langsam beruhigte sie sich wieder, während er schweigend dasaß und innerlich nach einem Vorwand suchte, um entrinnen zu können, denn er konnte dieses Unglück kaum ertragen.
»Soll ich dir die nötigsten Sachen bringen? Nachthemden, einen Morgenmantel und Wäsche? Du musst mir nur deine Kleidergröße sagen«, sagte er schließlich zaghaft.
Beate gab ihm die gewünschte Auskunft und schloss dann erschöpft die Augen. Das nahm Tobi zum Anlass, sich zu verabschieden.
»Du musst dich ausruhen. Ich bring dir die Sachen vorbei«, sagte er liebevoll, aber er brachte es nicht über sich, sie wenigstens auf die Stirn zu küssen.
Beate nickte nur, und er schloss behutsam die Tür hinter sich. Doch sie schlief nicht ein, sie hatte nur das Bedürfnis gehabt, allein zu sein. Gleichzeitig konnte sie kaum begreifen, dass sie Tobis Besuch nur als anstrengend empfunden hatte und erleichtert war, als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte.
Das musste an ihrem Zustand liegen, redete sie sich ein.
Tobi kam am übernächsten Abend pflichtbewusst mit mehreren Tragetaschen in das Krankenhaus, nachdem er am Tag zuvor unter Mithilfe seiner Mutter alles eingekauft hatte, was eine junge Frau benötigen würde.
Stolz breitete er zwei Nachthemden auf Beates Bett aus und hielt einen dicken, gesteppten Morgenmantel in die Höhe. Die Farbe Rosa herrschte bei fast allen Teilen vor, der Mantel hatte außerdem ein großblumiges Muster.
»Mädchen mögen ja Rosa und Blümchen auch«, meinte er und hängte die Sachen sorgsam in den Schrank.
»Danke«, murmelte Beate.
»Und die Mutter hat noch Unterwäsche gekauft«, sagte er etwas verlegen und legte einen Stapel in ein Fach.
»Lieb von ihr.«
Tobi setzte sich zu ihr und schilderte, was sich auf dem Rathaus alles zugetragen hatte. Beate schien geduldig zuzuhören, doch er hatte den Verdacht, dass sie mit den Gedanken weit weg war. Bald versiegte das Gespräch, und er saß still neben ihr und hielt ihre Hand.
Die Tür öffnete sich, und der behandelnde Arzt trat ein. Mit einem schnellen Blick erfasste er die Situation.
»Das ist genug für heute. Auch angenehme Besuche strengen die Patientin immer noch an«, sagte er mit einem kleinen Lächeln.
Tobi erhob sich dankbar.
»Das stimmt. Ich komm morgen wieder vorbei.«
Nachdem Tobias gegangen war, unterzog Dr. Reithofer Beate einer raschen Untersuchung.
»Besuche scheinen Sie immer noch sehr zu belasten. Oder gibt es Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und Ihrem Verlobten?«
Beate schüttelte den Kopf.
»Jedenfalls sollte die Besuchszeit vorerst noch kürzer sein«, befand er und tätschelte väterlich ihre Hand.
Der Arzt machte sich so seine Gedanken über dieses Paar. Zwar kümmerte sich Tobias Mitterer um seine Verlobte und war wohl aufrichtig besorgt um sie, dennoch schien eine gewisse Fremdheit zwischen das Paar getreten zu sein. Und das war nicht nur den erschütternden Ereignissen geschuldet. Für einen Mann wie Tobias Mitterer war Beate seiner Meinung nach einfach zu empfindsam.
***
Die Trauer um ihre Familie lastete so auf Beate Rainbacher, dass sie nur langsam das Ausmaß des Unglücks begriff, das ihr widerfahren war. Allmählich kam ihr zu Bewusstsein, dass sie nicht nur ihre engsten Blutsverwandten, sondern auch den geliebten Hof, den weiterzuführen sie als ihre Lebensaufgabe betrachtet hatte, verloren hatte. Der Hof, den ihre Vorfahren zu einem der größten im Tal gemacht hatten und der in der Familie bleiben sollte.
Tobias hatte sich sogar damit einverstanden erklärt, dass ihre gemeinsamen Kinder Rainbacher heißen würden, sodass der Familienname erhalten bliebe. Doch nun war alles dahin. Es war sinnlos, den Hof wieder aufzubauen, denn das Gelände war hoffnungslos verwüstet, wie sie inzwischen erfahren hatte. Es widerstrebte Beate auch zutiefst, wieder an jenem Ort zu leben, wo ihre gesamte Familie ein furchtbares Ende gefunden hatte.
Sie erkannte, dass sie kein Zuhause mehr hatte und dass mit der Zerstörung des Hofs auch der Verlust ihrer Existenzgrundlage einherging. Ihre ganze Ausbildung war darauf ausgerichtet gewesen, Hofbäuerin zu werden, doch das war nun vorbei.
Mit Tobias sprach sie nicht darüber, er sollte nicht denken, dass sie ihn jetzt zu einer Heirat drängte, weil es für sie keine Zukunftsperspektiven mehr gab. Erst wenn sie wieder gesund war und Fuß gefasst hatte, würde eine Heirat wieder zur Sprache kommen.
Es war nur seltsam, dass sie nicht mehr das geringste Verlangen danach verspürte.
Mittlerweile waren die Rainbachers unter großer Anteilnahme der Dörfler zu Grabe getragen worden. Sie waren in Seekirchen und darüber hinaus geachtet gewesen, denn sie hatten im Ruf gestanden, rechtschaffen und tüchtig zu sein. Außerdem waren durch sie der Kirche und dem Kindergarten großzügige Spenden zugeflossen, auch an der Renovierung des altertümlichen Schulgebäudes hatten sie sich beteiligt.
Beate hatte unbedingt an der Beerdigung teilnehmen wollen und sich von ihrer Freundin Annamirl die entsprechende Kleidung bringen lassen. Doch schon das Ankleiden erschöpfte sie, und nachdem sie ein paar Schritte gegangen war, brach sie zusammen und erlitt einen Rückfall, von dem sie sich nur schwer erholte.
Danach stattete ihr Hochwürden einen Besuch ab, was schon längst überfällig gewesen war, wie er fand. Auch er war bestürzt, als er sah, in welchem Zustand sich das Mädchen befand. Allerdings hatte er nie aufgehört zu preisen, dass Beate durch göttlichen Beistand gerettet worden war, was wahrlich als Wunder betrachtet werden konnte.
Er kannte sie schon seit ihrer Kindheit, hatte sie sogar getauft. Mit seiner einfühlsamen und liebenswürdigen Art besaß er Beates ganzes Vertrauen, und sie freute sich aufrichtig, ihn zu sehen.
»Madel! Die Ärzte haben mich einfach nicht zu dir lassen wollen, zuletzt hab ich gar nicht mehr zu fragen gewagt. Aber jetzt bin ich da, und wir können endlich miteinander reden«, sagte er und rückte sich den Besucherstuhl zurecht.
Beates Gesicht verdüsterte sich wieder.
»Es reut mich so, dass ich net zu der Beerdigung hab kommen können, das wird mir ewig nachgehen.«
»Die Annamirl, deine Freundin, hat mir erzählt, dass du es versucht hast. Du bist halt noch zu entkräftet, das ist net deine Schuld. Wenn deine Eltern und die Ahndl von heroben herabschauen …«, er bekreuzigte sich, »dann sind sie froh und glücklich darüber, dass du noch am Leben bist.«
Beate nickte, ihre Augen waren mit Tränen gefüllt.
In vorsichtig gewählten Worten berichtete er über die Beerdigung und über die vielen ehrenden Nachrufe, die den Verstorbenen zuteil worden waren. Der Schützenverein, dessen Mitglied Rainbacher gewesen war, hatte anschließend den Leichenschmaus ausgerichtet.
»Und der Chor hat schön gesungen, in der Kirche und auch am Familiengrab. Dort wird im Sommer wieder der Rosenbusch blühen, den die Ahndl gepflanzt hat, als ihr Mandl von ihr gegangen ist«, schloss Hochwürden und schien selbst den Tränen nahe.
Beate weinte, und Hochwürden saß bei ihr, bis ihre Schultern aufhörten zu zucken. Da er aus einer alten bäuerlichen Familie stammte, besaß er auch praktische Vernunft, und die gewann jetzt die Oberhand.
»Wo wirst du eigentlich unterkommen, wenn du aus dem Krankenhaus entlassen wirst?«, fragte er beiläufig.
»Ich weiß gar net, was aus mir werden soll«, gab Beate mutlos zur Antwort, und ihre Hände fuhren unruhig über die Bettdecke.
Hochwürden zog die dichten dunklen Brauen zusammen, wie immer, wenn ihm etwas überhaupt nicht gefiel.
»Du bist doch dem Mitterer-Tobias versprochen. Kann dich nicht seine Familie aufnehmen?«, schlug er vor.
»Da ist kein Platz für mich. Und mit dem Tobias will ich erst zusammenziehen, wenn wir verheiratet sind.«
»Löblich.«
Dann legte er den Kopf zur Seite und dachte nach. Hochwürden kannte jedes einzelne seiner Schäfchen und auch oft ihre sehr wirren verwandtschaftlichen und auch sonstigen Beziehungen, was den Betroffenen nicht immer recht war.
»Wenn ich mich recht entsinne, so hast du doch noch eine Tante hier in Seekirchen, die Schwester deiner Mutter, die um einiges jünger ist. So ganz ohne Verwandtschaft bist du also nicht«, sagte er dann.
»Ja, das stimmt.«
»Die nimmt dich doch sicher auf.«
Beate schüttelte heftig den Kopf.
»Nie und nimmer! Meine Eltern und die Tant sind seit Jahren verfeindet, ich kann mich überhaupt net an sie entsinnen.«
»Ja, das ist immer traurig, wenn es Streit innerhalb der Familie gibt und keiner nachgeben will«, meinte Hochwürden, ließ das Thema dann aber ruhen.
Eine Weile sprach er noch ermutigend auf sie ein, bis er den Eindruck hatte, dass sie sich seinen Worten öffnete.
»Und vergiss nicht – an dir ist ein Wunder gewirkt worden, und das bedeutet, dass du den Lebensmut nicht verlieren darfst«, erklärte Hochwürden mit Nachdruck, als er sich von ihr verabschiedete.
Beate bedankte sich für seinen Zuspruch. Als sie wieder allein war, spürte sie, dass sie innerlich ruhiger geworden war.
***
Wenn Hochwürden einmal einen Entschluss gefasst hatte, so schob er es nie lange hinaus, ihn in die Tat umzusetzen. Und obwohl der Winter das Gebirgstal immer noch in seinem eisigen Griff hielt, machte er sich auf, um Hedwig Manz zu besuchen, die etwas außerhalb von Seekirchen ein kleines Landgasthaus betrieb.
Einer der Bauern hatte ihn bis zu der Abzweigung mitgenommen, und nun kämpfte er sich durch den schneidenden Wind zu dem Anwesen vor. Vor Anstrengung war ihm ganz heiß geworden, und er blieb stehen, um Atem zu schöpfen.
Vor ihm erhob sich ein zweistöckiges Gebäude im rustikalen Stil. Die Frontseite war schlicht gehalten, die Haustür wies jedoch aufwendige Schnitzereien auf, genauso wie die Fensterläden. Der Vorplatz war gähnend leer, wahrscheinlich standen dort im Sommer Tische und Stühle, die sicher einladend wirkten.
Früher musste dieses Landgasthaus bestimmt beeindruckend gewesen sein und viele Gäste herbeigelockt haben. Doch jetzt war der weiße Anstrich abgeblättert und die Fensterläden schadhaft. Es wirkte dem Verfall nahe, und die Krähenschar, die krächzend vom Hausbaum aufflog, verstärkte diesen Eindruck noch.
Hochwürden seufzte, steuerte aber entschlossen den Eingang an. Die schwere Tür ließ sich aufstemmen, und er trat in einen halbdunklen Raum, wo er Tische und Stühle an der Wand aufgestellt vorfand. Die Theke im hinteren Bereich war verwaist.
»Bist du da, Hedwig?«
Zunächst kam keine Antwort, dann hörte er leichte Schritte, die sich näherten.
Hochwürden erschrak, als er Hedwig Manz, der Schwester der Rainbacher-Bäuerin, gegenüberstand. Obwohl sie weitaus jünger war als Antonia, noch nicht einmal Mitte dreißig, wirkte sie seltsam verblichen.
Als junges Mädchen war sie ausnehmend hübsch gewesen, und sie hatte nicht wenige Verehrer gehabt. Sie entschied sich für Bruno Manz, den Besitzer des Landgasthofs. Und so hieß es allgemein, dass die beiden Schwestern gut geheiratet hätten. Die ältere war Bäuerin auf einem großen Hof und die jüngere Wirtin eines stattlichen Gasthauses.
Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit Hedwig. Aus Gründen, die niemand genau erfuhr, kamen die Eheleute schon nach kurzer Zeit nicht mehr miteinander aus. Es wurde gemunkelt, dass Bruno es mit der ehelichen Treue nicht so genau nahm, doch niemand wusste etwas Bestimmtes.
Um den ehelichen Auseinandersetzungen zu entfliehen, hatte er begonnen, häufig nach München zu fahren, wo er wohl in schlechte Gesellschaft geraten war. Er verspielte große Summen und trank zu viel, und bald ging es mit dem Landgasthof bergab.
Auf der Heimfahrt von München geriet er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er musste sofort tot gewesen sein, und es wurde festgestellt, dass er sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Es gab Gerüchte, dass Bruno Manz den Tod gesucht hätte, nachdem seine Lage immer hoffnungsloser geworden war.
Mithilfe einer Lebensversicherung, die Bruno ihr hinterlassen hatte, konnte Hedwig die Schulden bezahlen und die Landgaststätte weiterführen. Aber aus ihr war eine verbitterte, unfreundliche Frau geworden, die Männern tiefe Abneigung entgegenbrachte und so die Gäste in die Flucht schlug.
Schlimmer noch war, dass sich die beiden Schwestern heillos zerstritten. Antonia hatte ihrer Schwester die Schuld gegeben, dass Bruno immer mehr auf Abwege geraten war. Sie warf ihr sogar vor, aus Egoismus kein Kind haben zu wollen, was Bruno ihrer Meinung nach stärker an die Familie gebunden hätte.
Voller Neid hatte Hedwig zusehen müssen, wie das Ansehen der Rainbachers immer mehr wuchs, während man über Bruno und sie hinter vorgehaltener Hand zu tuscheln begann und ihr scheele Blicke zuwarf, wenn sie zum Einkaufen durchs Dorf ging.
Die Gäste blieben aus, und sie konnten nicht mehr genug Leute einstellen, um den Betrieb ordentlich aufrechtzuerhalten. Zuletzt brach Antonia jede Verbindung mit ihrer Schwester ab, weil sie sich dieser armseligen Verwandtschaft schämte.
Auch nach Brunos Tod versöhnten sich die beiden nicht, und Hedwig steigerte sich in einen immer größeren Hass gegen die Rainbachers hinein. Gleichzeitig wurde es immer einsamer um sie, denn ihr unzufriedenes, schroffes Wesen hatte alle vertrieben, die ihr wohlgesinnt gewesen waren.
Hochwürden wollte Hedwig entgegenkommend die Hand reichen, doch sie trat hastig einen Schritt zurück.
»Was gibt es, Hochwürden?«, fragte sie nicht sonderlich freundlich.
»Können wir uns nicht einen Augenblick setzen? Es gibt so einiges zu bereden«, bat er sie unbeeindruckt.
Sie zuckte mit den Achseln, führte ihn dann aber in die Küche, wo es angenehm warm war, und bedeutete ihm, sich auf die Eckbank zu setzen. Sie nahm ihm gegenüber Platz und verfiel in Schweigen.
»Ich hab dich bei der Beerdigung von deinen Verwandten vermisst, Hedwig«, sagte er, ließ es aber mehr wie eine Feststellung als einen Vorwurf klingen.
»Die sind schon lang gestorben für mich«, erwiderte sie mit einer Härte, die den Priester zusammenzucken ließ.
»Es ist traurig, dass du nicht deinen Frieden mit deiner Schwester gemacht hast«, fuhr er unbeirrt fort.
»Dazu gehören halt zwei.«
»Aber du hast sicher auch gehört, dass das Madel überlebt hat …«
»Ja, das Wunder von Seekirchen. Wer hätte net davon gehört.«
Aus ihrem Mund klang das ausgesprochen höhnisch, doch Hochwürden hatte sich geschworen, nicht die Geduld mit ihr zu verlieren.
»Und nun weiß die Beate net wohin. Sie hat ja alles verloren.«
»Und was hab ich damit zu tun? Sie ist doch alt genug, um sich selbst um sich kümmern. Oder soll ich sie etwa bei mir aufnehmen?«, fragte sie spöttisch.
»Ja, genau das hab ich gemeint. Du bist die einzige Verwandte, die sie noch hat, und das ist allemal besser, als bei fremden Leuten unterzukommen. Außerdem könnt sie dir zur Hand gehen, und es würde dir wahrhaftig guttun, wenn du hier nimmer alleine hausen tätst«, sagte er mit großer Entschiedenheit.
Hedwig presste verstockt die Lippen zusammen.
»Vielleicht könnte sich die Beate auch für das Gastgewerbe erwärmen und sich beteiligen. Ich glaube nicht, dass sie den Hof ihrer Eltern wieder aufbauen lässt. Ja, das ist traurig, ich weiß ja, dass das ihr Lebenstraum war. Aber es ist halt alles ganz anders gekommen«, sagte Hochwürden bedauernd.
Hedwig war hellhörig geworden, denn allzu lange würde sie den Landgasthof nicht mehr halten können. Oft gab es tagelang keine Gäste, oder es fielen höchstens ein paar Holzfäller ein, die sich an Hedwigs Missmut nicht störten.
Dann jedoch verschloss sich ihr Gesicht wieder.
»Junge Madeln sind doch flatterhaft, nichts ist bei ihnen von Dauer. Heute dies, morgen das«, wandte sie ein.
»Beate ist anders. Sie hat schon immer gewusst, was sie gewollt hat. Umso schlimmer, dass alles umsonst gewesen ist.«
»Aber wenn sie sich erst mal verliebt, dann gilt nur noch der Mann etwas, net der Beruf. Und ich steh wieder allein da.«
»Beate ist verlobt, aber sie hat sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen, Hofbäuerin zu werden. Heutzutage ist das nimmer so.«
Darauf gab Hedwig keine Antwort. Mit zusammengezogenen Brauen saß sie da, die Arme vor der Brust verschränkt. Sie war sogar so unhöflich, Hochwürden nichts anzubieten, obwohl er ein heißes Getränk gut hätte vertragen können.
Aber er sah, dass ihr trotz ihrer ablehnenden Haltung allerhand durch den Kopf ging, und entschied, dass jetzt der richtige Moment war, sie mit ihren Gedanken allein zu lassen. Aufseufzend erhob er sich.
Hedwig schrak zusammen.
»Jesses, Hochwürden …«
Fleckige Röte überzog ihr Gesicht, anscheinend hatte sie sich eben doch auf ihre Pflichten als Gastgeberin besonnen.
»Lass nur, Hedwig, ich muss nach Haus. Heut Abend ist noch eine Versammlung der Kirchenältesten.«
»Ich bring dich.«
Dieses Angebot lehnte er nicht ab, obwohl er es bald bereuen sollte. Hedwigs Gefährt, eine Art Lieferwagen, mit dem sie den Bedarf für das Gasthaus heranschaffte, war in einem beklagenswerten Zustand. Nicht nur, dass es angerostet und ramponiert war, sondern auch seine Reifen waren abgefahren, sodass sie auf der Fahrt zum Dorf mehrmals gefährlich ins Schlittern gerieten.
Außerdem entsprach Hedwigs Fahrweise ihrem Wesen. Unbeirrbar preschte sie über vereiste Schlieren, und einmal versuchte sie sogar, den Sportwagen des Bürgermeistersohns zu überholen. Da es naturgegeben nicht gelang, brach sie in Verwünschungen aus, die Hochwürden die Schamröte ins Gesicht trieben.
Er war sehr erleichtert, als sie ruckartig vor dem Pfarrhaus anhielt und beinahe im Vorgarten gelandet wäre. Hochwürden ging durch den Sinn, dass Fahrten mit Hedwig Manz ohne Zweifel auch eine Art von Läuterung bedeuteten.
»Also, Hedwig, überleg es dir«, sagte er freundlich, nachdem er sich bei ihr bedankt hatte.
Sie gab einen unbestimmten Laut von sich und ließ den Motor wieder an, was Hochwürden bewog, eiligst im Pfarrhaus zu verschwinden. Dann bekreuzigte er sich und beschloss, in der Kirche eine Kerze anzuzünden, weil er diese Prüfung unversehrt überstanden hatte. Vorerst aber gönnte er sich eine kleine Stärkung aus der Flasche, die in der Schreibtischschublade seines Studierzimmers verborgen lag.
***
Beates Genesung schritt nun rasch voran, und sie würde bald das Krankenhaus verlassen können. Doch noch immer empfand sie das Gefühl der Unwirklichkeit, als ob sie in einem immerwährenden Albtraum gefangen wäre, aus dem sie trotz aller Willensanstrengung nicht mehr erwachen könnte.
Oft versank sie inmitten eines Gesprächs in einen Zustand grüblerischer Abwesenheit und schenkte ihrem Gegenüber keine Aufmerksamkeit mehr. Es schien, als ob der Verlust ihrer Familie und die furchtbare Zeitspanne, die sie eingesperrt in dem Gewölbekeller zugebracht hatte, ihr Wesen vollständig verändert hätten.
Inzwischen hatte sie häufig Besuch, vor allem von ihren Freundinnen, die ihr Bett umlagerten und sie mit Dorfklatsch und Süßigkeiten versorgten. Es störte Beate allerdings, dass Annamirl, die eigentlich ihre liebste Freundin war, immer wieder auf die Umstände ihrer Rettung zurückkam.
»Ohne den Brandner-Timon wärst du jetzt nimmer bei uns.«
Das sagte Annamirl mehrere Male, und sie bekreuzigte sich dabei immer hastig.
»Keine Ruh hat er gegeben, bis auch ein Zugang zum Gewölbekeller freigeschaufelt worden war und er zu dir hinuntersteigen konnt. Und dann hat er noch lange nach dir gesucht, denn du bis ja unter den Kartoffelsäcken gelegen. Das hat mir mein Cousin, der Kofler-Bartl, ausführlich erzählt, der ist ja auch bei der Bergwacht. Dein armer Tobi ist in Ohnmacht gefallen. So sehr liebt er dich«, fügte sie schnell hinzu.
»Ohne den Timon wär das Wunder von Seekirchen überhaupt net möglich gewesen«, bekräftigte eine andere.
Beate nickte dazu nur, gab den anderen dann aber zu verstehen, dass sie davon nichts mehr hören wollte. Insgeheim wunderte sie sich. Tobi hatte mit keinem Wort erwähnt, welche Rolle Timon Brandner bei ihrer Rettung gespielt hatte. Und dass er ohnmächtig geworden war, hatte er ebenso verschwiegen, aber das war verständlich.
Auch Hochwürden erwähnte bei einem seiner häufigen Besuche Timon Brandner außergewöhnlich lobend.
»Der Timon hat sich richtig heldenhaft verhalten. Ihm verdankst du, dass du noch am Leben bist. Hat er dich eigentlich schon besucht?«
Beate schüttelte den Kopf.
»Nein. Das hab ich alles net gewusst. Ich tät mich aber gern bei ihm bedanken.«
Als sie Tobi darauf ansprach, gab dieser sich eher unbeeindruckt.
»Der Timon hat sich sehr eingesetzt. Aber das haben wir alle, schließlich sind wir eine Mannschaft.«
Damit hatte er natürlich recht. Dennoch hatte Beate das Empfinden, dass Tobi so manches bei seinen Schilderungen ausgespart hatte, nicht nur seinen Ohnmachtsanfall. Und das versetzte ihr einen Stich. Doch sie kam nie wieder darauf zurück, und sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass er darüber sehr erleichtert war.
Eines Tages erhielt sie unerwarteten Besuch.
Unvermittelt wurde die Tür heftig aufgerissen, und eine Frau unbestimmbaren Alters stürmte ins Zimmer, blieb vor ihrem Bett stehen und sah sie mit düsterer Eindringlichkeit an, ohne ein Wort zu sagen.
Auch Beate starrte die Unbekannte, die ihr irgendwie doch vertraut vorkam, an. Eine wilde dunkle Haarflut umstand ihr Gesicht, das schön gewesen wäre, wenn es nicht einen Ausdruck von tiefer Unzufriedenheit und von Missmut gezeigt hätte. Die schlecht sitzende, altbackene Kleidung tat ein Übriges, sie reizlos und verblüht erscheinen zu lassen.
»Du bist also die Tochter von der Antonia«, sagte sie schließlich und ließ sich auf den Besucherstuhl fallen.
Beate musste nicht mehr lange nachdenken, um wen es sich bei dieser seltsamen Frau handelte. Ihre Mutter hatte sich oft genug über ihre jüngere Schwester ausgelassen, mit der sie außer einer tief gehenden Feindschaft nichts zu verbinden schien.
»Und du bist meine Tante Hedwig, nicht wahr?«, gab sie zurück.
»Deine einzige Verwandte, wie es scheint. Nun, deine Mutter wird dir sicher viel über mich erzählt haben«, fügte sie bissig hinzu.
»Schon«, murmelte Beate bedrückt.
Kein Wort der Anteilnahme oder des Bedauerns über den frühen Tod von Schwester und Schwager kam über Hedwigs Lippen, sie erkundigte sich auch nicht danach, wie es Beate nun ging. Sie schien wirklich so gefühlsarm und kaltherzig zu sein, wie Beates Mutter sie immer hingestellt hatte.
»Hochwürden war bei mir und hat mir erklärt, dass du nun irgendwo unterkommen musst. Zumindest, bis mit dem Erbe alles geregelt ist«, sagte Hedwig stattdessen. »Oder hast du inzwischen andere Pläne?«
Beate schüttelte den Kopf.
Tobi hatte ihr mehrmals vorgeschlagen, eine kleine Wohnung anzumieten, sodass sie zusammenziehen könnten. Doch Beate hatte entschieden abgelehnt, für sie musste alles seine Ordnung haben.
»Du bist halt ein altmodisches Madel«, hatte er halb liebevoll, halb verärgert gesagt, »aber vielleicht mag ich dich deshalb so.«
»Und ich mag dich, weil du drauf Rücksicht nimmst, dass ich so altmodisch bin«, gab sie zurück.
»Was für andere Pläne meinst du?«, fragte Beate nun nach.
»Du könntest ja in die Stadt gehen, wie es viele junge Leut tun, oder so schnell wie möglich heiraten. Vielleicht auch den Hof wiederaufbauen.«
Beate zuckte zusammen.
»Dort wird niemals mehr ein Hof stehen. Mit dem Tod meiner Eltern ist das Vergangenheit. Aber die Heimat werde ich trotzdem net verlassen. Und eine überstürzte Ehe führt auch zu nichts Gutem.«
Hedwig legte den Kopf schief und betrachtete das junge Mädchen mit einer Mischung aus Verwunderung und Neugier. Im Allgemeinen war sie auf junge Leute nicht gut zu sprechen, hielt sie für oberflächlich und unzuverlässig. Aber dieses schmächtige Wesen war anders. Ihre Nichte besaß Vernunft und wusste, was sie wollte.
Wie elend sie aussah! Beate galt als große Schönheit, doch jetzt hatte Hedwig ein Mädchen vor sich, das kränklich und niedergeschlagen wirkte und jeden Reiz verloren hatte. Und seltsamerweise regte sich in Hedwigs verhärtetem Herz so etwas wie Mitgefühl.
»Wie ein zerrupftes Vogerl schaust du aus«, sagte sie zu Beates Überraschung.
»Aber ich fühl mich schon besser«, erwiderte Beate abwehrend, denn sie verabscheute es, mitleiderregend zu erscheinen.
»Du kommst zu mir aufs Landgasthaus. Dort hast du viel Ruhe, und niemand stört dich. Du wirst sehen, wie schnell ich dich wieder aufgepäppelt hab! Und wenn es dir bessergeht, dann kannst du ja mithelfen und kommst auf andere Gedanken.«
Beate erkannte, dass das unerwartete Angebot ihrer Tante ihr eine Tür öffnen würde, die schwere Zeit, die vor ihr lag, zu überstehen. Vor allem die Aussicht, vor unerwünschten Besuchern, die ihr neugierige Fragen über ihre Rettung stellten, verschont zu bleiben, sagte ihr zu. Und sie würde auch eine Aufgabe haben, damit sie sich nicht mehr quälenden Grübeleien überließ.
»Ich helfe dir gern, Tante«, sagte sie zögernd.
»Das heißt, du kommst zu mir?«
Beate nickte.
»Gut. Aber nenn mich net Tante, sondern Hedwig. Sonst komm ich mir ja uralt vor«, sagte sie ohne ein Lächeln und erhob sich. »Ruf mich halt an, wenn du entlassen wirst, dann hol ich dich ab.«
»Ja«, stammelte Beate, immer noch verwirrt über die plötzliche Wendung, die alles genommen hatte.
Kurz danach erschien Tobi, dem sie sofort berichtete, dass sie vorerst auf dem Landgasthof ihrer Tante wohnen würde. Der junge Mann lehnte sich auf dem Besucherstuhl zurück und verzog abschätzig das Gesicht.
»Warst du eigentlich in der letzten Zeit überhaupt mal auf dem Landgasthof Manz?«, fragte Tobias sie.
Beate hatte nur eine schwache Erinnerung daran, die aus ihrer Kindheit stammte, als die beiden Schwestern noch nicht völlig verfeindet waren. Es hatte ihr dort gefallen, das wusste sie noch.
»Nein«, gestand sie ein.