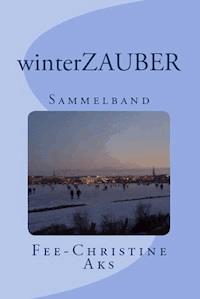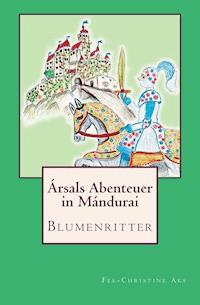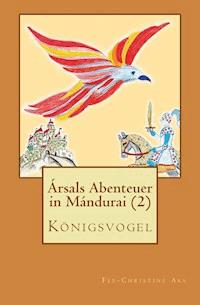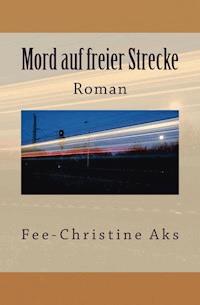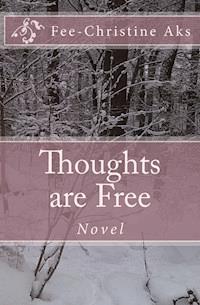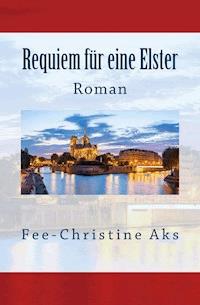Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Verlorene Jugend
- Sprache: Deutsch
Fritz Mann ist 10 Jahre alt, als sein Vater in die NSDAP eintritt. Fortan ist nichts mehr wie zuvor - Fritz muss zur Hitlerjugend und mitmarschieren, obwohl er doch viel lieber Bücher lesen, Modellflugzeuge bauen oder einfach nur mit anderen Kindern spielen möchte. Während Deutschland und das einstmals so rote Hamburg gleichgeschaltet werden, trägt Fritz mehr und mehr Gedanken mit sich herum, die es ihm zunehmend schwerer machen, sich als Teil dieses neuen Deutschland zu fühlen. Und dann ist da ja auch noch Maria, das schöne Mädchen aus seiner Klasse... Buch 5 der Jugendroman-Serie "Verlorene Jugend".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fee-Christine Aks
Als der Wind kälter wehte
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung und Vorbemerkung
Anstelle eines Prologs
Teil 1 Für das deutsche Vaterland
Teil 2 Man hat Gewalt, so hat man Recht
Teil 3 Alle außer Emil
Teil 4 Heute trifft es jenen, morgen diesen
Teil 5 Der Wind schlug um
Epilog
Anhang
Literaturverzeichnis
Verlorene Jugend (Serie)
Mehr von der Autorin?
Impressum neobooks
Widmung und Vorbemerkung
Als der Wind kälter wehte
Ein Roman von Fee-Christine Aks
Copyright © Dezember 2017 Fee-Christine AKS
All rights reserved.
ISBN: 1974688593
ISBN-13: 978-1974688593
Für das Gute im Menschen
„Keiner weiß,
ob er aus dem Stoffe gemacht ist, aus dem der entscheidende Augenblick Helden formt.
Kein Volk und keine Elite darf die Hände in den Schoß legen und darauf hoffen,
dass im Ernstfall, im ernstesten Falle, genügend Helden zur Stelle sein werden.“
(Erich Kästner)
Vorbemerkung
Diese Geschichte ist frei erfunden, spielt aber vor dem geschichtlichen Hintergrund der späten Weimarer Republik und den Anfangsjahren des Dritten Reiches im Zeitraum 1930 bis 1933 im zu dieser Zeit noch eigenständigen Altona westlich von Hamburg. Abgesehen von geschichtlich belegten Persönlichkeiten, sind alle handelnden Personen Phantasiegestalten.
Jegliche Ähnlichkeiten mit noch lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.
Anstelle eines Prologs
Ich halte alle Menschen der Welt für merkwürdig und auch für gleichmäßig selbstverständlich.
Ich halte überhaupt dafür, dass die Menschen vor allem Menschen sind. Und solange nicht in aller Welt, in allen Sprachen dieser Erde, die selbstverständliche Wahrheit gesagt wird, dass alle Menschen einander viel mehr gleichen, als sie sich voneinander unterscheiden, glaube ich, dass es eine Sünde ist, die Unterschiede der verschiedenen Völker vor ihren Ähnlichkeiten und Gleichheiten bekanntzugeben.
(Joseph Roth, 1934)
Teil 1 Für das deutsche Vaterland
(aus: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Das Lied der Deutschen)
Februar 1932.
Fritz spürt, wie er errötet. Schnell schaut er weg. Es ist doch immer das Gleiche. Sobald er Maria sieht, ist er nicht mehr in der Lage sich zu beherrschen. Rasch sinkt er auf seinen Sitzplatz und konzentriert sich mit aller Gewalt auf sein Modell der Armstrong Whitworth F.K.3, mit der die Briten im Großen Krieg geflogen sind. Vergangenen Sonntag hat er das zweisitzige Mehrzweckflugzeug fertiggebaut; nun muss es nur noch an einen starken Bindfaden gebunden an die Zimmerdecke gehängt werden.
Die Gedanken an seine Modellflugzeugsammlung, die mittlerweile auf vier Stück angewachsen ist und zuhause die Ecke über dem Küchenregal ausfüllt, lenkt Fritz heute jedoch nur wenig ab. Normalerweise sind sie seine Zuflucht, auch wenn ihn Gunnar deswegen piesackt. Nicht auszudenken, wenn Gunnar anfängt ihn wegen Maria aufzuziehen…
Immer noch fühlt Fritz seine Ohren rot schimmern, während er sich bemüht, nicht zu Maria hinüber zu sehen. In der vergangenen Pause hat sie mit ihm gesprochen; „danke“ hat sie gesagt, mehr nicht. Aber ihr warmes Lächeln dazu hat das eine Wort zum Schönsten gemacht, was Fritz je von einem Mädchen gehört hat.
Hilda und Charlotte, die schräg vor ihm sitzen, würden nie so warm lächeln. Keine der anderen würde mit ihm sprechen, höchstens noch Pauline Weiß, Esther Ahrlt oder Susanne Clausen, die neben der kleinen Johanna Grünberg sitzt. Fritz macht sich nichts daraus – er ist es gewohnt, übersehen zu werden, und meistens ganz froh darüber.
Aber Maria sieht ihn; mehr noch, sie scheint ihn zu mögen. Aber Maria mag jeden in der Klasse – vielleicht Hilda und Charlotte weniger als Pauline, Susanne, Esther, Julia Müller und die kleine Johanna. Gunnar, Kalle und Dieter mag sie sichtlich am wenigsten. Aber sie mag ihn, Fritz, und das ist die Hauptsache.
Fritz spürt, wie ihm heiß wird. Seine Ohren sind bestimmt schon krebsrot, ebenso sein Gesicht, das mit der Nasenspitze nun schon fast die Schreibtafel mit seinem vom Vater geerbten Griffel berührt.
Erneut konzentriert sich Fritz auf seine Flugzeuge – und auf die neue Tiger Moth, ein flotter Zweisitzer von De Havilland. Wenn er doch nur das Geld hätte, den Bausatz zu kaufen, den es seit einer Woche auch hier in Altona im Fachhandel gibt. Wie oft hat er schon bei Bamberger vor dem Spielzeugladen gestanden und sich die Nase am Schaufenster plattgedrückt; beinah jeden Tag macht er auf dem Nachhauseweg einen kleinen Schlenker in die Straße, wo sich auch der Laden von Augsburgers befindet; Augsburgers verkaufen jedoch Gemüse und Obst.
„He, träumst du?“ wird Fritz plötzlich von vorne angezischt und spürt ein leichtes Auftreffen auf seiner Wange.
Natürlich ist es Gunnar, der ihn – von der Lehrerin unbemerkt – mit einem Stück Kreide beworfen hat. Rasch lehnt sich Fritz so weit wie möglich in seiner Bank zurück, um außer Reichweite von Gunnars kräftigen Fäusten zu kommen.
Dabei gleitet sein Blick jedoch erneut zu Maria hinüber, was wiederum die Röte in seinen Ohren verstärkt. Es ist doch immer das Gleiche. Er kann es nicht abstellen – und will es eigentlich auch gar nicht.
Er himmelt Maria an, seit er sie das erste Mal gesehen hat. So geht das nun schon seit fast drei Jahren, seit ihrer gemeinsamen Einschulung zu Ostern 1929 – dem „schwarzen Jahr“, wie es sein Vater nennt. Damals ist der Vater von einem Tag auf den anderen entlassen worden.
Fortan hat er nicht mehr als Hilfsarbeiter bei der Holsten-Brauerei in Altona gearbeitet, sondern mit vielen Tausend anderen für ein geringes Arbeitslosengeld am Arbeitsamt anstehen müssen. An den anderen Tagen des Monats muss er sich zu Fuß ins benachbarte Hamburg aufmachen, um dort als Tagelöhner wenigstens ein paar Pfennige schwarz hinzu zu verdienen.
„Nein, Herr Mann“, heißt es dort jedoch immer häufiger, „heute gibt es nix für Sie zu tun hier. Guten Tag!“
Die Zeiten sind mindestens so hart wie der derzeitige Winter, das weiß Fritz. Dazu braucht er weder den bereits früher hin und wieder auftretenden Jähzorn seines Vaters noch die Niedergeschlagenheit seiner Mutter erleben. Jeden zweiten Tag gibt es kein Abendessen und nur einmal in der Woche – sonntags – eine Lage Brennholz für den kleinen Bollerofen im Wohnzimmer oder den gusseisernen Herd in der Küche, sodass er mit knurrendem Magen unter der dünnen Wolldecke auf der alten Küchenbank liegt und sich zitternd mit aller Macht von Gedanken an Essen abzulenken versucht.
Ablenkung verschaffen ihm dabei neben den Modellflugzeugen nur seine Bücher – allen voran seine drei Lieblinge: Emil und die Detektive, Die Schatzinsel und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. In der Schule lobt ihn die Lehrerin oft, dass er schon so gut lesen kann – was letztlich nicht verwunderlich ist; immerhin steckt Fritz seit dem Ende der ersten Klasse fast jede freie Minute seine Stupsnase in ein Buch. Am liebsten hat er Abenteuer mit Jungen wie Emil Tischbein, Jim Hawkins oder dem Neffen von Professor Lidenbrock, aber im Grunde genommen liest er alles, was sich zwischen zwei Buchdeckeln befindet.
Seit einem Jahr ist er außerdem dazu übergegangen, Zeitungen und Zeitschriften zu lesen – den Anzeiger und das Tageblatt aus dem benachbarten Hamburg sowie den Stürmer, den der Vater erst kürzlich direkt aus München abonniert hat, den Fritz aber nicht gern liest. Die Worte sind oft kompliziert und sinnleer für ihn.
Im Nähkorb der Mutter findet er manchmal Briefe von Tante Clara, die in Solby an der Ostsee nördlich der Schlei wohnt und mit dem dortigen Pastor Frieder Asmus verheiratet ist. In diesen Briefen stehen hin und wieder sogar ganze Gedichte und auch andere kürzere Texte, die von der Tante irgendwo abgeschrieben zu sein scheinen; manchmal sind es auch aus der Zeitung ausgeschnittene Artikel, die den Briefen beiliegen.
Fritz ist aufgefallen, dass die Mutter diese Briefe vor dem Vater verborgen hält; warum sie das tut, versteht er nicht. Vielleicht will sie den Vater einfach nur nicht aufregen? Denn manche der Texte sind ziemlich frech, aber so einprägsam, dass Fritz sie nach einmal Lesen auswendig kann. Einige davon machen ihm Angst, beispielsweise jener Text, den er eines Abends vor etwa einem Jahr gefunden und sofort gelesen hat. Es ist ein Gedicht gewesen, das mit den Worten begann:
Stoßt auf mit hohem Klang!
Nun kommt das Dritte Reich!
Ein Prosit unserm Stimmenfang!
Das war der erste Streich!
Fritz kann sich noch sehr genau an jenen Tag Anfang Oktober erinnern; denn es war nur wenige Tage nach der Hamburger Bürgerschaftswahl, deren Ausgang den Vater so sehr gefreut hat, dass er mit dem Hamburger Anzeiger in der Hand durch die Küche getanzt ist.
Von Hause aus ist der Vater „ein Konservativer“, sagt er immer. Und deshalb freue es ihn zu sehen, dass es vielen anderen „aufrechten Deutschen“ genauso gehe und sie deutlich gegen die verhasste Republik Weimar gestimmt haben, wenngleich das Wahlergebnis bis heute nicht zu einem neuen Senat gereicht hat. Noch immer ist die von der Sozialdemokratischen Partei geführte Koalition am Ruder – zumindest bis zu den Neuwahlen, die für Ende April geplant sind.
Wo auch immer Tante Clara das Gedicht her hat, der Verfasser scheint sich nicht über den Wahlerfolg der konservativen „aufrechten Deutschen“ zu freuen; jedenfalls geht der Text mit den Worten weiter:
Der Wind schlug um. Nun pfeift ein Wind
Von griechisch-nordischer Prägung.
Bei Wotans Donner, jetzt beginnt
Die Dummheit als Volksbewegung.
Fritz mag den Schreibstil des nicht genannten Autors, der ihn manchmal ein wenig an den Emil erinnert. Aber natürlich hat er Tante Claras Brief schnell zurück in den Weidenkorb unter zwei Wollknäule gelegt und den Deckel des Handarbeitskorbs zugeklappt, als er die Mutter ins Wohnzimmer kommen hörte.
Die Mutter hat keinen Verdacht geschöpft, sondern ihm sogar beim Abschneiden des neuen Haltefadens geholfen, mit dem der Vater am Abend das neue Modell in die Küchenecke gehängt hat.
Seit der Vater arbeitslos ist, verbringt er viel Zeit zuhause. Er schläft, wenn er von seiner Arbeitssuche zurück ist, für ein bis zwei Stunden. Danach achtet er darauf, dass Fritz seine Aufgaben macht, wenngleich es die Mutter ist, die jeden Tag vor dem Abendessen die Rechenaufgaben durchsieht. Der Vater lässt sie gewähren und seufzt nur leise, wenn sie beinah jeden Tag sagt: „Aus Fritz muss mal was werden. Und wer gut rechnen kann, der hat es später leichter im Leben.“
Der Vater ist nicht sonderlich gut im Rechnen; Fritz weiß, dass er sich im ersten Jahr des Großen Krieges freiwillig zur Reichswehr gemeldet hat und ohne einen Abschluss von der Mittelschule gegangen ist – direkt an die Front in Frankreich.
Die Mutter hat die Mittelschule beendet und danach eine Ausbildung zur Stenotypistin begonnen; aufgrund einer schweren Erkrankung, die bis heute ihre Lunge und den Rest ihres zierlichen Körpers schwächt, hat sie die Ausbildung abbrechen müssen und nach dem Krieg den Vater geheiratet.
Dieser hat Glück gehabt, dass ihn in seinem Schützengraben an der Somme nur ein Schrapnell ins Knie getroffen hat; seinen besten Freund Jürgen Kolb hat eine englische Kugel glatt durchs Herz geschossen, sodass er auf der Stelle tot war und im darauffolgenden Granatenhagel zurückgelassen werden musste.
Der Vater wirft sich das bis heute vor und gerät schnell in Zorn, wenn jemand die Reichswehr oder die einstigen Generalfeldmarschalle Ernst von Ludendorff oder Paul von Hindenburg, der seit sieben Jahren Reichspräsident ist, schlecht macht.
Einen Artikel, den die Mutter vor rund sieben Monaten in der Küche gelesen hat, ist Anlass für einem handgreiflichen Wutausbruch des Vaters geworden, der nichts lesen oder auch nur im Haus haben will von dem Mann, der mit dem Satz „Soldaten sind Mörder“ das „Militär entehrt“ und die „Reichswehr in den Dreck zieht“. Daraufhin hat sich der Vater am Bücherbord der Mutter vergriffen und den kleinen Band Der Zeitsparer von Ignaz Wrobel – ein Geschenk von Tante Clara – kurzerhand und gegen jeden Protest der Mutter ins Ofenfeuer geworfen.
Danach hat die Mutter drei Tage lang nicht mit dem Vater gesprochen, während Fritz selbst in der warmen Küche wie von kaltem Wind fröstelnd geblieben ist, da der Vater drei Tage lang auf dem Sofa im Wohnzimmer geschlafen hat. Wenn der Vater doch nur einmal seinen Jähzorn beherrschen könnte!
Ein Streit über von Ludendorff soll es auch gewesen sein, der ihn im Zorn seine letzte Kurzzeit-Anstellung gekostet hat. Feste Anstellungen sind derzeit selten und erst recht für missverstandene Veteranen wie den Vater.
Daran, dass es keine Arbeit für ihn gibt, seien die Anderen – die Roten und vor allem die Juden – schuld, sagt der Vater. Denn selbst beim derzeit größten Arbeitgeber Norddeutschlands, auf der großen Hamburger Werft Blohm + Voss, haben die Kommunisten das Sagen: allen voran Leute wie ihr Nachbar von gegenüber, der einstige „Spartakus-Mann“ Albert Jessen, und der rote Hein, der mit richtigem Namen Heinrich Schön heißt und zwei Straßen weiter wohnt. Ihre Freunde sind zahlreich und halten zusammen, sagt der Vater, darunter auch der Sievers von nebenan, die Lehmanns aus ihrem Haus und sogar der nette Maximilian Kirchhoff aus Haus Nr. 18 in der Parallelstraße, die über den Innenhof zu erreichen ist.
Bei den anderen Industrieanlagen und Fabriken in Hamburg und hier in Altona brauche er es auch nicht zu versuchen, sagt der Vater immer wieder. Dort säßen Leute wie Joachim Clausen aus dem Haus am Ende der Straße, der nebenbei für Die Rote Fahne schreibt, und Bodo Mertens, ihr Nachbar von schräg über die Straße, der nicht nur der Vater von Kai aus Fritz‘ Klasse, sondern auch Buchhalter bei Rothenfels – Tabak &Zigarren in Bahrenfeld und dazu Sozialdemokrat ist.
Am schlimmsten aber seien die Juden. Fritz versteht nicht recht, warum der Vater das immer wieder betont. Er mag Leute wie Giesemanns, Reichbergs, die Familie Weiß und selbst das Ehepaar Lipowetzky aus der Parallelstraße gern leiden.
Liza Giesemann mit ihren Mandelaugen und den haselnussbraunen Locken ist für Fritz zwar kein Vergleich mit Maria, aber dennoch eines der schönsten Mädchen der Gegend und außerdem sehr nett. Auch Lizas jüngerer Bruder Léon ist nett, genau wie Pauline Weiß und ihre Geschwister Helene und der kleine Johannes aus dem Haus von über den Innenhof, wo auch Kirchhoffs und Lipowetzkys wohnen. Genauso ist es mit den Reichberg-Brüdern und der Mutter von Elisa Herzberg von nebenan oder Esther Ahrlt und der kleinen Johanna Grünberg aus seiner Klasse.
Die alte Frau Silberstein gar ist so etwas wie die Großmutter, die er sich immer gewünscht hat – stets hat die kleine alte Dame mit dem silberweißen Haar ein freundliches Wort für ihn übrig und verschenkt Süßigkeiten, die sie von ihrer Witwenrente kauft, an alle Kinder aus der Umgebung.
Nun, vielleicht nicht an alle Kinder. Fritz weiß, dass Gunnar Berger, der auch seine Klasse besucht und drei Straßen weiter wohnt, noch nie etwas von ihr erhalten hat. Dass Gunnar darüber wütend ist, hat er erst heute in der Pause wieder sehr deutlich zu spüren gehabt.
Eine halbe Handvoll Karamellbonbons hat er noch gehabt – heute Morgen. Frau Silberstein hat sie ihm vorgestern geschenkt. Wenn er die Bonbons bloß nicht mit zur Schule gebracht hätte! Aber er wollte Maria davon abgeben und hat es auch getan. Leider hat Gunnar es mitangesehen – und ihn in einem unbeobachteten Moment in den Schwitzkasten genommen.
Kalle Koch und Dieter Andresen, die immer an Gunnars Seite sind, haben ihm alle verbliebenen Bonbons aus der Hosentasche gezogen und sich im Davonlaufen mit fröhlichem Johlen jeder zwei davon auf einmal in den Mund geschoben; Gunnar hat die restlichen vier gegessen.
„Fritz“, reißt ihn die Stimme von Frau Kleinert aus seinen trüben Gedanken. „Was für ein Gedicht hast du auswendig gelernt?“
Die Lehrerin sieht ihn fragend und ein wenig besorgt an, da er offenbar ihre erste Nachfrage überhört hat. Fritz fährt ein heißer Schauer über den Rücken. Eigentlich ist er ein guter Schüler, vielleicht in Mathematik und Zeichnen besser als im Sport, aber vor allem im Deutschunterricht gehört er zu den Besten der Klasse.
Gunnar, Kalle und Dieter bilden zusammen mit Klaus Göppert, der neben Dieter sitzt, die vier Schlusslichter. Vielleicht sitzen sie deshalb in den vorderen beiden Bankreihen der Jungenseite, was bisher aber auch nicht viel gebracht hat.
Fritz sitzt allein in seiner Bank, weil es bei dreiunddreißig Schülern einen Jungen mehr als Mädchen in der Klasse gibt. Direkt hinter ihm sitzen Kai Mertens und der sportliche Jörn Olbers. Über den Mittelgang hinweg sitzt Pauline Weiß und neben ihr – Maria Goldberg.
„Du hast doch bestimmt ein Gedicht gelernt, Fritz“, wiederholt Frau Kleinert mit immer noch freundlicher Stimme, aber leicht gerunzelter Stirn. „Sagst du es auf?“
Fritz nickt stumm und steht auf. Er schließt kurz die Augen und hofft, nicht wieder knallrot zu werden. Alle blicken ihn an, auch Maria. Plötzlich weiß er seinen Text nicht mehr. Es ging um Briefmarken, so viel weiß er noch.
„Wie heißt dein Gedicht?“ hört er Maria leise fragen.
Er weiß, dass sie ihm helfen will. Und er ist ihr dankbar dafür. Fritz öffnet ein Auge und blinzelt zu ihr hinüber. Sie sieht ihn unverwandt an, ihre blauen Augen unter dem blonden Haar sind mitfühlend und aufmunternd zugleich. Da strafft er sich und weiß plötzlich wieder, was er gelernt hat.
Es ist ein Gedicht, das die Mutter aus der Zeitung ausgeschnitten und zu ihren Stricksachen in den Nähkorb gelegt hat. Beim Suchen nach der scharfen Schere fürs Zuschneiden des Aufhängefadens für seinen neuesten Bausatz hat er den Ausschnitt gefunden, gelesen und sofort auswendig gelernt. Er kann nicht anders, wenn er etwas zu lesen findet, muss er es lesen.
So ist es schon immer gewesen; Frau Kleinert sagt, er habe ein großes Talent für Sprachen. Schließlich konnte er bereits zum Ende des ersten Schuljahres flüssig lesen und sogar memorieren und aufsagen, auch schwierige Texte. Am meisten aber mag er die abenteuerlichen, die seltsamen und die lustigen.
„Ein männlicher Briefmark“, beginnt er mit leicht zitternder Stimme und verlagert sein Gewicht auf das linke Bein. Dann räuspert er sich und beginnt erneut:
Der Briefmark
Ein männlicher Briefmark erlebte
Was Schönes, bevor er klebte.
Er war von einer Prinzessin beleckt.
Da war die Liebe in ihm geweckt.
Er wollte sie wiederküssen,
Da hat er verreisen müssen.
So liebte er sie vergebens.
Das ist die Tragik des Lebens.
Seine Klassenkameraden brechen in Beifall aus. Fritz sieht, dass Gunnar unwirsch die Stirn runzelt und dem neben ihm sitzenden Kalle etwas ins Ohr flüstert. Aber Fritz ist das gleichgültig: Maria klatscht am lautesten und strahlt ihn an.
„Ringelnatz“, lächelt Frau Kleinert. „Sehr nett. Vielen Dank, Fritz. Wer will jetzt?“
*****
Natürlich hat Gunnar Berger die Nase vorn, als es im Sportunterricht ums Werfen von Medizinbällen geht. Fritz schafft es kaum, einen davon hochzuheben. Jeder der ledernen Bälle ist so groß und schwer wie ein dicker, runder Kürbis.
Der Sportlehrer ist der stets grimmig blickende Herr Ziegler, der Lehrer ihres Jahrgangs für die dritte Klasse der Grundschule, die nach einem ehemaligen Reichspräsidenten ‚Friedrich Ebert Grundschule und Gymnasium Altona‘ heißt. Leider hat Herr Ziegler überhaupt kein Mitleid mit kleinen schwachen Jungen, wie Fritz einer ist. Zur Strafe für eine nicht vollständig zu Ende gebrachte Übung mit dem dicken Medizinball lässt er Fritz zehn Kniebeugen machen, gefolgt von drei Lauf-Runden in der kalten Sporthalle.
„Ein echter deutscher Junge muss das können“, ruft ihm der Lehrer hinterher. „Lauf, Fritz! Lauf für das deutsche Vaterland!“
Fritz rennt gehorsam los und hört Gunnars abschätziges Lachen, als er bereits bei der zweiten Runde gut sichtbar langsamer wird. Mühsam schleppt er sich weiter und versucht die schmerzenden Stiche in seinen Seiten zu ignorieren. Zu Beginn der dritten Runde erblickt er Maria, die zwischen Pauline und Esther steht und ihn mitleidig ansieht – und jetzt zwinkert sie ihm sogar aufmunternd zu!
Fritz beißt die Zähne zusammen und bringt die letzte Runde mit erstaunlich guter Schnelligkeit hinter sich. Seine Beine werden morgen schmerzen, aber die Zeit ist gut gewesen auf der letzten Runde, das muss auch Herr Ziegler anerkennen. Der Lehrer nickt wohlwollend und strubbelt ihm einmal durchs Blondhaar, bevor er ihn zurück in die Schüler-Reihe mit den Medizinbällen schickt. Fritz sieht jedoch, dass Gunnar nicht zufrieden ist; er flüstert schon wieder mit Dieter, Kalle und Klaus Göppert. Die Blicke der vier Jungen verheißen nichts Gutes.
Zum Glück ist es die letzte Stunde des Schultages, sodass Fritz zehn Minuten der Qual später nur die Schuhe wechselt und noch in seine kurze Turnhose gekleidet in die abgetragene Männerjacke fährt, die ihm als Wintermantel dient, und vom Schulhof nach Hause rennt. In seinen Seiten tobt ein stechendes Feuer, das kaum auszuhalten ist. Aber er weiß, dass Gunnar hinter ihm her ist. Und seine einzige Chance ist es, die Tür des Mietshauses hinter sich zu schließen; dicke deutsche Eiche kann selbst Gunnar Berger nicht eintreten.
Überraschenderweise wird das Laufen leichter, je länger Fritz unterwegs ist, auch wenn das Stechen in seinen Seiten bleibt. Die Winterluft ist kalt, sodass sich sein Atem in weißen Wolken um sein Gesicht hüllt.
„Was ist denn mit dir geschehen?“ ruft die Mutter aus, als sie Fritz die Wohnungstür öffnet. „Bist du gerannt?“
Fritz nickt und sinkt auf die Küchenbank, die abends auch seine Schlafstelle ist. In der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock gibt es außer der Küche und dem Wohnzimmer nur ein weiteres kleines Zimmer, in das gerade das Bett seiner Eltern passt. In der Küche zu schlafen hat jedoch auch den Vorteil, dass es dort im Winter am wärmsten ist; der gusseiserne Herd heizt das Zimmer mit, selbst wenn sie kein Feuerholz für den alten Bollerofen im Wohnzimmer haben. Gekocht wird jeden zweiten oder dritten Tag und das Eisen des Ofens bleibt auch mit nur der Glut noch eine ganze Zeitlang warm.
Die Mutter mustert ihn noch ein paar Augenblicke, dann füllt sie ihm die lauwarm gebliebene Kartoffelsuppe von gestern auf. Fritz löffelt gierig, wenngleich er ein schlechtes Gewissen hat – die Mutter hat bereits gestern ihre Portion an ihn abgetreten. Das macht sie viel zu oft und wird dadurch mit jedem Tag schmaler. Sie mache es gern, sagt sie immer, wenn er sich weigern und sie essen lassen will. Sie bräuchten auch noch Geld für Kohlen, das sie sich ebenfalls vom Mund absparen. Aber wie viel sie auch sparen – das Geld reicht hinten und vorne nicht, weil der Vater noch immer keine dauerhaft feste Anstellung bekommen hat.
Das geht nun schon seit Jahren so, Fritz kennt es gar nicht anders. Im Mai 1923, als der Vater noch in der Fabrik von C.F. Scheeßel in Stellingen beschäftigt war, soll er im Streit einen anderen Arbeiter zu Boden geschlagen haben; jedenfalls hat das so in der Zeitung gestanden. Fritz kann sich nicht daran erinnern, er selbst ist damals ja nur knapp ein Jahr alt gewesen. Aber der Vater hat den Artikel aus dem Vorwärts ausgeschnitten und in sein Album geklebt, in dem er für ihn wichtige Sachen sammelt.
Fritz hat lange nicht verstanden, warum der Vater den Artikel aufgehoben hat; er ist immerhin vom „roten Joachim“ geschrieben worden, dem Vater von Susanne Clausen aus seiner Klasse, der heute nur noch für die Kommunisten schreibt. Und dass der Vater den Journalisten Clausen nicht mag, hat er mehr als einmal betont. Mit den Roten, hat er gesagt, gebe er sich nicht ab – vor allem, wenn sie Lügen in der Zeitung verbreiten.
Der Vater kann diese „Roten“ nicht ausstehen; die seien alle gegen ihn, obwohl er doch auch ein Arbeiter sei – aber ein patriotischer. Was das heißt, hat er Fritz vor einigen Jahren erklärt: Er sei sehr stolz darauf, Deutscher zu sein, und er wolle ein Deutschland für die Deutschen mit einem starken Mann an der Spitze. Für Fritz klingt das ein bisschen so, als ob sich der Vater den alten Kaiser zurückwünscht, für den er damals in Frankreich im Schützengraben lag.
Nachdem bei Scheeßel Schluss war, hat der Vater einige Monate in der Reemtsma Cigarettenfabrik in Bahrenfeld gearbeitet und Cigarettenkartons aus Produktionshallen zu Lastwagen getragen. Seinem Knie zuliebe hat er versucht, sich auf eine sitzende Position zu bewerben; stattdessen hat ihn der Vorarbeiter – ein Sozialdemokrat – jedoch sofort von der Liste der Hilfsarbeiter gestrichen.
Als seine alten Stahlhelm-Kameraden davon hörten, sollen sie diesen Vorarbeiter aufgesucht und mit ihm geredet haben. Das Ende vom Lied war, dass auch zwei Anführer der alten Kameraden ihre Stellen bei Reemtsma verloren haben, zwei Wochen in Polizeihaft saßen und auch der Vater beinah von der Polizei verhaftet worden wäre – als Aufrührer!
Von seinem Vater weiß Fritz, dass die beiden Anführer – zwei Brüder aus Altona – nach dieser Sache für eine ganze Weile ohne Arbeit waren. Wo sie jetzt arbeiten, weiß Fritz nicht; es interessiert ihn auch nicht. Selbst wenn sie wieder arbeiten, die beiden sollen die Zeit genutzt und sich mit dem Aufbau einer neuen Gruppe in Altona beschäftigt haben. Viele ihrer alten Kameraden sollen weiterhin dabei sein in der Truppe, die sie – nach dem Gründungsjahr 1925 – nur ‚25‘ nennen.
Der Vater ist nicht dabei – aber nicht, weil er nicht gewollt hätte. Seit er aus dem Großen Krieg zurück ist, fällt ihm das Gehen wegen dem Schrapnell, das noch immer in seinem linken Knie steckt und nicht entfernt werden kann, schwerer und schließt langes Gehen oder gar Marschieren ganz aus. Dennoch lässt er es sich nicht nehmen, so oft wie möglich in der alten Kneipe Zur Rebe an der Holstenstraße – keine dreihundert Meter vom Haupthaus der Brauerei entfernt – seine alten Kameraden zu treffen.
Fritz weiß, dass die Mutter es nicht gern sieht, dass der Vater weiterhin mit diesen Leuten zusammen ist – schließlich sind sie in den vergangenen acht Jahren mehr als einmal verhaftet worden und somit polizeibekannt. Die Mutter befürchtet, dass der Vater aufgrund der Bekanntschaft immer wieder seine Stelle verliert.
Der Vater aber lässt sich dadurch keineswegs beirren, wenngleich Fritz erzählen hören hat, dass die Brüder und ihr ‚25‘-Trupp mittlerweile einer anderen Partei angehören, die sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz: NSDAP, nennt. Die Mutter zuckt immer zusammen, wenn von diesen Leuten geredet wird; der Vater hingegen bricht in Begeisterung aus.
Selbstverständlich ist er auch damals im Februar 1926 dabei gewesen, als der Vorsitzende der NSDAP auf Einladung des ‚Nationalclubs von 1919‘ in Hamburg eine Rede hielt. Fritz weiß aus der Zeitung, dass dieser Vorsitzende Adolf Hitler heißt. Und er weiß auch, dass dieser Hitler der dritte Mann nach den Anführern von Trupp ‚25‘ ist, den der Vater bewundert – ja, er traut ihm sogar zu, ganz allein für das bessere Deutschland sorgen zu können.
*****
An der lauten Art, wie der Vater zwei Stunden später noch in Jacke und Mütze in die Küche kommt, kann Fritz ablesen, dass es heute Arbeit gegeben hat. Warum der Vater der Mutter stolz seinen Jackenaufschlag hinhält, versteht er erst auf den zweiten Blick: Dort blitzt ein kleiner runder Anstecker, wie ihn auch Herr Ziegler und der Hauswart Miess an der nämlichen Stelle tragen.
„Ab heute wird alles besser“, strahlt der Vater und zieht ein kleines Heftchen aus seiner Jackentasche. Fritz kann sehen, dass auf dem Heft in dicker Schrift das Wort ‚Mitgliedsausweis‘ steht; darunter befindet sich das seltsame Kreuz mit den Haken an den Enden, das auch den kleinen Anstecker ziert.
„Erich!“ entfährt es der Mutter erschrocken. „Warum hast du das getan?“
„Aber Hilde…“, antwortet der Vater nach einem kurzen Zusammenzucken; die Mutter erhebt sonst nie ihre Stimme. Dass die zierliche Frau dazu überhaupt in der Lage ist, hat Fritz bisher immer bezweifelt; nun hat sie fast geschrien. „Glaube mir, ab jetzt geht es uns gut. Die Kameraden sorgen für uns.“
„Welche Kameraden?“ fragt die Mutter, obwohl sie wie Fritz die Antwort ahnt. Es kann sich nur um jene Leute handeln, die der Vater damals kennengelernt hat, als er in den letzten Februartagen des Jahres 1919 seinen inzwischen verstorbenen Bruder, Onkel Emil, zu einer Versammlung der Deutschnationalen begleitet hat, die sich wenig später zur Deutsch-Nationalen Volkspartei, kurz: DNVP, zusammenschlossen. Darunter ist auch jener Mann, mit dem sich der Vater in den frühen 1920er Jahren häufiger getroffen haben soll – Karl-Heinz Sonne.
Dieser Sonne ist einer der beiden Anführer vom Trupp ‚25‘, der mittlerweile als ‚Sturm 25‘ über Altona hinaus bekannt ist. Im Jahr 1928, als sich die DNVP über den neuen Parteivorsitzenden Alfred Hugenberg zerstritt, sind Karl-Heinz und sein Bruder Hans-Dieter samt ihrem Trupp zu jener anderen Gruppe übergegangen, die in der Zeitung oft nur „die Nazis“ genannt wird. Diese Nazis haben seit 1921 ihre mit jeder Wahl einflussreichere Partei NSDAP, die der Mutter so wenig gefällt. Der Kontakt zwischen Sonne und dem Vater ist danach ein wenig abgekühlt, aber offenbar bis heute nicht abgerissen.
Fritz weiß, dass der Vater diesen Mann, der ihm selbst ein wenig unheimlich ist, ziemlich offen bewundert. Solche Männer brauche Deutschland, hat er mal gesagt und dabei geradezu ein Leuchten in den Augen gehabt. Es sei an der Zeit, dass Leute wie Karl-Heinz Sonne zum Zuge kämen – für das deutsche Vaterland.
Wie bereits damals beim Stahlhelm-Kampfbund, dem der Vater bis heute angehört, hat sich auch Sonne einem besseren Deutschland verschrieben – einem Land, das sich nicht mehr von den anderen Nationen vorschreiben lässt, was es tun und nicht tun darf. Den Reichstag in der deutschen Hauptstadt Berlin nennt der Vater abfällig eine „Quasselbude“, in der sowieso nichts erreicht werde.
Dem kleinen Mann gehe es schlecht; sie müssten schon selbst sehen, wie sie zurechtkommen, weil „die da oben“ nur mit Parlamentieren beschäftigt seien und gar nicht mehr merkten, dass Deutschland vor die Hunde geht. Und deshalb ist der Vater auch ganz Feuer und Flamme gewesen, als Sonne sich heute völlig unverhofft mit ihm getroffen hat – um über Deutschlands Zukunft zu sprechen und wie der Vater dabei mithelfen könne.
Offenbar bedeutet Mitglied bei Sonnes Leuten zu sein, dass der Vater die bessere Zukunft für Deutschland mitgestalten kann. Fritz weiß nicht recht, ob er lachen oder weinen soll; wenn er seine Mutter ansieht, erscheint ihm Letzteres richtiger. Aber ist es nicht gut, dass die Kameraden für den Vater sorgen? Dass sie für ihn da sind und zusammenhalten? Wie wünscht er sich, dass es so jemanden auch für ihn gäbe. Dann würde selbst Gunnar Berger sich nicht mehr trauen, ihn zu triezen.
Ein heißkalter Schauer jagt Fritz über den Rücken, als ob plötzlich Wind durch die Küche wehen würde. Er spürt, dass heute ein besonderer Tag ist. In den Augen des Vaters glüht Hoffnung, die ansteckend ist.
Zum ersten Mal seit langem ist er fröhlich und läuft nicht Gefahr, seinen Jähzorn mit wütenden Worten über den „Saustall in Berlin“, womit er die Regierung der Republik meint, hervorbrechen zu lassen und in seiner Unbeherrschtheit auf alles und jeden in seiner Nähe einzuschlagen. Allerdings ist seine Bierfahne auch kein gutes Zeichen…
„Karl-Heinz sagte“, fährt der Vater mit erhobener Stimme fort, „dass ich ab übermorgen bei Rothenfels anfangen kann. Dort gibt es jetzt extra Stellen für Parteimitglieder. Ist das nicht großartig, Hilde?“
„Hm“, murmelt die Mutter mit gesenktem Kopf und wendet sich dem Herd zu. Ob es Tränen waren, die Fritz in ihren Augenwinkel schimmern gesehen hat?
Er hat jedoch keine Zeit darüber nachzudenken. Was der Vater da gesagt hat, ist die Rettung für sie drei. Rothenfels – Tabak &Cigarren in Bahrenfeld ist ein guter Arbeitgeber, der vor allem gut zahlt – fast so viel wie auf der Werft in Hamburg.
Der Vater spricht weiter und freut sich wie ein Geburtstagskind über die neue Anstellung als Fabrikarbeiter, für die er in der gleichen Schicht wie Karl-Heinz Sonne und dessen Bruder Hans-Dieter eingeteilt worden ist.
„Es wird so werden wie früher, Hilde“, lacht der Vater zufrieden, „du wirst schon sehen. Und der Stundenlohn ist höher als bei Holsten. Ist das nicht großartig?“
„Warum“, fragt die Mutter leise und wendet ihnen noch immer den Rücken zu, „hast du es nicht noch einmal bei Blohm + Voss versucht? Max Kirchhoff hätte da bestimmt ein gutes Wort für dich eingelegt. Und der Kowalski von über der Straße hat erst gestern gesagt, dass gerade eine Menge neuer Aufträge…“
„Kirchhoff klüngelt mit Jessen und dem roten Hein“, widerspricht der Vater heftig. „Bei dem ist nichts zu holen. Und Kowalski hat noch nie ein wahres Wort von sich gegeben, der dreckige Pole…“
„Erich!“ Erneut wird die Mutter laut. „Nicht vor dem Jungen – ich bitte dich!“
„Hör mal zu, Hilde“, fährt der Vater unbeirrt fort, „Karl-Heinz hat mir eine kleinere Summe als Vorschuss auf meinen ersten Lohn mitgegeben. Schick den Jungen zur Steiner und lass ihn ein Viertelpfund Lachsschinken kaufen. Und eine Dose Sar…“
„Ich will jetzt keine Sardinen in Öl!“ japst die Mutter und wirbelt herum. Ihr Gesicht ist nass vom Weinen, die Augen sind rot und geschwollen. „Und ich will dich nicht bei diesen… diesen Leuten sehen, Erich. Bitte, mach es rückgängig.“
„Bist du von allen guten Geistern verlassen?“ poltert der Vater los.
Fritz sieht, wie er bereits unwillkürlich die Hand zum Schlag erhebt, sie dann aber nur auf die Tischkante sausen lässt. Trotzdem zuckt Fritz zurück und geht vorsorglich in Deckung. Er registriert verwundert, dass die Mutter steif und mit empor gerecktem Kinn vor dem Vater stehen bleibt und nicht zurückweicht. Im Gesicht des Vaters spiegeln sich Wut, Unglauben und Enttäuschung. Seine Worte dröhnen in Fritzens Ohren, obwohl der Vater plötzlich ganz leise und zwischen den Zähnen hervor spricht.
„Du hast zu viel mit deiner Schwester und ihrem Pfaffen von Mann gesprochen“, zischt der Vater. „Ich kann nicht glauben, dass du nicht siehst, welche Chance das für uns ist, Hilde. Wenn Hitler erst an der Macht ist, und das wird nicht mehr lang dauern, dann wird alles besser werden. Glaub mir!“
„Für das deutsche Vaterland?“ fragt die Mutter erstickt. „Bist du sicher?“
„Karl-Heinz ist sich absolut sicher. Bald sind wir Deutschen wieder wer in der Welt – und man wird bewundernd zu uns aufsehen.“
Die Mutter sackt plötzlich in sich zusammen. Kraftlos versucht sie sich noch an die Tischkante zu klammern, doch der Vater muss sie auffangen, um einen Sturz auf den harten Küchenboden zu verhindern.
„Hilde!“ ruft er erschrocken aus. „Was ist denn? Geht es dir nicht gut?“
Plötzlich ist er wieder der besorgte Ehemann und Vater, den Fritz liebt und der in den letzten Jahren nur in den wenigen Momenten zutage getreten ist, in denen sie genug zu essen und zu heizen gehabt haben. Es tut gut zu sehen, dass dieser nette, gute Mann noch immer im allzu oft griesgrämig-jähzornigen Vater ist und nun wieder ans Licht kommt. Rasch platziert der Vater die Mutter auf den nächstbesten Küchenstuhl und ist sehr um sie besorgt, bis sie wieder zu sich kommt.
„Was ist denn, Hilde?“
„Es geht schon“, antwortet sie matt und richtet sich etwas mühsam auf, wobei sie einen Hustenanfall zu unterdrücken versucht.
Der Vater streckt Fritz stumm einen Geldschein entgegen und ruckt mit dem Kopf zur Wohnungstür. Fritz versteht dies als Aufforderung, augenblicklich den Einkauf bei Frau Steiner zu erledigen. Auch wenn er seine hustende Mutter nur ungern allein lässt, zieht er sich seinen Jacken-Mantel wieder an und läuft, noch immer in Turnhosen, über die Straße zum Gemischtwarenladen von Trude Steiner.
Die Ladenbesitzerin ist gerade mit einer Kundin im Gespräch, die Fritz als Maria Goldbergs Mutter erkennt. Höflich sagt er „guten Tag“ zu beiden Frauen und stellt sich hinter Frau Tischendorf aus der Parallelstraße, die noch vor ihm dran ist.
Während er wartet, lässt er sich die Worte seines Vaters noch einmal durch den Kopf gehen. Wenn der Vater wieder eine feste Anstellung hat, dann werden sie in Zukunft wieder genug zu essen und zu heizen haben. Und wer weiß – vielleicht ist auch noch genug Geld übrig für eine neue Wolldecke. Die alte, unter der er nachts auf der Küchenbank liegt, besteht fast nur noch aus Löchern.
Somit muss es gut sein, dass der Vater noch immer mit Karl-Heinz Sonne bekannt ist. Fritz kann sich nicht daran erinnern, wann die beiden sich zum ersten Mal getroffen haben, schließlich ist er damals noch nicht einmal geboren gewesen.
Aber er weiß, dass die Gebrüder Sonne Mitglieder im Verein ‚Wanderbund e.V.‘ in Hamburg gewesen sind, bis dieser im November 1922 als getarnte Organisation der Nationalsozialisten von der Polizei Hamburg verboten wurde – genau wie neun Monate zuvor auch die Ortsgruppe der NSDAP. Das sei so typisch für die „rot-jüdische Saubande“ in der Regierung der verhassten Republik, hat der Vater gewettert – eine Schande für das deutsche Vaterland, wenn Liebe zum Vaterland verboten werde.
Mittlerweile ist die Partei wieder erlaubt, wenngleich ihre Organisationen Sturmabteilung, kurz SA, und die SS genannte Schutzstaffel neuerdings wieder verboten sind. Fritz hat in der Zeitung gelesen, dass Reichskanzler Heinrich Brüning, der seit zwei Jahren mithilfe von Notverordnungen regiert und über den der Vater immer nur schimpft, vor allem Ärger mit Leuten von der NSDAP und mit Alfred Hugenberg von der DNVP hat; letztere hat der Vater bisher immer gelobt und gewählt. Aber damit ist es nun offensichtlich vorbei.
Der Vater ist nun also auch Mitglied bei den Nazis, über die so viel geredet wird. Fritz hat viele verrückte Sachen über sie und ihren Anführer Adolf Hitler gehört, aber in den Worten des Vaters ist das alles nur üble Nachrede. Man neide Hitler den Erfolg, hat er gesagt; denn die NSDAP gewinnt bei jeder Reichstagswahl viele Stimmen dazu – besonders seit September 1930. Fritz fragt sich, ob der Vater da auch schon Hitler gewählt hat; ab heute wird er mit Sicherheit bei jeder Wahl für die Nazis stimmen. Und natürlich weiß Fritz, dass Erfolg Neider anzieht.
Seine guten Schulnoten sind wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Gunnar Berger es immer auf ihn abgesehen hat. Er muss etwas tun, irgendetwas, denn so kann es nicht weitergehen mit ihm und Gunnar.
„Was kann ich für dich tun, junger Mann?“ wird Fritz von Frau Steiners Stimme in das Hier und Jetzt zurückgerissen. Die rüstige Frau, die ursprünglich aus der Nähe von Königsberg stammt, macht sich immer einen Scherz damit, ihn auf diese Art anzusprechen. Mit einem Nachnamen wie dem seinen ist das aber auch einfach; manche Leute fragen sogar, ob er – was er nicht ist – mit dem Literaturnobelpreisträger Thomas Mann aus Lübeck verwandt sei.
Fritz trägt seine Bestellung vor und erhält die Dose Ölsardinen und den in weißes Butterbrotpapier eingeschlagenen Lachsschinken. Als er den Geldschein vor Frau Steiner auf den Tisch legt, macht diese große Augen.
„Mensch, Junge! Hast du die Lotterie gewonnen? Oder ist heute Weihnachten?“
„Mein Vater“, antwortet Fritz mit ein bisschen Stolz, „fängt ab übermorgen in der Fabrik von Rothenfels an.“
„Oh“, macht Frau Steiner überrascht. „Da haben sie doch gestern den Schmidt und den Holz aus der Nachmittagsschicht rausgeworfen. Sag bloß, dein Vater ist einer von denen, die der Sonne dort als die Neuen angeschleppt haben soll.“
Fritz nickt ein wenig unbehaglich. Herr Schmidt und Herr Holz wohnen beide in der Parallelstraße, nebenan von Maria Goldberg, und sind mit Max Kirchhoff gut bekannt. Warum man sie wohl hinausgeworfen hat? Aber solange es nur diese ‚Roten‘ getroffen hat, die der Vater so verabscheut, ist es wohl in Ordnung; jedenfalls ist Fritz froh, dass sie nun Geld für Essen und in Zukunft auch wieder für Koks genannte Brennkohlen haben. Denn der Husten der Mutter ist in diesem Winter keinesfalls besser geworden.
„Na“, macht Frau Steiner und zwingt sich zu einem Lächeln. „Das wird mal noch angehen, dass dein Vater endlich wieder ne feste Stelle bekommt. Vielleicht kann er ja noch gegensteuern…“
Die letzten Worte hat sie eher gemurmelt, sodass Fritz nicht sicher ist, ob sie auch für seine Ohren bestimmt gewesen sind. Er beschließt sie zu überhören, vor allem weil er sie nicht versteht. Meint Frau Steiner den Husten der Mutter? Oder wollte sie etwas über die ‚Roten‘ und die Freunde des Vaters sagen? Er beschließt, dass es nicht so wichtig ist, auch wenn er den Vater bei Gelegenheit fragen wird, ob seine Stelle die von Herrn Schmidt oder von Herrn Holz ist.
Während er bereits wieder über die Straße geht und grübelt, wie er die Frage an seinen Vater richten soll, baut sich plötzlich ein Schatten vor ihm auf. Fritz zuckt erschrocken zusammen: Es ist Gunnar Berger! Und natürlich nicht er allein, Dieter und Kalle sind ebenfalls da und mustern ihn mit größter Neugier.
„Na, kleiner Mann“, beginnt Gunnar und klingt dabei keineswegs so mütterlich-freundlich wie Frau Steiner. „Was gibt es denn zu feiern?“
Fritz schweigt und versucht die Ölsardinendose und das weiße Päckchen in seine Jackentaschen zu schieben. Beim Laufen würde er sie sonst womöglich verlieren. Doch Gunnar kommt gar nicht dazu, weiter blöde Bemerkungen zu machen oder Kalle und Dieter den Befehl zum Festhalten zu geben. Noch bevor er seine Frage wiederholen kann, ertönt eine raue Männerstimme hinter Fritz.
„Dass Erich endlich zur Besinnung gekommen ist“, sagt der große kräftige Mann in Hut und Arbeiterjacke, an dessen Kragenaufschlag der gleiche Anstecker blitzt wie beim Vater.
Auch wenn er im ersten Moment zusammengezuckt ist, kann Fritz nicht leugnen, dass er zum ersten Mal froh über die Gegenwart von Karl-Heinz Sonne ist. Denn auch Gunnar scheint der Mann nicht ganz geheuer zu sein; jedenfalls ist er plötzlich sehr freundlich und unglaublich höflich, fast schon unterwürfig.
„Entschuldigen Sie, Herr Gruppenführer“, beeilt er sich zu sagen und hebt schnell und zackig die rechte Hand. „Ich habe Sie nicht gesehen. Heil Hitler!“
„Ist gut“, nickt Sonne und mustert Gunnar aufmerksam. „Sag deinem Vater einen schönen Gruß von mir, wir sehen uns nachher in der Rebe. Und jetzt macht, dass ihr nach Hause kommt.“
Gunnar nickt knapp und macht auf dem Absatz kehrt. Kalle und Dieter folgen ihm unaufgefordert, als er raschen Schrittes davon geht. Fritz wird es unbehaglich mit dem Sonne allein zurück zu bleiben. Immerhin ist sogar Gunnar sofort davongelaufen. Aber wieso der Gruß an Herrn Berger? Oder war es eher eine Drohung? Aus den Worten von Sonne glaubt Fritz herauszuhören, dass Gunnars Vater, der genau wie Maria Goldbergs Vater beim Postamt Altona an der Großen Mühlenstraße arbeitet, offenbar auch ein Bekannter von Sonne ist – ein ziemlich guter Bekannter. Warum sonst sollten sie sich in der Kneipe Zur Rebe verabreden, in der es kaum Wein aber dafür umso mehr Bier gibt?
Auch der Vater ist hin und wieder dort, seit damals, als er noch bei Holsten gearbeitet hat, die ihr Bier zu niedrigsten Preisen an die Rebe liefern, wodurch selbst Arbeitslose etwas davon abbekommen können – irgendjemand gibt dort immer eine Runde aus, hat der Vater gesagt, wenn er bierselig von dort nach Hause kam. Wahrscheinlich geht Gunnars Vater auch deshalb dorthin.
„So, mein Junge“, holt Sonnes Stimme Fritz aus seinen Gedanken. „Na, was gibt es zur Feier des Tages zu essen?“
„Ölsardinen und Lachsschinken.“
„Da fehlt dann aber noch das hier“, grinst Sonne und zieht eine Halbliterflasche Holsten aus der Jackentasche. „Grüß Erich von mir, hörst du? Und sag ihm, er soll am Abend zur Rebe kommen. Vergiss es nicht, hörst du?“
„Jawohl“, nickt Fritz und imitiert dabei unwillkürlich Gunnars zackigen Tonfall.
„Brav“, grinst Sonne und streicht Fritz über den blonden Scheitel. „Aus dir werden wir auch noch einen wackeren Hitlerjungen machen, was?“
Fritz schluckt stumm und bemerkt, dass Sonne ihn von oben bis unten mustert. Er spürt die Röte aufsteigen und senkt den Blick, doch der Mann fasst ihn am Arm, als er ihm mit der anderen Hand die Bierflasche in die Jackentasche schiebt.
„Ich habe gehört“, fährt Sonne fort und hält Fritz dabei immer noch am Arm fest, „dass du dich für Flugzeuge interessierst. Stimmt das?“
Fritz nickt, ihm bleibt nichts anderes übrig. Der Mann lacht leise in seinen Kragen und zieht dann noch etwas aus der Jackentasche. Dieses Mal ist es ein Brief im braunen Kuvert. Auf der Vorderseite steht der Name ‚Erich Mann‘, auf der Rückseite prangt, anstelle der Adresse des Absenders, ein gestempeltes Hakenkreuz.
„Gib den Erich“, sagt Sonne und schiebt Fritz den Umschlag unverwandt in die andere Jackentasche. „Und sag ihm, er soll das restliche Geld für deine Kleidung nehmen. Du brauchst ne lange Hose für den Winter, die Uniform kann er davon“, er deutet auf die aus der Tasche herausblitzende Ecke des Umschlags, „bezahlen.“
„Und jetzt lauf, Junge“, schließt Sonne. „Sonst frierst du dir noch was weg.“
Erst jetzt bemerkt Fritz, dass seine Beine rot und fast taub geworden sind. In der Kälte des hereinbrechenden Abends frischt der Wind auf und weht eisig um seine nackten Beine. Er ist unendlich froh, als er zurück in der Wohnung und am Herd in der Küche sitzt.
Der Vater freut sich über das neuerliche Geschenk seines neuen besten Freundes und bekommt sogar die Mutter dazu, dass sie dem Mann dankbar ist für das Geld, mit dem Fritz neue Hosen bekommen soll. Die alte Hose hat dank der geschickten Finger der Mutter keine Löcher, ist aber für einen Winter wie diesen viel zu dünn.
*****
Einleitung
Wenn wir das deutsche Volk und seine Geschichte überblicken, so bieten sich uns vorzugsweise zwei Helden dar, die seine Geschicke gelenkt haben, weil einer von ihnen hundert Jahre tot ist. Der andre lebt. Wie es wäre, wenn es umgekehrt wäre, soll hier nicht untersucht werden, weil wir das nicht auf haben. Daher scheint es uns wichtig und beachtenswert, wenn wir zwischen dem mausetoten Goethe und dem mauselebendigen Hitler einen Vergleich langziehn.
Erklärung
Um Goethe zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass derselbe kein Patriot gewesen ist. Er hat für die Nöte Napoleons niemals einen Sinn gehabt und hat gesagt, ihr werdet ihn doch nicht besiegen, dieser Mann ist euch zu groß. Das ist aber nicht wahr. Napoleon war auch nicht der größte Deutsche, der größte Deutsche ist Hitler. Um das zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass Hitler beinah die Schlacht von Tannenberg gewonnen hat, er war bloß nicht dabei. Hitler ist schon seit langen Monaten deutscher Spießbürger und will das Privateigentum abschaffen, weil es jüdisch ist. Das was nicht jüdisch ist, ist schaffendes Eigentum und wird nicht abgeschafft. Die Partei Goethes war viel kleiner wie die Partei Hitlers. Goethe ist nicht knorke.
März 1932.
Fritz hält inne und lauscht. Ist das die Mutter, die dort nebenan im Wohnzimmer so stark hustet? Es tut schon beim Zuhören weh, und noch mehr, wenn er sich dabei vorstellt, wie der zierliche Körper der Mutter unter dem Husten geschüttelt wird. Ob sie doch eine Frühjahrserkältung bekommen hat?
Vielleicht hätte sie gestern nicht den Weg bis nach Hamburg gehen sollen, um im Hanseviertel und am Gänsemarkt ihre Näharbeiten persönlich abzugeben. In den Wohnungen, die sich dort über den Geschäften befinden, wohnen Bürgerliche, die früher in Altona mit der Mutter zur Schule gegangen sind und heute davon leben, dass ihre Männer für die Zeitung oder den Rundfunk arbeiten.
Bei der Aufsicht über die Kinderschar, die wegen der Vier-Zimmer-Wohnungen und der Geschäfte im Erdgeschoss im Hinterhof spielen müssen, haben die Frauen offenbar keine Zeit übrig für Näharbeiten. Die Mutter ist froh, sich dadurch noch hin und wieder etwas hinzuverdienen zu können, auch wenn sie nun nicht mehr darauf angewiesen sind.
Der Lohn des Vaters ist zwar nicht reichlich, aber wenigstens wird er wöchentlich und immer pünktlich ausgezahlt. Dennoch hat die Mutter Fritz anvertraut, dass sie gern handarbeitet. Es sei eine gute Beschäftigung, hat sie gesagt, die sie davon ablenkt, auf Fritz und den Vater zu warten. Denn ihre kleine Wohnung hat sie mit wenigen Handgriffen innerhalb einer Stunde saubergemacht, und die Reinigung des Treppenhauses – Wischen und Bohnern bei ihnen im zweiten Stock – nimmt ihr freundlicherweise oftmals die verwitwete Frau Herzberg von nebenan ab, wenn die Mutter an der Reihe wäre.
Fritz weiß, dass er dem Vater nichts davon sagen soll, dass Elisas Mutter für die Mutter einspringt, wie sie es schon damals vor zwei Jahren tat, als die Mutter im Januar 1930 zum ersten Mal diesen schlimmen Husten bekam. Bisher hat er nicht lügen müssen, weil der Vater sowieso nicht danach fragt, was die Mutter macht. Er fragt nur, wie es ihr geht.
Mit angehaltenem Atem lauscht Fritz weiter und hört eine Tür klappen. Der Vater ist auf den Flur getreten und nimmt offenbar den neuen Hut vom Haken. Seine Schritte verharren kurz vor der Küchentür, die einen Spalt geöffnet wird, sodass Fritz schnell auf Zehenspitzen in die Ecke mit den Flugzeugen zurückweicht.
„Fritz?“
„Ja“, antwortet er so unaufgeregt wie möglich. „Ich bin hier.“
„Tu mir einen Gefallen“, sagt der Vater und knöpft sich dabei die Jacke zu, „geh nach draußen zum Spielen, ja? Ich schlage vor, du machst bei diesem schönen Wetter einen Spaziergang zur Elbe.“
Fritz will nach dem Grund fragen, doch das Gesicht des Vaters ist hart und duldet keinen Widerspruch. Folgsam zieht Fritz Jacke und Mütze an und wickelt sich den alten Schal des Vaters um den Hals; auch wenn draußen die Frühlingssonne vom blauen Himmel scheint, weht der Wind noch immer kühl durch die Straßen.