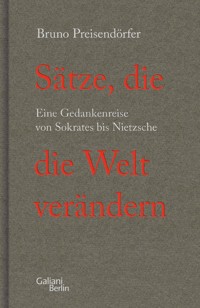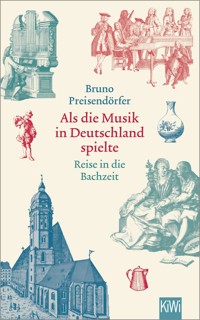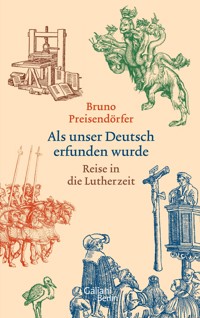12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als sich Wilhelm I. – von Bismarck dazu gedrängt – 1871 zum Kaiser krönen ließ, war ›sein‹ Berlin noch »die einzige europäische Großstadt, in welcher wir tagtäglich an den Ufern stinkender Rinnsteine wandeln« – Kanalisation gab es nicht. Als 1890 Bismarck ging, waren 144 Kilometer an Kanälen gebaut und 584 Kilometer an Rohrleitungen verlegt. Was das für die Nasen der Bewohner und die Bewegungsfreiheit des Verkehrs bedeutete, kann man in Bruno Preisendörfers Buch nachlesen. Ähnlich ging es überall. In unglaublicher Geschwindigkeit wurden Tausende Kilometer Eisenbahnlinien, Strom- und Telegraphenleitungen verlegt, Fabriken gebaut, die Bevölkerung vervielfachte sich. Das Gefälle zwischen Reich und Arm wuchs enorm, alte Arbeits- und Familienstrukturen sowie Wertesysteme zerbrachen. In Bruno Preisendörfers Zeitreise spazieren wir durch die Wilhelmstraße und lernen Haus für Haus ihre Bewohner kennen, besuchen Cafés, Ateliers und Tanzpaläste genauso wie Fabriken, Amtsstuben und Hinterhöfe. Wir zuckeln mit der Bahn in 16 Stunden von Berlin nach Köln, erleben, wie die ersten sechs Mädchen zum Abitur zugelassen werden und wie mit Franziska Tiburtius die erste Ärztin eine Praxis aufmacht. Wir tafeln mit Fontane, gehen mit Ferdinand Lasalle zum Duell, mit Marx zur Arbeiterversammlung, mit Bismarck in den Krieg und mit dem Kaiser zur Krönung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bruno Preisendörfer
Als Deutschland erstmals einig wurde
Reise in die Bismarckzeit
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bruno Preisendörfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bruno Preisendörfer
Bruno Preisendörfer ist freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift (www.fackelkopf.de). Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, die zu SPIEGEL-Bestsellern wurden, darunter: »Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit«, »Als die Musik in Deutschland spielte. Reise in die Bachzeit« und »Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit«. Letzteres wurde zudem mit dem NDR-Sachbuchpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als sich Wilhelm I. – von Bismarck dazu gedrängt – 1871 zum Kaiser krönen ließ, war ›sein‹ Berlin noch »die einzige europäische Großstadt, in welcher wir tagtäglich an den Ufern stinkender Rinnsteine wandeln« – Kanalisation gab es nicht. Als 1890 Bismarck ging, waren 144 Kilometer an Kanälen gebaut und 584 Kilometer an Rohrleitungen verlegt.
Ähnlich ging es überall. In unglaublicher Geschwindigkeit wurden Tausende Kilometer Eisenbahnlinien, Strom- und Telegrafenleitungen verlegt, Fabriken gebaut, die Bevölkerung vervielfachte sich. Das Gefälle zwischen Reich und Arm wuchs enorm, alte Arbeits- und Familienstrukturen sowie Wertesysteme zerbrachen.
In Bruno Preisendörfers Zeitreise spazieren wir durch die Wilhelmstraße und lernen Haus für Haus ihre Bewohner kennen, besuchen Cafés, Ateliers und Tanzpaläste genauso wie Fabriken, Amtsstuben und Hinterhöfe. Wir zuckeln mit der Bahn in 16 Stunden von Berlin nach Köln, erleben, wie die ersten sechs Mädchen zum Abitur zugelassen werden und wie mit Franziska Tiburtius die erste Ärztin eine Praxis aufmacht. Wir tafeln mit Fontane, gehen mit Ferdinand Lasalle zum Duell, mit Marx zur Arbeiterversammlung, mit Bismarck in den Krieg und mit dem Kaiser zur Krönung.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Einleitung Im Spiegelsaal der Geschichte
Am Anfang die Revolution
Besuch in der neuen Hauptstadt
Kapellmeister Piefke und die Einigungskriege
Der dänische Krieg
Der deutsche Krieg
Der Krieg gegen Frankreich
Gründerzeit – Gründerkrach
Ein Jugendstreich auf alte Tage
Lagebericht 1871
Goldelse und Germania
Großmacht und Krise
Auswanderung nach Amerika
Ausgriff nach Afrika
Das Museum als Beutekammer
Die alte Gesellschaft
Die Junker
Auf dem Hofball
Im Adelssalon
Duell und Mensur
Was ist eine Pickelhaube?
Das neue deutsche Leben
Die Villa
Kurze Blicke in bürgerliche Salons
»Ein gutes Tier ist das Klavier«
Vom Alltag zu Hause
Ehe und Familie
Frühlings Erwachen, Max und Moritz, Struwwelpeter
Weihnachten
Zoo und Zirkus
Landpartie und Landflucht
Errungenschaften
Etwas vom Pferd erzählt
»Lebensgeschichte einer Lokomotive«
Telegraph und Telephon
Die Zeitung
Die Photographie
Kanalisation
Elektrifizierung
Industrienahrung: »Liebig’s Fleisch-Extract«, Maggis Würze und Knorrs Erbswurst, Margarine, Saccharin
Großbürger, Bildungsbürger, Kleinbürger
Bleichröder und das Geld
Krupp und die Kanonen
Büchmann und die Bildung
Ist Wissen Macht?
Leberecht Hühnchen und das kleine Glück
Zylinder und Mützen
Masse und Klasse
Große Fragen
Die Arbeiterfrage
Die soziale Frage
Die Wohnungsfrage
Die Dienstmädchenfrage
Die Frauenfrage
»Die Juden sind unser Unglück« oder Die ›Judenfrage‹
Große Männer
Menzel auf Stühlen
Marx war kein Marxist
Werner (von) Siemens
Verneigung vor Virchow
Wo sind die Frauen?
Erinnerung an eine ›Hyäne‹
Am Ende der Abstieg
Bildteil zum Buch
Anhang
Nachweise
Quellen- und Literaturverzeichnis
Zeitgenössisches
Sekundärliteratur
Bismarck über Bismarck
Bismarck über andere Leute, andere Leute über Bismarck
Bismarck-Kult und Bismarck-Kitsch
Dank …
Personenregister
Für Più
»Wir leben in der Zeit der materiellen Interessen.«
Otto von Bismarck
Einleitung Im Spiegelsaal der Geschichte
Ein Blitz zuckt durchs Halbdunkel. Sein Licht fällt auf das Gesicht eines schnauzbärtigen Mannes, der reglos im Bett liegt. Zwei Gestalten stehen für einen bizarren ›historischen Moment‹ vom Licht wie aus dem Morgengrauen geschnitten im Raum. Die eine schaut durch eine Kamera auf einem Stativ, die andere hält eine Magnesiumlampe in die Höhe. In eine Ecke gedrückt beobachtet der Totenwächter die Photographen. Er hat den beiden gegen Geld in den frühen Morgenstunden des 31. Juli 1898 ermöglicht, durch ein Fenster in das Sterbezimmer des Mannes zu steigen, der die preußische, deutsche und europäische Politik jahrzehntelang maßgeblich mitbestimmt, zeitweise dominiert hat. Sein Kopf wurde auf dem Kissen von den Photographen für das makabre Porträt zurechtgerückt. Ein übersehenes Nachtgeschirr, das nach dem Entwickeln des Bildes zum Vorschein kommt, wird retuschiert. Die Photographen machen es so ähnlich wie ihr Objekt: Bismarck war in seinen Memoiren notorisch unzuverlässig, die Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten, gewissermaßen die Nachtgeschirre des Geschehens, hat er bei dessen Verwandlung in Geschichte retuschiert. Das Photo wiederum wurde über Annoncen in Berliner Zeitungen zum Verkauf angeboten. In einem darauf folgenden Prozess verurteilte das Gericht die Photographen und den bestechlichen Totenwächter zu Gefängnisstrafen.
Otto Eduard Leopold von Bismarck kam am 1. April 1815 im altmärkischen Schönhausen zur Welt, gut anderthalb Monate vor der endgültigen Niederlage Napoleon Bonapartes am 18. Juni in der Schlacht bei Waterloo. Der Sieg der britischen und preußischen Armeen hatte die Festsetzung Napoleons als britischen Gefangenen auf St. Helena und den Zusammenbruch des Kaiserreichs zur Folge. Anstelle von Napoleon II., dem einzigen Sohn Bonapartes, ergriff ein Bourbone als König Ludwig XVIII. in Frankreich die Macht, dem als letzter Bourbone Karl X. folgte. Die Pariser Julirevolution von 1830 brachte Louis Philippe an die Macht – den ›Bürgerkönig‹, der seine Krone dem Parlament verdankte –, bis die Revolution von 1848 die Monarchie durch eine Republik ersetzte, der wiederum Charles-Louis Napoleon, ein Neffe Bonapartes, im Dezember 1851 mit einem Staatsstreich ein Ende machte. Ein Jahr später ließ er sich als Napoleon III. zum Kaiser der Franzosen ausrufen, mit Seitenblick in den Spiegel der Geschichte symbolbewusst am 2. Dezember, jenem Tag, an dem sich Napoleon Bonaparte 1804 selbst zum Kaiser gekrönt hatte.
Knapp neunzehn Jahre später, Anfang September 1870, geriet Napoleon III. nach der verlorenen Schlacht bei Sedan in preußische Gefangenschaft. In Paris wurde wieder eine Republik ausgerufen, nach 1789 und 1848 nunmehr die dritte, und der gestürzte Potentat wurde im Kasseler Schloss Wilhelmshöhe untergebracht, wiederum mit Seitenblick in den Spiegel der Geschichte. Denn während der Besetzung deutscher Länder durch französische Truppen von 1806 bis 1813 hieß die Wilhelmshöhe – benannt nach einem hessischen Landgrafen – zeitweise Napoleonshöhe und war Residenz des als ›König von Westphalen‹ installierten Jérome Bonaparte, Napoleons jüngstem Bruder.
Während sich der gestürzte und auf der Wilhelmshöhe festgesetzte Kaiser der Franzosen an einen Aufenthalt als kleiner Junge bei seinem Onkel auf der Napoleonshöhe zu erinnern suchte, wurde am 18. Januar im Schloss von Versailles der preußische König Wilhelm I. zum Kaiser ausgerufen, von Bismarck wieder mit Blick in den Spiegel der Geschichte arrangiert, denn am 18. Januar 1701 hatte sich der Kurfürst von Brandenburg in Königsberg als Friedrich I. zum König in Preußen gekrönt, und Wilhelm I. hatte mit seiner Selbstkrönung am 18. Oktober 1861 in Königsberg das von Volk und Verfassung unabhängige Gottesgnadentum seiner Herrscherwürde bekräftigt. Im Jahr darauf, am 8. Oktober 1862, ernannte er Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten, ohne vorhersehen zu können, dass ihm dieser Mann keine zehn Jahre später die Kaiserkrone aufdrängen würde.
Einen »Witz der Geschichte« nannte es Bismarck, dass die nach Versailles gereiste Delegation des Norddeutschen Reichstages von Eduard Simson angeführt wurde, der 1849 als Präsident der Frankfurter Nationalversammlung einer Deputation vorgestanden hatte, die Wilhelms Vorgänger Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserwürde antrug – die der gar nicht wollte: Preußische Herrscher pflegten ihre Kronen nicht von dahergelaufenen Parlamentariern zu empfangen, sondern von Gott und aus eigener Hand unter Zustimmung der deutschen Fürsten.
1870 war der ranghöchste dieser Fürsten König Ludwig II. von Bayern. Er bat den aus Preußenstolz widerstrebenden Wilhelm im Namen der übrigen Fürsten in einem Brief um die Annahme des Kaisertitels. Der eigentliche Verfasser des Briefes war Bismarck als Verfechter der kleindeutschen Lösung der deutschen Einheitsfrage unter Preußens Führung beim gleichzeitigen Ausschluss Österreichs. Die Rolle als Botenjunge des preußischen Ministerpräsidenten ließ sich der bau- und wagnersüchtige Bayernkönig im Wortsinn vergolden: mit 300000 Goldmark jährlich.
Was Bismarck bei seinem historischen Triumphmoment als ›Reichsgründer‹ im Spiegelsaal von Versailles am 18. Januar 1871 nicht vorhersehen konnte, war die Versammlung, die am 18. Januar 1919 die Beratungen über den Vertrag zur Beendigung des Ersten Weltkriegs aufnahm, der ein halbes Jahr später von der deutschen Delegation unter Protest unterschrieben und in der Weimarer Republik zum Racheanker des Revanchismus wurde.
Das zweite Deutsche Reich, nach lange verzögerter Einheit aus symbolischen Gründen überstürzt am 18. Januar 1871, noch vor der Beendigung des Krieges mit Frankreich, gegründet, währte recht kurz – knapp 48 Jahre, bis zur Novemberrevolution 1918. Das dritte, das ›Tausendjährige Reich‹, brach nach zwölf Jahren zusammen, die Hälfte davon Kriegsjahre – Jahre eines verlorenen Krieges, trotz der von Albert Speer zum Großen Stern umgesetzten Siegessäule[1], eingeweiht 1873 zum dritten Jahrestag des Sieges von Sedan, und trotz des in unmittelbarer Nähe aufgestellten Bismarck-Denkmals, das ursprünglich vor dem Reichstag stand, noch nach des Kanzlers Tod die Abgeordneten einschüchternd.
Während sein Standbild die Parlamentarier in Schach hielt, fuhr er selbst von Walküren eskortiert in den germanischen Götterhimmel auf wie ein Krieger der nordischen Sagenwelt, so jedenfalls stellt es ein zeitgenössisches Gemälde von Alexander Zick dar. Die Walküren hatten sich unter der musikalischen Leitung von Richard Wagner zu einer deutschen Männerphantasie ausgewachsen. Als 1876 im gerade fertiggestellten Bayreuther Festspielhaus der »Walkürenritt« in Wagners Oper ertönte, saßen Kaiser Wilhelm und Bismarcks Kaiserbote König Ludwig von Bayern im Publikum. Der ›Drive‹ dieser Musik, wie man heute sagen könnte, wurde später ein Mittel der Ästhetisierung des Krieges, vor allem des Angriffskrieges aus der Luft, sei es in propagandistischer (wie bei der Deutschen Wochenschau von 1941 über die Luftlandung auf Kreta) oder in kritischer Absicht (wie in Coppolas Kinofilm Apocalypse Now von 1979 beim Hubschrauberangriff auf ein vietnamesisches Dorf).
Die deutsche Mannsbesessenheit von den germanischen Heroinen ging so weit, dass die nationalsozialistischen Maßnahmen zur Niederschlagung eines Aufstands gegen das Regime als »Operation Walküre« zusammengefasst wurden. Die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 wiederum übernahmen die Bezeichnung für die eigenen Umsturzpläne mit dem Ziel einer vorläufigen Machtübernahme durch das Militär.
Keine zehn Monate nach dem gescheiterten Umsturz kapitulierte die Wehrmacht, und die drei Siegermächte – Frankreich, dessen Hauptstadt von Juni 1940 bis August 1944 von der Wehrmacht besetzt war, gehörte nicht dazu – teilten auf einer Konferenz in Potsdam, der Symbolstadt für preußischen Militarismus, das zerstörte Land und die ehemalige Hauptstadt Berlin in vier Zonen beziehungsweise Sektoren auf, aus denen 1949 die beiden deutschen Staaten hervorgingen.
In Ostberlin wurde das im Krieg teilweise ausgebrannte Stadtschloss der Hohenzollern abgebrochen, später an seiner Stelle der Palast der Republik errichtet, der nach dem Zusammenbruch der DDR seinerseits abgebrochen wurde. Inzwischen steht an dieser Stelle ein Museumsbau mit fingierter, höflicher gesagt: rekonstruierter Barockfassade, der faktisch an den Wilhelminismus erinnert, aber vorsichtig nach den Brüdern Humboldt benannt ist. In Westberlin wurde die 1895 am Vorabend des 25. Jahrestages des Sieges bei Sedan eingeweihte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als ausgebaute Ruine zur ›Gedächtniskirche‹ des Bombenkrieges.
Der Nimbus ›Bismarck‹ hat wie alle vorhergehenden Kriege auch diesen überlebt. In der zertrümmerten Gedächtniskirche schaut der ›Eiserne Kanzler‹ grimmig und schnauzbärtig aus der Hinterwand eines Reliefs und blickt uns über einen militärischen Kartentisch hinweg an, als wäre nichts geschehen: keine Weltkriege, keine europäischen Revolutionen, keine deutsche Teilung, keine Wiedervereinigung.
Den letzten großen Auftritt hatte Bismarck 1990 anlässlich des hundertsten Jahrestages seiner Entlassung als Kanzler. Hingegen wurde 2021 der 150. Jahrestag der Reichsgründung in Versailles mit größtmöglicher Zurückhaltung begangen. Die Würdigung von 1990 fand statt in dem 1877 bis 1881 nach Entwürfen von Martin Gropius errichteten Kunstgewerbemuseum, im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, von 1978 bis 1981 wieder aufgebaut und dann nach Martin Gropius benannt. Die dort installierte Ausstellung dauerte vom 26. August bis zum 25. November. Dazwischen wurde am 3. Oktober die ›Wiedervereinigung‹ gefeiert, staatsrechtlich der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
Mitunter erlaubt sich die Geschichte den Scherz, schneller zu sein als ihre Historiker. Als die Ausstellung über Bismarck, Gründerzeit und Kaiserreich Mitte der 1980er in die Planung ging, konnte niemand vorhersehen, dass es während ihrer Dauer zur deutschen Vereinigung kommen würde. Inzwischen ist die historische Beantwortung der ›deutschen Frage‹ selbst historisch geworden. Der Abstand zu den nationalen Ereignissen hat sich vergrößert und der europäische Horizont erweitert.
1889, hundert Jahre vor der ›Friedlichen Revolution‹ und dem Fall der Mauer, sagte Bismarck einem Abgesandten des amerikanischen Erfinders Thomas Edison zuliebe ein paar Sätze für eine Phonographenwalze, darunter ausgerechnet der Anfang der Marseillaise: »Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé.«
Mit diesem Buch über die Bismarckzeit ist die vierteilige Reise in die deutsche Geschichte vom 16. bis zum 19. Jahrhundert abgeschlossen. Wie die drei Vorgänger ist auch dieser Band strukturoffen angelegt. Die einzelnen Kapitel und deren Abschnitte bleiben verständlich, auch wenn sie nicht in der angebotenen Reihenfolge gelesen werden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass der innere Aufbau besser sichtbar wird und die vielen Geschichten innerhalb der Geschichte leichter nachzuvollziehen sind, wenn man der Darstellung kontinuierlich folgt.
Zentriert um die im Verlauf der deutschen Geschichte symbolisch maßlos erhöhten, zugleich auch be- und überlasteten Gestalten Luther, Bach, Goethe und Bismarck, wollen diese Zeitreisen mehr sein als touristische Ausflüge in die Vergangenheit, ohne sich deshalb zu überfliegerischen ›Gesamtdarstellungen‹ der Epochen zu erheben. Sie bleiben auf dem Boden der Tatsachen, vor allem denen des alltäglichen Lebens der Menschen. Wie viel sich daraus lernen lässt, sei dahingestellt. ›Historia‹ ist eine unberechenbare Lehrerin.
Am Anfang die Revolution
Extrablatt! Extrablatt! »Telegraphische Depesche. Paris, den 24. Februar 1 Uhr Nachmittags. Der Minister des Innern an den Präfekten des Niederrheins. Louis Philippe I. hat die Krone niedergelegt.« Die 1848 in den Berliner Straßen ausgerufene Sonderseite der Vossischen Zeitung kommentiert die Ereignisse mit Sorge: »Dem gegenwärtigen Zustand Frankreichs und Europas gegenüber erscheint diese Wendung der Dinge durch ihre Plötzlichkeit, Gewaltsamkeit und in dem jede Erwartung übersteigenden Maaß außerordentlicher, vielleicht auch folgenschwerer, als selbst die Julius-Revolution.« Die ›Julius-Revolution‹ 1830 hatte dem ›Bürgerkönig‹ die Krone aufgesetzt, die ihm jetzt die rebellierenden Pariser Arbeiter wieder herunterrissen.
Die Furcht des Berliner Bürgertums, der Berliner Behörden und des Berliner Hofes vor dem, was kommen sollte, wurde vergrößert durch die Erinnerung an das, was bereits geschehen war. Immerhin lag die Französische Revolution erst gut zwei Generationen zurück, und während der vergangenen Jahre hatte es ebenfalls Aufstände gegeben, die erahnen ließen, welche Gefahr der bürgerlichen Ordnung, dem bürgerlichen Besitz und der Monarchie drohte, wenn die Besitzlosen auf die Barrikaden gingen – oder auch nur die Kartoffelstände stürmten.
Im April 1847 hatten hungernde Berliner Arbeiterfrauen, die den halben Tageslohn ihrer Männer für eine Familienration Kartoffeln hergeben mussten, auf dem Molkenmarkt und dem Gendarmenmarkt die Stände der Händler umgestürzt und die herumkullernden Knollen in ihre Schürzen gerafft. Die dabeistehenden Marktpolizisten waren schlau genug gewesen, nicht einzugreifen, und retteten dadurch ihre Haut. Als es in den Folgetagen zu Plünderungen von Fleischer- und Bäckerläden durch arbeits-, wohnungs- und brotlose Stadtarme kam, jene Unterschicht der Unterschicht, die Marx und Engels als ›Lumpenproletariat‹ bezeichneten, wurde das Militär aus den Berliner Kasernen geholt und dem Rabatz ein Ende gemacht. Der Mob schmiss zwar dem Oberbefehlshaber, Prinz Wilhelm von Preußen, dem späteren königlichen und ab 1871 kaiserlichen Chef Bismarcks, die Fensterscheiben ein, aber auf die Straßen und Marktplätze kehrte die Ruhe und mit ihr die Geschäftigkeit des Alltages zurück.
Die plebejische Berliner Kartoffelrevolte, und sie war nur eine von über hundert lokalen Unruhen in den deutschen Gebieten seit 1840, signalisierte etwas sehr viel Gefährlicheres als das Hambacher Fest von 1832 mit seiner bildungsbürgerlichen Begeisterung in Schwarz-Rot-Gold oder als der verratene und missratene Studentensturm auf die Frankfurter Hauptwache ein knappes Jahr später. Der Plebejerrabatz in Berlin führte den Herren des Hofes und den Honoratioren der Stadt vor Augen, dass man Bajonette gegen die Hungernden braucht, wenn man keine Kartoffeln hat, um sie satt zu machen. Das war von den Behörden versäumt worden – erst kümmerte man sich nicht rechtzeitig um eine Notversorgung, dann war man zur Aufrechterhaltung der Ordnung nicht fähig. Und ebendies wurde später von Bismarck auf sozialpolitischer Ebene berücksichtigt – Minimalversorgung der ›arbeitenden Klasse‹ und Sozialistengesetz, obrigkeitsstaatlich gewährte Wohltätigkeit und obrigkeitsstaatlich erzwungenes Wohlverhalten.[2] »Revolution machen in Preußen nur die Könige«, sagte Bismarck gern, und solange er die Macht hatte, tat er alles, diesem Versprechen (nach oben) und dieser Drohung (nach unten) politisch und polizeilich Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig scheute er sich nicht, das liberale Bürgertum in Preußen mit der Erinnerung an aufrührerische Volksmassen zu erschrecken und die liberalen Parteien im Reichstag mit dem allgemeinen Wahlrecht[3] in Schach zu halten. Mit den deutschen Potentaten verfuhr er ähnlich: »Was wollen die kleinen Fürsten?« – »sie wollen vor allem auf ihren Thronen bleiben, fürchten sich wohl vor uns, aber noch mehr vor der Revolution.«
Nach dem Thronverzicht des ›Bürgerkönigs‹ eskalierte in Paris das Geschehen. Die telegraphisch übermittelten Berichte und die Verbreitung dieser Berichte durch die Extrablätter der Zeitungen ließen bei den einen die Sorge wachsen, bei den anderen den Mut: Schon wenige Tage nach Beginn der Pariser Erhebung kam es in den rheinländischen Gebieten zu Aufständen, im März folgten Bauernrevolten im Schwarzwald, im Odenwald, in Franken, Hessen, Thüringen und Sachsen, vereinzelt sogar in Mecklenburg. In den Industriebetrieben des Rheinlandes und in Sachsen kam es zur Demolierung von Maschinen, an Rhein und Donau griffen Fährleute Dampfschiffe an und die Fuhrleute von Nassau die Taunus-Eisenbahn.
Das alles waren Scharmützel, aber in Paris und Wien, in Dresden und Berlin ähnelten die Kämpfe eher dem Krieg, allerdings ohne dessen völkerrechtliche Einhegung. In einer Schrift für preußische Unteroffiziere verlangte Friedrich Gustav Graf von Waldersee, Kommandeur der preußischen Einheiten, die den Aufstand in Dresden niederschlugen: »Jeder in einem eroberten Hause oder auf einer Barrikade mit den Waffen in der Hand betroffene Empörer […] ist auf der Stelle niederzumachen. Es dürfen hier nämlich nicht die Rücksichten eintreten, welche in einem ehrlichen Kampfe […] gegen geregelte Truppen einer mit uns im offenen Kriege begriffenen Macht von der Menschlichkeit, dem Großmuth und dem Völkerrechte geboten werden.«
Das Niederwerfen der Revolution in Paris im Juni kostete schätzungsweise 1500 Soldaten und etwa 5000 Aufständische das Leben. In Wien – der Hof war nach Innsbruck geflohen – kamen im Oktober 1848 etwa 1000 Menschen bei Einsätzen vor allem tschechischer und kroatischer Truppen um. Im sächsischen Dresden – der Hof war auf die Festung Königstein geflohen – beschossen preußische Truppen im Mai 1849 die Barrikaden mit Artillerie, es gab 250 Tote. Zur Entmachtung der aufständischen Armee in Baden marschierte Prinz Wilhelm, dem man während der Kartoffelrevolte die Scheiben eingeschmissen hatte, mit 54000 Soldaten ins Großherzogtum. Auf die Niederlage der revolutionären Truppen und die Kapitulation der Festung Rastatt folgte eine Serie von Exekutionen. Die aufständischen Soldaten erlitten ebenjenes Schicksal, das sie in einer ihrer Petitionen beklagt hatten: »Mit Wehmuth und tiefer Entrüstung blicken wir auf die entsetzlichen Vorgänge in Paris, Wien und Berlin, wo königliche Unmenschlichkeit den Soldaten zum Würger seiner Brüder und Väter herabwürdigte.«
Zu diesem Zeitpunkt war die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt, wie die Preußische Nationalversammlung in Berlin im Mai 1848 gewählt, bereits aufgelöst. Das im März 1849 noch verabschiedete Grundgesetz blieb wirkungslos, und wirkungslos bis zur Novemberrevolution 1918 blieben die darin erklärten »Grundrechte des deutschen Volkes«, darunter § 137: »Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Alle Titel, insoweit sie nicht mit einem Amte verbunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie wieder eingeführt werden.« Es wurden keine Titel aufgehoben, sondern weitere eingeführt, und Bismarck setzte fortan aus Protest gegen den Frankfurter Verfassungsversuch das v. vor seinen Namen, das er bis dahin aus Nonchalance weggelassen hatte.
Die Preußische Nationalversammlung war schon am 15. November des Vorjahres vom Militär aufgelöst worden. Im Juni noch hatten Arbeiter und Tagelöhner das Berliner Zeughaus gestürmt, diesmal nicht, um an Kartoffeln, sondern um an Waffen zu kommen. Aber am 10. November besetzte General Wrangel mit 13000 Soldaten die Stadt, rief zwei Tage später den Belagerungszustand aus und machte den Unruhen, die im März begonnen hatten, ein Ende.
Für den König, für den Adel, für das Besitzbürgertum und auch für Bismarck hatten die Märzereignisse eine besondere Bedeutung als Symbol und zugleich als Lehrstück des Straßenkampfs um die Macht. Man kann einzelne Rabatzmacher erschießen oder ein Dutzend oder ein paar Hundert, aber nicht ein ganzes Volk; man kann Rädelsführer aus der Menge fischen und füsilieren, aber nicht das ganze Volk; man kann über Leichen gehen, aber wehe, wenn das Volk zur Duldung nicht länger bereit ist und wenn die Gefahr besteht, dass die einfachen Soldaten ihre Gewehre nicht mehr auf die Menge, sondern auf ihre Offiziere richten. Alfred Heinrich Graf von Waldersee, hoher preußischer Militär mit Präventivkriegsinstinkt nach innen und außen, schrieb noch 1877 an Generalfeldmarschall Edwin von Manteuffel, der 1848 königlicher Adjutant gewesen war, »wir brauchen bald eine Armee, klein und gut bezahlt, die ohne Bedenken, sobald es verlangt wird, die Kanaille zusammenschießt.« Und Wilhelm II. verlangte im November 1891 von frisch vereidigten Rekruten: »Ihr habt Mir Treue geschworen […], ihr habt euch Mir mit Leib und Seele ergeben […]. Bei den jetzigen socialistischen Umtrieben kann es vorkommen, daß Ich euch befehle, eure eigenen Verwandten, Brüder, ja Eltern niederzuschießen – was ja Gott verhüten möge –, aber auch dann müßt ihr Meine Befehle ohne Murren befolgen«. Solche Sätze können noch heute den Wunsch provozieren, die revolutionären Soldaten hätten im November 1918 den Kaiser vor die Gewehrläufe bekommen.
Bei den Berliner Barrikadenkämpfen im März 1848 und während der Auseinandersetzungen in den folgenden Wochen kamen etwa 300 Aufständische und 50 Soldaten ums Leben. Wie oft in historischen Schlüsselmomenten, etwa beim Sturm auf die Bastille 1789, führte auch diesmal ein Zufall in die Eskalation, die – nun anders als 1789 – durch Umsicht, Glück und Härte auf Seiten der Machthaber wieder eingedämmt werden konnte. Nachdem in eine vor dem König auf dem Schlossplatz demonstrierende Menge hineingeschossen worden war, befahl Friedrich Wilhelm IV. gegen den Widerstand seiner Generäle den (einstweiligen) Rückzug des Militärs aus der Stadt, zog vor den aufgebahrten Leichnamen den Hut und ritt mit schwarz-rot-goldener Armbinde durch die Straßen. Er spürte: Man muss das Volk beruhigen, man darf jetzt nicht den Kopf verlieren, sonst verliert man ihn unter der Guillotine. Sie drohte noch in Ferdinand Freiligraths Fluchgedicht Die Todten an die Lebenden: »Die Kugel mitten in der Brust, die Stirne breit gespalten, / So habt ihr uns auf blut’gem Brett hoch in die Luft gehalten! / Hoch in die Luft mit wildem Schrei, daß unsre Schmerzgeberde / Dem, der zu tödten uns befahl, ein Fluch auf ewig werde! / Daß er sie sehe Tag und Nacht, im Wachen und im Traume – / Im Oeffnen seines Bibelbuchs wie im Champagnerschaume! / […] Mög’ er das Haupt nun auf ein Bett, wie andre Leute pflegen, / Mög’ er es auf ein Blutgerüst zum letzten Athmen legen!«
Ebendies wusste Friedrich Wilhelm zu vermeiden. Auf die wenigen, aber wirksamen Augenblicke der Ehrenbezeugung für die ›Märzgefallenen‹ folgte eine Gegenrevolution von jahrzehntelanger Dauer. Zum wendigen Kopf dieser Gegenrevolution wurde der kalte Machtpolitiker Bismarck. Doch selbst er hatte ein Herz im Leib und in diesem Herzen Liebe und Hass. Nach einem Besuch der Gräber der Barrikadentoten in Berlin Friedrichshain im Herbst 1849 wandte er sich in einem Brief an Johanna von Puttkamer, mit der er seit gut einem halben Jahr verheiratet war: »Gute Nacht, mein geliebtes Herz, mögen Dich Gottes Engel schützen, und bete für mich, daß ich Ihm treu bleibe, ich werde hier so weltlich und so zornig, wenn Du nicht bei mir bist. Gestern war ich im Friedrichshain, und nicht einmal den Toten konnte ich vergeben, mein Herz war voll Bitterkeit über den Götzendienst mit den Gräbern dieser Verbrecher«. Diesen ›Götzendienst‹ erwähnt auch ein anonymer Zeitschriftenartikel und berichtet von dem Platz, »dessen heilige Erde unsere theuren Brüder bedeckt, die im heiligen Kampfe für die Freiheit am 18–19 März ihr Blut dahin gaben. Nicht wenig überrascht war ich, als ich diese Stätte betrat, und Hunderte von Besuchern aus allen Ständen die Reihen der seither mit den schönsten Blumen und Grabdenkmälern geschmückten Gräber durchwandeln sah.«
Verbrecher für die einen, Helden für die anderen – der Kampf um die Toten wurde von den Lebenden jahrzehntelang fortgesetzt. 1856 sperrten die Behörden den Friedhof, mussten ihn jedoch wegen der Proteste aus der Bevölkerung 1861 wieder freigeben. Noch 1898, ein halbes Jahrhundert nach den Ereignissen, wurde behördlicherseits die Errichtung eines Denkmals für die ›Märzgefallenen‹ verhindert. Der sozialdemokratische Vorwärts erklärte daraufhin: »Man lasse doch den gefallenen Proletariern des Friedrichshains ihren epheuübersponnenen, verwilderten, proletarischen Friedhof. Daran erkennen wir ja um so deutlicher, daß es unsere Todten sind, die hier ruhen.« Tatsächlich handelte es sich bei den über zweihundert dokumentierten Toten mit wenigen Ausnahmen (wie dem jungen Verwaltungsreferendar und Landwehroffizier Gustav von Lenski) um Männer und Frauen (wie die junge Handarbeiterin Wilhelmine Lange) aus den niederen Schichten, darunter, vielleicht wegen des Barrikadenbaus, auffallend viele Tischler und Zimmerleute. Der jüngste dieser ›Verbrecher‹, die den Junker-Hass über den Tod hinaus entfachten, war der elfjährige Carl Ludwig Kühn, Sohn eines Tagelöhners.
Während Bismarck 1848 im gärenden Berlin an den Gründungstreffen für die Neue Preußische Zeitung teilnahm, als Kreuzzeitung bald ein publizistisches Flaggschiff reaktionärer Standespolitik[4], reanimierte der gerade aus Belgien ausgewiesene Karl Marx[5] in Köln zusammen mit Friedrich Engels, Ferdinand Freiligrath und anderen die Neue Rheinische Zeitung als »Organ der Demokratie«. Das Tagesblatt war die Nachfolgerin der fünf Jahre zuvor verbotenen Rheinischen Zeitung und stellte im Mai 1849 mit einer rot gedruckten Ausgabe das Erscheinen wieder ein. Marx ging über Paris nach London ins Exil. Im Dezember 1848 hatte er über »die preußische Bourgeoisie nach der Märzrevolution« geschrieben, sie sei »ohne Glauben an sich selbst, ohne Glauben an das Volk, knurrend gegen oben, zitternd gegen unten, egoistisch nach beiden Seiten und sich ihres Egoismus bewußt, revolutionär gegen die Konservativen, konservativ gegen die Revolutionäre«. Vier Jahrzehnte nach den Ereignissen bekräftigte Friedrich Engels diese Einschätzung: »Die Revolution von 1848 war […] auf Befriedigung ebensosehr der nationalen wie der freiheitlichen Forderungen gerichtet. Aber hinter der im ersten Anlauf siegreichen Bourgeoisie erhob sich […] schon die drohende Gestalt des Proletariats, das den Sieg in Wirklichkeit erkämpft hatte, und trieb die Bourgeoisie in die Arme der eben besiegten Gegner – der monarchischen, bürokratischen, halbfeudalen und militärischen Reaktion, der die Revolution 1849 erlag.«
Als das Manifest der Kommunistischen Partei herauskam, schien dieser Ausgang noch offen zu sein, und Marx konnte Deutschland als Land des großen Umsturzes identifizieren: »Auf Deutschland richten die Kommunisten ihre Hauptaufmerksamkeit, weil Deutschland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution steht und weil es diese Umwälzung unter fortgeschritteneren Bedingungen der europäischen Zivilisation überhaupt, und mit einem viel weiter entwickelten Proletariat vollbringt als England im siebenzehnten [mit der ›Glorreichen Revolution‹] und Frankreich im achtzehnten Jahrhundert, die deutsche bürgerliche Revolution also nur das unmittelbare Vorspiel einer proletarischen Revolution sein kann.«
Die proletarische Revolution, oder der Ansatz dazu, fand dann jedoch nicht in Deutschland, sondern wiederum in Frankreich statt: die Pariser Kommune von März bis Mai 1871. Und diesmal machte Bismarck mit der neuen Regierung des besiegten Landes gemeinsame Sache, um den Aufstand niederzuschlagen. Dagegen sagte August Bebel öffentlich eine Erhebung in ganz anderen, europäischen Dimensionen vorher. In Aus meinem Leben fasste er später seine Rede in der ersten »Session des Deutschen Reichstages« zusammen: Werde »von deutscher Seite die Kommune bekämpft, so wolle ich meinerseits erklären, daß das europäische Proletariat hoffnungsvoll auf Paris sehe. Der Kampf in Paris sei nur ein kleines Vorpostengefecht, und ehe wenige Jahrzehnte ins Land gegangen seien, werde der Schlachtruf des Pariser Proletariats, ›Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggang‹, der Schlachtruf des europäischen Proletariats sein.« Die Parlamentarier waren allesamt entsetzt, von der erzreaktionären Junkerfraktion über die gemäßigten Liberalen bis zu den Fortschrittlichen. Sie alle hatten gute politische und noch bessere persönliche Gründe, den Aufstand der Besitzlosen zu fürchten. Eine organisierte Revolution mit disziplinierten Arbeiterverbänden als Rückgrat und Führern wie Bebel an der Spitze würde nicht nur Kartoffelstände umstürzen, sondern den ganzen Staat.
Dies galt es um jeden Preis zu verhindern: Lieber unter der politischen Halbfreiheit des Bismarck-Regimes weiter Geschäfte machen als sich dem Willen der ›arbeitenden Classen‹ unterwerfen. Bismarck wusste das und wusste es zu nutzen – nach allen Seiten hin: »Ich mußte mit Betrübniß und Befremden hören, daß die Wahlreden […], die Preßerzeugnisse, die auf die Wahlen hinwirkten, gerade an die Leidenschaft der unteren Classen, der Masse, appellirten, um sie zu erregen gegen die Regierung«. Diese Reichstagsrede im Januar 1872 richtete sich nicht etwa gegen die Sozialdemokraten, sondern gegen die konservativ-antipreußische katholische Zentrumspartei, die vor allem in Süddeutschland von vielen aus den ›unteren Classen‹ gewählt wurde. Der ›Kulturkampf‹ gegen die Katholischen und die Kirche (1871–1878) wurde mit Unterstützung der bürgerlich-liberalen Abgeordneten geführt, ebenso wie das zeitlich anschließende »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« (1878–1890) mit Zustimmung der meisten dieser Parlamentarier verabschiedet und verlängert wurde. Das Zentrum konnte sich schließlich mit Bismarck arrangieren, auch deshalb, weil er es für das ›Sozialistengesetz‹ brauchte[6].
Besuch in der neuen Hauptstadt
Die Berliner Mauer fiel 1867. In diesem Jahr begann der bis zur Reichsgründung beendete Abriss der alten Zoll- und Akzisemauer, die zwischen den Toren um die wachsende Stadt verlief: Brandenburger Tor, Oranienburger, Hamburger, Rosenthaler, Schönhauser, Prenzlauer, Landsberger, Frankfurter, Stralauer, Schlesisches, Köpenicker, Cottbuser, Hallesches, Anhaltisches und Potsdamer Tor. Fehlen noch das Neue Tor, das Königs-Tor und das Wasser-Tor. »Das Potsdamer Thor bildet den Uebergang von der Aristokratie zur reichen Bourgeoisie«, schrieb Robert Springer in Berlin wird Weltstadt: »An der Ecke der Wilhelmstraße endet das Quartier der Paläste mit den monotonen Fronten und hohen Rampen; es beginnt die Leipziger Straße, eine der lebhaftesten und glänzendsten der Residenz. Durch den angrenzenden Thiergarten und die Potsdamer Eisenbahn wird dieses Thor die Hauptpforte für das Vergnügen und den Reiseverkehr.«
Wir kommen im Frühsommer 1876 am Potsdamer Bahnhof an, ein Kopfbahnhof wie auch die anderen rund um die Stadt. Entstanden schon 1838, erhielt er ein Jahr nach der Reichsgründung ein neues Gebäude. Es stellt den Reisenden ihren Fahrkarten entsprechend drei Wartesäle zur Verfügung, der unterste mit rohen Holzbänken, der für die erste Klasse mit Plüschsofas ausgestattet. Bei den Fahrkarten gibt es noch eine vierte Klasse. Sie berechtigen nur zum Aufenthalt in Waggons, die neben einigen Sitzplätzen entlang der Seitenwände hauptsächlich Stehplätze bieten. Immerhin haben auch diese Waggons inzwischen Dächer.
Bei unserer Ankunft hat die wirtschaftliche Krise nach dem Gründerkrach von 1873 ihren Höhepunkt erreicht. Nach der Party herrscht Katerstimmung. Zum Glück liegt wenigstens die letzte Typhus-Epidemie inzwischen vier Jahre zurück. An ihr starben in Preußen mehr Menschen, als im Krieg gegen Frankreich auf deutscher Seite gefallen sind. Die letzte Pocken-Epidemie mit 5212 Toten allein in Berlin ist fünf und die letzte Cholera-Epidemie mit 6174 Toten zehn Jahre her. Dennoch überstehen von den Neugeborenen nur ein Drittel der Mädchen und nur ein Viertel der Jungen das erste Lebensjahr. Auch die Tuberkulose grassiert, vor allem in den ärmeren Schichten. Robert Kochs Entdeckung des Erregers steht noch bevor.
Obwohl wir wissen, was die Zeitgenossen noch nicht wissen konnten, versuchen wir wie die anderen Reisenden, die mit uns am Bahnhof ankommen, einstweilen über all das hinwegzusehen, trotz der miserablen hygienischen Zustände in der Stadt. Das Wasser kommt noch immer aus den Brunnen. Es gibt nur ein einziges Wasserwerk, das zweite wird erst im Folgejahr in Tegel in Betrieb gehen. Die Abwässer laufen in Gruben oder in die Rinnsteine, auch die der lächerlichen 16000 Wasserklosetts in den besseren Wohnungen. Der Bau der Kanalisation ist zwar schon seit 1873 beschlossen, kommt aber nur langsam voran[7]. Es ist noch immer so wie vor zehn Jahren von dem vielgereisten Hans Wachenhusen beschrieben: Berlin sei »die einzige europäische Großstadt, in welcher wir tagtäglich an den Ufern stinkender Rinnsteine wandeln.«
Dafür ist die Stadtrohrpost gerade in Betrieb gegangen, deren Röhrennetz im Lauf der Jahre auf vierhundert Kilometer anwächst. Der Müll wird von Straßenkehrern und Spritzenmännern beseitigt, die Tag und Nacht in 83 sogenannten ›Kehrbezirken‹ unterwegs sind.
Wir sehen zu, dass wir den Bahnhof schnell verlassen. Kurz vor der Ankunft haben wir im brandneuen Kiessling’s Berliner Baedeker mit einschärfenden Fettdrucken gelesen: »Die erste Sorge nach Verlassen des Coupé’s sei die Beschaffung einer Droschke, da die Fuhrwerke, namentlich bei der Ankunft stark besetzter Eisenbahnzüge, leicht vergriffen sind. Ein am Ausgange des Bahnhof-Perrons stationirter Schutzmann giebt Blechmarken aus, die mit der Nummer bereitstehender Droschken erster (theurer) oder zweiter (billiger) Klasse versehen sind.« An den Wagenkästen sind die Nummern in schwarzer Farbe in weiße Felder gemalt.
In Berlin rattern rund 4300 Droschken über das Pflaster, trotzdem ergattern wir nur eine zweiter Klasse, oder ›zweiter Güte‹, wie man hier auch sagt. Von den erstklassigen gibt es keine dreihundert. Vielleicht hätten wir auf der vorletzten Station vom Angebot der telegraphischen Bestellung eines Fahrzeugs Gebrauch machen sollen. Das würde jedoch eine Mark in der neuen Reichswährung gekostet haben, immerhin ein Drittel von dem, was wir für die Übernachtung in einem der billigeren Zimmer des vornehmen Hotel Royal bezahlen, oder etwa dem Tagesverdienst eines Handlangers entsprechend.
Aus Sparsamkeit, die Gepäckträger dürften es wohl Geiz nennen, haben wir auch den kleinen Handkoffer (darin zwischen frischer Wäsche Kiessling’s Baedeker, Springers Berlin wird Weltstadt und das Berliner Adreß-Buch für das Jahr 1876) gegen die Dienstleute am Bahnsteig verteidigt. Die Kolporteure, die sich auf den Bahnsteigen oder draußen zwischen den Droschken herumdrücken und die neuesten Fortsetzungsromane im Heftchenformat anpreisen, konzentrieren sich ohnehin auf die Abreisenden. Die Bahnhöfe sind nicht ihr einziges Beutegebiet. An den Samstagabenden, wenn die Arbeiter, Dienstboten und Nähmädchen ihren Wochenlohn erhalten haben, steigen sie die Hintertreppen empor und klingeln an den Wohnungstüren, um die Groschenromane anzubieten. Wenn ihnen nicht geöffnet wird, schieben sie farbige Zettel mit Ankündigungen der neuesten Werke unter den Türschlitzen durch. An den Bahnsteigen und auf dem Bahnhofsvorplatz verhökern sie ähnliche Ware, dünn in bunten Umschlägen, rasch und leicht zu lesen, ›Eisenbahnliteratur‹, wie man sagt.
Die Droschke ist klapprig, das Pferd müde und der Kutscher achtlos. Während der Fahrt schrammen in den Kurven oder beim Ausweichen immer wieder die Hinterräder an den Prellsteinen entlang. Was ist aber auch nicht alles unterwegs: langsame Droschken, schnelle Karossen, vornehme Equipagen, Pferdeomnibusse, Postwagen, Heuwagen, Wagen mit Baumaterial, Kastenwagen mit Müll, riesige Bierwagen mit quergelegten Fässern auf langen Balken, Wagen mit als Scheuermittel verkauftem weißem Sand von den Weddinger Rehbergen[8], Sprengwagen mit Wasser gegen den ewigen Berliner Staub, schwerfällige Rollwagen auf dem Weg zu den Verladestationen der Spreehäfen und Bahnhöfe, Möbelwagen mit dem Hausrat umziehender Kleinbürger, dazwischen von Frauen geschobene Gemüse- und von Hunden gezogene Milchkarren (Bolle ist mit seinen Lieferwagen erst ab 1881 im Geschäft). Nur Fahrräder sind noch keine zu sehen. Mit dem gerade entwickelten Ariel-Hochrad von 1874 wagt sich niemand in den Stadtverkehr, und die sogenannten ›Sicherheitsniederräder‹ kommen erst ab Mitte der 1880er auf.
Wehe, wenn man zur Hauptverkehrszeit eine Hauptverkehrsstraße überqueren muss. In der Volks-Zeitung steht die Klage zu lesen: »Die Gefahr, überfahren zu werden, ist an den Knotenpunkten unserer Straßen bei dem überaus lebhaften Wagenverkehr keine geringe mehr. So sehen wir häufig Frauen, welche Kinder an der Hand führen, unter Zittern und Zagen sich durch die schnell fahrenden Droschken und Rollwagen winden, welche über den Potsdamer Platz kommen. Fünf Straßen münden auf diesen verhältnismäßig sehr kleinen Platz aus, und das Wagengerassel ist hier ein vollkommen betäubendes.«
Wehe, wenn wegen der zahlreichen Pferdeäpfel, mit deren Abräumen man nicht hinterherkommt, wieder eines der Zugtiere gestürzt ist. Was ist schneller als ein Gedanke, fragt der Berliner Witz und antwortet: Ein Droschkengaul, du denkst, er fällt – da liegt er schon. Ab 1880 werden als ›Asphaltburschen‹ bezeichnete junge, wendige Männer angeheuert, die im Verkehr herumwuseln, um den Pferdemist einzusammeln.
Wehe, wenn von zwei Kutschern einer sturer als der andere ist und keiner weichen will oder wenn einer der überladenen Möbelwagen mit gebrochener Achse liegen bleibt und die Straße verstopft. Die Kinder stehen weinend herum, die Mutter sammelt herumkullernde Blechtöpfe auf, der Vater schreit auf den Kutscher ein. Dann können auch die Schutzleute mit ihren Pickelhauben nichts weiter tun, als würdevoll und wohlbeleibt dem Chaos standzuhalten.
Trotz allem kommen wir ans Ziel: Hotel Royal, Unter den Linden/Ecke Wilhelmstraße. Dort haben wir, ermutigt vom Verlagsvorschuss für diese Zeitreise, ein Zimmer gebucht. Zehn Jahre vor unserer Ankunft, im Mai 1866, war in diesem Hotel Ferdinand Cohen-Blind abgestiegen, um Unter den Linden dem Reichskanzler aufzulauern. Er feuerte mehrere Pistolenschüsse ab, die Bismarck aber nur leicht verletzten. Der Attentäter schnitt sich in der Haft die Halsschlagader auf und verblutete.
Die deutsche Geschichte hätte vermutlich einen anderen Verlauf genommen, wäre der Anschlag nicht gescheitert. Wir betreten das Hotel mit etwas plümerantem historischem Gefühl. Im Unterschied zu Cohen-Blind und Bismarck wissen wir, was nach dieser Geschichte aus der deutschen Geschichte geworden ist.
An der den Linden zugewandten Fassade des dreistöckigen Baus steht KÖNIGS HOF. Er ist nicht ganz so prunkvoll (und teuer) wie das Grandhotel Kaiserhof am Wilhelmplatz, das allerdings im Oktober des Vorjahres kurz nach seiner Einweihung gebrannt hat und erst 1878 wiedereröffnet wird[9]. Es ist auch nicht so mondän wie das erst 1880 am Bahnhof Friedrichstraße eröffnende Central-Hotel, in dessen mit einem Glasdach überwölbtem Innenhof ab 1886 das Varieté Wintergarten mit sensationellen Revuen sensationelle Erfolge feiert. Und es ist nicht so hypermodern ausgestattet, wie es das 1885 eröffnende Hotel Continental mit seinen elektrisch beleuchteten Zimmern sein wird. Arthur Schnitzler, der 1888 hier nächtigt, erinnert sich daran noch viele Jahre später: »In Berlin angelangt, stieg ich in dem […] Hotel Continental ab, wo ich zum erstenmal ein Zimmer mit elektrischer Beleuchtung bewohnte, die nicht nur für mich, sondern für die gesamte mitteleuropäische Menschheit im Jahre 88 noch etwas ziemlich Neues bedeutete.«
Das Hotel Royal ist ebenfalls weder drittklassig noch provinziell, dafür mustert uns der Portier zu erstrangig, als wir aus der zweitklassigen Droschke steigen, nur das kleine Köfferchen in der Hand. Er macht keine Anstalten, es uns abzunehmen.
Vom Royal ließ sich Wilhelm angeblich eine Wanne ins Schloss bringen, wenn er baden wollte. Aber das gehört zu den Gerüchten, die in großen Städten umlaufen, in denen viele Leute auf kleinem Raum zusammenhocken. Der schriftstellernde Arzt Isidor Kastan, der in den 1870ern in der Reichshauptstadt praktizierte, hat es in seinen Erinnerungen Berlin, wie es war sogar im Jahr 1919 noch einmal aufgewärmt.
Unser Zimmer im Royal hat keine Wanne. Ohnehin wäre es besser, wenn man darin einen dieser »Bade-Apparate« aufgestellt hätte, die dann in der Gewerbeausstellung von 1879 beworben werden, mit »bis zu 5 Brausen für Kopf, Brust, Bauch, Unterleib und Rücken; letztere verstellbar.« Und besonders wichtig: »Keine Wasserleitung erforderlich.«
In Berlin, nach der Volkszählung vom Dezember 1875 gerade dabei, die erste Millionenstadt der deutschen Geschichte zu werden, ist scheinbar alles neu: Kiesslings Reiseführer, der Bade-Apparat, die Villen-, Verwaltungs-, Rathaus- und Kirchenbauten in den Neo-Stilen (Neo-Romanik, Neo-Gotik, Neo-Renaissance, Neo-Barock, Neo-Klassizismus), das Reich, die Reichsmark, der Kaiser, der Kaiserhof, die Kaiserpassage und die an Kaisers Geburtstag 1876 eingeweihte Nationalgalerie. Die Reichsmark hat erst zu Beginn des Vorjahres den Taler abgelöst. Der Berliner Börsen-Courier schrieb am 1. Januar 1875: »Die ›Mark‹ ist ein Parvenü von eines Parlamentsbeschlusses Gnaden, ein Neuling, von dem man vor Jahren noch keine Ahnung hatte. Doch – die Welt liebt das Neue«.
Nur die Zeit selbst ist noch die alte. Bis zum Inkrafttreten des »Gesetzes betreffend die Einführung einer einheitlichen Zeitbestimmung« am 1. April 1893, mit dem die ›mitteleuropäische Zeit‹ gültig werden wird, gab es im Reichsgebiet zwanzig verschiedene Ortszeiten. Die Uhr am Potsdamer Bahnhof zeigte bei unserer Ankunft die »Berliner Zeit«.
Ganz neu wiederum ist die erst kürzlich eröffnete Rollschuhbahn in der Hasenheide[10], außerhalb der Stadt im Landkreis Teltow gelegen und mit Schießständen der Armee ausgestattet. Auch zum rituellen Totschießen[11], das trotz des staatlichen Duellverbots weiter – wie soll man sagen: gepflegt wird, gehen ehrsüchtige Herren gern in die Hasenheide. Die Rollschuhbahn ist nicht frei zugänglich. Dort drehen höhere Kreise ihre Runden, sogar Angehörige der Hohenzollernfamilie sollen dem ›Rollsport-Club‹ beigetreten sein. Derweil projektiert am noch nicht fertiggestellten Anhalter Bahnhof eine englische Aktiengesellschaft den ›Central-Skating-Rink‹. Für den Hauptsaal sind Kronleuchter vorgesehen, drumherum wird es Billardsäle, Rauchsalons, ein Restaurant und eine Konditorei geben, wo man wie in allen Berliner Konditoreien kostenlos Zeitung lesen kann – wenn man genug Geld hat, Kaffee und Kuchen zu bezahlen. Der ›Skating-Rink‹ wird sich übrigens nicht halten. Nach einem Umbau wird daraus 1888 das Konzerthaus der Berliner Philharmoniker[12].
Die 1873 zwischen Friedrichstraße und Unter den Linden eingeweihte Kaiserpassage besteht länger[13]. Sie hat, wie so vieles in Berlin, etwas vom Triumphalismus des Emporkömmlings. Nachdem man erst den österreichischen und dann den französischen Feind besiegt hatte und selbst Hauptstadt geworden war, musste eine dieser Passagen her, die in Wien und Paris im Gaslicht ›absoluter Modernität‹ erstrahlten[14]. Sie wurde »im reinsten Renaissance-Styl 1871–73 vom Actien-Bau-Verein ›Passage‹ erbaut«, wie Kiessling erklärt: »50 elegante Geschäftsmagazine«, ein Panoptikum, »ein grossartiges Wiener Café nehmen die Parterre-Localitäten ein, während in den oberen Geschossen ein grosser, schöner Concertsaal, sowie elegante Wein- und Bier-Restaurants eingerichtet sind.«
Die Passage ist eine Attraktion, die Leute strömen hindurch, von der Friedrichstraße zu den Linden, von den Linden zur Friedrichstraße. Etwa in der Mitte, wo der 130 Meter lange Durchgang einen Knick zur Seite macht, legen sie die Köpfe in den Nacken und schauen beeindruckt zur Kuppel empor. Die Passanten schauen und strömen und strömen und schauen, aber sie kaufen nicht, jedenfalls nicht genug. Einige der fünfzig ›eleganten Geschäftsmagazine‹ stehen schon wieder leer. Allein von den 68 Millionären, die Berlin derzeit aufzuweisen hat, können die Inhaber der Läden nicht leben. Dabei ist die Passage letztlich ein »bloßes Gäßchen«, wie Theodor Fontane im August 1875 aus Mailand schreibt, wo sich ihr architektonisches Vorbild befindet. »O Berlin, wie weit ab bist Du von einer wirklichen Hauptstadt des Deutschen Reiches! Du bist durch politische Verhältnisse über Nacht dazu geworden, aber nicht durch Dich selbst.«
Vieles ist in Berlin im Werden. Die Ringbahn zur Verbindung der Kopfbahnhöfe steht kurz vor der Vollendung, der repräsentative Anhalter Bahnhof ist noch im Bau. Desgleichen das Kunstgewerbemuseum[15], während über den Neubau des Reichstags im Parlament immer noch gestritten wird. Das erste städtische Krankenhaus indessen wurde 1874 eingeweiht. Auch Parks entstehen seit 1876, der Plänterwald zum Beispiel und der Treptower Park. Der Volkspark Humboldthain im Arbeiterbezirk Wedding wurde schon 1872 eingeweiht, wie die beiden anderen Parks entworfen von Gustav Meyer, dem Direktor des 1870 installierten Gartenamts. Die Volksparks werden zu den ›grünen Lungen‹ in der ›Steinwüste‹, zu der sich die Stadt nach Meinung besorgter Beobachter auswächst, seit 1874 im Wedding die erste ›Mietskaserne‹ im modernen Sinn errichtet wurde[16].
Bei all dem Neuen in Berlin hat doch manches Alte Bestand, jedenfalls vorläufig. Auf dem Prenzlauer Berg stehen immer noch Bockwindmühlen, und die Schönhauser Allee ist wirklich eine. Die Bebauung mit Mietshäusern erfolgt ab Ende der 1870er. Immerhin gibt es schon das recht wuchtige »Ausschanklokal der Brauerei Julius Boetzow«, wie das Etablissement auf einer Photopostkarte von 1865 bezeichnet wird.
Wilmersdorf dagegen liegt jotwede im Grünen, aber doch nah genug an der Stadt, damit dort leicht erreichbare Wochenendhäuser und später Vorortvillen errichtet werden können. Am See – er wird 1899 zugeschüttet – befindet sich eine Badeanstalt. Das Dorf hat keine zweitausend Einwohner. Viele der Alteingesessenen sind vermögend, weil sie ihr Bauernland an Bodenspekulanten und Investoren verkauft haben – für so viel Geld, dass die Berliner sie mit neidischem Spott als ›Millionenbauern‹ titulieren.
Zum Neuen und Alten kommt gegen Ende der 1870er etwas sehr Altes: schätzungsweise 150 Millionen Jahre alt, eine Zahl, bei der es gleichgültig ist, ob von der Jetzt- oder der Gründerzeit aus gerechnet wird. Es handelt sich um einen schrägen Vogel aus Stein, vom bayerischen Finder, weniger geschäftstüchtig als die Berliner Millionenbauern, gegen eine Kuh getauscht und dann weitergehandelt, bis das Exponat, heute unter dem ehrwürdigen Titel Archaeopteryx im Berliner Naturkundemuseum zu besichtigen, für 20000 Mark von Werner Siemens erworben und schließlich – gegen Erstattung des Kaufpreises! – der Universität überlassen wird.
Nachdem wir uns im Hotel ein wenig frisch gemacht haben, überlegen wir, ob wir Fontane einen Besuch abstatten sollen. Die Adresse lautet Potsdamer Straße 134c. Er lebt hier seit Oktober 1872. Der Umzug war nötig geworden, weil die Mieten in dem Haus, in dem die Fontanes vorher wohnten, nach dessen Verkauf an einen Bankier vom neuen Besitzer um das Doppelte bis Dreifache erhöht wurden.
Wir lassen die menschlichen Berühmtheiten in Ruhe und wenden uns einer äffischen zu. In dem bis vor Kurzem von Alfred Brehm geleiteten sogenannten »Aquarium« Unter den Linden logiert neuerdings einer unserer Vettern, wie die einen glauben und die anderen fürchten. Er ist gerade erst in der Hauptstadt angekommen. Die Vossische Zeitung schreibt: »Noch nie und nirgends ist ein Mitglied des Thierreiches mit größerer Sehnsucht erwartet worden als dieser Gorilla«. Es herrscht riesiger Andrang. Der frisch entlassene Brehm hatte Mitte der 1860er im ersten Band seines Thierlebens beobachtet, »daß wir blos diejenigen Affen wirklich gern haben […], welche die wenigste Aehnlichkeit mit den Menschen zeigen, während uns alle diejenigen Arten, bei denen die Aehnlichkeit schärfer hervortritt, geradezu abscheulich erscheinen.« [17]
Vielleicht sollten wir lieber nicht in den lebenden Spiegel schauen, der uns da im Aquarium präsentiert wird. Die Warteschlange ist ohnehin zu lang. Statt uns anzustellen, spazieren wir zu Kroll am Königsplatz. Es gefällt es uns dort hoffentlich besser als vor zwei Jahren dem russischen Schriftsteller Dostojewski, der weder die Preußen noch die Sachsen noch überhaupt die Deutschen mochte, obwohl er in Baden-Baden und Wiesbaden spielte, in Dresden Gemälde bewunderte und in Bad Ems zur Kur ging. »Aber, mein Gott, was für eine öde, was für eine entsetzliche Stadt ist dieses Berlin! […] Die Deutschen waren am Sonntag alle auf der Straße, in ihrem Sonntagsstaat. Ein grobes, ungehobeltes Volk. In der Konditorei« – wir werden nach einem Gang durch die Wilhelmstraße ebenfalls eine aufsuchen – »riet mir ein junger Mann, zu Kroll im Tiergarten zu gehen«. Das tat er am nächsten Tag auch: »Dieser Garten ist der allerschrecklichste Ekel, aber es war eine Unmenge Publikum da, und die Deutschen gehen da mit Wonne spazieren. Für meine 10 Groschen Eintrittsgeld hatte ich das Recht, das Theater zu betreten, mußte aber auf der Galerie stehen. Das Theater ist ein riesiger dunkler Saal, wo bis zu 1000 Zuschauer Platz haben, die Bühne ist etwa 10 Schritt lang, das Orchester 12 Mann stark (und gar nicht übel), und da geben sie nun […] ›Robert der Teufel‹. Ich hörte nur die Hälfte des 1. Aktes an und entfloh dann vor den entsetzlichen deutschen Sängern«.
Robert der Teufel von Giacomo Meyerbeer muss wirklich nicht sein. Aber Die Fledermaus von Johann Strauss? Es steht die zweihundertste Aufführung bevor, dirigiert vom Meister selbst. Gerade einmal zehn Jahre ist es her, dass der preußische Militärkapellmeister Johann Gottfried Piefke nach dem Sieg über Österreich den »Königgrätzer Marsch« komponierte. Und der Gründerkrach, der die Börse in Wien kollabieren ließ und die Uraufführung der Fledermaus verzögerte, liegt nur drei Jahre zurück. Trotzdem tut man lustig und fidel in Wien und Berlin. Die Herrschaften trinken Champagner, nicht nur auf der Bühne, und die niederen Chargen wie Wärter Frosch in dem Gefängnis, in dem ein Teil der Operette spielt, besaufen sich mit Schnaps. Oder man süffelt »Wolkenschieber«. Dieser »Special-Liqueur« von Apotheker Schultze in der Köpenicker Straße entstand wie die Operette von Strauss im Jahr 1874. Die Reklame dafür reimt sich auch unvertont: »So hab’ nach sinnenschweren Stunden / Ich jetzo einen Trank erfunden, / Der schiebt die Wolken von der Stirn, / Stärkt Rücken, Magen und Gehirn, / Der schützt vor Regen auf der Reisen, / Verdaut die allerschwersten Speisen, / […] / Der macht, daß Alles lacht und liebt / Und daß der Geist zur Wolke schiebt«.
In Wolkenschieberstimmung nach einer Zwischenerholung im Hotelzimmer machen wir uns auf zu einem Gang durch die Wilhelmstraße. Sie hat ihren Namen nicht etwa von Wilhelm I., sondern von Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig. Von ihm erzählt man, er sei mit dem Stock fuchtelnd durch die Straßen Potsdams gelaufen und habe gerufen: »Lieben, lieben sollt ihr mich!« Zum Glück ist es historisch unmöglich, dass wir ihm über den Weg laufen in der nach ihm benannten Straße. Wir verlassen das Hotel Royal durch das Portal in der Wilhelmstraße Nummer 69 und begeben uns zur Nummer 64. Von dort schreiten wir die Bauten preußischer Macht und deutschen Geldes ab:
Haus und Grundstück Nummer 64 wurden 1868 vom Bankier Gerson Bleichröder[18], dessen Aufstieg mit demjenigen Bismarcks verbunden ist, für 37000 Taler ge- und fünf Jahre später für 680000 Mark (etwa 225000 Taler) wieder verkauft. 1876, im Jahr unseres Besuchs, gehört es einem Rittergutsbesitzer aus Posen. 1879 wird Bleichröder das Anwesen zurückkaufen (für wie viel wissen wir nicht). Fünfzehn Jahre später übernimmt der preußische Fiskus die Immobilie für 1900000 Mark von Bleichröders Erben.
Nummer 65 ist das 1867/68 für das Preußische Justizministerium umgebaute Haus.
Nummer 66 ist das Wohnhaus des Bankiers Friedrich Wilhelm Krause, errichtet 1867/68 nach Plänen von Friedrich Hitzig, der in den Gründerjahren reihenweise Villen entworfen und auch die 1876 noch im Bau befindliche neue Reichsbank geplant hat. Krauses Wohnhaus war den französischen ›Adelhotels‹ nachempfunden und wurde analog dazu als ›Bürgerhotel‹ bezeichnet. Krause wurde 1873 geadelt. Das ›Bürgerhotel‹ war in einzelne Wohnungen unterteilt, die sich über ganze Stockwerke zogen.
Das Palais in der Nachbarschaft wurde 1874 fertiggestellt. Es gehörte dem oberschlesischen Kohlebergbau- und Eisenbahnunternehmer Rudolf Pringsheim zu Rodenberg. Das Gebäude machte als ›buntes Haus‹ Furore wegen der an der Fassade eingesetzten verschiedenen und verschiedenfarbigen Materialien. Das Berliner Adressbuch von 1876 erläutert: »Pringsheim’sches Haus, Wilhelmstraße 67, im Styl Venetianischer Paläste […], bestehend aus einem hohen Erdgeschoß und großem dominirenden Hauptgeschoß, ersteres aus Sandstein, letzteres in farbiger Terracotta. Die Facade ist mit hohem Fries gekrönt, auf welchem in lebensgroßen Figuren das menschliche Leben in echt venetianischem Glas-Mosaik […] nach Compositionen von A. von Werner dargestellt ist. Karyatiden in über Doppel-Lebensgröße, aus 500 Centner schweren Sandsteinblöcken gebildet, stützen den Balkon.« Auch die Innenräume, die wir freilich nicht zu sehen bekommen, sind mit großformatigen Wandbildern von Anton von Werner ausgestattet.
Wem Haus und Grundstück Nummer 68 gehören, wissen wir nicht.
Die Nummer 69 ist das Hotel, in dem wir untergekommen sind.
Den Eingang des Palais auf dem Grundstück Nummer 70 bilden korinthische Säulen, als handele es sich um einen Tempel der Antike. Seit 1867 im Besitz des ›Eisenbahnkönigs‹ Bethel Henry Strousberg[19], ging das Anwesen nach dem Zusammenbruch von dessen Firmen-Imperium in die Konkursmasse über und wurde gerade für 900000 Mark an Fürst Hugo zu Hohenlohe versteigert. Während Strousberg einer jüdischen Aufsteigerfamilie entstammt, verkörpert der Fürst zu Hohenlohe die Verbindung aus altem Adel und neuem Geld, von aristokratischen Privilegien mit unternehmerischer Tatkraft.
Nummer 70a wurde im April 1872 von einem Kaufmann erworben und im April 1875 an einen Rittergutsbesitzer verkauft, der es im November 1875 an einen Bankier weiterverkaufte, der es im April 1876 wiederum an einen Rittergutsbesitzer verkauft, der es im März 1877 erneut an einen Bankier verkaufen wird, der es dann immerhin achtzehn Jahre behält.
Nummer 71 wurde 1867 von Leopold Ullstein erworben und 1871 unter Wahrung eines lebenslangen Wohnrechts weiterverkauft. 1876 erfolgt die Gründung seines Verlags[20].
Nummer 72 befindet sich im Besitz der Hohenzollernfamilie.
Nummer 73 ist im Besitz der Krone, aber seit 1873 residiert hier Graf Alexander von Schleinitz, seit vielen Jahren »Minister des königlichen Hauses« und zuständig für die Verwaltung der Krongüter. Das Palais ist ein gesellschaftliches Zentrum der Adelswelt rund um die »Schleinitzsche Kamarilla«, wie Bismarck den langjährigen Feind und dessen kulturell ambitionierte, 35 Jahre jüngere Frau Mimi nennt. Man stelle sich vor, Bismarck würde mit Pickelhaube unter dem Arm durch den Salon der wagnerianischen Gräfin[21] poltern, um zu verhindern, dass sie den Kaiser im August 1876 zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele mit der Uraufführung der Götterdämmerung lockt. Die Uraufführung von Tristan und Isolde hat im März im Königlichen Opernhaus stattgefunden. Freiherrin Spitzemberg, Mimis Salonkonkurrentin und Bismarck-Verehrerin, notierte darüber in ihrem Tagebuch: »Die halbe Welt war heute in der Oper gewesen, um Wagners ›Tristan und Isolde‹ zu hören; die meisten kamen schachmatt, wenn auch gebührend hingerissen daraus zurück.« Bismarck indessen besucht den Schleinitz’schen Salon nur ausnahmsweise, und der Kaiser wird Mimi (weniger Wagner) zuliebe nach Bayreuth fahren.
Die Nummer 74 wurde nach der Reichsgründung im Stil eines florentinischen Palastes umgebaut, um als neues Bundeskanzleramt zu fungieren. Das hat Bismarck jedoch nicht gefallen, er bleibt einstweilen in Nummer 76. In den umgebauten Palast zieht das Reichsamt des Innern.
Nummer 75 befindet sich im Besitz einer Druckerfamilie, in deren Werkstatt auch Reichssachen vervielfältigt werden. Das Reich wird das Anwesen, einschließlich der Druckerei, 1877 erwerben.
In Nummer 76 residiert Bismarck seit Herbst 1862, zunächst als preußischer Ministerpräsident und ab 1871 als Reichskanzler. Erst 1878 wird er hinüber nach Nummer 77 ziehen. Die Depeschentür an der Hinterseite des Gebäudes, an die unentwegt Pferdekuriere mit wichtigen Botschaften klopfen, können wir von der Straßenseite aus nicht sehen. Ebenso wenig können wir einen Blick ins Innere werfen. Vergeblich halten wir nach dem Gärtner Ausschau, der manchmal Leute gegen Trinkgeld über die Dienstbotentreppe in die Gemächer führt, wenn der Hausherr nicht anwesend ist. Jedenfalls erzählt das der französisch-schweizerische Reisereporter Victor Tissot. Er will sogar im Schlafzimmer gewesen sein: »Ein mit blauer Seide bespannter Wandschirm umgibt das riesige Ehebett. Ein kleiner Tisch dient als Waschtisch. Darauf entdecke ich ein halbes Dutzend Kämme und Bürsten, also viel mehr, als der Kanzler Haare auf dem Kopf besitzt«.
Nummer 77, das ehemalige Palais Radziwill, wird gerade zur Reichskanzlei umgebaut, in die Bismarck in zwei Jahren übersiedeln wird. Bismarcks Haltung zur polnisch-preußischen Fürstenfamilie Radziwill, insbesondere zu dem bei Hofe einflussreichen Boguslaw, ist distanziert bis feindselig. Bismarcks ›Kulturkampf‹ gegen die katholischen, die polnischen und die päpstlichen ›Elemente‹ dauert immer noch an. Übrigens heißt es in Fontanes Effi Briest über den Mann der Titelheldin, Baron von Innstetten, »am 1. April begab er sich in das Kanzlerpalais, um sich einzuschreiben«. Obwohl der Roman erst ein halbes Jahrzehnt nach Bismarcks Rücktritt 1890 erschien, konnte Fontane immer noch voraussetzen, dass seine Leserschaft die Bemerkung ohne Erläuterung verstehen würde: Der 1. April war Kanzlergeburtstag, in der Nummer 77 lag ein Gratulationsbuch aus[22].
Nummer 78 ist die Schornsteinfegerakademie. So wird der 1875 fertiggestellte Bau wegen seiner vielen Kamine vom Berliner Volksmund genannt. Die Kamine passen auf kuriose Weise zum Besitzer, Hans Heinrich Fürst von Pleß. Er ist einer jener Schlotbarone aus schlesischem Adel, die unter der Erde Kohlebergwerke und auf der Erde Landwirtschaft im großen Maßstab betreiben. Über sein Palais heißt es im Berliner Adreß-Buch: »Französische Renaissance mit Seitenflügel in weißem schlesischen Sandstein mit rother Verblendung. […] Hohes schmiedeeisernes Thor und Vorgitter längs der Straßenfront, von Pariser Arbeit.« Das ›Französische‹ an dem Bau ist ungewöhnlich, so kurz nach dem Krieg, und erregt, zusätzlich zum Spott wegen der Schornsteine, entsprechend Anstoß.
Nebenan entsteht mit der Adresse Voßstraße 1 ein weiteres Palais im Stil der Neo-Renaissance. Es gehört Albert Borsig, dem Sohn des Firmengründers, der mit dem Bau von Lokomotiven reich geworden ist. Der von ihm in Auftrag gegebene Gemäldezyklus »Lebensgeschichte einer Lokomotive«[23] ist gerade fertig geworden, aber den Einzug in das neue Palais wird er nicht mehr erleben. Auch erspart ihm sein Tod im Jahr 1878 die Auseinandersetzung mit Fürst von Pleß. Dem Schlotbaron von altem Adel stinkt die Nachbarschaft der neureichen Borsigs dermaßen, dass er die Pferdeställe auf seinem Grundstück in unmittelbarer Nähe des Borsig’schen Festsaals anlegen lässt.
Eigentum zieht Macht nach sich, und Macht erzeugt Eigentum. Aber nicht immer steht beides in ausgewogenem Verhältnis, vor allem dann nicht, wenn sich die Zeiten schneller ändern als die Leute.
Nach so viel baulichem Brustgetrommel suchen wir zur Entspannung die Konditorei Spargnapani auf. Tissot beschreibt sie in seiner höhnischen Art folgendermaßen: »Die Konditoreien ersetzen in Berlin die Cafés. Man trinkt dort Schokolade, Punsch und Limonade. Die Liebhaber von Süßigkeiten verzehren dort hauptsächlich Kuchen mit viel Sahne.« Und die »am häufigsten besuchte Konditorei ist die von Spargnapani Unter den Linden. Sie ist gleichzeitig ein Lesekabinett. Von 11 Uhr bis mittags trifft man hier ernste Staatsräte an, die sich an einem Stück Erdbeertorte delektieren« und dabei eine der vielen ausliegenden Zeitungen lesen. »Alle diese Menschen werden nur von zwei Dingen in Anspruch genommen, nämlich sich den Bauch mit Süßem vollzustopfen und den Kopf mit Ideen. Bei Spargnapani kann man die Weltereignisse Stunde um Stunde verfolgen. Nicht nur, daß der Briefträger jeden Augenblick eine neue Zeitung aus dem Osten oder dem Süden, aus St. Petersburg oder New York bringt, auch die Telegramme werden, so wie sie bei der Agentur Wolff[24] eintreffen, von ihr auf lose Blätter kopiert und an einer besonderen Stelle in der Konditorei angeschlagen. Man kann von diesen Konditoreien weder die Eleganz noch die Bequemlichkeit der Pariser Cafés erwarten. Den Deutschen kümmert nicht das Äußere und die Form, das Wichtigste ist ihm das leibliche Wohl. Dieses praktische Volk ist nicht gewillt, die vergoldeten Spiegel oder die mit Samt bezogenen Stühle zu bezahlen […]. Deshalb gibt es nichts Primitiveres als diese Konditoreien. Man sitzt an kleinen Marmortischen auf strohbespannten Stühlen, die Wände sind kahl, und der Fußboden ist mit Sägespänen bestreut.«
Wie hätte sich der verwöhnte Franzose erst in einer deutschen Kneipe gefühlt? Das Saufen und Raufen darin machte noch 1890 dem Zivilisationskritiker Julius Langbehn Sorgen. In seinem zwielichtigen Bestseller Rembrandt als Erzieher überlegte er, was wäre, wenn »es statt der 50000 Schenklokale, die es im jetzigen Preußen gibt, dort 50000 öffentliche Badeanstalten gäbe«: Es »würde um die physische, geistige und sogar sittliche Gesundheit […] besser stehen als jetzt. Denn körperliche und sittliche Reinheit« bedingten sich gegenseitig. Außerdem würde es »wahrscheinlich weniger Sozialdemokraten in Deutschland geben, wenn es dort mehr Bäder gäbe.« Auf diesen Ausweg war der gerade zurückgetretene Bismarck gar nicht gekommen. Weniger verplantscht hatte zehn Jahre zuvor Helmuth von Moltke, der alt gewordene Stratege des dänischen, des deutschen und des französischen Krieges, über friedensselige Verweichlichung geschrieben: »Der ewige Friede ist ein Traum, und nicht einmal ein schöner, und der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden des Menschen, Mut und Entsagung, Pflichttreue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens. Ohne den Krieg würde die Welt im Materialismus versumpfen.«
Kapellmeister Piefke und die Einigungskriege
Der dänische Krieg – Der deutsche Krieg – Der Krieg gegen Frankreich
Graf Moltkes Generalstabsheroismus und seine Sorge, der Friede ließe die Leute ›im Materialismus versumpfen‹, hinderten ihn so wenig wie Bismarck oder Generalfeldmarschall Albrecht von Roon daran, recht alt zu werden und den Tod fürs Vaterland im Bett zu sterben. Seinem borussischen Befehlshabernimbus tat das keinen Abbruch. Bis heute personifiziert er auf Denkmalsockeln und Gemälden neben Bismarck und Roon die preußische Überlegenheit in den deutschen Einigungskriegen. Ein Deutschland, drei Männer, drei Kriege, drei Schlachten: der Sturm auf die Düppeler Schanzen im dänischen, der Sieg über Österreich bei Königgrätz im deutschen, der Sieg bei Sedan im französischen Krieg.
Bei der für Moltke militärisch unnötigen, aber für Bismarck innenpolitisch wichtigen Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864 kamen 260 preußische und 800 dänische Soldaten ums Leben (der Krieg insgesamt kostete 1700 Tote und 4000 Verwundete); in der Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866 kamen knapp 2000 preußische und an die 6000 österreichische und sächsische Soldaten ums Leben (der Krieg insgesamt kostete 15000 Tote und 30000 Verwundete); in der Schlacht bei Sedan am 1. und 2. September 1870 kamen auf jeder Seite 3000 Soldaten ums Leben (der Krieg insgesamt kostete rund 200000 Tote und noch einmal so viele Verwundete).
Für sich und vor allem persönlich genommen sind diese Zahlen fürchterlich. »Ich habe auf dem Schlachtfeld«, bekannte Bismarck nach Königgrätz, »die Blüte unserer Jugend dahinraffen sehen durch Wunden und Krankheit, ich sehe jetzt aus dem Fenster gar manchen Krüppel auf der Wilhelmstraße gehen, der heraufsieht und bei sich denkt, wäre nicht der Mann da oben, und hätte er nicht den bösen Krieg gemacht, ich säße jetzt gesund bei ›Muttern‹«.
Allgemein und vor allem historisch genommen sind diese Zahlen eher niedrig. Zwei Jahrzehnte nach Königgrätz warnte Friedrich Engels: »Und endlich ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen […]. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet«. Die Vorhersage war recht genau. In den vier Jahren des Ersten Weltkrieges kamen 9,7 Millionen Soldaten um, außerdem rund zehn Millionen Zivilisten, die Opfer der epidemischen Spanischen Grippe eingerechnet.
Wie lässt sich militärische Gewalt bei solchen Zahlen rechtfertigen? Lässt sie sich überhaupt verantworten? Bismarck warnte in seinen Memoiren, »wehe dem Staatsmann, der sich […] nicht nach einem Grunde zum Krieg umsieht, der auch nach dem Kriege noch stichhaltig ist.« Ihm ist das dreimal hintereinander gelungen, vor allem deshalb, weil er seine Kriege gewonnen hat und die Gründe für gewonnene Kriege immer als ›stichhaltig‹ gelten. Die in Bismarcks Memoiren ebenfalls geäußerte »Überzeugung, daß auch siegreiche Kriege nur dann, wenn sie aufgezwungen sind, verantwortet werden können«, ist dahingehend zu korrigieren, dass es statt ›aufgezwungen sind‹ heißen müsste ›aufgezwungen erscheinen‹.