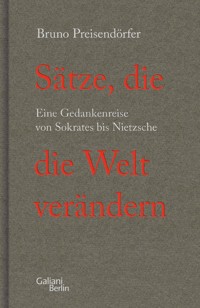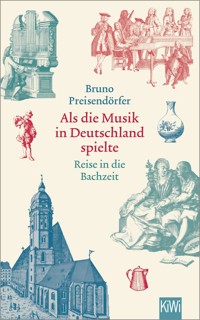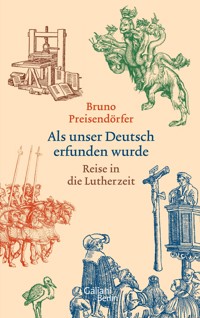9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Am Tore wurden wir angehalten. Ein Sergeant kam an den Postwagen und fragte: ›Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Werden Sie lange hierbleiben?‹« … ... so wurde befragt, wer zur Goethezeit an die Tore von Berlin kam. Das Gepäck wurde durchsucht, man bekam einen Passierschein – musste aber, kaum im Gasthaus angekommen, schon die nächsten Kontrollbögen, diesmal die der Polizei, ausfüllen. Wer mit Bruno Preisendörfer als Zeitreisender unterwegs ist, erlebt aber noch viel mehr: Er steht z. B. am 7. 11. 1775 morgens um fünf in Weimar vor dem Haus eines Kammergerichtspräsidenten namens von Kalb und sieht zu, wie Goethes Kutsche über das Pf laster rollt. Er besucht eine philanthropische Reformschule oder wird zwischen die Bauernkinder in die Bänke einer Dorfschule gesteckt. Er geht an die Universität, um Kant und Fichte zu lauschen, etwaige Verständnisschwierigkeiten müssen ihm nicht peinlich sein, es ging den Zeitgenossen ebenso. Aber der Zeitreisende lernt nicht nur den philosophischen Zeitgeist kennen, sondern erlebt auch handfeste Abenteuer, übersteht mit dem jungen Eichendorff einen Schiffsunfall auf der Oder, sieht aus E.T.A. Hoffmanns Eckfenster am Gendarmenmarkt Berlin brennen, oder ist bei Georg Lichtenberg in Göttingen, als der durchs Fernglas der Beerdigung von Gottfried August Bürger zusieht. Vielleicht ist er auch bei der Zofe einer Gräfin, die sich ohne fremde Hilfe nicht ankleiden kann, oder er schleicht in den Anatomiesaal von Jena, wo die Selbstmörderinnen obduziert werden, die in Weimar in die Ilm gegangen sind, stiehlt mit fronenden Bauern Korn oder gerät als Knecht mit seinem Brotherrn aneinander. Bruno Preisendörfer hat sich durch Hunderte von Büchern gelesen, Romane, Selbstzeugnisse, Briefe und Tagebücher. Er nimmt den Leser mit auf eine große Reise in die Goethezeit und man erlebt, wie das Lebe damals wirklich war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 780
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bruno Preisendörfer
Als Deutschland noch nicht Deutschland war
Reise in die Goethezeit
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bruno Preisendörfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bruno Preisendörfer
Bruno Preisendörfer ist freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift (www.fackelkopf.de).
Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt erschienen von ihm »Der waghalsige Reisende. Johann Gottfried Seume und das ungeschützte Leben« (2012) und »Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit« (2016).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wer mit Bruno Preisendörfer als Zeitreisender unterwegs ist, steht z.B. am 7.11.1775 morgens um fünf in Weimar vor dem Haus eines Kammergerichtspräsidenten namens von Kalb und sieht zu, wie Goethes Kutsche über das Pflaster rollt. Er wird zwischen die Bauernkinder in die Bänke einer Dorfschule gesteckt, geht an die Universität, um Kant und Fichte zu lauschen – etwaige Verständnisschwierigkeiten müssen ihm nicht peinlich sein, es ging den Zeitgenossen ebenso. Aber der Zeitreisende erlebt auch handfeste Abenteuer, übersteht mit dem jungen Eichendorff einen Schiffsunfall auf der Oder und sieht aus E.T.A. Hoffmanns Eckfenster am Gendarmenmarkt Berlin brennen. Vielleicht schleicht er auch in den Anatomiesaal von Jena, wo die Selbstmörderinnen obduziert werden, die in Weimar in die Ilm gegangen sind.
Bruno Preisendörfer hat sich durch Hunderte von Büchern gelesen, Romane, Selbstzeugnisse, Briefe und Tagebücher. Er nimmt den Leser mit auf eine große Reise in die Goethezeit und man erlebt, wie das Leben damals wirklich war.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Einleitung
1. Aus der Chaoszeit
Reisewarnung
Neues und Altes
Reisevorbereitungen
Deutschland und der Lauf der Welt
Ankunft in Weimar
2. Unterwegs
Wege um Weimar
›Kunststraßen‹
Die Post
Ratschläge für Reisende
Kutschen und Katastrophen
Schifffahrt
Schiffsklagen
Exkurs über das Reisen als Mode
3. Stadtleben
Blick von außen
Am Tor und im Wirtshaus
Die große und die kleine Stadt
Salonbesuche
Bei Hofe
Im Theater
Oper und Konzert
Gang über den Markt
Abgebrochener Stadtbummel
An der Universität
Werkstattbesichtigungen
Ortstermin im Armenhaus
Gang zum Richtplatz
Blick ins Getto
Landleute kommen in die Stadt
Städter fahren aufs Land
4. Auf dem platten Land
Besuch aus der Stadt
Die Landbevölkerung
Die Obrigkeit
In der Dorfschule
Leibeigenschaft und Fronarbeit
Vom Pflügen
Über den roten Klee
Agrarökonomie
5. Der Alltag
Tagesabläufe
Briefe über Betten
Haushalt und Häuslichkeit
Das Gesinde
Vom Licht
Vom Wasser
Vom Feuer
Blitze und Blitzableiter
Vom Heizen
Exkurs über Holz, Kohle, Eisen und Schnaps
6. Essen und Trinken
Wer isst warum wann was mit wem und womit
Kurzer Blick in die Küche
Brot und Butter
Die Kartoffel
Fleisch und Geflügel
Gemüse und Obst
Bier, Branntwein, Wein
Etwas über Tabak
Eine Prise Salz
Vom Zucker
Kaffee und Tee
›Colonial-Waaren‹ und ihre Ersatzstoffe
Exkurs über Kochbücher (mit Rezepten für ein historisches Menü)
7. Kleider und Leute
Wer trägt wann was und warum
Beantwortung der Frage: Was ist Mode?
Leinen und Baumwolle
Samt und Seide
Westen und Taillen wandern nach oben, die Hosen nach unten
Der Zopf wandert nach vorn
Von Haar und Haut
Bänder und Hauben
Knopf und Kragen
Über Unterwäsche
Kritik der Schnürbrust, Lob der Muttermilch
Kleines Mode-Lexikon von Andrienne bis Zopf
8. Sexualität
Lust und Lucinde
Prostitution
Der Kampf gegen die ›Selbstbefleckung‹
›Sodomie‹ und ›Knabenliebe‹
›Nothzucht‹
Zeugung, Schwangerschaft, Geburt
Ein Denkmal für die Gretchen: über ›Kindermord‹
9. Ehe und Familie
Liebe oder Konvenienz
Vier Hochzeiten
Gattin und Gatte
Ein Absatz über Schwiegermütter
Kindersegen, Kinderfluch
10. Gesundheit, Krankheit, Tod
Wunderheiler und Tablettenkrämer, Ärzte und Apotheker
Vom Hospital zum Krankenhaus
Die Pocken und die Impfung
Aderlass
Zahnweh
Zipperlein
Hirnforschung
Besuch im ›Tollhaus‹
Todesfälle
Bestattungen
Abflug
Anhang
Zitatnachweise
Quellen- und Literaturverzeichnis
Die Goethezeit in Zahlen
Danksagung
Bildrechtenachweis
Personenverzeichnis
Vorsatzabbildung
Für Più
Wagner: Verzeiht! es ist ein groß Ergetzen,Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen
Faust: Mein Freund, die Zeiten der VergangenheitSind uns ein Buch mit sieben Siegeln;Was ihr den Geist der Zeiten heißt,Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust. Eine Tragödie
Einleitung
In welche Zeit würden Sie reisen, wenn Sie einmal im Leben die Chance bekämen, aus der Haut der Gegenwart zu fahren für eine Tour in die Vergangenheit? Wem möchten Sie dort gern begegnen – und wem lieber nicht? Welche Abenteuer möchten Sie als historischer Tourist erleben, wenn Sie wüssten, dass Sie unbeschadet in die Gegenwart zurückkehren? Leider (und Gott sei Dank) sind solche Fahrten nicht möglich – es sei denn, als ›armchair traveller‹, wie die Briten über Leute sagen, die behaglich im Sessel reisen mit einem Buch in der Hand. Auch Die Zeitmaschine von H.G. Wells beginnt in einem Kaminzimmer. Die Maschine ist ein Gebilde aus Metall und Elfenbein, dessen Form und Größe Wells ausgerechnet mit einem Wecker vergleicht. Das Ding hat zwei Hebel, einen für die Fahrt in die Vergangenheit, einen für die in die Zukunft. Am Ende des Romans verschwindet der Zeitreisende, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, bleibt unklar.
Das Reiseziel dieses Buches ist genauer bestimmt. Es führt in die Jahre um 1800, in eine Epoche, die in der deutschen Kulturgeschichtsschreibung gewöhnlich ›Goethezeit‹ genannt wird. Heinrich Heine, ein kritischer Bewunderer Goethes, sprach von der ›Kunstperiode‹, die an Goethes Wiege begonnen und an Goethes Grab geendet habe. Den Namen einer Kunstperiode zur Bezeichnung einer ganzen historischen Epoche auszuweiten, war eine Idee des von der politischen Macht lange ferngehaltenen deutschen Bildungsbürgertums, das sich halb frustriert, halb erleichtert ins Kulturelle zurückgezogen hatte, ins Reich des Geistes (und manchmal der Gespenster). Doch soll hier die Angemessenheit des Begriffs nicht diskutiert werden. Auch nicht, ob die in jeder Hinsicht und in aller Welt höchst turbulenten Jahrzehnte vor und nach 1800 mit einem Personennamen aus dem Adresskalender eines thüringischen Residenzstädtchens angemessen charakterisiert sind. Goethe selbst jedenfalls wusste nicht, dass er in der ›Goethezeit‹ lebte, mochte er gegen Ende seines Lebens sich selbst noch so historisch geworden sein. Vermutlich wäre er halb geschmeichelt, halb amüsiert gewesen, dass nachfolgende Generationen seinen Namen zur Geschichtsepoche überdehnten. Er hätte den Kopf darüber geschüttelt, aber bestimmt nicht so heftig, dass dabei sein Lorbeerkranz heruntergefallen wäre.
Dieses Buch soll als Zeitreiseführer die Epoche Goethes nicht systematisch erfassbar, sondern erzählerisch erfahrbar machen. Dabei werden Publizisten und Schriftsteller in den Zeitzeugenstand[1] gerufen, um Auskunft zu geben über das kulturelle, politische, wirtschaftliche, soziale und auch banale Leben, über Kleines und Großes, über Alltagsbegebnisse und historische Ereignisse.
1. Aus der Chaoszeit
Reisewarnung – Neues und Altes – Reisevorbereitungen – Deutschland und der Lauf der Welt – Ankunft in Weimar
Reisewarnung
Wenn das Auswärtige Amt für den Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger nicht nur beim Besuch ferner Länder zu sorgen hätte, sondern auch beim Besuch vergangener Zeiten, müsste es für die Jahrzehnte um 1800 eine Reisewarnung aussprechen. Nicht nur wegen der Brutalität, des Lärms, des Gestanks und der anderen Beschwernisse des Alltags, sondern vor allem wegen der großen Krisen. In einer Zeitspanne, nicht länger als ein Menschenleben, wurden das deutsche Kleinstaatensystem, das europäische System der Mächte und das globale Weltsystem verändert. Es wurden Kriege geführt mit einem unvorstellbaren Einsatz an Menschen, Material und ›Menschenmaterial‹, um es im Sprachgebrauch der Militärs auszudrücken. Des Weiteren kam es zu wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Entwicklungen in einem Innovationstakt wie in keiner Epoche zuvor.
Die ›Goethezeit‹ war Chaoszeit, gefährlich, unberechenbar, unheimlich. Sie hatte wenig von der Behaglichkeit, die dem greisen Geheimrat in seinem Haus am Frauenplan so wichtig war. Überall wankte die Ordnung, alles ging drunter und drüber in Weimar, in Deutschland, in Europa und auf der ganzen »Pomeranze«, wie Lichtenberg die Weltkugel nannte. Kolonien wurden Staaten, Könige verloren den Kopf, Imperatoren zerrten im Zeitraffer das historische Lehrstück vom Aufstieg und Fall über die Bühne der Geschichte.
Als in den späten Zwanziger- und frühen Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts der alte Herr im Arbeitszimmer die Hände auf den Rücken legte und herumwandernd einem Sekretär aus seinem Leben diktierte oder dem jungen Eckermann seine Meinungen erklärte, stand ihm die Unvergleichlichkeit seiner zeitgeschichtlichen Situation klar vor Augen. Er übertrieb nicht, als er sagte, dass er »zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen und sich durch mein langes Leben fortsetzten, so dass ich vom siebenjährigen Krieg, sodann von der Trennung Amerikas von England, ferner von der französischen Revolution und endlich von der ganzen Napoleonischen Zeit bis zum Untergang des Helden und den folgenden Ereignissen lebendiger Zeuge war.«
Johann Wolfgang Goethe kam 1749 in der reichen, aber behäbigen Handelsstadt Frankfurt am Main zur Welt. Patrizier wie Goethes Vater und Großvater gingen ihren Geschäften nach, und gelegentlich richtete man die Krönung eines Kaisers aus, wenn die Kurfürsten des jahrhundertealten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation einen neuen gewählt hatten. Die Stadt selbst hatte mittelalterlichen Charme, wie man sagen mag, solange man diesen ›Charme‹ nicht mit eigener Nase in den Gassen riechen muss. Die Welt schien in Ordnung und hörte für die Mehrzahl der Bewohner bald hinter der Stadtmauer auf. Das Leben floss langsamer dahin als der Main.
Als Johann Wolfgang von Goethe 1832 in Weimar starb, hatte sich alles geändert, nicht nur sein eigener Name, der durch die Nobilitierung drei Buchstaben länger geworden war. Das Heilige Römische Reich gab es nicht mehr, seit 1806 der letzte Kaiser die Krone vom Haupt genommen hatte, erzwungen von Napoleon. Das Ancien Régime in Frankreich war nach der Revolution von 1789 der ›neuen Zeit‹ gewichen, und in den deutschen Ländern vollzog sich nach den Wirren der Revolutionskriege auf den Wegen der Reform ein ähnlicher Prozess, auch wenn durch Metternichs Restauration nach Napoleons Sturz die Uhr dieser neuen Zeit zurückgedreht wurde.
Doch waren dies nur die Haupt- und Staatsaktionen der Geschichte. Auf Neben- und Hinterbühnen spielten sich zahllose andere Dramen ab, auch Possen, Rühr- und Lehrstücke und elende Tragödien. Der Hunger (nicht der Preußenkönig) führte in den deutschen Provinzen die Kartoffel ein – obgleich in den Städten bis gegen Ende des Jahrhunderts das Brot Hauptnahrungsmittel gewöhnlicher Leute blieb; die Pocken erzwangen in Europa die Impfung – obgleich das Impfen mit Menschenpocken bis zum Übergang zur Kuhpockenimpfung ebenso Teil des Problems wie der Lösung war. Zucker und Baumwolle, ›Chocolade‹, ›Thee‹ und ›Coffee‹ kamen über die Meere. In den Kolonien schufteten auf Plantagen die Sklaven, auf den Rittergütern der deutschen Kleinstaaten die Leibeigenen, in den Manufakturen die Weber, Spinner und ihre Kinder. »Wie der Mensch mit dem Menschen verfährt«, höhnt Arthur Schopenhauer mit der Bitternis seiner Mitleidsphilosophie, »zeigt z.B. die Negersklaverei, deren Endzweck Zucker und Kaffee ist. Aber man braucht nicht so weit zu gehen: im Alter von fünf Jahren eintreten in die Garnspinnerei oder sonstige Fabrik und von dem an erst zehn, dann zwölf, endlich vierzehn Stunden täglich darin sitzen und dieselbe mechanische Arbeit verrichten heißt das Vergnügen, Atem zu holen, teuer erkaufen.«
Das Gewerbe breitete sich aus, der Handel wuchs, in den Häfen schaukelten schwer beladen die Schiffe. Städte wie Hamburg oder Bremen prosperierten, andere wie Aachen oder Nürnberg erlebten einen Niedergang. Bürgerliche Kaufleute wurden märchenhaft reich, uralte Adelsgeschlechter verarmten. Entwurzelte Kleinbauern wurden zu Tagelöhnern, heruntergekommene selbstständige Handwerker zu Manufakturarbeitern, geschäftstüchtige Bürger zu Fabrikanten – und gelegentlich ein Kleinbauernkind zum Landpastor oder gar zum Schriftsteller. Philosophische Denksysteme stellten Glaubensdogmen infrage, Empirie ersetzte die Buchgelehrsamkeit, wissenschaftliche Methoden mündeten in technische Fertigkeiten. Das Wissen wurde zur Macht, und die Macht förderte und forderte das Wissen. Die Kommunikation zwischen den Schichten vertiefte sich, auch wenn Goethe in den Wahlverwandtschaften den Landjunker Eduard in aristokratischem Dünkel bemerken lässt: »Ich mag mit Bürgern und Bauern nichts zu tun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann«. Gleichwohl debattierten in gelehrten Gesellschaften aristokratische und bürgerliche Herren miteinander, und in den Salons der kultivierten Damen von Hamburg, Berlin oder Weimar traf die bürgerliche Bildungselite mit der traditionellen aristokratischen Oberschicht zusammen.
Der rasch wachsende publizistische Markt verstetigte die Kommunikation, die den Gedankenaustausch (den der Gefühle mitunter auch) von persönlichen Begegnungen unabhängig machte und gewissermaßen frei flottieren ließ. Die lateinisch abgefassten Bücher über Gott wurden von deutsch geschriebenen Büchern über die Welt verdrängt. Die Zahl der Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren nahm beständig zu. Die Messkataloge mit den Neuerscheinungen in Frankfurt, Leipzig oder Wien wurden jedes Jahr dicker, obgleich um 1800 in Wien immer noch weniger Bücher gedruckt wurden als in – Kalkutta, der rund hundert Jahre zuvor von der englischen East India Company gegründeten bengalischen Stadt.
Die Vielfalt begeisterte, aber sie verwirrte auch und erzeugte Überdruss. Schriftsteller schrieben Bücher über die ›Bücherseuche‹, viel Tinte wurde vergossen, um das ›tintenklecksende Säculum‹ lächerlich zu machen. Die Zelebritäten der Literatur fürchteten, der höhere Geist einer schmalen Kennerschaft werde vom schlechten Geschmack des breiten Publikums erdrückt. Die ›Empfindsamkeit‹ war auf dem Weg ihrer literarischen Konventionalisierung zur ›Empfindeley‹ verkommen, die Aufklärung selbst schien abgestanden – Aufkläricht eben statt der frischen Ideen von einst, saturiertes Mittelmaß statt Feuer des Gedankens. Die Vernünfftigen Gedancken von der Menschen Thun und Lassen des großen Aufklärers Christian Wolff galten drei Generationen nach ihrem Erscheinen dem jungen Heine als »Runkelrübenvernunft«, und Jean Paul lässt kurz nach der Wende zum 19. Jahrhundert seinen Luftschiffer Giannozzo über die Leute spotten, auf die er von oben herabsieht: »Himmel! es waren aufgeklärte Achtzehnjahrhunderter – sie standen ganz für Friedrich II., für die gemäßigte Freiheit und gute Erholungs-Lektüre und einen gemäßigten Deismus – und eine gemäßigte Philosophie – sie erklärten sich sehr gern gegen Geistererscheinungen, Schwärmerei und Extreme.« Schon anderthalb Jahrzehnte vorher hieß es in Wielands Teutschem Merkur, kaum war im Dezember 1784 Kants Aufsatz Was ist Aufklärung? erschienen: »Das Wort Aufklärung fängt jetzt allmählich an, so wie die Wörter Genie, Kraft, gutes Herz, Empfindsamkeit und andre in üblen Ruf zu kommen.«
Die Moden, die geistigen und schöngeistigen eingeschlossen, schienen einander immer schneller abzuwechseln, die neuesten Kenntnisse schon die eigene Veraltung zu erwarten. Die Beständigkeit von Wahrheiten und die Dauerhaftigkeit der Erkenntnisse ließ sich nicht mehr kommandieren. Goethes befehlsgewohnter Eduard klagt ironisch-selbstironisch über das, was wir heute ›lebenslanges Lernen‹ zu nennen gelernt haben: »Es ist schlimm genug […], dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsre Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen.«
Neues und Altes
Inmitten der Veränderungen und im Rücken des Neuen hielt sich das Alte. Es wurden Nachttöpfe aus den Fenstern gekippt (in Weimar ab 1774 erst nach 23 Uhr erlaubt), und das Wasser für den täglichen Bedarf schleppten Mägde in Krügen von den Marktbrunnen in die Küchen, wobei es sich bei den idyllischen ›Krügen‹ in Wahrheit um Kannen und Eimer handelte, schwer wie die Arbeit des Gesindes. In vielen Städten und fast überall auf dem Land waren die Häuser mit Stroh oder Schindeln gedeckt statt mit Ziegeln. Zwischen den Häusern standen die Scheunen, in den Straßen streunte das Vieh. Trotz aller Wissenschaft ließen die Ärzte ihre Patienten zur Ader, wann immer sie nicht weiterwussten, was häufig vorkam, und die Hirten hielten es mit ihren Kühen genauso. Wandernde Bader legten in den Hinterzimmern der Wirtshäuser, in denen sie logierten, ihre chirurgischen Instrumente aus. Wunderheiler zogen über die Dörfer, Hochstapler schmarotzten in Palästen, Goldmacher weckten bei aufgeklärten Fürsten (sogar bei Friedrich II.) die falschesten Hoffnungen, spiritistische Frömmler schmeichelten sich bei unaufgeklärten ein (bei Friedrichs Nachfolger Friedrich Wilhelm II.). Den Aristokraten, die sich vom Licht der Aufklärung geblendet fühlten, verrückten Geisterseher in verdunkelten Salons die Tische und Köpfe.
Ziegel waren kostbar und schwer. Gewöhnliche Häuser wurden mit Stroh gedeckt, wie auf diesem Stich in der Oeconomischen Encyclopädie von Krünitz gezeigt.
Cagliostro war erst der berühmteste, dann der berüchtigtste unter ihnen. Die deutsch-baltische Gräfin Elisa von der Recke glaubte 1779 an seine übernatürlichen Kräfte und verfasste 1787 eine Entlarvungsschrift. Aber ihre Kritik der Schwärmerei blieb schwärmerisch und ihre Rehabilitierung der Vernunft unvernünftig. Kurz vor der Französischen Revolution hielt sie den »Zauberritter« für das Haupt einer jesuitischen Verschwörung und nach der Revolution diese Verschwörung für die Ursache des Umsturzes.
Cagliostro starb in einem vatikanischen Gefängnis, nicht weil er ein Hexenmeister, sondern weil er keiner war, bloß ein magischer Betrüger. Die letzte ›Hexe‹ in Deutschland, die Dienstmagd Anna Maria Schwegelin, wurde 1775 – nein, nicht verbrannt, sondern zur Enthauptung verurteilt: wegen eines Teufelspakts (den sie gestanden) und eines Schadenzaubers (den sie nicht gestanden hatte). Die Hinrichtung wurde nicht vollzogen, Schwegelin starb 1781 im Stockhaus des Stifts Kempten. Heute hat sie dort einen Brunnen als Denkmal. Ein Jahr nach ihrem Tod wurde in der Schweizer Stadt Glarus die Magd Anne Göldin nach einem Hexenprozess wegen Giftmischerei enthauptet. Der rabiate Publizist Wilhelm Ludwig Wekhrlin hat dafür gesorgt, dass aus dem Justizmord ein Justizskandal wurde. Die Göldin hat seit 2007 ein Museum in Mollis, im August 2008 wurde sie offiziell rehabilitiert.
Nach dem Tod der beiden armen Annen schwirrten die Hexen weiter auf Besenstielen umher oder trieben in der Walpurgisnacht ihr Unwesen – nicht nur auf dem Blocksberg in Goethes Faust, auch auf den Gipfeln des Erzgebirges rund um eine viel frequentierte böhmische Kurstadt, wie Elisa von der Recke 1795 notierte: »Gestern abend ist hier sehr viel und bis lange in die Nacht hinein geschossen worden. So bewillkommnet der Aberglaube in Karlsbad den 1. Mai, um an diesem vorgeblichen Versammlungstage der Hexen diese Mißgeburten des Wahns durch das Donnern des Geschützes aus der Gegend zu vertreiben!« In Wahrheit, und auf dem Brocken, waren die Gespenster nur noch ein Schatten – von einem selbst. Heinrich Zschokke erklärte sie als ganz natürliche Erscheinung: Brockengespenster »treten nur dann vor das erstaunte Auge, wenn man auf einer schroffen Felswand über einem Abgrund steht und ein dichter, feuchter Nebel aus der Tiefe steigt, auf welchen der Schatten der Person fallen kann, in deren Rücken die Sonne leuchtet.«
Reckes verächtliche Bemerkung lässt darauf schließen, dass die Erzgebirgsrituale mehr waren als nostalgische Vergnügungen in ›gotischer‹ Tradition. Trotz der natürlichen Erklärungen blieben magische Vorstellungen in vielen Gegenden, auch Herzgegenden, lebendig. Die aufgeklärte Obrigkeit rügte Dorfprediger, die den Aberglauben schürten oder wie Pfarrer Johann Joseph Gaßner 1774 in Meersburg den Teufel austrieben, bis Kaiser Joseph II. das Treiben unterband. Gaßners Schriften wurden übrigens in Kempten gedruckt. Heute hat er in Meersburg eine Skulptur als Schandmal. Der aufgeklärte bayerische Landpfarrer Franz Xaver Geiger wiederum wanderte ins Gefängnis, weil er in seiner lehrhaften Schönen Lebensgeschichte des guten und vernünftigen Bauersmanns Wendelinus von 1790 die Existenz von Hexen bestritten hatte.
Auch auf vielen anderen Gebieten schlugen sich die Menschen der neuen Zeit mit den ewigen alten Problemen herum. In Hungerjahren machten Scharen von Bettlern, die nicht immer von Räubern zu unterscheiden waren, die Landstraßen unsicher. Die Regierungen bauten Arbeits-, Zucht-, Waisen- und Invalidenhäuser und verpachteten die dort eingerichteten Manufakturen an Privatunternehmer. Zugleich lebten die überkommenen Strafrituale fort, das Stehlen wurde nicht nur angeprangert, sondern der Dieb oft genug wie eh und je leibhaftig an den Pranger gestellt. Und draußen vor den Stadtmauern verwesten an den Galgen die Leichen der Gehängten, als herrschte weiter das Mittelalter.
Und immer noch wurden Zöpfe geflochten, mochten im übertragenen Sinn auch viele schon abgeschnitten sein. Für die Zulassung zur Hoftafel brauchte man gleichwohl weiter den Adelstitel, sonst hatte man, wie Goethe bis zur Nobilitierung, an einer Nebentafel Platz zu nehmen, an der nicht der Fürst, sondern der Hofmarschall den Vorsitz führte. Beim Ball zeigte der Mann von Welt selbst in der Provinz bestrumpfte Waden unter einer bis zu den Knien reichenden bestickten Weste. Die höheren Damen erhöhten auch ihr Hinterteil und trugen »cul de Paris«, den »Unterziehsteiß«, wie Jean Paul das Po-Kissen wohlberechnet unerzogen nannte, ließen die Frisuren in den Himmel wachsen und montierten auf ihre Hüften Fischbeingestelle für Reifröcke, die so kostbar ausladend waren, dass sie nur seitwärts durch die Türen passten. Nach dem Ball ließ sich das bei seiner Toilette so tapfere ›schwache Geschlecht‹ in einer Portechaise nach Hause tragen, damit die Pantöffelchen an den Füßchen in den verwinkelten Gassen nicht von Schlamm und Kot beschmutzt wurden. Für die Herrn standen Mietlakeien mit Lampen bereit, um heimzuleuchten.
Waren in den kleinen Residenzstädten die Straßen für die großen Equipagen zu verwinkelt, so waren die Wege zwischen den Städten zu weit und abseits der Postrouten schockierend schlecht. Es schien leichter, bei Sturm über den Ozean zu fahren als bei Regen mit dem Pferdewagen von Weimar nach Erfurt oder Jena. Adele Schopenhauer war nicht die Einzige, die bei einer dieser irrsinnigen Überlandfahrten aus der Kutsche stürzte.
So fremd die dingliche Seite dieser Epoche wirken mag, in der mit Tinte und Feder (wenn auch schon mit welchen aus Stahl) geschrieben wurde, in der Kerzen so kostbar waren, dass Schlossdiener die Stümpfe stahlen, um sie an Arme-Leute-Kundschaft zu verkaufen, und in der elektrischer Strom noch nichts in Bewegung setzte außer die Beine geköpfter Frösche bei galvanischen Experimenten – so fern uns das alles ist, so nah sind wir den Menschen der Goethezeit in Gedanken und Gefühlen. An ihren rationalen Erwägungen und seelischen Erschütterungen, an ihren Leidenschaften und Interessen, an ihren Empfindlichkeiten und an ihrer Empfindsamkeit, an ihrer List und Hinterlist, ihrem Bewusstsein und Selbstbewusstsein können wir ohne Weiteres Anteil nehmen, können urteilen und verurteilen, mitleiden und mitlachen. Auf dieser Ebene braucht die Vernunft keine Kommentare und das Herz keine Fußnoten. Die überlieferten Lebenszeugnisse in Tagebüchern, Autobiografien und Briefen sind wie die Ränkespiele auf der Bühne oder die Intrigen im Roman ohne Weiteres zu verstehen, sobald es ums Menschliche geht.
Aus der Chaos-Epoche, die wir ›Goethezeit‹ nennen, gingen die geschichtlichen Voraussetzungen unserer eigenen Gegenwart hervor, und die Menschen, die diese Voraussetzungen schufen oder Zeuge ihrer Entstehung waren, sind in geistiger, seelischer und sogar körperlicher Hinsicht mit uns viel näher verwandt als etwa ein Warlord der Renaissance, ein Mönch des Mittelalters oder ein antiker Sklavenhalter. Nur wenig übertrieben ausgedrückt: Reisende in die Zeit um 1800 treffen bei der Ankunft auf ihresgleichen.
Reisevorbereitungen
Die Warnungen lassen sich ignorieren, Zeitreisen sind nicht gefährlicher als gewöhnliche Reisebeschreibungen, selbst wenn man fürs travelling den armchair verlässt wie die sanfte Ottilie in Goethes Wahlverwandtschaften: »Sie sprang in den Kahn und ruderte sich bis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde.« Ihr stößt bei dieser Lektüre nichts zu – wohl aber dem Säugling, der ihr anvertraut ist. Er fällt aus dem Kahn, und sie kann ihn nicht retten, weil sie wegen des aufgeschlagenen Buchs die Hand nicht gleich frei hat. Wenn Lesen gefährlich ist, wie harmlose Leute meinen, liegt das nicht am Gelesenen.
Man stelle sich vor, das Tor zur Vergangenheit wäre eine Art Sicherheitsportal ähnlich dem an unseren Flughäfen. Es würde anfangen zu piepen, wenn etwas nicht in die bereiste Epoche passt. Man käme erst durch die historische Schleuse, nachdem man alles Zeitfremde abgelegt hätte. Nichts, aber auch gar nichts dürfte man mitnehmen, völlig entblößt stünde man da. Weniger wegen der Mode als wegen des Materials, aus dem sie gemacht ist, ganz abgesehen von all unseren elektronischen Bild-, Text- und Sprechmaschinen. Vieles, was wir im Kopf haben, passt recht gut in die Goethezeit, aber alles, was wir am Körper tragen, müssen wir zurücklassen.
Dann stehen wir am 7. November 1775 morgens um fünf splitterfasernackt, aber wenigstens unsichtbar in Weimar vor dem Haus eines Kammergerichtspräsidenten namens von Kalb und sehen zu, wie Goethes Kutsche über das Pflaster rollt. Bei anderer Gelegenheit sitzen wir zwischen dem Berliner Aufklärer Anton Büsching und seiner Frau in der Kutsche. Das ist immerhin besser, als 1773 während eines Achttageritts von Berlin nach Danzig hinter dem Kupferstecher Daniel Chodowiecki auf dem Pferd zu hocken. Mit Büschings reisen wir für fünf Tage ins märkische Reckahn, um die philanthropische Reformschule des Landjunkers Eberhard von Rochow kennenzulernen. Ohne Rücksicht auf unsere von aller Gegenwart entkleideten Verfassung werden wir unter die Bauernkinder in die Bänke gesteckt. Ein Versuch, unsere Namen ins Holz zu ritzen, wäre vergeblich, nachträgliches Einschreiben in die Vergangenheit kann die Geschichte nicht dulden. Dafür könnten wir ohne Weiteres den Sprung von der Landschule an die Universität machen, in die Vorlesungen berühmter Philosophen: vor 1800 von Professor Kant in Königsberg, um 1800 von Professor Fichte in Jena und Erlangen, nach 1800 von Professor Hegel in Berlin. Weil wir unsichtbar sind, müssen wir kein Hörgeld bezahlen wie die anderen Studenten (Studentinnen gab es kaum), und falls wir, was sehr wahrscheinlich ist, die Ausführungen der Herren nicht sofort und ganz verstehen, können wir das Gehörte nach der Rückkehr in die Gegenwart in modernen kommentierten Werkausgaben nachlesen.
Etwaige Verständnisschwierigkeiten müssen uns nicht peinlich sein, es ging den Zeitgenossen ebenso, etwa Georg Ludwig Spalding (nicht zu verwechseln mit seinem Vater Johann Joachim). Henriette Herz erzählt in ihren Erinnerungen: »Ich begegnete eines Tages Professor Spalding, dem Philologen. ›Ach‹, rief er mir schon in der Entfernung einiger Schritte entgegen, ›morgen steht mir ein saueres Diner bevor! Im Laufe desselben soll ich ein Werk, das ich nicht ganz verstehe, in eine Sprache übertragen, die mir nicht geläufig ist.‹ Und es ergab sich, dass er zu Frau von Stael eingeladen war, um ihr beim Diner so nebenher ein philosophisches Werk Fichtes in französischer Sprache beizubringen.«
Aber Zeitreisende lernen nicht nur den philosophischen Zeitgeist kennen, sondern erleben auch handfeste Abenteuer, überstehen mit dem jungen Eichendorff einen Schiffsunfall auf der Oder, blicken am Berliner Gendarmenmarkt zu E.T.A. Hoffmanns Eckfenster hinauf, traurig darüber, dass oben der Gespensterschreiber im Sterben liegt, gequält von blutenden Wunden auf dem Rücken. Oder wir sehen zu, wie Georg Lichtenberg in Göttingen seinerseits durchs Fernglas der Beerdigung von Gottfried August Bürger zusieht.
Vielleicht stehlen wir uns auch in den Anatomiesaal von Jena, wo die Selbstmörderinnen obduziert werden, die in Weimar in die Ilm gegangen sind. Auf abgelegenen Rittergütern schauen wir fronenden Dreschern zu und beobachten, wie sie jeden Abend heimlich eine Handvoll Körner in ihren Hosentaschen vom Herrenhof schmuggeln, um sich für die erzwungene Arbeit wenigstens symbolisch zu entschädigen. In heruntergekommenen Dörfern blicken wir durch offen stehende Türen in Stuben, in denen halb verhungerte Familien an Webstühlen, die ihnen nicht gehören, aus Garnen, die ihnen nicht gehören, Stoffe herstellen, die ihnen nicht gehören. In Berlin begegnen wir einer Äpfelfrau auf dem Hackeschen Markt, einem Wacholdersaftverkäufer vor der Oper, einer Brezelverkäuferin vor dem Schloss: »Kauffen sie nicht schöne Spandosche Zimtpretzeln?«
An einem Tag begleiten wir unbemerkt eine Gräfin, die nicht einmal in der Lage ist, sich ohne die Hilfe ihrer Zofe anzuziehen, den nächsten Tag verbringen wir mit dieser Zofe, die nur besitzt, was sie auf dem Leib trägt, und außer sich gerät vor Dankbarkeit, wenn die Herrin ihr ein buntes Band schenkt. In der einen Stunde langweilen wir uns bei einem prunkvollen Souper in einer Residenzstadt, in einer anderen löffeln wir in einer verrußten Bauernkate Hirsebrei aus einer Holzschüssel. Im einem Augenblick sind wir unter den Straßenräubern, die Knüppel schwingend eine Kutsche überfallen, im nächsten unter den Reisenden, die hoffen, dass sie mit dem Leben und ohne Blessur davonkommen – und vielleicht auch, ohne die Goldstücke einzubüßen, die man sich unter die Achsel gesteckt oder, noch sicherer, ins Mieder genäht hat.
Dem Zeitreisenden kann im Unterschied zu den Zeitgenossen nichts passieren, was immer auch – geschehen ist. Zum Glück sind Touristen der Vergangenheit für Zeitgenossen unsichtbar, zum Unglück ist die Geschichte ein Geschehen, in das niemand mehr eingreifen kann. Nichts ist wiedergutzumachen, alles nur besser zu verstehen.
Dennoch schadet es nicht, zur Einstimmung gewisse Vorbereitungen zu treffen. Man könnte sich beispielsweise zum Ersatz für die Zahnbürste, die das historische Sicherheitsportal nicht passieren durfte, ein Läppchen zurechtschneiden und Zahnpulver aus geriebener Kohle oder aus verbranntem und zerbröseltem Brotteig in eine Emailledose füllen, deren Deckel ein Medaillonporträt des Alten Fritz trägt. Es zeigt ihn in der letzten Lebensphase, mit spitzem Zopf, spitzer Nase und eingefallenen Wangen. Er hat alle Zähne verloren und kann die Flöte nicht mehr blasen.
Die Tabatiere könnte aber auch das Merkpulver eines erzgebirgischen Apothekers trocken halten, damit man später alles gut erinnert, was man auf der Zeitreise erlebt: »Dieses wohl appretierte Extra feine Hirn und Fluß Pulver des Tags 2 bis 3 mahl geschnupft ist gut vor den Schwindel und Flüsen, stärket das Gedächtnis.«
Wenn man weder dem erzgebirgischen Pulver noch dem eigenen Gedächtnis traut, sollte man genug Federn bereitlegen, um alles aufzuschreiben, am besten Düsseldorfer Schreibfedern, wie Philipp Andreas Nemnich in seinem Tagebuch einer der Industrie gewidmeten Reise 1809 rät:. »Sie empfehlen sich durch vollkommene Klarheit, Zahnlosigkeit und Härte.« Jedes Bündel dieser Federn enthält 25 Stück. Sie »werden zu je 8 und 8 Bündel, d.i. 200 Stück, in Papier und mit vorgedruckten Nummern als Waare angeboten. Die Nummern zeigen die Qualität.« In der Tabatiere könnte man statt des Merkpulvers Sauerkleesalz aufbewahren, um die ›Dintenflecke‹ aus der Wäsche zu reiben.
Um während der Reise zu wissen, wie spät es ist, käme eine Taschenuhr infrage, vielleicht eine aus der 1765 von Friedrich II. in Berlin gegründeten Königlichen Uhrenmanufaktur. Man sollte nur gut auf sie achtgeben, besonders in den Menschenmengen bei öffentlichen Hinrichtungen. Nirgends wird mehr gestohlen als unter dem Galgen. Eine klappbare Taschensonnenuhr aus Holz wäre sicherer, wenn auch weniger praktisch, weil nur im Freien und am Tage benutzbar. Hilfreicher, aber auch umständlicher wäre eine der »Reise-Pendul-Uhren« des Weimarer Hofmechanikus Jacob Auch: »mit der ganzen Vorrichtung zum Arretiren, Einpacken und Aufstellen; in Mahagony-Gehäuse und Coffer von Eichenholz«.
Für Fußmärsche ist ein versteifter Felltornister empfehlenswert (er muss ja nicht gleich mit einem Dachskopf verziert sein wie der vom Syrakuswanderer Seume), für weite Kutschfahrten mit großem Gepäck eine eisenbeschlagene Holzkiste, für Herren erweitert durch einen Deckelaufsatz aus Blech, der aussieht wie ein Ofenrohr, aber für den (noch nicht klappbaren) Zylinder bestimmt ist, für Damen ergänzt durch (mindestens) eine Hutschachtel, deren Umfang nur wenig geringer ist als der Radumfang der Kutsche, mit der sie transportiert wird.
Zur Orientierung hilfreich wäre in Weimar Karl Gräbners Handbuch für Einheimische und Fremde: Die Großherzogliche Haupt= und Residenz=Stadt Weimar, nach ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen gesammten Verhältnissen dargestellt; zur Orientierung in Deutschland Vollrath Hoffmanns Handbuch der Vaterlandskunde für alle Stände. Zur Orientierung in der Welt kann man sich an ein Kompendium von Theophil Ehrmann halten, mit allem über alles für alle: Allgemeines historisch-statistisch-geographisches Handlungs-, Post- und Zeitungs-Lexikon für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reisende und Zeitungsleser: enthaltend in alphabetischer Ordnung eine genaue, planmäßig vollständige, historische, statistische und topographische Beschreibung aller Erdtheile, Länder, Staaten, Inseln, Bezirke, Gebiete, Herrschaften, Völker, Meere, Seen, Flüsse, Wälder, Berge, Städte, Vestungen, Schlösser, Stifter, Seehäfen, Handelsplätze, Fabrikörter, Gesundbrunnen und Bäder, Poststazionen, Flekken und überhaupt aller, in irgend einer Hinsicht bemerkenswerter Ortschaften und Gegenden der Erde.
Ebenso wichtig wie gewisse Grundkenntnisse sind gewisse Geldstücke – auch das ein Sachverhalt, den wir mit den Leuten der Goethezeit gemeinsam haben, obwohl es heute in ganz Europa nicht so viele verschiedene Währungen gibt wie damals in drei deutschen Herzogtümern. Jedenfalls war der zeitgenössische Reisende gut beraten, immer ein paar Groschen griffbereit zu halten, ›gute Groschen‹ wenn möglich, kurrent in allen deutschen Gegenden. Man benötigte sie, wenn man zu spät vor der Stadt ankam und die Tore schon verschlossen waren, um nach Entrichtung eines ›Sperrgeldes‹ doch noch eingelassen zu werden. Man brauchte sie aber auch, wenn die Tore offen waren, um die Torwächter zu beschwichtigen, damit sie das Gepäck nicht so aufreizend umständlich kontrollierten aus Verdruss übers Nicht-Bestochenwerden. Den armen Blumenmädchen, die in den Straßen Passanten ihre Sträuße aufdrängten, drückte man die Münze lieber in die Hand – falls man nicht schon bei der Fahrt über die Dörfer zu viele davon den Kindern zugeworfen hatte, die den Durchreisenden Sträuße in die Kutschen zu werfen pflegten und dafür Entgelt erwarteten. Dem Kutscher selbst rechtzeitig ein ›Trinckgeld‹ auszuhändigen war ebenso ratsam, denn wer gut schmiert, fährt gut, wie es (nicht nur über die Achsen) hieß. Ohne Schmiergeld betrank sich der Kutscher an der nächsten Poststation womöglich auf eigene Kosten, was nicht nur unangenehm, sondern wirklich gefährlich werden konnte, besonders nach Einbruch der Dunkelheit und bei unerfahrenen Pferden, die den Weg noch nicht allein wussten.
Nach glücklicher Ankunft im Gasthof brauchte auch der Bediente sein Groschengeld, sonst ließ er womöglich den ›Eichenholzcoffer‹ mit Auchs Pendul-Uhr fallen. Außerdem konnte man sich dann bei ihm erkundigen, wo in der Stadt die berühmten Leute wohnten, und ihn mit Visitenkarten zu ihnen schicken. War man selbst eine Berühmtheit, hatte beim Verteilen der Visitenkarten besondere Sorgfalt zu walten. Karl Ludwig Fernow berichtet in einem Brief an Karl August Böttiger über einen Besuch des russischen Zaren Alexander bei seiner Schwester, der Großfürstin Maria Pawlowna, im November 1805 in Weimar: »Was die Visitenkarten betrifft, so hat der Kaiser nicht nur allen Geheimenräten, sondern sogar den Hofdamen samt und sonders welche senden lassen, und es ist allerdings eine ehrende Aufmerksamkeit, dass auch eine auf des Kaisers ausdrücklichen Befehl an Wieland hat gesendet werden müssen, obgleich er weder Geheimerrat noch Hofdame ist. Es ist aber falsch, dass bloß Wieland und nicht auch Goethe dergleichen erhalten haben sollte.«
Hatte der Hotelbediente keine Zeit (oder keine Lust), sich um das Verteilen der Visitenkarten zu kümmern, musste man einen Laufdiener nehmen. Der kostete extra und erwartete ein Trinkgeld obendrein. Oder man mietete gleich einen ›Lohnlakei‹, wie es zum Beispiel ein anderer russischer Reisender, der junge Nikolai Karamsin, in Berlin gehalten hat. Über die Kosten gibt er keine Auskunft, aber aus Nicolais Berlinbeschreibung hätte er wissen können: »Ein Lohnlakei bekommt, polizeilich festgelegt, 12. Gr. pro Tag.« Am 6. Juli 1789 (acht Tage vor dem Sturm auf die Bastille) berichtet Karamsin von folgender Szene: »›Führe mich zu Moritz‹, sagte ich heute morgen zu meinem Lohnbedienten. – ›Wer ist das, Moritz?‹ – ›Wer das ist? Philipp Moritz, der Schriftsteller, der Philosoph, der Pädagog, der Psycholog.‹ – ›Warten Sie, warten Sie. Sie sagen zuviel auf einmal; man muss ihn im Adreßkalender unter irgendeinem Titel suchen; er ist also (indem er ein Buch aus der Tasche zog), er ist also ein Philosoph, wie Sie sagen? Wir wollen sehen …‹« Der Bediente stößt im Berliner Adressbuch auf keine Philosophenrubrik, aber nachdem Karamsin vorgeschlagen hat, er möge unter den Professoren nachsehen, ist die Anschrift schnell gefunden.
Der Autor dieses Zeitreiseführers übrigens würde den aufgesuchten Zelebritäten vorher nicht auf die Nase binden, dass er hinterher über sie schreiben will. Sonst könnte es ihm gehen wie Karamsin bei Wieland in Weimar. Eine Woche nach dem Sturm auf die Bastille, von der man in Weimar noch nichts wusste, wurde Karamsin nach zwei vergeblichen Versuchen erneut bei Wieland vorstellig (morgens um acht!), sah sich endlich empfangen und fragte: »Was fürchten Sie denn von mir?« Wieland antwortete: »Es ist jetzt in Deutschland Mode geworden, zu reisen und dann seine Reise zu beschreiben. Dergleichen Reisebeschreiber, deren Anzahl nicht gering ist, ziehen von Stadt zu Stadt und suchen mit berühmten Leuten nur deswegen zu sprechen, um das, was sie von ihnen hören, drucken zu lassen.«
Man fühlt sich beinahe ertappt. Doch geht es hier weniger um die Berühmtheiten als um normale Leute und weniger um die Literatur als ums Leben, das kleine und große Leben mit seinen Freuden, Leiden und Eitelkeiten (was hätte Wieland gesagt, wenn ihn keiner mehr aufgesucht hätte?), mit all dem, was Leute tun müssen oder nicht lassen können, je nachdem, in welche Rollen sie hineinfinden, in welchen Charakteren sie festwachsen oder aus welchen Verhältnissen sie ausbrechen.
Deutschland und der Lauf der Welt
Anfang der 1790er-Jahre erschien eine Art Animal Farm des europäischen Staatensystems: Darin wird das Land Brum-Brum von einem Löwen regiert, Kakerlak von einer schönen Hyäne, Mimi von einer Truthenne. Das dreibändige Werk hieß Die Regenten des Thierreichs und stammte aus der Feder von Johann Friedrich Albrecht. Im Löwen von Brum-Brum ist leicht Friedrich II. von Preußen zu erkennen, der 1786 gestorben war. Mit der Truthenne von Mimi ist Maria Theresia von Österreich gemeint, gestorben 1780, mit der schönen Hyäne Katharina II. von Russland, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch lebte (sie starb 1796). Auch Ludwig XVI. lebte noch. Bei Albrecht posiert er als Strauß, und tatsächlich steckte der französische König den Kopf so lange in den Sand, bis er ihn verlor (am 21. Januar 1793). Seine Anerkennung der neuen Machtverhältnisse kam zu spät, seine Flucht war tölpelhaft vorbereitet und misslang. Ludwigs Schicksal erschreckte auch in Deutschland, besonders natürlich Menschen, die selbst eine Krone (und darunter den Kopf) zu verlieren hatten.
Die Territorien der zahlreichen deutschen Landesherren bezeichnete Thierreich-Erfinder Albrecht als »Mischmasch«. Das klingt so grob satirisch wie seine übrige Nomenklatur, entsprach jedoch den sogenannten ›gewachsenen‹ politischen Verhältnissen. Das knapp tausendjährige Heilige Römische Reich Deutscher Nation bestand aus rund dreihundert Territorien, von Kurfürstentümern und Großherzogtümern bis zu Mini-Grafschaften; von Erzbistümern bis zu Prälaturen mit derart winziger Fläche, dass die Würdenträger sie fast mit ihren Schärpen hätten bedecken können oder »oft kaum so groß«, wie Anselmus Rabiosus alias Wilhelm Ludwig Wekhrlin über die schwäbischen Verhältnisse schreibt, »dass ihr Erdkreis die Tabatiere des Regenten ausfüllt«. Der Publizist Johann Kaspar Riesbeck konstatiert in seinen fingierten Briefen eines reisenden Franzosen: »Unter allen Kreisen des deutschen Reiches ist der schwäbische am meisten zerstückt. Er zählt nicht mehr als 4 geistliche und 13 weltliche Fürstentümer, 19 unmittelbare Prälaturen und Abteien, 26 Graf- und Herrschaften und 31 freie Reichsstädte.«
Die politische Landkarte der deutschen Territorien (hier nach dem Stand von 1789) wurde wegen ihrer bunten Unübersichtlichkeit von Zeitgenossen mit einer Harlekinsjacke verglichen.
Insgesamt gab es von diesen Städten über vier Dutzend. Die größte hatte 150000 Einwohner (Hamburg), die kleinsten blieben unter 500 (Kempten, Offenburg, Ravensburg, Schweinfurt). Hinzu kamen die Grund-, Guts- und Lehensherren, all die Barone und Ritter, die faktisch souverän über ihre Dörfer und über die ›schollengebundenen‹ (westlich der Elbe) oder leibeigenen Bauern (östlich der Elbe) herrschten. Bis hinab auf die Kreise herrschte vielfältiges Durcheinander. Der Kreis Teltow zum Beispiel bestand nach der Beschreibung Büschings in seiner Reise nach Reckahn Mitte der 1770er-Jahre aus einem »Hauptkreis«, einem »Aemter Kreis« und der »Herrschaft Wusterhausen und Teupitz, welche […] dem Prinzen von Preußen [Friedrich Wilhelm] gehört.« Der »Hauptkreis begreifet […] das Königliche Amt Cöpenick mit seinem Zugehör; Unterschiedene Königl. Vorwerke und Dörfer, welche unter den Aemtern Mühlenhoff im Niederbarnimschen, Saarmund im Zauchischen, Potsdam und Spandau im Havelländischen Kreise stehen; fünf Aemter des Prinzen von Preußen, nemlich Gallun, Groß-Machenow, Rotzis, Selchow und Waltersdorf. Die kleine adeliche Stadt Teltow, 41 adeliche Dörfer, ein Dorf und Vorwerk, welches dem Magistrat zu Mittenwalde, 3 Dörfer, welche dem Magistrat zu Berlin, und 2 Dörfer, welche der Domkirche in Berlin gehören.«
In anderen Teilen Deutschlands ging es ebenfalls bunt zu, bunt wie eine aus Flecken zusammengenähte Harlekinsjacke. Ein halbes Jahrhundert nach Büsching zählt Carl Julius Weber in seinen Reisebriefen die sechs Kreise des Großherzogtum Badens auf, und über den sechsten, den »Main- und Tauberkreis«, heißt es: »Leider! besteht fast der ganze letztere Kreis aus standesherrlichen Besitzungen der Fürsten und Grafen von Leiningen, Löwenstein, von der Leyen […] und einer Menge grundherrlicher Güter. Baden zählt acht Standesherren und einundachtzig Grundherrn mit etwa neunzig Quadrat-Meilen und 300000 Seelen!«
Die französische Schriftstellerin Madame de Stael fasste die politische Geografie des Reichs in ihrem Deutschlandbuch 1810 so zusammen: »Es gibt nur wenig Hauptpunkte, in denen die Gesamtheit der deutschen Nation übereinstimmt, denn die Unterschiede sind in diesem Lande so groß, dass man nicht weiß, wie man so verschiedene Religionen, Regierungsformen, klimatische Verhältnisse und selbst Völkerstämme unter ein und denselben Gesichtspunkt bringen soll. Das südliche Deutschland ist in vielen Beziehungen ganz anders als das nördliche, die Handelsstädte ähneln in keiner Hinsicht den Universitätsstädten [allerdings gab es Städte, die wie Leipzig beides waren], und die Kleinstaaten unterscheiden sich merklich von den beiden großen Monarchien, Preußen und Österreich.«
Die territoriale Zerstückelung Deutschlands mit seiner politschen, rechtlichen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Unübersichtlichkeit ist von vielen beklagt worden, am wenigsten von alteingesessenen Aristokraten, am meisten von neu aufstrebenden Kaufleuten. Deren Geschäfte litten unter den verschiedenen Währungen, den zahllosen Zöllen, den vielfältigen Steuern und Stapelgebühren sowie den Brücken-, Chaussee- und Torgeldern; vor allem aber unter den wechselnden Gewohnheiten, die oft gewohnheitsmäßiger Willkür ähnelten. Das trieb die Korruption hervor und beförderte den Schmuggel, vom ›offiziell‹ durch Bestechung gesicherten Gütertransport durch die Stadttore bis zum nachts über die Stadtmauer geworfenen Kaffeesack, von dem eine der psychosozialpathologischen Geschichten im Magazin für Erfahrungsseelenkunde von Karl Philipp Moritz berichtet.
Die Unübersichtlichkeit hatte sich so ausgeweitet, dass mit dem wiederum durch Bestechungsdiplomatie zustande gekommenen »Reichsdeputationshauptschluss« 1803 in Regensburg 112 Reichsstände aufgehoben werden konnten, ohne dass die deutsche Vielfalt darunter besonders litt. »Wir kommen nicht einmal zu einem rechten Nationalfluche«, hatte der Osnabrücker Regierungsbeamte Justus Möser schon Jahrzehnte zuvor in den Patriotischen Phantasien geschrieben, »jede Provinz flucht und schimpft anders«. Osnabrück war mit 8100 Quadratkilometern eines der deutschen Mimimalterritorien, wobei schon das ›deutsch‹ problematisch war. Das Bistum musste, eine weitere Besonderheit, nach seiner Verfassung abwechselnd von einem katholischen und einem evangelischen Landesherrn regiert werden. Nach dem Tod des katholischen Bischofs 1761 war ein Nachfolger aus dem Haus Braunschweig-Lüneburg an der Reihe, das dem englischen König Georg III. unterstand, der gleichzeitig Herzog von Braunschweig-Lüneburg war und dem Haus Hannover entstammte. Die deutsche Unübersichtlichkeit wurde durch die in ganz Europa quer zu den staatlichen Territorien liegenden Familienverbindungen des Hochadels, einschließlich der dadurch hervorgerufenen Erbstreitigkeiten (und Erbfolgekriege), weiter verstärkt.
Was den ›Nationalfluch‹ angeht, machte später Carl Julius Weber einen Einigungsversuch: »Schwerenoth«. Oder »Sakerment«. Und schon gab er auf: »Im Ganzen aber flucht doch jede Provinz wieder anders. In Schwaben ist Potz Blitz einheimisch, in Baiern Sauschwanz, in Oesterreich Talk, Schlankerl, in Franken Quad, in Preußen Gott straf mir« (mit korrekt verkehrtem Dativ). Immerhin nennt Weber wenigstens ein Nationalspiel: das Kegeln; eine Nationalkrankheit: die philosophische ›Systemsucht‹; eine ›Nationalthorheit‹: die ›Titelsucht‹. Die Mode hingegen »richtet sich, da wir zu keinem Nationalkleide gelangen konnten, leider! immer noch nach Paris oder London – Diplomaten, Stutzer und Kaufmannsdiener tischen sie zuerst auf, dann verliert sie sich in die kleinen Landstädtchen und Handwerksburschenwelt, während in der höhern Welt wieder neue Thorheiten an der Tages-Ordnung sind.« Selbst beim Kaffee war man sich nicht einig. In den 1780er- und 1790er-Jahren konkurrierten unter der Bezeichnung ›Teutscher Caffee‹ Ersatzkaffees aus Zichorienwurzeln, Rübenschnitzeln und Eicheln.
Es gab kaum Stael’sche ›Hauptpunkte‹ der Übereinstimmung in Deutschland: keine Hauptstadt, kein Machtzentrum, keinen Nationalfluch, keinen gemeinsamen Kopf, kein gemeinsames Herz. Aber immerhin einen Nabel. Der reisende Überflieger Jonas Ludwig Heß schrieb in seinen Durchflügen, wo er lag: »Der fränkische Kreis ist der Nabel des deutschen Reichs, und von ihm aus muß die Theilungslinie zwischen den nördlichen und südlichen Germanien gezogen werden, welcher, so viel ich von der Sache weiß, bisher weder Mittel- noch Endpunkt angewiesen ist.«
Trotz des vielfältigen Spottes über die politische Vielfalt fand sie auch ihre kulturellen Verteidiger, nicht nur bei den Nostalgikern des Mittelalters. Wieland in Weimar zum Beispiel, der Autor des Agathon (1766), verglich den ›Aggregatzustand‹ der deutschen Nation mit dem des alten Griechenland und veredelte die politische, organisatorische und verfassungsrechtliche Rückständigkeit ins Antike. Carl Julius Weber zog ebenfalls den Vergleich mit Griechenland, allerdings ohne Veredelung: »Wir sind schon vertheilt geboren, wie die Griechen!«
Goethe stimmte Wieland zu, und zusammen mit Schiller definierte er Deutschland als Kulturnation in bewusster Abgrenzung zu einer Nationalstaatlichkeit, die auf politischer und wirtschaftlicher Macht beruhte. Gleichwohl klagte der um seine Tantiemen fürchtende Dichter, die deutsche ›Vielländerei‹ erleichtere den Raubdruck.
Allerdings verunmöglichte sie zugleich eine zentrale Zensurbehörde, was der »Wohltat der Preßfreiheit« zugute kam, wie Walter Scott in seinem Leben Napoleons über die deutsche Zersplitterung bemerkte – und wie Madame de Stael spürte, deren Deutschlandbuch von der napoleonischen Zensur sofort verboten wurde. Durch de Staels Sympathie für die deutsche Kultur klang ihre Ablehnung der französischen Politik, ganz ähnlich, wie einst Tacitus die Germanen idealisiert hatte, um den Sittenverfall in Rom zu geißeln.
Adelbert von Chamisso zitierte Scotts Betonung des Zusammenhangs zwischen staatlicher Zersplitterung und publizistischer Freiheit in seinem Bericht einer Erdumseglung und fügte hinzu: »Was er von Deutschland sagt, gilt von der Welt.« Der Hintergrund dieser Bemerkung wird deutlich durch Chamissos Hinweis auf »London, das nächst und abwechselnd mit Paris die Geschichte für die übrige Welt macht und verkündigt«.
London und Paris waren die bevölkerungsreichsten Städte Europas[2]. England und Frankreich waren die wichtigsten Mächte einer Welt, die nach den europäischen Eroberungen um 1500 zwischen 1750 und 1830, also nahezu passgenau in der Lebenszeit Goethes, die zweite Phase einer Art ursprünglichen Globalisierung durchlief. Es »schießen die Schiffe als Weberschiffchen hin und her und weben Weltteile und Inseln aneinander«, heißt es bei Jean Paul aus der Heimatperspektive des Feldpredigers Schmelzle auf einer »Reise nach Flätz«. Die Beobachtung ist, wie oft bei Jean Paul, sachhaltiger, als die ›humoristische‹ Formulierung vermuten lässt. Dass die Schiffe des Welthandels mit Weberschiffchen assoziiert werden, hat mit dem internationalen Baumwollhandel und den nationalen Textilindustrien zu tun. Die Schiffe transportierten in Indien hergestellte und zum Re-Export nach England eingeführte, später in England selbst hergestellte Baumwolltextilien an die westafrikanische Küste, tauschten die Ware gegen Sklaven, brachten die Sklaven nach Amerika und kehrten beladen mit Baumwolle zurück. Bei anderen Welthandelsverbindungen ging es um das Geschäft mit den »Colonial-Waaren« Zucker, Tee, Kaffee, Pfeffer und Tabak. An diesen Geschäften hatten Spanien, Portugal oder die holländische Ostindien-Kompanie ihren Anteil. Gleichwohl konnten nur Frankreich und England Weltmachtansprüche stellen. Friedrich Schiller hatte, jedenfalls diesbezüglich, ganz recht, wenn er 1801 in einem universalgeschichtlichen Gelegenheitsgedicht reimte: »Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden,/Und das neue öffnet sich mit Mord.//Und das Band der Länder ist gehoben,/Und die alten Formen stürzen ein;/Nicht das Weltmeer hemmt des Krieges Toben,/Nicht der Nilgott und der alte Rhein.//Zwo gewaltge Nationen ringen/Um der Welt alleinigen Besitz,/Aller Länder Freiheit zu verschlingen,/Schwingen sie den Dreizack und den Blitz.«
Gemessen am globalen Einfluss der ›neptunischen‹ Seemacht England und der kanonendonnernden Landmacht Frankreich war jedes deutsche Kurfürstentum eine lokale Größe, in politischer wie ökonomischer Hinsicht. »Unsere Kaufmannssöhne«, klagte Justus Möser und meinte damit nicht nur die von Osnabrück, »spazieren nach Bremen und Hamburg. Nach Cadix, nach Lissabon, nach Smyrna, nach Aleppo, nach Kairo sollten sie gehen, sich um dasjenige bekümmern, was dort mit Vorteil abgesetzt werden kann, sich dort Bekannte und Assoziierte erwerben und dann handlen.« Man hatte wenig Einfluss auf internationale Geschäfte, sondern unterlag ihm vielmehr selbst, etwa hinsichtlich der Bedeutung der europäischen Silbereinfuhren für die Produktpreise in den Reichsprovinzen. Ein Kaufmann aus Breslau schrieb 1774: »Man meldete uns schon im Januar, dass ein Teil der spanischen Flotte aus Havanna angekommen wäre; dass der Rest derselben erwartet würde, und dass sie zusammen 38 Mill. Piasters an Bord hätten. Dieser Umstand wirkte mächtig auf unsere Leinwandmanufakturen im Gebirge.« Auch von den Schweizer Bergen hallte das Echo der Welt. »Der ganze nun allenthalben durch Geldinteresse eng verbundene Erdball stosset gegen das Befriedigende der eingeschränkten Geniessungen«, stellte der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi 1782 in seinem Schweizerblatt fest, Bauer wie Bürger seien »an Ost- und Westindien, an Amerika und Asia angebunden.« Philipp Andreas Nemnich schreibt 1809 im Tagebuch seiner ›industriellen Reise‹ durch Deutschland über die Flachsweber in den Dörfern um Göttingen: »Die flächsenen Linnen sendet der inländische Kaufmann größtentheils nach Bremen, einiges auch nach Hamburg. Von da geht die Waare entweder über Cadiz oder direkte nach Westindien und dem spanischen Amerika.«
Die ›Globalisierung‹ jener Jahre warf selbst in abgelegenen preußisch-polnischen Kleinstädten ihre Bilder an die Wand. Karl Friedrich Klöden berichtet, wie er als Halbwüchsiger Ende der 1790er-Jahre in Friedland die ›Laubhütte‹ eines Juden aus der Nachbarschaft ausmalte: »ich hatte Cooks Seereisen gelesen, […] außerdem entzündeten die damals durch die Zeitungen veröffentlichten ersten Berichte Alexanders v. Humboldt von seiner Reise in Südamerika durch ihre lebhaften Schilderungen meine Einbildungskraft, und so komponierte ich denn die Landung der Engländer auf Otaheiti […], denen ich Momente aus Humboldts Reisen hinzufügte. Obgleich ich mich damit nicht wenig quälte, so wurden es doch herzlich schlechte Bilder, gemalt mit Kienruß, Fernambukabsud, Ockerfarben, Gänsegalle und was sich sonst Färbendes darbot.« Der Sohn eines Berliner Unteroffiziers, der in einer Kleinstadt des zwischen Preußen und Russland aufgeteilten Polen das kümmerliche Amt eines Toreinnehmers versieht, schmückt die Hütte eines jüdischen Nachbarn in dürftigsten dörflichen Farben mit der Landung der Weltmacht England auf der Südseeinsel Tahiti. Mochten die Bilder auch »herzlich schlecht« gewesen sein, schöner war die bizarre Dimension der globalen Welt nicht zu illustrieren.
Das gerühmte und gefürchtete Preußen, von Friedrich zur ›mitteleuropäischen Großmacht‹ emporgekämpft, zählte im internationalen Vergleich bloß als Provinz, die eine andere (Schlesien) in drei Kriegen an sich gerissen und festgehalten, und als mittleres Königreich, das ein anderes (Polen) zwischen sich und Russland aufgeteilt hatte. Am globalen Geschäft hatte Preußen nur wenig Anteil. 1750 war eine »Asiatische Handelskompanie« mit vier Schiffen gegründet worden. Das Flaggschiff »König von Preußen« konnte man nicht selbst bauen, sondern beauftragte eine englische Werft. Drei Jahre nach der »Asiatischen« folgte die »Bengalische Kompanie«. Der Siebenjährige Krieg unterbrach den Handel bald wieder. Die nach dem Krieg gegründete »Levantische Kompanie« machte 1769 Pleite. Die 1772 von Friedrich in Stettin etablierte »Preußische Seehandlung« konzentrierte sich auf den innereuropäischen Handel, wandelte sich im frühen 19. Jahrhundert zur preußischen Staatsbank und erweiterte sich allmählich zu einem Mittelding zwischen Industrieunternehmen und Industrialisierungsbehörde. Die Förderung der Dampfschifffahrt auf Spree, Havel und Elbe trat an die Stelle des Handels über die Ozeane.
Der Konkurrenzkampf zwischen England und Frankreich um die Welt ist jedoch selbst nur ein Aspekt der Geschichte, eben der europäische, genauer gesagt: der nordwesteuropäische. Aus globaler Perspektive handelte es sich um einen zwei Jahrhunderte dauernden Prozess des ökonomischen Niedergangs des ostasiatischen Weltsystems um China und des Aufschwungs des euroamerikanischen Weltsystems um England. Um 1800 kreuzte sich die absteigende mit der aufsteigenden Linie, jedenfalls was die statistisch rekonstruierbaren ökonomischen Daten angeht. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich eine Entwicklungsdynamik durch, die zur globalen Dominanz des ›Westens‹ führte. »Wie kam also Europa zu seiner Kultur und zu dem Range, der ihm damit vor andern Völkern gebühret?«, fragte Herder in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit. Eine Frage, die von ›Welthistorikern‹ und ›Globalgeschichtlern‹ immer noch gestellt und noch immer nicht beantwortet ist. Nur Europas Vorzugsrang würde heute nicht mehr mit der gleichen naiven Überheblichkeit reklamiert. Carl Julius Weber hat das vorhergesagt: »Wir sprechen von einem europäischen Staatensystem, künftige Geschlechter werden von einem Weltstaatensystem sprechen«. Der ›Geschichtsphilosoph‹ Herder indessen brachte es in seinem Eckchen hinter der Weimarer Stadtkirche fertig, von China als von einem Land zu sprechen, das »im östlichen Winkel Asiens unter dem Gebirge liegt«.
Die Welt war weit, Weimar ließ sich in einer Viertelstunde durchqueren. Hier verlor man keine Provinzen, allenfalls silberne Löffel: »Es ist heute Morgen ein silberner Teelöffel mit Wasser auf die Straße geschüttet worden; wer ihn gekauft oder gefunden hat, wird gebeten, ihn gegen eine kleine Vergütung abzuliefern.« Diese Anzeige stand am 29. September 1805 im Weimarischen Wochenblatt. Teelöffel braucht man nur, wenn man Tee hat; und Tee bekommt man nur, wenn Schiffe um die Welt fahren. »Selbst in den alltäglichen Verrichtungen des bürgerlichen Lebens können wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menschheit steuern zu unserer Kultur, wie die entlegensten Weltteile zu unserm Luxus. Die Kleider, die wir tragen, die Würze an unsern Speisen und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unsrer kräftigsten Heilmittel und ebenso viele neue Werkzeuge unsers Verderbens – setzen sie nicht einen Kolumbus voraus, der Amerika entdeckte, einen Vasco da Gama, der die Spitze von Afrika umschiffte?« So erklärte Schiller Ende Mai 1789 den herbeigeströmten Studenten bei seiner Jenaer Antrittsvorlesung über das Studium der Universalgeschichte, wie die Behaglichkeit daheim mit den Weltverhältnissen und der Weltgeschichte zusammenhing.
Der forsche Optimismus dieser Vorlesung hielt sich so wenig wie ihr kulturelles Überlegenheitsgefühl. Die Freiheit, so schien es, ist nicht von dieser Welt. Aus Schillers ›Jahrhundertgedicht‹ von 1801: »In des Herzens heilig stille Räume/Musst du fliehen aus des Lebens Drang,/Freiheit ist nur in dem Reich der Träume,/Und das Schöne blüht nur im Gesang.«
Um »aus des Lebens Drang« in »des Herzens heilig stille Räume« zu fliehen, war Weimar nicht der schlechteste Ort, obwohl die Weltgeschichte in Gestalt plündernder französischer Soldaten 1806 über die Stadt hereinbrach. In dieser ›historischen Stunde‹ handelte Goethes Bettgefährtin, Hausmagd und Kindesmutter Christiane Vulpius so umsichtig, dass Goethe die Verbindung gegen alle gesellschaftlichen Widerstände, auch die von Schiller und dessen aufgebrachter Gattin, endlich ›legitimierte‹. Nach der ›Völkerschlacht‹ 1813 ritt Napoleon nicht mehr als »Weltgeist zu Pferde« durch die Stadt – diese Rolle hatte ihm Hegel in Jena auf den Leib philosophiert –, sondern machte sich auf gespenstische Weise in einer Kutsche davon.
Immerhin hatte Napoleon nach der preußischen Niederlage von 1806 dem Weimarer Herzog Würde und Land gelassen, obwohl Carl August als Offizier in preußischen Diensten auf so viel Rücksicht nicht rechnen konnte. Wie bei Goethe war es auch beim Herzog die Frau des Hauses, die rettete, was zu retten war. Die burschikose Christiane brachte randalierende französische Soldaten zur Räson, die mutige Louise trat dem ›Empereur‹ selbst mit Erfolg entgegen. Carl August durfte sich weiter Herzog nennen. Nach dem Zusammenbruch des Systems Napoleon wurde Sachsen-Weimar-Eisenach auf dem Wiener Kongress 1815 zum Großherzogtum und Carl August zur »Königlichen Hoheit« aufgewertet.
Wenn man es genau nimmt, obwohl das nicht einmal die Zeitgenossen wollten oder konnten, war Sachsen-Weimar-Eisenach de iure noch gar kein Herzogtum, als Louise es verstand, Napoleon zu beeindrucken. Sachsen-Weimar und Sachsen-Eisenach waren zwei Fürstentümer, vereint unter einer Landesherrschaft. Deshalb durfte Carl August den Herzogtitel führen. Die Fürstentümer wurden juristisch jedoch erst im Dezember 1806 zum Herzogtum – mit dem Beitritt zum Rheinbund, der von Napoleon abhing.
Die Fürstentümer Weimar und Eisenach hatten jeweils eigenständige Behördensysteme mit Regierung (Gerichtswesen, Verwaltung), Oberkonsistorium (Kirche, Schulwesen) und Kammer (Finanzverwaltung). Bis zur »Konstitution der vereinigten Landschaft der Herzoglichen Weimarischen und Eisenachischen Lande mit Einschluss der Jenaischen Landesportion« im Jahr 1809 waren nicht einmal die Grundsteuern einheitlich. Zudem gab es in jedem Fürstentum landständische Vertretungen: die Rittergüter, die Städte und die Universität Jena. Die Verwaltung der Universität musste nicht nur mit der Universität selbst, sondern auch zwischen Weimar und Eisenach abgestimmt werden, weil das Amt Jena zu Eisenach gehörte. Auch im Landtag der Verfassung von 1816 hatte die Universität einen eigenen Sitz, neben jeweils zehn Sitzen für die Ritter, zehn für das Bürgertum und, erstmals, zehn für die (landbesitzenden) Bauern.
Die landesherrlichen Verhältnisse in Thüringen entsprachen in ihrer kleinformatigen Mannigfaltigkeit der Situation im ganzen Deutschen Reich. So gehörte die Stadt Erfurt zu Kurmainz und wurde 1803 preußisch. Erfurt war wichtig für Weimar, aber auch lästig. Zum Beispiel machten die Erfurter Schuster während der Weimarer Jahrmärkte den eingesessenen Handwerkern Konkurrenz. Und nach der Revolution von 1789 trieben die neunhundert französischen Emigranten in Erfurt die Lebensmittelpreise auch in Weimar in die Höhe.
Neben Sachsen-Weimar-Eisenach gab es noch Sachsen-Gotha-Altenburg und Sachsen-Coburg-Saalfeld (aus beiden ging 1826 Sachsen-Coburg-Gotha hervor). Hinzu kamen Sachsen-Hildburghausen und Sachsen-Meiningen. Doch damit ist die Sach- und Machtlage immer noch nicht vollends geklärt. Das Dorf Lichtenhain etwa lag zwar auf dem Gebiet von Sachsen-Weimar, gehörte aber zu Sachsen-Meiningen. Es erweiterte dessen gewaltiges Staatsgebiet (elf Quadratmeilen[3]) und fügte den 50000 Einwohnern ein paar weitere Seelen hinzu.
Sachsen-Weimar-Eisenach war der Riese unter den Zwergen, wenn auch gewissermaßen nur ›zweitriesig‹ nach Sachsen-Gotha, jedenfalls bis zur Gebiets- und Einwohnerverdoppelung auf dem Wiener Kongress. Bis dahin hatte Sachsen-Gotha-Altenburg so viel Einwohner mehr als Weimar-Eisenach, als Sachsen-Meiningen überhaupt zählte. Auch Weimar selbst konnte sich mit Gotha nicht messen, weder was die Zahl der Einwohner (um 1800 Weimar 7500, Gotha 11000) noch die fürstliche Pracht noch den bürgerlichen Reichtum anging. Das größte und schönste Haus in Weimar hatte Justin Bertuch. Das Dach war mit Ziegeln gedeckt, nicht mit Schindeln wie die Dächer der meisten anderen Häuser, für deren Dachstühle Ziegel zu schwer gewesen wären. Der umtriebige Bertuch war Verleger, Autor, Unternehmer und Finanzberater. Er war seit 1782 Teilhaber an Wielands Teutschem Merkur, gründete 1786 das erfolgreiche Journal des Luxus und der Moden, machte sich schriftstellerisch Gedanken um die »ausländischen Colonial-Waaren«[4] und unterhielt eine ›Fabrique‹ für Kunstblumen. Die Zahl der dort beschäftigten zehn Näherinnen verhielt sich zu den 140 Arbeiterinnen einer in Berlin betriebenen Kunstblumenfabrik fast wie die Einwohnerzahl Weimars zu der Berlins. Eines von Bertuchs Nähmädchen war Christiane Vulpius, bis Goethe sie 1788 in sein Haus holte.
Ankunft in Weimar
»Die Stadt Weimar an sich selbst ist nicht schön«, gibt Karl Gräbner in seinem Handbuch von 1830 unumwunden zu und macht nur einen matten Versuch, dieses Urteil einzuschränken: »doch hat sie einzelne schöne Straßen und Gebäude«. Nicht einmal die hat drei Jahrzehnte früher Friedrich Albrecht Klebe, ebenfalls Beschreiber der »berühmten Residenzstadt Weimar«, vorgefunden. »Krumme Straßen durchziehen sie nach allen Richtungen, und die Häuser, welche meistens nur zwei, selten drei Stockwerke haben, zeugen von dem Alter dieses Orts. […] Die öffentlichen Plätze sind nicht besser als die Marktplätze mancher kleinen Landstadt. Der Markt ist ein sehr unregelmäßiges Viereck, das sich durch nichts auszeichnet. […] Am Ende der vier Hauptstraßen, die nach dem Topfmarkt führen, sind zu beiden Seiten hohe Steine angebracht, an welche starke Ketten befestigt sind, die des Sonntags während der Predigt in der Hauptkirche [also der Stadtkirche] quer vor die Straßen gezogen werden, so dass kein Fuhrwerk über den Topfmarkt fahren kann. Im Winter werden die Straßen abends durch Laternen erleuchtet.« Die ersten davon waren in den 1750ern aufgestellt worden und brannten mit Fischtran. Dass Weimar kein heißes Pflaster war, aber ein lautes blieb, bewiesen noch im Jahr 1823 die ›Polizeisoldaten‹, die während einer Erkrankung von Großherzogin Louise im April am Schloss aufgestellt wurden, damit die Kutschen und Karren schön langsam vorüberfuhren und nicht so viel Krach machten mit ihren beschlagenen Rädern. Jedenfalls wirkte die Stadt nur von Weitem idyllisch: »Die Lage von Weimar hat sehr viel Angenehmes. Es liegt in einer lachenden fruchtbaren Gegend, die sich hier und da in reizende Hügel erhebt, welche mit Gebüschen bedeckt, oder als Felder angebaut sind. Auf der Seite nach Erfurt, rechts von der Chaussé, erhebt sich allmählich der hohe Ettersberg, auf dem man eine weite Aussicht genießt. Die Stadt selbst erstreckt sich etwas abhängig nach dem romantischen Thal zu, welches die Ilm durchfließt.«
Das Erfurter Tor in Weimar, 1792 »aufgenommen nach Natur« von Konrad Westermayr.
Weimar war nicht nur keine repräsentative oder elegante, es war eine abgebrannte Stadt – im übertragenen wie im Wortsinn: Die Kassen waren leer, das Schloss lag in Trümmern. Die Sanierung der herzoglichen Privatschatulle hatte kurz vor Goethes Ankunft Justin Bertuch übernommen, Goethe selbst musste 1782 kommissarisch die Leitung der staatlichen Finanzverwaltung übernehmen. Das Schloss war bereits anderthalb Jahre vor Goethes Ankunft durch ein vermutlich in der Küche ausgebrochenes Feuer zerstört worden. Es sollte fast dreißig Jahre dauern (und statt der geplanten 130000 Taler fast 700000 kosten), bis der Palast wieder bezogen werden konnte.
Im Mai 1774 brannte das Weimarer Schloss ab. Der Wiederaufbau wurde (wie üblich) teurer als geplant und dauerte (wie üblich) sehr viel länger.
Aber schließlich dauerte es auch über ein halbes Jahrhundert, von Goethes Ankunft gerechnet, bis 1830 die Lotte vollständig eingehaust war, jene schönfärberisch oder eher schönriecherisch als ›Bach‹ bezeichnete Kloake, die nur mit Schrittsteinen überdeckt durch die Gassen floss. Die »wasserreichen, versehenen, wohlverteilten Kanäle«, von denen Goethe bei seinem Lob der Kleinstadt in Hermann und Dorothea später schwärmte, hatte er in Weimar nicht vorgefunden.
Immerhin legte man Ende der 1770er-Jahre einen Park an, untersagte 1779 das Aufhängen von Wäsche an der Stadtkirche, an der seit drei Jahren Herder predigte, noch nicht durch Sperrketten vom Straßenlärm geschützt. Im Januar 1780 eröffnete ein Komödienhaus. In den folgenden Jahren wurde die Straßenbeleuchtung erweitert und die Chaussee nach Erfurt und Jena ausgebaut. Gegen Ende des Jahrzehnts, als in Paris das Volk die Bastille stürmte, beschloss die Obrigkeit von Weimar, das nächtliche Klettern über die Stadtmauer mit einem Bußgeld von sechs Talern zu belegen. Und in dem Jahr, in dem man in Paris den König köpfte, untersagte man in Weimar das Auskippen der Nachttöpfe auf die Straße auch für die Zeit nach 23 Uhr. Im großen Berlin wurden unterdessen die Töpfe zur Spree getragen, wie Georg Friedrich Rebmann auf seiner Kosmopolitischen Wanderung kurz vor dem »abscheulichen Königsmord« beobachtete: »Nach zehn Uhr kommen alte hässliche Weiber und gießen links und rechts mit gellendem Geplätscher die Unreinigkeiten von 167000 Menschen in die Spree, die, zumal in den Kanälen, einer Mistpfütze gleicht.«