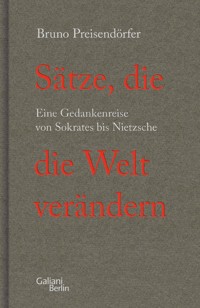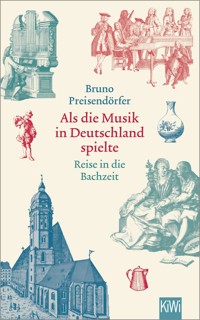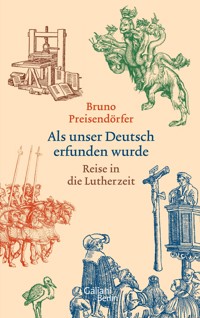16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Verwandlung der Dinge: Eine faszinierende Zeitreise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände Bestsellerautor Bruno Preisendörfer nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Alltagsgegenstände und wie sie unser Leben verändert haben. In seinem neuesten Werk Die Verwandlung der Dinge blickt er zurück auf seine eigenen Erfahrungen seit den 1960er Jahren und reflektiert mit Neugier, Nostalgie und verschmitztem Staunen über die rasante technologische Entwicklung. Von der Schiefertafel über den Rechenschieber bis hin zu Fernseher, Radio und Schreibmaschine - Preisendörfer beleuchtet mit stilistischer Raffinesse, wie diese Kulturtechniken unser Sozialgefüge beeinflusst haben. Er zeigt, wie sich das gemeinsame Fernsehen von der Tablet-Nutzung unterscheidet, wie sich das Musikhören von der LP zum Streaming gewandelt hat und wie das Telefon die Kommunikation revolutioniert hat. Mit wachem Blick und philosophischem Tiefgang ergründet Preisendörfer die Bedeutung dieser Alltagsgegenstände für uns als Individuen und als Gesellschaft. Die Verwandlung der Dinge ist eine fesselnde Betrachtung darüber, wie Technologie unsere Vergangenheit geprägt hat - und wie sie unsere Zukunft gestalten wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bruno Preisendörfer
Die Verwandlung der Dinge
Eine Zeitreise von 1950 bis morgen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bruno Preisendörfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bruno Preisendörfer
Bruno Preisendörfer ist freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift (www.fackelkopf.de). Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u.a. Die letzte Zigarette und Der waghalsige Reisende. Johann Gottfried Seume und das ungeschützte Leben. Seine beiden letzten Bücher Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit und Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit waren Bestseller.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Auf der Spur der Philosophie der Alltagsgegenstände und dem, was sie mit uns machen
1963, als der Erstklässler Bruno Preisendörfer aufgeregt seinen ersten Schulweg antrat, hing an seinem Schulranzen noch ein Wischläppchen für seine Schiefertafel, gerechnet wurde mit Stift und Rechenschieber, Musik hörte man im Radio oder auf LP und nur 14% der Bevölkerung hatten ein Telefon – die Preisendörfers gehörten nicht dazu, einen Fernseher gab es bei ihnen daheim auch nicht und auch keine Schreibmaschine, mit der man z. B. das Manuskript zu diesem Buch hätte schreiben können.
Mit einer Mischung aus Irritation, Faszination und verschmitztem Staunen lässt Preisendörfer die rasante Entwicklung Revue passieren, die seinem persönlichen Alltag im Laufe weniger Jahrzehnte widerfuhr. Manchmal mit ein wenig Nostalgie, manchmal fasziniert, immer aber mit Neugier und dem Bewusstsein, dass auch jede Zukunft nur allzu bald ihre Vergangenheit hat.
Preisendörfer wäre dabei nicht Preisendörfer, beleuchtete er nicht mit wachem Blick und stilistischer Raffinesse, was die jeweiligen Kulturtechniken mit ihren Benutzern machten und wie sie sich auf das jeweilige Sozialgefüge auswirkten – wenn sich die gesamte Familie um einen Fernseher versammelt, lebt man anders, als wenn jeder ein Tablet hat; mit physischen LPs war Musikhören etwas anderes als mit Streamen; und wenn jeder ein Handy hat, entwickelt sich auch kein erbitterter Kampf um das einzige Telefon mehr.
Inhaltsverzeichnis
Motti
Einleitung
1. Schreiben, rechnen, mit dem Rechner schreiben
Erinnerung an hilfreiche Mädchen
Rückblicke auf globale Netze und soziale Medien
2. Tragbare Töne
Liebeserklärung an Lissy
3. Tonträger
Eine Generationskontroverse
4. Laufende Bilder
Der Bügeltest
Nachrufe aufs Fernsehen
5. Bildspeicher
Eine Mondlandung auf VHS
6. Zelle und Etui
Versuch über Selfies
Highsmith mit Handy
Zukunft 2.0.
Anhang
Nachweise
Quellen
Bücher
Nachschlagewerke, Zeitschriften, Broschüren, Bedienungsanleitungen
www.
Komisches Glossar
Zeittreppe
Personenregister
»Wir haben heute ein fundamental anderes Verhältnis zur Welt als 1950. Wir werden in den nächsten fünfzig Jahren einen wesentlich größeren Sprung machen als in den letzten fünfzig Jahren.«
Rodney Brooks[1]
»Wo es um neue Dinge geht, besteht nur allzu häufig die Tendenz, zunächst einmal zu überschätzen, was uns interessant und merkwürdig vorkommt – um sodann, in irgendwie natürlicher Gegenreaktion, den tatsächlichen Stand der Sache zu unterschätzen.«
Ada Lovelace[2]
»1. Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu.
2. Alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär […].
3. Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der Dinge.«
Douglas Adams[3]
Einleitung
Heutzutage unterscheidet sich der Mensch hauptsächlich dadurch vom Affen, dass er mit dem Daumen auf dem Zahlenfeld eines Handys Nummern eingeben oder gleichzeitig mit zwei Daumen auf dem Buchstabenfeld eines Smartphone-Displays Botschaften tippen kann. Sogar im Gehen!
Aber das Entscheidende ist nicht der aufrechte Gang, sondern die Fähigkeit, den Daumen anstrengungslos nach innen zu beugen, und zwar so weit, dass die Daumenkuppen ohne Weiteres die Kuppen der anderen Finger berühren können. Anthropologen bezeichnen diese evolutionäre Errungenschaft der menschlichen Anatomie als ›Opponierbarkeit‹ des Daumens. Sie kommt bei keiner anderen Primatenart vor. Schimpansen, bei denen die Daumen ebenfalls von den übrigen Fingern abgesetzt, aber eben nicht opponierbar sind, können mit den Zeigefingern auf einem Tastentelefon herumdrücken oder sie in die Löcher einer Wählscheibe stecken. Sie sind jedoch nicht in der Lage, doppeldäumig Botschaften ins Smartphone zu tippen.
Unsere unmittelbaren Vorfahren auch nicht. Womit nicht gesagt sein soll, ältere Leute, die nicht beidhändig simsen, stünden den Schimpansen näher als jüngere Leute, obwohl jüngere Leute mitunter den Eindruck erwecken, als käme es ihnen genau so vor. Der Verfasser, der sich vor einem Vierteljahrhundert gegen die Installierung von Windows 95[4]auf seinem Redaktionscomputer sträubte und darauf bestand, vorläufig mit dem DOS-basierten Word 5.0 weiterzuarbeiten, wurde damals vom Verlagstechniker als ›Neandertaler‹ bezeichnet. Heute wirkt Windows 95 mit seiner von Brian Eno komponierten Startmelodie[5] selbst ›prähistorisch‹. Bei einem 2016 durchgeführten Experiment sahen sich etliche nach 1995 geborene ›User‹ außerstande, Windows 95 überhaupt in Gang zu bringen. Sie schalteten den Bildschirm an und warteten und warteten und warteten. Bildschirme waren in den 90ern keine Flatscreens, sondern weit nach hinten ausladende Monitore. Und der Rechnerblock stand unterm Tisch. Dass dieser Apparat ebenfalls anzuschalten war, nicht nur der monströse Monitor, kam einigen der mit Smartphones aufgewachsenen Teens erst gar nicht in den Sinn.
In der Praxis wirft das schnelle Altern jüngster Errungenschaften Probleme der Anpassung auf, in der Philosophie tiefgründige Fragen. Was sollen etwa Großeltern, in deren eigener Kindheit die Telefone Apparate waren, die im Flur an der Wand hingen, auf die Enkelfrage antworten »Wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab?« Ein Philosoph würde diese Frage, die ich von einem Elfjährigen gehört habe, auf die ›Naturalisierung‹ kultureller Erscheinungen zurückführen, auf die Verwandlung von historisch Entstandenem in etwas Natürliches, seinsmäßig Vorgegebenes. Dem Elfjährigen wiederum, dessen eigene Geschichte kürzer ist als die des Internets, geht das Internet tatsächlich voraus, jedenfalls insofern, als für seinen Alltag die ›Historizität‹ der Praktiken, mit denen er ihn bewältigt, nicht von Belang ist. Im Übrigen könnte man die meisten Dinge nicht benutzen, wollte man sich vorher darüber klar werden, wie sie entstanden sind und wie sie funktionieren. Man müsste Experte für alles sein. Wer kann das schon? Wer will das überhaupt? Wir wissen, dass die Dinge funktionieren (jedenfalls wenn und solange sie funktionieren), auch wenn wir nicht wissen, warum. Insofern haben wir ein magisches Verhältnis zu ihnen. Im Unterschied zum magischen Menschen der Vorzeit allerdings wären wir in der Lage, von der Praxis zur Theorie überzugehen, um uns die Dinge einschließlich ihrer kausalen Zusammenhänge wissenschaftlich erklären zu lassen.
Die Dinge und die Kulturtechniken ihrer Benutzung entwickeln sich mit hoher und immer höherer Geschwindigkeit. Das begeistert die Euphoriker und betrübt die Nostalgiker. Die Euphoriker sind hysterisch versessen aufs Neue, immer auf dem ›aktuellen Stand‹ und bereit für den nächsten Trend. Die Nostalgiker sentimentalisieren das Alte und ignorieren die neuesten Errungenschaften von zurückliegender Warte.
Der Autor dieser Erinnerungen an die Gegenstandswelt von gestern zählt sich weder zu den einen noch zu den anderen. Dass früher alles besser war, hält er für ein Märchen, dass früher, als vieles schlechter war, von alten Leuten erzählt wurde. Dass morgen alles noch besser sein wird, hält er für eine Übertreibung junger Leute, die das Leben mit einem Start-up verwechseln. Und so werde ich es keinem recht machen, aber hoffentlich viele amüsieren mit dieser Reise zu Dingen der eigenen Vergangenheit seit den späten 1950ern. Auf einer solchen Reise trifft man ›Objekte‹ wieder, die man völlig vergessen hat, obwohl sie einst ungeheuer wichtig waren. Oder man lacht sich kaputt über Gewohnheiten, die noch vor wenigen Jahren mit unerschütterlichem Alltagsernst gepflegt wurden.
Die einzelnen Dinge sterben, wenn wir aufhören, mit ihnen zu leben. Die ›Population‹ der Dinge indessen wächst im Lauf unseres Lebens. Nicht nur deshalb, weil sich in Wohnungen und Häusern, auf Dachböden und in Kellerräumen mehr und mehr Gegenstände ansammeln, die man ›irgendwann vielleicht noch einmal brauchen kann‹. Sondern auch, weil die Zahl der tatsächlich in Gebrauch befindlichen, wenn auch nicht immer wirklich gebrauchten Dinge zunimmt. »Ein Deutscher nennt im Durchschnitt zehntausend Gegenstände sein Eigen.« Angaben wie diese aus der opulenten »Geschichte des Konsums« von Frank Trentmann sind statistisch konstruiert und nicht beim Wort, genauer: bei der Zahl zu nehmen. Doch immerhin veranschaulichen sie die Dimension der Anhäufung von Gebrauchsgegenständen. Wollte man alles, was eine normale deutsche Familie besitzt, in einer Ausstellung präsentieren, in Vitrinen, auf Sockeln und ordentlich beschriftet, könnte man damit ein eigenes historisches Museum einrichten. Schon wenn ich die Augen vom Computerschirm löse und einen Blick über meinen eigentlich nicht überhäuft wirkenden Schreibtisch werfe, irritiert die Vielfalt des Ensembles an Dingen: ein halbes Dutzend Nachschlagewerke, zwei Buchstützen, sage und schreibe zehn verschiedene Notizhefte, zwei Stapel mit Papierausdrucken, ein Taschenkalender, ein aufrecht stehendes Buch aus Granit, an dem blaue, grüne, rote und gelbe Merkzettelchen kleben, auf dem oberen Schnitt des Steinbuchs ein USB-Stick; neben dem Steinbuch ein kleiner Amboss aus Edelstahl, den mein Vater, ein gelernter Schmied, an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik gefräst und mir geschenkt hat, als ich noch bei den Eltern wohnte; außerdem ein Ganesha aus Bronze, der mir irgendwann zugelaufen oder eher zugekrabbelt ist, denn das Figürchen stellt den Hindugott mit dem Elefantenkopf auf allen vieren dar; des Weiteren eine Schreibtischlampe, ein schnurloser Handapparat fürs Festnetztelefon, die Ladeschale für diesen Handapparat, ein Handy, ein Taschenkalender, ein Kugelschreiber, ein Drehbleistift, ein Holzbleistift, ein Bleistiftspitzer, ein Kopfhörer und schließlich meine Brille, die eigentlich beim Schreiben auf der Nase sitzen sollte.
Die zehn parallel geführten Notizhefte übrigens machen mich fassungslos. Das hätte ich – ohne Nachzählen – nicht für möglich gehalten. Offenbar rücken viele Gegenstände um uns herum erst dann in unseren Wahrnehmungshorizont, wenn wir bewusst nach ihnen sehen oder absichtlich nach ihnen greifen. Ein beliebiger Selbstversuch dürfte das bestätigen. Man stelle sich beispielsweise eine Ecke der jeden Tag benutzten Küche vor und notiere alles, was sich dort befindet. Dann gleiche man die Liste mit der Wirklichkeit ab!
Es ist wunderlich, wie viele der Sachen einem nicht einfallen, die man täglich um sich hat. Nur Lissy würde ich nicht vergessen, da bin ich mir sicher. Das kleine Kofferradio, Jahrgang 1970, steht in der Küche und erzählt mir jeden Morgen, was vorgefallen ist in der Welt. Anderswo hat sie bereits Vitrinenreife. In Technikmuseen repräsentiert sie stumm ihre Epoche des Gerätedesigns. Sobald wir den persönlichen Umgang mit unseren Dingen einstellen, werden sie ›historisch‹.
Ohne Körperkontakt mit den Menschen können Alltagsgegenstände nicht funktionieren – und das ist wörtlich zu nehmen, fast: Viele Funktionen werden heute nicht mehr am Apparat ausgelöst, sondern an kleinen Schächtelchen, die wir ›Fernbedienung‹ nennen. Auf Knöpfe allerdings drücken wir immer noch. Einstweilen. Es wird freilich nicht mehr lange dauern, bis wir unsere Befehle nicht mehr mit den Fingern erteilen, sondern mit dem Mund. Stimmerkennungsprogramme ermöglichen es, dass wir den Dingen Anweisungen geben können, als wären sie unseresgleichen. So brachte in der zweiten Jahreshälfte 2016 Amazon seinen in den USA bereits erprobten Spracherkennungslautsprecher Echo auf den deutschen Markt. Der Name ist insofern geschickt gewählt, als der griechischen Mythologie zufolge die Bergnymphe Echo von der Zeus-Gemahlin Hera der eigenen Stimme beraubt und dazu verurteilt wurde, nur die jeweils letzten an sie gerichteten Worte zu wiederholen. Dies war die Strafe dafür, dass Echo die eifersüchtige Hera mit Geschichtenerzählen von den Fremdgängen des Göttergatten abgelenkt hatte. Nun kann man die vernetzte Nymphe bitten, das Licht auszuschalten oder ein Taxi zu rufen.
Aber noch sind die meisten Befehle, die wir unseren Dingen geben, haptischer Natur. Weil unsere alten Reflexe weiterfunktionieren, wenn ein Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert, sind wir im allerersten Moment schockiert, wenn auf Knopfdruck nichts passiert. Dabei sollten wir eigentlich wissen, dass nur die Batterien zu erneuern sind. Was würde jedoch geschehen, gäbe es Probleme nicht beim An-, sondern beim Ausschalten? Vor Jahren träumte mir, ich käme nach Hause und alle Dinge wären in Aufruhr: Die Waschmaschine drehte wie wahnsinnig die Trommel und schleuderte die Leere, die Spülmaschine zog unentwegt Wasser, Kaffeemaschine und Wasserkocher blubberten, das Bügeleisen glühte, der Mixer ließ das Messer rotieren und machte Geräusche wie ein Hubschrauber, Lissy plapperte selbstzufrieden vor sich hin; im Arbeitszimmer hatte sich der Computer hochgefahren, das FAX piepte erwartungsvoll auf Empfang, der Anrufbeantworter wiederholte unermüdlich seine Ansage, und sämtliche Lampen brannten. Fassungslos stürzte ich in diesem Lärm der Dinge von Gerät zu Gerät, aber keines ließ sich abschalten. Unbeeindruckt von der befehlsgewohnten Menschenhand machten alle einfach weiter, mochte ich auf die On/Off-Knöpfe drücken, so viel ich wollte. Es war zum Verrücktwerden. Dann hatte ich die rettende Idee: Drehe die Zentralsicherung raus, dreh um Himmels willen die Zentralsicherung raus. Schweißgebadet erwachte ich. Nachdem ich mich beruhigt hatte, ging ich in die Küche, nachsehen. Alles stand still und ruhig an seinem Platz. Nur der Kühlschrank brummte. Im Arbeitszimmer schimmerten die grünen Punkte am Router und draußen am ›Himmelszelt‹ die Sterne. Was für ein Glück, dass Dinge nicht träumen. Aber wer weiß …
Im Übrigen hat die Zukunft bereits begonnen. Vor einem Vierteljahrhundert, in der dritten World Media taz-Ausgabe von 1991, wurde gefragt: »Ein Wasserboiler, der mit dem Geschirrspüler ein Schwätzchen hält, während die Waschmaschine mit Besuchern plaudert?« Das klang in den frühen 1990ern belustigend. In den späten 2010ern halten Haushaltsgeräte zwar immer noch keine Schwätzchen, dafür haben sie keine Zeit, aber es ist möglich geworden, die Haustechnologie, vom Heizkessel bis zur Waschmaschine, mithilfe von Computerprogrammen zu koordinieren und per Funk zu steuern, auch wenn man gar nicht zu Hause ist. Aus Lautsprechern ertönt Hundegebell, um Einbrecher abzuschrecken, während Roboter staubsaugend durch die Stuben kurven oder rasenmähend durch den Garten.
Die Verwandlung von Zukunft erst in Gegenwart und dann in Vergangenheit geht inzwischen so schnell vor sich, dass die Herstellungszeit des Langsamkeitsmediums Buch damit nicht mehr kompatibel ist. Weil das Schreiben dem Leben hinterherhinkt, muss das Leben dem Schreiben auf die Sprünge helfen. Den Leserinnen und Lesern wird es hoffentlich Vergnügen machen, diesen Text mit gedanklichen Updates aus der eigenen Erfahrungswelt zu aktualisieren.
Ich kam 1957 zur Welt, dem Jahr, in dem die Sowjetunion, die es längst nicht mehr gibt[6], zum Erstaunen und Entsetzen der ›westlichen Welt‹ den ersten Satelliten ins All geschossen hat. Zwölf Jahre später machten die ›Amis‹, die es – einstweilen – immer noch gibt, die Sputnik-Scharte wieder wett mit einem kleinen Schritt vom Leiterchen, der ein großer Schritt für die Menschheit war. Denn dieses Leiterchen lehnte an einer Mondfähre.
Genau in der Mitte zwischen Sputnikschock und Mondlandung fand meine Einschulung statt. Aber als ich im September 1963 zum ersten Mal den Ranzen in die Schule trug, baumelte an diesem Ranzen ein Tafellappen, als wäre nicht 1963, sondern 1893 gewesen.
1. Schreiben, rechnen, mit dem Rechner schreiben
Von der Schiefertafel zum Tablet
Der Tafellappen, der aus meinem Ranzen hing, war mit einer Schnur am roten Holzrahmen einer grauschwarzen Schiefertafel befestigt. Die Tafel war liniert, und im ersten Schuljahr tummelten sich über und unter, seltener auf den Linien die seltsamen Figuren, die von den Lehrern als ›Buchstaben‹ bezeichnet wurden, und die wir Schüler von der großen Tafel abmalten, der sogenannten ›Lehrertafel‹. Die Lehrertafel wirkte, als würde sie für alle Zeiten an der Stirnseite des Schulzimmers an der Wand hängen wie das Kreuz in der Kirche – oder gleichfalls im Schulzimmer. Die Kreuze sind vielerorts aus den Schulstuben verschwunden, die Lehrertafeln auch. Sie wurden durch interaktive Whiteboards ersetzt.
Im Unterschied zu den großen Wandtafeln mit ihrer grauschwarz drohenden Unerschütterlichkeit blieben die kleinen Tafeln keine zwei Wochen unbeschädigt, jedenfalls nicht in den Jungenranzen. Auch einem Mädchen mochte eine Tafel vom Pult rutschen und eine Schramme davontragen, aber die schweren Brüche kamen nicht durch Ungeschicklichkeit zustande, sondern durch Kämpfe Mann gegen Mann. Wenn Schulranzen wie Heldenschilde gegeneinanderprallten, bezahlten die Schiefertafeln mit dem Leben. Den Griffeln erging es besser, jedenfalls wenn sie brav im ebenfalls hölzernen Griffelkasten mit dem zurückschiebbaren Deckel untergebracht und nicht lose in den Ranzen geworfen wurden. Dem Schwämmchen wiederum machte das alles nichts aus. Solange es Tafeln gab statt Whiteboards und Displays, so lange gab es auch Schwämme: große Schwämme für die Lehrertafel (und die Wurfduelle der Schüler), kleine Schwämme für die Schreibtafeln der Kinder. Diese Schwämme hatten stets feucht zu sein und waren immer trocken. Sie gehörten zu jenen Dingen, die Kinder zur Verzweiflung treiben, weil sie nie so in Ordnung zu halten sind, wie Erwachsene sich das vorstellen.
Das Schlimmste an diesen kleinen Schwämmen waren die Geräusche, die sie ausgetrocknet auf bekritzelter Tafel hervorriefen. Die Schwämmchen lebten in runden Dosen (tatsächlich schon aus Plastik!) und zogen sich bei Trockenheit schneckenhaft unter deren Rand zurück. Beim Wischen rief dieser Dosenrand auf dem Schiefer ein schabendes Geräusch hervor. Es klingt mir noch heute in den Ohren und macht mir immer noch Gänsehaut. Ohren haben ein gutes Gedächtnis, fast so gut wie Finger und Hände, die auf Knöpfen, Tasten und Tastaturen (wie jetzt beim Schreiben auf dem Rechner) herumdrücken, ohne dass sich derjenige, dem diese Finger und Hände gehören, bewusst darum kümmern muss. Dem motorischen Gedächtnis entspricht das akustische Gedächtnis. Es bewahrt im Echoraum des Kopfes Geräusche auf, die im Leben längst ausgestorben sind. Hübsche Geräusche wie das Bimmeln, wenn der Schrankenwärter die Kurbel drehte und die Schranke herunterließ, um die Bahn für die Bahn frei zu machen. Fiese Geräusche wie dieses knirschende Schaben, das ein trockener Dosenschwamm auf einer Schiefertafel hervorrief.
Die Buchstaben, die auf Tastaturen so genormt zuverlässig angeordnet sind, machten uns ABC-Schützen mit ihrem Durcheinander mächtig zu schaffen. In der Suppe rührte man sie mit dem Löffel um, aber in der Schule hatte man sie in Reih und Glied so aufzustellen, dass Wörter dabei herauskamen. Das Hilfsmittel dazu war ein Setzkasten oder eine Setzfibel. Über den Setzkasten gibt es in Walter Benjamins Berliner Kindheit um Neunzehnhundert eine hübsche Miszelle unter dem Titel »Der Lesekasten«: Weil »das, was mein eigenes [Dasein] angeht, Lesen und Schreiben waren, weckt von allem, was mir in frühern Jahren unterkam, nichts größere Sehnsucht als der Lesekasten. Er enthielt auf kleinen Täfelchen die Schreibschriftlettern, die jünger und mädchenhafter waren als die gedruckten. Sie betteten sich schlank aufs schräge Lager, jede einzelne vollendet, und in ihrer Reihenfolge gebunden durch die Regel des Ordens, das Wort, dem sie als Schablone angehörten. Ich bewunderte, wie soviel Anspruchslosigkeit vereint mit soviel Herrlichkeit bestehen könne.«
Ich hatte eine Setzfibel und hasste sie. Die Buchstaben waren aus Pappe, ebenso die Schlitze, in die man die Pappbuchstaben zu stecken, zu schieben, zu fummeln hatte. Die Buchstaben fransten aus, die Schlitze rissen ein, und je mehr die Buchstaben ausfransten und die Schlitze einrissen, desto schwieriger wurde es, die Buchstaben in die Schlitze zu kriegen, damit Wörter herauskamen. Mit dieser motorischen Aufgabe waren die Kinderhände dermaßen beschäftigt, dass die Kinderköpfe kaum noch Restenergie fürs Schreibenlernen hatten. Aus dem ›Baum‹ an der Lehrertafel, mit wackelndem Griffel auf der kleinen Schiefertafel nachgemalt, aber korrekt buchstabiert, wurde im Setzkasten ein ›Buam‹, weil das völlig verfranste ›a‹ einfach nicht an der richtigen Stelle in den Schlitz wollte. Und in irgendeinen Schlitz musste es doch, das verflixte a!
Ich weiß nicht, wo die dunkelrote Setzfibel mit ihren schwarzen Buchstaben auf dünner weißer Pappe geblieben ist. In meinem persönlichen Museum der Dinge – es enthält unter vielen pensionierten Objekten zum Beispiel einen Zirkelkasten, einen Rechenschieber, einen Stenofüller und meinen ersten elektronischen Taschenrechner – ist sie jedenfalls nicht zu finden. Auch die frühen Schreibhefte, die aufs Tafeljahr folgten, sind verloren. Sie wiesen von Schuljahr zu Schuljahr immer weniger Linien auf, bis in der vierten Klasse eine einzige Linie übrig blieb. Mit diesen einfach linierten Heften begann die Epoche der Patronenfüller.
Bis dahin hantierten wir nach dem Griffeljahr der ersten Klasse mit Federhaltern. Die Federn steckten in sich nach hinten verjüngenden und von Milchzähnen benagten Haltern aus Holz, waren ziemlich starr und konnten die Tinte nicht halten. Ein Teil davon tropfte ab auf dem Weg vom Fass zum Heft, und wenn man nicht schnell genug beim Buchstabenmalen war, breiteten sich blaue Kleckse auf den Seiten aus, kleine Seen mitunter, die sich mit dem faserigen Löschpapier kaum trockenlegen ließen. Die Heftseiten selbst waren Schlachtfelder der Alphabetisierung, übersät mit in ihrem Tintenblut schwimmenden Leichen der von ABC-Schützen hingemordeten Buchstaben. Das Mordinstrument Federhalter ist inzwischen und zum Glück aus dem Alltag verschwunden und nur noch etwas für Zeichenkünstler und Kalligraphie-Liebhaber.
Ob unsere Federn sich nach solchen für die ›Ausgangsschrift‹ und nach solchen für die ›Verkehrsschrift‹ unterschieden, kann ich heute nicht mehr sagen. ›Form follows function‹ hat mal jemand gesagt[7], und so gab es verschiedene Federn zum unterschiedlichen Gebrauch, wie es auch Patronenfüller mit verschiedenen Federn gab, zum Beispiel mit besonders weichen und biegsamen beim Stenofüller.
Die offizielle »Lateinische Ausgangsschrift« kam in der BRD seit 1953 auf Beschluss der Kultusminister länderübergreifend im Unterricht der damals noch offen und ehrlich sogenannten Volksschulen zum Einsatz. Auch ich wurde mit ihr ›beschult‹, obwohl ich in der ersten und zweiten Klasse noch die zackige Sütterlinschrift lernte. Neben den Unterschieden im Aussehen der beiden Schriften und in den motorischen Abläufen beim Schreiben gab es zwischen ihnen noch eine gewissermaßen ethische Differenz: Die Sütterlinschrift war als Normschrift konzipiert, an die sich die Leute zu halten hatten, während die Ausgangsschrift, wie ihr Name schon sagte, als Ausgangsbasis für die Entwicklung einer allgemein lesbaren und dennoch individuellen Handschrift fungieren sollte. Es ist wie beim modernen Wohlstandsmenschen insgesamt: Alle entfalten ihre Individualität, aber so, dass sie in Grundzügen einander ähnlich bleibt.
Ob die Ausgangsschrift ihren Anspruch erfüllte, blieb unter Lehrern und Eltern umstritten. In den frühen Siebzigern wurde in einigen Bundesländern eine »Vereinfachte Ausgangsschrift« unterrichtet, während in der DDR seit 1968 eine artverwandte »Schulausgangsschrift« galt.
Die Debatten ums Schreibenlernen waren in ihrer verstiegenen Grundsätzlichkeit und mit ihrer Überzeugungsinsbrunst dem Religionskrieg ähnlich, der in den 1990ern um die Rechtschreibreform geführt wurde. Aber schließlich ging es um mehr als nur darum, welche Schnörkel Schulkinder bei a, b und c hinzumalen oder wegzulassen hatten. Die Oberhoheit über die Motorik der Kinderhand hing (und hängt) zusammen mit der Oberhoheit über die Erwachsenenseele. Ada Sasse, Professorin für Grundschulpädagogik, hat das so zusammengefasst: »Die Schreibschrift als Schrift zum Schreibenlernen war vor ein paar Jahrzehnten noch angesehen wie eine preußische Primärtugend – gleichzusetzen mit Fleiß, Ordnung, Sauberkeit und Disziplin. Aber darauf kommt es doch nicht an. Die Kinder müssen erkennen, dass Schrift ein lebensbedeutsames Kommunikationsmittel ist.« Tatsächlich? Ist die Handschrift als ›lebensbedeutsames Kommunikationsmittel‹ inzwischen nicht selbst eher eine quasimoralische Forderung als eine selbstverständliche Lebenspraxis? Jedenfalls darf man mit Begeisterung rechnen, wenn man Freunden oder Bekannten mit der Hand nicht bloß eine Urlaubspostkarte mit schönen Grüßen schreibt, sondern einen ›richtigen‹ Brief. Die Freude über den ›persönlichen‹ Brief dürfte sogar unabhängig davon sein, wie gut man ihn lesen kann.
Einer von mir wäre schwer zu entziffern. Meine Handschrift ist durch schriftstellerische Tagesroutine verkümmert zu einer Art Privatstenografie. Viele Wörter und Silben sind nur noch Ruinen, Ruinen der Routine eben, deren Bedeutung ich nur im Zusammenhang ganzer Sätze erschließen kann. Einzelne isolierte Worte, an den Rand eines ›Manuskripts‹ geschrieben, das in Wahrheit weder ›Manus‹ noch ›Skript‹ ist, sondern ein Computerausdruck, werden in kurzer Zeit mir selbst geheimnisvoll wie Hieroglyphen. Allerdings hatte ich bereits als Schulkind in Schönschreiben schlechte Noten, wenn ich auch im Einzelnen nicht mehr nachprüfen kann, wie schlecht. Vor Jahren überantwortete ich in einem Anfall von autobiographischem Aufräumwahn sämtliche Schulzeugnisse der blauen Tonne. Meine Tagebücher sind dem Entsorgungsanschlag knapp entronnen und liegen nun korrekt klischeegemäß in einer Kiste auf dem Dachboden.
›Schreiben mit der Hand‹ verhält sich zum Tippen am Tablet wie der Eintrag ins Poesiealbum zum Posten auf Facebook. Aber wie immer, wenn alles gut läuft, wenn auch in die falsche Richtung, entwickeln sich Gegentrends. ›Handlettering‹[8] ist ein solcher Gegentrend. In speziellen Kursen kann man das ›Schönschreiben‹ üben, eine Kunst, die in meiner Volksschulzeit noch keine war, sondern zeugnisrelevante Alltagsfertigkeit.
Schrift wirkt! So heißt ein Ratgeber, der »Einfache Tipps für den täglichen Umgang mit Schrift« anbietet. Schlägt man ihn auf, stellt man allerdings fest, dass es mitnichten um die Handschrift geht, sondern um Typographie und Seitenlayout, also um das Schreiben mit Rechnern. Der Klappentext verspricht, dass dieses Buch »Sie zum souveränen Chef der enormen ›Setzerei‹ macht, die sich hinter der Tastatur von Mac und PC versteckt.« Aber der erste Macintosh kam erst 1984 heraus, und so weit sind wir noch nicht. Einstweilen tauchen wir Federn in Tintenfässer und bereiten uns auf die Ära der Patronenfüller vor.
Uns Schulkindern bereitete es ein seltsames, irgendwie froschquälerisches Vergnügen, die in Holzgriffel gesteckten Federspitzen so aufs Löschpapier zu drücken, dass sich deren Hälften spreizten und der schmale Tintenkanal zum klaffenden Spalt auseinandertrat. Wie breit ließ sich der Spalt wohl drücken? Ging man zu weit und drückte zu fest, glitten die Spitzenhälften nicht wieder zurück in die Ausgangslage und schlossen die Kluft nicht mehr, sobald der Druck nachließ. Dann war die Feder ruiniert, und man musste sich etwas einfallen lassen, um zu Hause zu erklären, warum man schon wieder eine neue brauchte. Sollte man es mit der Ausrede versuchen, der Federhalter sei – leider – vom Pult gerollt? Das war riskant. Wurde die Feder daraufhin einer elterlichen Inspektion unterzogen, stellte sich sofort heraus, dass diese Aufspreizung nie und nimmer von einem Fall herrühren konnte. Fiel die Feder ungünstig auf ihre Spitze, wurde sie geknickt oder verbogen, aber sie spreizte sich nicht in dieser verräterischen Weise. All das war zu bedenken, wenn man versonnen die Feder aufs Pult drückte, damit ihre Hälften so weit wie möglich auseinandertraten, ohne kaputtzugehen.
Auf den Federhalter folgte der Patronenfüller und mit ihm die Emanzipation vom Tintenfass. Die blauen Seen auf den Pultdeckeln und in den Schreibheften trockneten aus, die blauen Flecken zwischen den Fingern blieben. Keine Patrone hält beim Einstecken in den Füllerschaft dicht genug, um nicht an Kinderfingern immer irgendwie etwas zurückzulassen. Hatte man sich beim Schreiben die Hände schmutzig gemacht oder das Heft vollgekleckst, konnte man seit 1972 zu speziellen, als »Tintenkiller« vermarkteten Stiften greifen. Sie waren von eigenartig ekelhaftem Geruch und Geschmack. Dass etwas nicht zum Essen da ist, hat Kinder noch nie gehindert, nachdenklich darauf herumzubeißen, seien es nun Bleistifte, Federhalter oder Tintenkiller. Das kann zu tragischen Missgeschicken führen. Am 3. Januar 2015 erkundigte sich auf der Website gutefrage.net ein Schulkind: »Heute beim lernen[9] ist mir etwas sehr ungeschicktes passiert. Ich habe aus versehen den Tintenkiller abgebissen und verschluckt … Muss ich jetzt sterben? Wie viele Tage bleiben mir über, um mein Leben zu genießen?« Die rührende Ratsuche im (nur für ältere Leute neuen) Medium Internet rief neben tröstenden Reaktionen auch diese hervor, sarkastisch, aber ganz auf der technischen Höhe der Zeit: »Du solltest dir den [!] Tintenkiller-abbiss-app auf dein Smartphone laden, der berechnet dir dann genau die Zeit, mit Timer«.
Mit den Patronenfüllern wurde der Endpunkt der handschriftlichen Evolution in der Schule erreicht. Kugelschreiber waren im Unterricht tabu, weil sie die Handschrift ›verdarben‹, wie es hieß. Mich erfasste dennoch die Sehnsucht nach einem Vierfarbkugelschreiber mit Stahlgehäuse, aus dem man an einem blauen, einem schwarzen, einem roten und einem grünen Metallknopf die jeweiligen Minen in die Spitze schieben konnte. Ich opferte mein angespartes Taschengeld, wurde jedoch des angeberischen Objekts nicht froh. Zu Hause konnte ich es nicht gebrauchen, in der Schule durfte ich es nicht benutzen.
In der DDR gab seit 1974 Heiko »der Handschrift Charakter«, wie der Verpackungsaufdruck versprach. Bei dem als ›Pionierfüller‹ etikettierten Schreibgerät für Schüler der ersten bis vierten Klasse kam die Tinte nicht aus Patronen, sondern aus einer Füllkammer. Der VEB Füllhalterfabrik Wernigerode stellte jährlich eine halbe Million Kolben- und eine ganze Million Patronenfüller her. Das Unternehmen wurde Anfang der 90er von der Treuhand an den westdeutschen Minenhersteller Schneider verkauft und produziert heute jährlich zwischen 15 und 20 Millionen Tintenschreiber, darunter auch Tintenroller im Set mit Tintenlöschern oder den Füllhalter Ray, ein »Füller mit ergonomisch gummiertem Griffprofil und hochwertiger Edelstahlfeder mit Iridiumkorn. Standard-Tintenpatronen königsblau löschbar. Für Linkshänder gibt es die spiegelverkehrt geformte L-Version.« Früher, als vieles schlechter war, hätte es das nicht gegeben. Da wurden Linkshänder so lange gequält, bis sie wie ›normale‹ Menschen mit rechts schreiben gelernt hatten.
Manche mit Patronenfüllern beschulte Mitmenschen entdeckten im Erwachsenenleben die klassischen Kolbenfüller: Sie wirken so kultiviert. Besonders wenn sie einer Traditionsmarke wie Waterman angehören. Selbst einer Virginia Woolf ist das der Rede – und des Schreibens – wert. Am 14. Februar 1934 notiert sie, dass sie ausgegangen sei, »um Tinte für meinen neuen Waterman zu kaufen«. In der gleichen Eintragung hält sie fest: »der neue Badewasserapparat wird installiert«. Die arme Virginia war eben auch nur ein Genie mit alltäglichen Bedürfnissen. Zwischen Waterman und Badewasser findet sich noch die Bemerkung: »Alle Männer sind Lügner.«
Ich hoffe, man glaubt mir trotzdem, dass ich vier Realschuljahre lang unterwegs war zu einem Ausbildungsberuf, der noch heute bei den Mädchen der beliebteste ist (bei den Jungs ist es der Mechatroniker): Einzelhandelskaufmann (bzw. -frau). In Vorbereitung auf diesen und ähnliche Berufe wurden im kaufmännischen Zweig der Realschule nicht nur Buchführung und Wirtschaftsrechnen erlernt, sondern auch – im Wortsinn – handgreiflichere Fertigkeiten wie Stenographie und Schreibmaschineschreiben. Das Erste ist ein Beispiel dafür, wie sinnlos es sein kann, in der Schule für das Leben zu lernen. Dann nämlich, wenn die in der Schule erlernte Fähigkeit beim Eintritt ins Berufs- und Erwachsenenleben bereits überholt ist, wie es der Stenographie erging, die nur als Mischung aus Schönschreibkunst und Schnellschreibsport überlebt hat und heute selbst an bayerischen Schulen nicht mehr gelehrt wird. Das Zweite ist ein Beispiel dafür, wie sinnvoll es sein kann, in der Schule für das Leben zu lernen. Dann nämlich, wenn die in der Schule erlernte Fähigkeit – etwa die, seine Finger blind auf die Tastatur zu setzen und dabei unfehlbar die ›Grundstellung‹ ASDF JKLÖ zu treffen – durch die Anforderungen des Berufs- oder Erwachsenenlebens nicht ent-, sondern aufgewertet wird. Und zwar so sehr, dass beispielsweise Ärzte ihre Befunde lieber gleich selbst in den Computer geben, statt sie erst auf ein Diktiergerät zu sprechen und dann von einer Praxishilfe nachschreiben zu lassen.
Eine Computertastatur kann man sogar mit zwei Fingern bedienen, gewiss, und Schnecken kommen auch voran. Aber wer es flotter haben will, wird zeitlebens dankbar sein für die Tortur, als junger Mensch das ordnungsgemäße Tippen mit zehn Fingern erlernt zu haben. Übrigens lässt sich das als alter Mensch nachholen: am Schirm. Es gibt online Übungsprogramme[10], die auf dem Display ein Tastenfeld im QWERTZ-Format[11] zeigen und dort die Buchstaben aufleuchten lassen, die man auf der eigenen Tastatur antippt. Ein Selbstversuch ergab ein zweischneidiges Ergebnis. Mir wurde beschieden: »Du schreibst viel zu schnell.« Ich war geschmeichelt. Dann kam: »Schreib langsamer, um weniger Fehler zu machen.« Wie in der Schule!
Das Stenographieren als Beruf ist ausgestorben, von sehr wenigen Ausnahmen wie der Parlamentsstenographie[12] abgesehen. Dabei bereitete ich mich noch mit einem Mustertext auf meine Steno-Prüfung vor, in dem gewissermaßen Eigenwerbung gemacht wurde. In diesem Übungstext zum »Prüfungsgebiet ›Schreibfertigkeit‹ 5-Minuten-Ansage von 80 Silben/Minute« von 1973 wird einem Fräulein Müller auf ihre Bewerbung um die Stelle einer »Anfangssekretärin« beschieden: »Vor allem hat uns gefallen, daß Sie nach Verlassen der Schule nicht aufgehört haben, sich auf den beiden wichtigen Arbeitsgebieten der Kurzschrift und des Maschinenschreibens weiterzubilden […] Das ist ein Beweis, daß Sie es mit ihrer Berufsauffassung sehr ernst nehmen und auch gewillt sind, Ihre ganze Kraft Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.«
Stenofüller kann man heute nur noch als Antiquität erwerben. Pelikan brachte das erste Modell 1971 auf den Markt. Es war wie die anderen Schreibfüller ein Patronenfüller, nur hatte er eine besonders weiche und zugleich belastbare Feder und keine Griffrillen für die Finger. Im Vergleich zum Stenobleistift hinterließ der Stenofüller, von Könnern übers Blatt geführt, das deutlich hübschere Schriftbild. Und man konnte ihn im Leben auch für das ›normale‹ Schreiben verwenden, obwohl das in der Schule verboten war. Diese Charaktereigenschaften reichten jedoch nicht, dem Produkt eine Chance nach dem Niedergang des Stenographierens zu verschaffen. Es kam außer Kurs, kaum war es auf den Markt gekommen.
Etwa zur selben Zeit begann der Niedergang des Rechenstabes oder Rechenschiebers. Dieses Instrument mit seiner ehrwürdigen Geschichte ist heute nur noch für Sammler interessant und für pensionierte Ingenieure, die beim Zahlenschieben den Erinnerungen an ihre Studentenzeit nachhängen. Die Geschichte des Rechenstabes ist tatsächlich so ›ehrwürdig‹, respektloser könnte man auch sagen: langwierig, dass er bei seiner Wiedereinführung durch James Watt, den sogenannten ›Erfinder der Dampfmaschine‹, bereits zweihundert Jahre in halber Vergessenheit hinter sich hatte. Im Zuge der rasanten Entwicklung der modernen wissenschaftlich-technischen Welt wurde er seit den 1950er-Jahren zum Symbolwerkzeug der Ingenieure. Er hing ihnen nicht am Hals wie das Status-Stethoskop[13] der Ärzte, sondern lugte in Mini-Ausgaben aus den Hemdtaschen der ›Entwickler‹, lag in normaler Arbeitsgröße überall auf den Zeichentischen und hing in Mammutvarianten an den Wänden von Besprechungsräumen. Selbst bei Fahrten zum Mond war er mit an Bord. Und in einem alten Lehrfilm über Umlaufbahnen, der – natürlich – bei Youtube zu sehen ist, benutzt Wernher von Braun den Rechenschieber als Zeigestab für die Erläuterung einer Schautafel[14].
In meiner Schultasche mit an Bord war der weitverbreitete Schulrechenschieber von Aristo in einem halb weißen, halb roten Plastikschuber. In einer alten Gebrauchsanweisung – so alt wie ich, Jahrgang 1957 – wird den Schülern eingeschärft: »Der Rechenstab ist ein wertvolles Rechenhilfsmittel und braucht eine pflegliche Behandlung.« Außerdem heißt es in jenem glasklaren Anweisungsdeutsch, das man in der heutigen Diskussionsdidaktik manchmal vermisst: »Erst Sicherheit im Lesen der Skalen erwerben, dann damit rechnen!« Da meine Schulerziehung – ich bekenne: zum Glück – auch schon diskussionsdidaktisch infiltriert war, habe ich diese Regel nicht beherzigt und mich entsprechend gequält mit dem Rechnen durch Schieben.
Weder ich noch der ›Lehrkörper‹ konnten Anfang der 1970er ahnen, dass das technik- und kulturgeschichtliche Ende dieses analogen Wunderwerkzeuges unmittelbar bevorstand und dass man nur ein wenig hätte abwarten müssen, um sich das Erlernen dieser altehrwürdigen Kulturtechnik zu ersparen. In der Wirtschaftslehre für Realschulen, die ich 1972/73 in der 9. Klasse benutzte, heißt es noch stolz: »Für das Rechnen sind viele Hilfsmittel verfügbar. Neben den Rechentabellen« – etwa den Furcht einflößenden Logarithmentafeln – »und dem Rechenstab gibt es für jeden Verwendungszweck geeignete Rechenmaschinen. Neben Saldiermaschinen (Addieren und Subtrahieren), den Dreispeziesmaschinen (zusätzlich noch Multiplizieren) und den Vierspeziesmaschinen (auch Dividieren) mit Handantrieb [!] und elektrischem Antrieb werden heute Rechenmaschinen mit elektronischen Bauteilen eingesetzt.«
Der Verfasser dieses 1969 in neunter Auflage verbreiteten Schulwerks hat bei den »Rechenmaschinen mit elektronischen Bauteilen« gewiss nicht an den elektronischen Taschenrechner gedacht. Der wurde zwar im letzten Drittel der 1960er entwickelt, erreichte jedoch erst in den frühen 70ern die Marktreife. Der allererste Taschenrechner wurde 1967 von Jack Kilby gebaut und war gar keiner. Es sei denn, man kann eine bibeldicke Maschine mit über einem Kilo Gewicht als ›Taschenrechner‹ bezeichnen. Kilby war übrigens auch der Erste, der einen integrierten Schaltkreis montierte, also das, was man heute einen ›Mikrochip‹ nennt. Das war im Sommer 1958.
Seit Mitte der 70er setzte sich der Taschenrechner im westdeutschen Schulunterricht durch (in der DDR konnte sich der Schieber bis in die 80er in den Klassenzimmern halten), wie viele Neuerungen davor und danach von heftigen Pro-und-Kontra-Diskussionen begleitet. Es gab Lehrer, die den Untergang der mathematischen Kultur vorhersagten, falls es den Schülern erlaubt würde, Zahlen in eine digitale Blackbox zu tippen, statt analog einen Stab hin- und herzuschieben. Andere meinten, im Gegenteil könne die dadurch frei gewordene Energie zu einer ungeahnten Blüte der Mathematik führen und jeden viertels begabten Mathe-Schüler zu einem halben Pascal oder Leibniz machen, die selbst Rechenmaschinen erfunden hatten. Oder zu einem Charles Babbage, um neben dem französischen und dem deutschen Philosophen auch jenem englischen Erfinder die Referenz zu erweisen, dessen Rechenmaschine aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts als die erste programmierbare gilt. In einem Aufsatz definierte er: »Rechenmaschinen bestehen aus verschiedenen mechanischen Vorrichtungen, die den menschlichen Geist bei der Ausführung arithmetischer Operationen unterstützen.«
In diesem evolutionären Vorfahren der heutigen Computer ratterten die Räder, und nicht die geringste der zu überwindenden Schwierigkeiten bei der Herstellung der Maschine bestand darin, die Zähne dieser Räder mit ausreichender Präzision ins Metall zu schneiden. Seit den Zeiten von Pascal und Leibniz griffen die Rechen- und die Uhrmacherkunst so ineinander wie die Zahnräder in den Rechenmaschinen und Uhrwerken. Damals waren Computer ›Rechenuhren‹, während heute manche Uhr ein Computer ist.
Der von Babbage nie zu Ende gebaute Apparat war annähernd zweieinhalb Meter hoch, gut zwei Meter breit und neunzig Zentimeter tief. Was hätte sein Konstrukteur wohl über meinen »Portable Electronic Calculator« von Commodore gesagt, den ich 1976 für heute unglaubliche dreihundertneunzig Mark anschaffte? Ich musste mich dafür fast so verschulden wie der glücklose Babbage für die Zahnräder seiner Rechenmaschine. Wenigstens war meine schon zusammengebaut. Mit ihr ließen sich mathematische Funktionen ausführen, die über die Grundrechenarten hinausgingen. Auf einer Taste stand zum Beispiel »sin«, auf der daneben »cos«. Doch bin ich trotz des Commodore ein mathematischer Leichtmatrose geblieben. Sinus und Cosinus klingen für mich noch heute Furcht einflößend wie Scylla und Carybdis.
Das Besondere meiner Maschine bestand darin, dass sie sich in zwei getrennten Minispeichern Zwischenergebnisse merken konnte, die sich per Tastendruck abrufen ließen. Zum Vergleich: Der »Adam Riese«, wie ein tatsächlich riesiger Tischrechner von Triumph-Adler in den frühen 1970ern nach dem Rechenmeister aus dem frühen 16. Jahrhundert genannt wurde, hatte nur einen Speicher.
Das Commodore-Display war tief ins Gehäuse gesenkt, um es vor Lichteinfall zu schützen, und maß gut einen Zentimeter in der Höhe und sechs in der Breite. Dahinter schimmerten die Zahlen in jenem heimeligen Rot, in dem schon das Holz in den Höhlenfeuern unserer Vorfahren geglommen hatte. Das sieht hübscher aus als die schwarzen Zahlen auf dem Display des Mini-Rechners, der nun beim Schreiben neben dem Commodore liegt. Das Dingchen kann nahezu genauso viel, obwohl es insgesamt nicht mehr Fläche hat als allein dessen Zahlenfeld, dünner als Scheiblettenkäse ist und seine Energie von Tages- oder Lampenlicht bezieht. Gekostet hat es auch nichts, es war ein Werbegeschenk. Allerdings passen nur acht Ziffern aufs Display.
Die begrenzte Anzeigekapazität machte schon dem Commodore zu schaffen beziehungsweise seinen Benutzern. Zum Ausgleich gab es den »automatischen Underflow« und die »Einblicktaste«. Vor mir liegt der Ratgeber Blitzrechnen mit dem Elektronik-Taschenrechner, den ich mir als Schüler zugelegt hatte und der in meiner Bibliothek den ›historischen Wandel‹ überdauert hat, ohne einer der von Zeit zu Zeit stattfindenden Aussonderungen zum Opfer zu fallen, die von der beschränkten Aufnahmekapazität meines Bücherzimmers erzwungen werden. Der Ratgeber erklärt den »automatischen Underflow« folgendermaßen: »Bei der Multiplikation wird die Kapazität des Taschenrechners schnell überschritten. Bei automatischem Underflow werden so viele Nachkommastellen abgeschnitten, daß die wichtigen acht bzw. zwölf linken Stellen angezeigt werden. Erst wenn keine Nachkommastellen mehr abgeschnitten werden können, leuchtet die Anzeige für Kapazitätsüberschreitung auf.« Wie romantisch: eine Anzeige für Kapazitätsüberschreitung. Das gab es bei den frühen Heimcomputern nicht – die Anzeige; die Kapazitätsüberschreitung schon. Ein Ratgeber aus den 80ern empfiehlt: »Sie sollten sich daran gewöhnen, vor Beginn der Arbeit am Computer stets den freien Platz auf der Diskette zu prüfen. Wenn Sie dies vergessen und die Diskette schon fast voll ist, verbleibt möglicherweise nach Abschluss der Arbeit nicht mehr genügend Platz zum Speichern der gesamten Datei.«