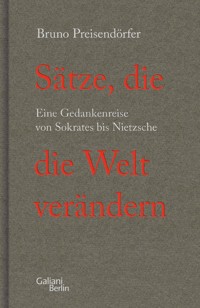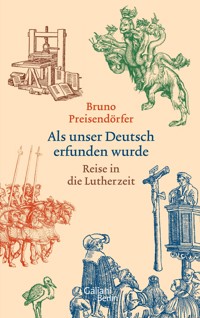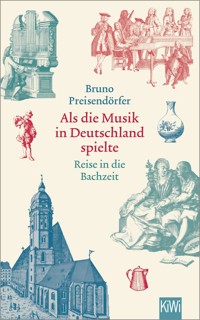
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Zeitreise in die Lebenswelt des Barock. Wie die Familie Bach im Alltag lebte, Händel sich kurieren ließ und Telemann sein Geld anlegte: Bruno Preisendörfers Zeitreise führt in die Zeit der Fürstenfeste und Bauernhochzeiten, der Stadtpfeifer und Bierfiedler, der Kaffeehäuser und Kastraten. Wir tauchen ein in den Alltag der Leute, erfahren von ihren Freuden und Lastern. Beinahe alle großen Themen des Lebens finden sich in diesem Buch – wie wurden etwa Ehen angebahnt, wer durfte überhaupt wen heiraten und wie hielt man es mit der Kindererziehung? Auch die neuesten Moden und Erfindungen der Zeit kommen nicht zu kurz: gebratene Singvögel zum Abendessen, Blumenzwiebeln als Spekulationsobjekte, Tabak für die Männer, Kaffee für die Frauen, Tanz, Bier und Schnupftabak für alle. Und immer spielt die Musik, mit ihren verschiedenen Vorzeichen zwischen religiösem Pflichtbewusstsein, Dienstbarkeit gegenüber dem Adel und einfachem Vergnügen, eine Hauptrolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bruno Preisendörfer
Als die Musik in Deutschland spielte
Reise in die Bachzeit
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bruno Preisendörfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bruno Preisendörfer
Bruno Preisendörfer ist freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift (www.fackelkopf.de). Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u.a.: Die letzte Zigarette, Der waghalsige Reisende. Johann Gottfried Seume und das ungeschützte Leben und Die Verwandlung der Dinge. Eine Zeitreise von 1950 bis morgen. Seine beiden Bücher Als Deutschland noch nicht Deutschland war. Reise in die Goethezeit und Als unser Deutsch erfunden wurde. Reise in die Lutherzeit waren SPIEGEL-Bestseller. Letzteres wurde zudem mit dem NDR-Sachbuchpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Das Deutschland, in das wir mit Bruno Preisendörfer reisen, war erfüllt von der Musik tausender Hoforchester, Kirchenorgeln und Chöre, ob zur Unterhaltung des Adels, zu jedem Gottesdienst oder auf den Dorffesten der einfachen Leute – immer wurde gefiedelt, geflötet und getrommelt. Und es wurde komponiert: Musik, die bis heute weltweit die Menschen beeindruckt und berührt. Bruno Preisendörfer nimmt uns mit in das Leben der Menschen im Barock, in die Zeit der großen Komponisten Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann.
Wir tauchen ein in den Alltag der Leute, erfahren von ihren Freuden und Lastern. Beinahe alle großen Themen des Lebens finden sich in diesem Buch – wie wurden etwa Ehen angebahnt, wer durfte überhaupt wen heiraten und wie hielt man es mit der Kindererziehung? Auch die neuesten Moden und Erfindungen der Zeit kommen nicht zu kurz: Gebratene Singvögel zum Abendessen, Blumenzwiebeln als Spekulationsobjekte, Tabak für die Männer, Kaffee für die Frauen, Tanz, Bier und Schnupftabak für alle. Und immer spielt die Musik, mit ihren verschiedenen Vorzeichen zwischen religiösem Pflichtbewusstsein, Dienstbarkeit gegenüber dem Adel und einfachem Vergnügen, eine Hauptrolle.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln, nach dem Originalumschlag von Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-32026-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildung: Thomaskirche
Widmung
Motto
Persönliches Vorwort
Die Zeit der schrägen Perle. Was bedeutet Barock?
Präludium: Drei Meister
Telemanns Trauer-music eines kunsterfahrenen Canarien-Vogels
Händels Dettinger Te Deum und das Gespenst vom Lindigwald
Bachs Chaconne im Untergrund
1. Die Welt, Europa und die deutschen Länder
Tanz der Kontinente
Singende Geographie
Der ›Südseeschwindel‹
Deutschland nach der Verheerung
2. Die Fürsten machen Staat
Friedrich von Brandenburg setzt in Königsberg eine Krone auf
Ein ›Hannoveraner‹ auf dem englischen Thron
Antichambrieren bei Herzog Anton Ulrich in Wolfenbüttel
Herzog Carl Rudolf von Württemberg unterzeichnet das Todesurteil über Süß Oppenheimer
August der Starke inszeniert das Zeithainer Lustlager
Der Soldatenkönig lässt in Potsdam exerzieren
Der Philosophenkönig reitet in Breslau ein
Der ›Herr der fünf Kirchen‹ krönt in Frankfurt seinen Bruder zum Kaiser
3. Städte und Leute
Vivaldi in Wien
Händel in London
Telemanns Reise nach Paris
Telemann in Hamburg
Quantz in Dresden
Die Gebrüder Graun in Berlin
Bach in Leipzig
4. Ausflüge aufs Land
Die Gärten der Familie Bose
Land-Leben in Ritzebüttel
Die ›Oberkeit‹
Warnung vor Lips Tullian
5. Fortschritte
Thomasius greift die Folter an
Leibniz rechnet
Wolff macht sich Vernünfftige Gedancken über Gott und die Welt
Ein Zeitsprung
Böttger muss das Porzellan erfinden
Zedler verlegt ein Lexikon
Ehrenrettung für Gottsched oder Der aussichtslose Kampf gegen Hans Wurst
Süßmilch treibt Statistik
Haller seziert Leichen
Dorothea Erxleben darf promovieren
6. Musik, Macht, Religion
Wie kommen die Noten aufs Papier?
Wie kommt der Klang ins Ohr?
Pauken und Trompeten
Stadtpfeifer, Bierfiedler, musikalische Lakaien, Konzertmeister
Kastraten und Diven
Soli Deo Gloria
Die große Klangmaschine
Wer sitzt wo in der Kirche
Der Gottesdienst als Erbauung und Strapaze
Die Kirchenbuße
Schafottpredigten
Passionen
7. Innere Frömmigkeit
Irdisches Vergnügen in Gott
Franckes Gottesstadt bei Halle
Graf Zinzendorf und die Herrnhuter
Windstille oder Der Kult der Selbsterforschung
Die Pietisterey im Fischbein-Rocke
8. Äußere Erscheinung
Etwas über die »Schönheit des Frauenzimmers«
»Abbildung eines vollkommenen Mannes«
»Kleider machen Leute«
Der weit ausgespannte Unterrock
Der hohe Haupt-Schmuck
Verschiedene schwache Stäblein
Schminck-Pflästergen
Der Berliner Perückenkrieg
Samthosen und Seidenstrümpfe
Das Justaucorps
Der Dreispitz
Die Bauernkluft
Maskeraden
Intermezzo: Die Galanterie greift um sich
9. Familienleben
Die Jungfern-Lotterie
»Große Hochzeit, große Freuden«
Bettelhochzeiten
Mätressen und Ehen ›linker Hand‹
»Leg ewig Uhr und Uhr zusammen«
Der ›gedoppelte Handgriff‹ der ›Hof-Wehmutter‹ Justine Siegemund
Kinder, Kinder
Schulmeisterkantate oder Wie gelingt Erziehung?
Die wol unterwiesene Köchinn
Hausrat oder »Specificatio der Verlassenschafft des Herrn Johann Sebastian Bachs«
10. Weltliche Freuden
Ruhestat der Liebe
»Lüsterne Brunsten«
Singen und Tanzen
Tabakskollegien und Tabakskantaten
Kaffeehäuser und Kaffeekantaten
Die Lerchen der Leipziger
Bach und Bier
Händels Tafel
Telemanns Blumenliebe
Münchhausens Ananas
Wie lustig ist das Studentenleben?
Volksbelustigung oder Der Rumpfmensch von Regensburg
Bänkelsänger
11. Irdisches Leid
Wetterberichte
Die letzte große Pest
Wer war Doktor Eisenbarth?
Carls Armen-Apothecke
Stahls Pillen und Hoffmanns Tropfen
Fahrenheit misst Fieber
Schlaflos in Dresden
Brockes wird ein Zahn gezogen
»Weiberkranckheiten«
Den Star stechen
Finale: »Der Abschied ist gemacht«
Anhang
Nachweise
Quellen- und Literaturverzeichnis
Zeitgenössisches
Sekundärliteratur
Sonstige Literatur
Websites
Bach, Händel, Telemann synchron
Dank …
Foto: Abdruck der Thomaskirche mit freundlicher Genehmigung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.
Für meine Più
»Ob diese [die Musik] zwar mein Acker und Pflug ist, und mir zum Hauptergetzen dienet, so habe ich ihr doch seither ein Par Jahren eine Gefehrtinn zugesellet, nemlich die Bluhmen-Liebe«.
Telemann 1742 an einen Freund
»Ich mache Ihnen ein Geschenk und schicke Ihnen eine Kiste Blumenzwiebeln«.
Händel 1750 an Telemann in einem auf Französisch abgefassten Brief
»Ohnerachtet der Herr Vetter sich geneigt offeriren, fernerhin mit dergleichen liqueur [gemeint ist ein Fäßlein Most] zu assistiren; So muß doch wegen übermäßiger hiesigen Abgaben es depreciren; denn da die Fracht 16 gr. der Überbringer 2 gr. der Visitator 2 gr. die Landaccise 5 gr. 3 pf. und generalaccise 3 gr. gekostet hat, als können der Herr Vetter selbsten ermeßen, daß mir jedes Maaß fast 5 gr. zu stehen kömt, welches denn vor ein Geschenke alzu kostbar ist.«
Bach 1748 an seinen Vetter und früheren Sekretär Johann Elias Bach
Persönliches Vorwort
Meine erste Begegnung mit Bach war wenig glücklich. Sie erfolgte im Musikunterricht der Mittelstufe. Noch heute sehe ich den Lehrer, einen kleinen, quecksilbrigen Mann, vor der Tafel hin und her hüpfen, stets seine Lieblingssentenz zur Kennzeichnung der Musik Bachs auf den Lippen: »Einheit in der Vielfalt – Vielfalt in der Einheit«. Wie es nicht anders sein kann, seit es Lehrer und Schüler gibt, verdrehten die Schüler dem Lehrer das Wort im Mund: »Einfalt in der Vielheit – Vielheit in der Einfalt.« Das war selbst recht einfältig. Und nicht besonders einfallsreich.
Schwer vorstellbar damals, dass der notorische Thomaskantor einmal mein Lieblingskomponist werden würde, falls diese eher kulinarische Kategorie dem überzeitlichen musikalischen Genius JSB angemessen ist. Zu seinen Lebzeiten war Bach, verglichen mit Händel in London oder dem in ganz Deutschland umtriebigen Telemann, eine regionale Größe, eine ehrerbietig behandelte und bevorzugt bezahlte, aber eben doch eine Provinzfigur. Ein Vergleich mit europäischen Instanzen wie dem Venezianer Vivaldi oder Rameau in Paris wäre erst gar nicht in Betracht gekommen. Heute ist die musikalische Reichweite dieser ›Provinzfigur‹ global und BACH mehr ein Marken- denn ein Eigenname. Auf allen Kontinenten gilt Bach, nach seinem Tod erst als Scholastiker der Fuge verspottet und dann drei Generationen lang ignoriert, als universeller Meister jenseits der Rangklassen. Nur Mozart umgibt ein vergleichbarer Nimbus.
Als der zwanzigjährige Felix Mendelssohn Bartholdy am 11. März 1829 in der Berliner Singakademie eine gestraffte Fassung der Matthäus-Passion zur Aufführung brachte (zwei Drittel der Arien ließ er weg), saßen Hegel, Heine, Schleiermacher und Schumann im Publikum. Allerdings nicht nebeneinander. Was hätten die vier wohl untereinander getuschelt? Und wären sich der anti-romantische Philosoph, der romantische Dichter, der romantische Theologe und der romantische Komponist über die musikalische Auferstehung der in lutherischer Frömmigkeit ruhenden Passion einig gewesen?
Die Frage nach einer innig gläubigen, also nicht nur schmückenden Bindung der Kunst an Religion ist seit dem Aufkommen der romantischen Kunstreligion bedeutungslos geworden. Bachs Kirchenmusik hat sich zur Konzertmusik gewandelt, und selbst wenn sie in Gotteshäusern aufgeführt wird, steht sie nicht mehr zuerst im Dienst einer Feier des Glaubens, sondern bietet ›Kunstgenuss‹ für zahlendes Publikum.
Den Meister hätte das befremdet. Aber wir können seine Musik nicht mehr hören, wie er selbst und seine Zeitgenossen sie gehört haben. An dieser akustisch-epochalen Verschlossenheit ändern auch ›historisch korrekte‹ Aufführungen mit alten Instrumenten nichts. Zwischen ihm und uns steht die Romantik, der seine Wiederentdeckung und Wiedererweckung zu verdanken sind. Jedoch wird alles, was von der Romantik berührt wird, unvermeidlich ›romantisiert‹ und in ihre eigene Daseinshaltung hineingezogen. Das Genie tritt nach vorn, und Gott tritt zurück.
Die Opulenz, in der uns die großen Messen und Passionen heute präsentiert werden, wäre zu Bachs Zeiten gar nicht möglich gewesen. Die damals eingesetzten Orchester kämen uns enttäuschend dünn besetzt vor, ebenso die Chöre mit nicht einmal zwei Dutzend Sängern.
Was hören wir also, wenn in einer Kirche eine Kantate erklingt? Oder die h-Moll-Messe, die Bach selbst nie vollständig gehört hat? Oder in einem Konzertsaal die Kunst der Fuge, von der er ebenfalls keine Aufführung erlebte? Oder in einer Philharmonie ein Brandenburgisches Konzert? Oder von einer CD die Toccata und Fuge in d-Moll? Oder vom MP3-Player eine Violinsonate. Oder auf Youtube »Breakdance zu Barock-Beats von Bach«?
Darf man ein Buch über Bach schreiben, wenn man im Musikunterricht schlecht aufgepasst hat und kaum Noten lesen kann? Man darf nicht! Allerdings besteht Musik nicht nur aus Noten, das gilt auch für die 16926 Minuten Musik, die Bach komponiert hat, wie ausgerechnet wurde. Ohne Interpreten und ohne Zuhörer und ohne die Räume, in denen beide einander begegnen, sind Noten nur schwarze Punkte auf liniertem Papier.
Im Übrigen ist dieses Buch keines über Bach und seine Kompositionen, sondern eines über Bach und seine Zeit, über seine Lebensumstände und die seiner Zeitgenossen. Stets spielt Musik im Hintergrund, aber ihr kompositorischer Aufbau und ihre ästhetische Struktur gehören nicht zu den Themen der hier erzählten Geschichten.
Als der kleine Johann Sebastian im Hause seines älteren Bruders Johann Christoph, der ihn nach dem Tod des Vaters aufgenommen hatte, nachts bei Kerzenlicht heimlich Noten kopierte, spielte die Musik nicht in Deutschland, sondern in Italien und Frankreich. Das änderte sich jedoch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Telemann zählte in einem Gedicht seinerzeit berühmte deutsche Komponisten auf – außer Händel heute allesamt vergessen – und resümierte: »So muss Venedig, Rom, Paris und London sagen, / Die besten Meister sind in Teutschland zu erfragen.«
Der Titel des vorliegenden Buches orientiert sich weniger an der historischen Wertung in der Rückschau als am frischen Selbstbewusstsein der deutschen Musiker jener Zeit. Ganz ernst sollte man ihn dennoch nicht nehmen, sondern mit nationaler Selbstironie. Der bedeutende Bach-Biograph Philipp Spitta allerdings meinte 1873, zwei Jahre nach der deutschen Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles, anders auftrumpfen zu müssen: Seit »dem Beginne des 18. Jahrhunderts übernahm Deutschland unter den musikalischen Völkern die Führerschaft und hat sie bis heute behauptet.« Und »wer die Zeit am Beginn des 18. Jahrhunderts culturhistorisch würdigen will, muß auf die Erscheinung Sebastian Bachs sein Auge richten, die, als noch alles ringsum todt und öde war, wie ungeahnt und durch einen Zauber hervorgerufen kam, der Wasserlilie gleich, die aus geheimnißvoller Tiefe über die graue und einförmige Fläche des Sees heraufgesendet wird, ein prangendes Zeugniß des nie ersterbenden Lebens im Schooße der Natur und der Zeiten.«
Eine Wasserlilie ist der grimmige Bach nicht wirklich gewesen. Das gibt auch Spitta zu, sondern ein »voller deutscher Mann, Recke und Kind in einer Person, wild und doch wieder hingebend weich – unter den deutschen Theologen kann ihm ganz doch nur Luther verglichen werden.« Diese heute komisch wirkenden Einlassungen weisen gleichwohl zu Recht auf die Bedeutung Luthers und seiner Glaubenslehre für Bach und dessen Musik hin. Das soll in diesem Buch nicht überbetont, aber auch nicht überhört werden.
Im Unterschied zu kulturgeschichtlichen Periodisierungen wie ›Lutherzeit‹ oder ›Goethezeit‹ wird gewöhnlich nicht von einer ›Bachzeit‹ gesprochen. Das hat – im Prinzip – seine Richtigkeit. Die Epoche, in der Bach lebte, und überhaupt die Jahrzehnte um 1700 lassen sich anders als die Jahrzehnte um 1500 oder die Jahrzehnte um 1800 nicht mit einer einzigen historischen Gestalt versinnbildlichen. Doch wie fragwürdig generell solche personenbezogenen (mitunter personenfixierten) Veranschaulichungen sein mögen und so zweifelhaft die Versuche, auf diese Weise der Vergangenheit abschnittsweise Name und Gesicht zu geben – ohne sie bleiben nur abstrakte Stilbegriffe übrig. Dass diese Begriffe kaum genauer sind als Kennzeichnungen nach Eigennamen, zeigt das schöne Wort ›Barock‹.
Die Zeit der schrägen Perle Was bedeutet Barock?
Wollte man mit Epochenbegriffen jonglieren, könnte man den (oder das) Barock als die Postmoderne der Renaissance bezeichnen. Allerdings darf im Unterschied zu ›Postmoderne‹ und ›Renaissance‹ der Begriff ›Barock‹ nicht als Selbstbezeichnung gelten. Er ist Bestandteil kultureller Nachrede, im 19. Jahrhundert einer üblen, die das Pathos jener Zeit als leeren Pomp verhöhnte und ihren lastenden Schmuck als schräge Abirrung von den Idealen der Klassizität. Wortgeschichtlich lässt sich das italienische ›barocco‹ auf die französische ›perle baroque‹ zurückführen und diese wiederum auf die ›barocco‹, mit der die portugiesischen Juweliere des 16. und 17. Jahrhunderts eine unregelmäßig geformte, schiefe oder schräge Perle bezeichneten.
Von diesen Perlen scheint es ziemlich viele gegeben zu haben. Und auch das Barock ist so vielfältig, dass der Begriff schon deshalb fragwürdig, um nicht zu sagen: von epochaler Untauglichkeit ist. Was hat ein von einer Putte aus der Tiepolo-Decke der Würzburger Residenz gestrecktes Gipsbein mit den geometrisch gestutzten Buchskugeln im Park von Versailles gemeinsam? Was Berninis ekstatisch von einem Engel erstochene Theresa in Santa Maria della Vittoria in Rom mit den weit aufgerissenen Mündern von Schlüters sterbenden Kriegern im Berliner Zeughaus? Was das züchtige Ännchen von Tharau des Simon Dach im abgelegenen Preußen mit der frivolen Manon Lescaut des zwielichtigen europäischen Herumtreibers Abbé Prévost? Was der prachtgewohnte Musiker Lully am Hof des Sonnenkönigs mit dem von Schulbuben geplagten Thomaskantor?
Man könnte diese Brückenfragen lange fortsetzen, ohne eine wirklich tragfähige Brücke über die Zeiten und Räume zu finden, in denen ›Barockes‹ sich entfaltet hat. Es gab einen spanischen, italienischen und französischen Barock, einen flämischen und einen holländischen, einen nord- und süddeutschen, einen katholischen und einen protestantischen. Einen fritzischen Barock gab es auch, freundlicher formuliert: das preußische Rokoko. Und über allem leuchtete die Sonne der Aufklärung, jedenfalls seit Anfang des 18. Jahrhunderts und in den Augen derjenigen, die das ›Enligthenment‹, das ›siècle des lumières‹ voller Optimismus zu einer europäischen Bewegung machten. In der Mitte des Jahrhunderts hatte das Barock den Höhepunkt überschritten, und als 1755, fünf Jahre nach Bachs Tod, in Lissabon die Erde bebte, wurde nicht nur die Stadt der schrägen Perlen, sondern auch der Optimismus der europäischen Aufklärung erschüttert. Von der ›besten aller möglichen Welten‹, wie Leibniz sie in seiner Theodizee philosophisch hergeleitet hatte, konnte nur noch parodierend die Rede sein, etwa in Gestalt des zwanghaften Optimisten Pangloss in Voltaires Candide von 1759.
Das Barock war schwülstig, aber auf mathematisch stringente Weise, seine Überladenheit folgte geometrischen Prinzipien. Selbst die verspielten Wucherungen des Rokoko lebten noch vom Rationalismus, dem sie sich entwinden wollten. Weil die Aufklärer an diesen Rationalismus anknüpften, konnten sie sich mit den Fürsten des Absolutismus verbünden. Die verborgene Strategie hinter diesem Bündnis bestand darin, sich der Machthaber zu bemächtigen: Wenn wir unsere Ideen in die Köpfe der Souveräne säen, werden sie im ganzen Land Früchte tragen; wenn der Staat berechenbar und zuverlässig funktionieren soll wie eine Uhr, so müssen wir den fürstlichen Uhrmacher entsprechend instruieren; und wir müssen ihn dahin bringen, dass er sich, wie Gott aus seiner Schöpfung, aus seinem Staat heraushält, wenn die Uhr erst einmal aufgezogen und der Staat eingerichtet ist.
Die Künste führten in dieser Zeit kein Eigenleben, sondern waren stets auf etwas außer ihnen Liegendes bezogen: auf die Verherrlichung eines Monarchen, auf festliche Repräsentation, auf Kirchenkult und Gottesdienst, auf Erziehung der Subjekte, und zwar der Subjekte in großer Zahl. Das Erbauen und Ergötzen kamen dabei nicht zu kurz, waren jedoch nie offener Selbstzweck. Mochte mancher Künstler die ästhetische Selbstzwecklichkeit bereits empfunden haben, noch war es angeraten, diese Empfindung mit Dienstbarkeit unkenntlich zu machen, statt sich als Genie zu exaltieren, das aus eigenem und nur aus eigenem Recht ans Werk geht. Der Künstler konnte sich selbst an die Decke malen, wie es Tiepolo in der Würzburger Residenz getan hat, und den Baumeister Balthasar Neumann gleich mit, im wirklichen Leben waren es die fürstlichen Auftraggeber, die von hoch oben auf die Künstler herabsahen.
Foto: Abdruck des Feuerwerks mit freundlicher Genehmigung von akg-images.
Feuerwerke waren nahezu unverzichtbar bei den höfischen Festen des Barock. Das galt auch für den kurfürstlichen Hof in Dresden. Die Gouache von 1709 zeigt ein Wasserfeuerwerk auf der Elbe.
Präludium Drei Meister
Der »berühmte Hamburgische Künstler Telemann […] ist einer von den dreyen musicalischen Meistern, die heute zu Tage unserm Vaterlande Ehre machen. Hendel [!] wird in London von allen Kennern bewundert, und der Capellmeister Bach ist in Sachsen das Haupt unter seines gleichen.« Johann Christoph Gottsched, Dezember 1728
Telemanns Trauer-music eines kunsterfahrenen Canarien-Vogels
Rund 1800 Kantaten komponierte Georg Philipp Telemann und hat sich mit ihnen und den 1000 Sinfonien, Sonaten, Duetten und Quartetten sowie 50 Opern, 40 Passionen, 16 Messen und 6 Oratorien nach eigener Auskunft ›ganz marode melodiert‹. Nicht nur wegen dieser unentwegten Produktion überboten sich die Gegner, die sich nach seinem Tod sehr vermehrten, in Schmähungen. Von ›schädlicher Fruchtbarkeit‹ und ›Abgeschmacktheit‹ war die Rede, von ›läppischer Schilderei‹, ›ermüdendem Einerlei‹, ›Sitzenbleiben im Alltäglichen‹, ›musikalischer Manufaktur‹ und ›seichter Affektiertheit‹. Die Urheber dieser ungerechten Abfertigungen eines von den Zeiten überholten Meisters seien zur Strafe verschwiegen. Nur Lessing sei erwähnt. Welche der Verunglimpfungen stammt wohl von ihm?
Wie leicht sich Qualitätsurteile disqualifizieren, wenn sie sich an die Meister halten statt ans Werk, zeigt das Beispiel des ehrwürdigen Albert Schweitzer. Wie so viele spielte auch er Bach gegen Telemann aus, nur unterlief ihm der amüsante Fehler, dass er an einer Bach-Kantate (BWV 145) gerade den Eingangschor besonders lobte, der sich später als von Telemann komponiert herausstellte. Es lebe der Blindtest! Anonym hören und werten, dann erraten, wer der Schöpfer ist.
Wie es Telemann bei Schweitzer mit Bach erging, so erging es Christoph Ludwig Fehre bei den Musikwissenschaftlern mit Telemann. Niemand, den einen oder anderen Spezialisten ausgenommen, kennt heute noch den armen Orgeltreter Fehre aus Dresden. Aber viele, vor allem Musiklehrer, kennen Telemanns Schulmeister-Kantate. Und die stammt eben nicht von Telemann, sondern von Fehre, wie Mitte der 1990er Jahre zuverlässig bewiesen wurde.
Gottlob wurde bislang Telemanns Autorschaft bei der menschlich-musikalisch merkwürdigsten seiner Kantaten nicht angezweifelt. Er veröffentlichte sie 1737 in Hamburg unter dem Titel Cantate oder Trauer-Music eines kunsterfahrenen Canarien-Vogels, als derselbe zum größten Leidwesen seines Herrn Possessoris verstorben. Trotz des Herrn Besitzers handelt es sich um ein Stück für Sopran: »Oh weh, oh weh, mein Canarin ist tot. / Wem klag’ ich meine Not, / wem klag’ ich meine bittren Schmerzen, / wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen, / wem klag’ ich diese Not?« Bei Aufführungen pflegen die Sängerinnen zu lächeln, damit das Publikum auch merkt, dass es sich um einen Schabernack handelt. Der Musik ist das nicht anzuhören. Sogar die Passagen, in denen der Tod in Gestalt der Katze, die den Vogel geholt hat, beschimpft wird (»Friss, dass dir der Hals anschwelle, friss du unverschämter Gast!«), halten den tragischen Ton. Im Rezitativ, das auf die Eingangsarie folgt, heißt es über den ermordeten Kanarienkünstler: »Er war mit seiner Kunst vortrefflich anzuhören und fast ein Wunder seiner Zeit.« Das trifft haargenau auf Telemann selbst zu, bis hin zum einschränkenden »fast«, denn das musikalische Wundertier der Zeit ist Georg Friedrich Händel gewesen.
Händels Dettinger Te Deum und das Gespenst vom Lindigwald
Händel und Telemann haben einander Briefe geschrieben, nicht nur über Blumen[1]. Bach und Telemann waren befreundet, Telemann stellte sich als Taufpate von Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel zur Verfügung. Händel und Bach sind einander nie begegnet, trotz eines Versuchs vonseiten Bachs im Juni 1719, Händel in dessen Geburtsstadt Halle in Brandenburg[2] zu treffen. Bach war zu diesem Zeitpunkt im sächsischen Köthen, Händel in der Weltstadt London berühmt. Und während Bach später in Leipzig Jahrgang um Jahrgang Kantaten schrubbte, wurde Handel (ohne Pünktchen, wie die Engländer sagten und schrieben) mit Kompositionen für repräsentative Feiern der englischen Monarchie beauftragt: Sei es eine Wassermusik, seien es die Krönungsanthems[3] oder die kirchlichen Triumphmusiken, wenn ein Friede geschlossen oder eine Schlacht gewonnen war.
Das Dettinger Te Deum ist eine solche Triumphmusik. Händel komponierte es im Auftrag Georgs II. nach der letzten großen Schlacht des österreichischen Erbfolgekriegs. Bei dieser Schlacht im Juni 1743 in der Nähe des mainfränkischen Dorfes Dettingen standen Truppen aus England, Kurhannover, Österreich und Hessen einem französisch-bayerischen Heer gegenüber. Der englische König war in dieser Schlacht noch einmal sein eigener Befehlshaber, was unter den europäischen Fürsten jener Zeit eigentlich nur noch der Hasardeur Friedrich II. von Preußen wagte. Wenn der König als Feldherr in die Schlacht reitet – oder wohl doch halbwegs behütet weiter hinten im Stabszelt kommandiert –, muss die Schlacht gewonnen werden. Und so geschah es in den Augen der königlichen Chronisten auch bei Dettingen, obwohl der tatsächliche Ausgang der Schlacht wohl eher ein Unentschieden ohne militärische Vorteile für die eine oder andere Seite war, trotz der Tausenden von Toten und Verwundeten.
Wie es im Krieg zuging, lässt Jonathan Swift in seinem 1726 erschienenen satirischen Roman Gullivers Reisen den Titelhelden auf der vierten und letzten Ausfahrt dem entsetzten König der Pferde erzählen: »Da mir die Kriegskunst nicht unbekannt war, beschrieb ich ihm Kanonen, Feldschlangen [fahrbare Kleingeschütze], Musketen, Karabiner, Pistolen, Kugeln, Schießpulver, Schwerter, Bajonette […]; ich sprach ihm von Schiffen, die mit tausend Mann untergingen, von zwanzigtausend Toten auf beiden Seiten, vom Stöhnen Sterbender, von Gliedern, die durch die Luft fliegen, von Rauch, Geschrei, Verwirrung, vom Unter-Pferdehufen-zertrampelt-Werden; von Flucht, Verfolgung und Sieg«.
Während der von Händel-Chören besungenen Schlacht vergruben der Legende zufolge flüchtende französische Soldaten in einem Wäldchen einen Münzschatz. Das Wäldchen wird in Dettingen und den umliegenden Dörfern, darunter mein Geburtsort Kleinostheim, als Lindigwald bezeichnet und der Schatz als Lindigschatz. Er ist bis heute nicht gefunden. In meiner Kindheit habe ich nach diesem Schatz gegraben. Aber nur am Tag, denn nachts wurde er von einem Gespenst bewacht. Es sprang den Schatzsuchern auf den Rücken, peitschte auf sie ein und ritt sie zurück ins Dorf. Inzwischen ist das Gespenst verstorben, wie alle Gespenster, an die niemand mehr glaubt. Der Schatz liegt immer noch ungehoben im Lindigwald. Und immer noch ertönt das herrliche Dettinger Te Deum. Es klingt heute weltweit mit seinem typischen Händel-Jubel wunderschön nach allgemeinem Lobpreis, obwohl es entstanden ist, um eine Schlacht des Königs von England zu feiern.
Bachs Chaconne im Untergrund
Am Morgen des 12. Januar 2007 ging Joshua Bell in den Untergrund. In seinem Geigenkasten befand sich jedoch keine Maschinenpistole wie in amerikanischen Mafia-Filmen, sondern eine dreihundert Jahre alte Stradivari. Der Stargeiger trug ein T-Shirt und eine fälschlicherweise richtig herum aufgesetzte Baseballkappe, als er sich in der Eingangshalle der Washingtoner Metro in Positur stellte. Er holte Geige und Bogen aus dem Kasten und begann zu spielen. Er spielte die Chaconne[4] aus der Partita Nr. 2 für Violine von Bach. Es war kurz nach sieben in der morgendlichen Rushhour. Die Menschen hasteten an ihm vorbei. Es dauerte drei Minuten, bis der erste Passant reagierte. Der Mann hob verwundert den Kopf, zögerte einen Moment – und eilte weiter. Drei Minuten später blieb der erste Passant stehen und hörte ein paar Takte lang zu. Dann warf er ein Geldstück in den aufgeklappten Geigenkasten und ging seiner Wege.
Drei Jahre nach Bells Experiment begann der Cellist Dale Henderson, Bach-Suiten in U-Bahnhöfen zu spielen. Er lud andere Musiker ein, es ihm gleichzutun und sich über die sozialen Medien zu vernetzen. Inzwischen finden unter dem Label »Bach in the Subways« jedes Jahr an Bachs Geburtstag am 21. März an zahllosen ›locations‹ in der ganzen Welt Aufführungen statt.[5]
Bach war Mitte dreißig, als er sich in Köthen über ein Blatt Notenpapier beugte, um geduldig die kalligraphische Reinschrift eines der geheimnisvollsten Stücke der abendländischen Musik anzufertigen, das »Stück der Stücke« nennt der niederländische Schriftsteller Maarten ’t Hart die Chaconne. Sie ist für Geige geschrieben, dauert eine Viertelstunde in 256 Takten und klingt, als käme sie aus der Ewigkeit, über alle Zeiten erhaben. Ob sie wirklich ein ›Grabstein‹ für seine erste, in Köthen während seiner Abwesenheit im Juli 1720 gestorbene Frau Maria Barbara ist, wie spekuliert wurde, sei dahingestellt. Die vollkommene Einzigartigkeit und einzigartige Vollkommenheit des Stückes indessen werden von niemandem bezweifelt, so wenig wie die Herausforderung, die es für jeden Virtuosen darstellt.
So unvergleichlich wie das Stück ist auch sein Ruhm. Und wieder hatte Felix Mendelssohn Bartholdy die Finger dabei im Spiel: im Wortsinn, denn er komponierte die Klavierbegleitung, mit der im Frühjahr 1840 die Chaconne zum ersten Mal nach Bachs Tod zur öffentlichen Aufführung gelangte.
Ich begegnete der Chaconne mit Anfang zwanzig in einem Frankfurter Buchladen. Die noch nie gehörte Musik ging mir durch Mark und Bein, ich kann es nicht anders ausdrücken. Sie kam von der Schallplatte, und als ich mich bei der Buchhändlerin erkundigte, was ›das‹ sei, erhielt ich die Auskunft, es handele sich um ein Stück aus Bachs Partiten. Daraufhin kaufte ich eine Platte mit diesen Stücken, die ich immer noch besitze, auch wenn ich schon lange keinen Plattenspieler mehr in Betrieb habe. Inzwischen höre ich die Chaconne von CD in einer Aufnahme mit Mark Lubotsky, gespielt auf einer Guadagnini-Geige aus dem Jahr 1728.
1. Die Welt, Europa und die deutschen Länder
Tanz der Kontinente – Singende Geographie – Der ›Südseeschwindel‹ – Deutschland nach der Verheerung
Tanz der Kontinente
Drei Akte hat Händels erstes ›Sing-Spiel‹ Almira, uraufgeführt im Januar 1705 in der Oper am Gänsemarkt der Hafenstadt Hamburg. Im dritten Akt treten drei Kontinente auf: Europa, Afrika, Asien. Frau Europa trägt dem Libretto zufolge römische Tracht, eine Oboenkapelle schreitet ihr voran. Afrika wird unter Trommeln und Trompeten von zwölf ›Mohren‹ über die Bühne gezogen. Asien tanzt, von Piccoloflöten und Trommeln begleitet, eine Sarabande. Aus diesem Instrumentalstück geht sechs Jahre später, in der Oper Rinaldo zu einer Klage-Arie erhöht, Händels größter Hit hervor: Lascia ch’io pianga. Die Almira, deren vollständiger Titel lautet Der in Krohnen erlangte Glücks-Wechsel, oder: Almira, Königin von Castilien, ist Händels einzige Oper ohne Kastratenrollen[6].
Vier Seiten hat die Decke über dem Treppenhaus der Würzburger Residenz, und vier Teile hat dort oben die Welt: Europa, Asien, Amerika und Afrika, für jede Seite des Deckengemäldes ein Erdteil. Von Australien wusste Giovanni Battista Tiepolo aus Venedig nichts, als er in Würzburg aufs Gerüst stieg. Das 1752/53 entstandene Fresko zeigt Europa als Herrscherin der Welt und in deren Zentrum den Würzburger Hof. Amerika, als halb wilde, mithin barbusig dargestellte Indianerin trägt Federschmuck und sitzt auf einem Krokodil. Zu ihren Füßen liegen die abgeschlagenen Köpfe weißer Männer, deren Körper, so durften die entsetzten Betrachter vermuten, von den roten Kannibalen verspeist worden waren. Frau Asia, ehrwürdige Repräsentantin einer uralten Kultur, reitet vollständig bekleidet auf einem prächtig aufgezäumten Elefanten, während die primitiv sinnliche Afrika von ›Mohren‹ umgeben nackt und träge auf einem Dromedar ruht in Erwartung der ihr dargebrachten Geschenke.
Etwa in der Mitte zwischen dem Bühnenauftritt von Händels Afrika in Hamburg zu Beginn des 18. Jahrhunderts und dem Erscheinen von Tiepolos Afrika an der Würzburger Decke in der Mitte des 18. Jahrhunderts meldeten die Wöchentlichen Hallischen Frage- und Anzeigungs-Nachrichten: »Hieselbst hat sich ein in Diensten Sr. Hochfürstl. Durchl. des regierenden Herzogs von Wolfenbüttel stehender getaufter Mohr Namens Herr Antonius Wilhelmus Amo, einige Jahre Studirens halber aufgehalten.« Die Meldung vom 28. November 1729 weist maliziös darauf hin, dass »das argument der disputation seinem Stande gemäß seyn möchte«, also »vom Mohrenrecht« handele und »vornehmlich dieses untersuchet, wie weit den von Christen erkauften Mohren in Europa ihre Freyheit oder Dienstbarkeit denen üblichen Rechten nach sich erstrecke.« Amos Dissertatio inauguralis de iure maurorum in Europa ist verloren gegangen. Einige spätere lateinische Schriften haben sich erhalten, außerdem ist das akademische Wirken des ›Mohren‹ neben Halle auch in Wittenberg und Jena belegt.
Amo kam als Kleinkind auf einem Sklavenschiff der holländischen »West-Indischen Compagnie« nach Amsterdam und dort in den Besitz von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, dem Dienstherrn von Leibniz in den frühen 1690ern. Jedoch sind der europäische Universalgelehrte und der spätere afrikanische Rechtsphilosoph, der seine außergewöhnliche Laufbahn als Kammermohr begann, einander nie begegnet. Selbst wenn man sich ausmalt, Leibniz hätte kurz vor seinem Tod 1716 sein Haus in Hannover für einen Besuch in Wolfenbüttel verlassen und wäre dort in einem Antichambre des Schlosses[7] auf den jugendlichen Kammermohr Amo gestoßen, selbst wenn zeitlich gerechnet eine Begegnung der beiden in einem Vorzimmer möglich gewesen wäre, so hätte in Herkunft und Haltung doch das Meer zwischen ihnen gelegen, das Europa von Afrika trennt. Ohnehin hielt der europäische Gelehrte die afrikanische Menschenware für gefährlich. Im Juni 1700 schrieb er an seine Gönnerin, die Kurfürstin Sophie in Hannover: »Als ich beim Kurfürsten in seinem Appartement war, wurde ihm gemeldet, dass einer der neu eingetroffenen Mohren sich gestern ertränkt habe. Die Ursache ist: Er hatte ich weiß nicht was für eine Dummheit begangen, er wurde festgenommen und sollte gezüchtigt werden, er entwich aus den Händen der Leute, die ihn führten, und stürzte sich in eine Schleuse und konnte nicht rechtzeitig gerettet werden. Erst heute wurde der Leichnam gefunden, er soll unter dem Galgen begraben werden. Menschen dieser Art sind eine Gefahr und fähig, sich an dem größten Fürsten zu vergreifen. Deshalb sollte man sie besser entfernen.«
Nach Herzog Antons Tod 1714 wurde Amo an dessen Sohn und Nachfolger August Wilhelm vererbt, als einer der an Fürstenhöfen und auf Fürstenbildern gern präsentierten Kammermohren. Sie waren die exotische Zier an europäischen Königs- wie an deutschen Provinzhöfen. Auf zahlreichen Gemälden tragen sie Blumenschalen durch Prunkzimmer oder stehen Schirmchen haltend hinter fürstlichen Kleinkindern, etwa auf einem Bild Antoine Pesnes von 1714, das den pausbäckigen kleinen Friedrich von Preußen mit seiner Schwester Wilhelmine darstellt. Andere Gemälde im sich gern ›leichtfertig‹ gebenden Rokoko-Geschmack ließen schwarze Jünglinge in Kammermohr-Livree bewundernd zu Gräfinnen emporblicken oder lüstern vor den Betten halb nackter Prinzessinnen herumlungern. Eine Porzellangruppe des Meißener Modellmachers Johann Joachim Kändler von 1737, betitelt als »Handkuss mit Mohrendiener«, besteht aus einer sitzenden Dame im Reifrock mit Hündchen im Schoß. Eine Hand überlässt sie recht desinteressiert einem knieenden Kavalier zum Kuss, mit der anderen hält sie dem aufgeputzten schwarzen Diener ein Schokaladentässchen zum Nachschenken hin. Von William Hogarth wiederum gibt es eine satirische Radierung aus dem Jahr 1746, die zeigt, wie eine Lady im Reifrock ein Negerbüblein unterm Kinn krault, wie sie sonst ihr Hündchen gekrault haben mag.
Die ›Mohren‹ wurden nicht nur auf Bildern vorgezeigt, sondern auch als Lebendschmuck bei fürstlichen Festen. David Fassmann berichtet in Leben und Thaten von Friedrich Augusti von einer entsprechenden Abteilung beim festlichen Einzug nach Dresden anlässlich der Vermählung des Sohnes von August dem Starken mit einer Habsburger Prinzessin im Jahr 1719: »Mohren zu Fuß alle einer Länge, so Ihre Majestät der König [in Polen, der Kurfürst August in Personalunion war] haben aus Portugall bringen lassen, in weißen Atlas gekleidet, mit rothen scharlachenen Talaren, so mit blauen sammtenen Borden und goldenen Tressen wechsels-weise besetzet waren; um den Hals hatten sie goldene Hals-Bänder, und auf den Köpffen Türckische Bünde mit Strauß-Federn.«
Der dressierte schwarze ›Wilde‹ im Festzug faszinierte das Straßenpublikum, und der ›Mohr‹ im Schlafgemach einer weißhäutigen Aristokratin beschäftigte die erotische Phantasie weißer Herren, hin- und hergerissen zwischen Aufreizung und Abscheu. Als Amo, durch die Förderung seines Wolfenbütteler ›Inhabers‹ zum Rechtsdozenten in Jena aufgestiegen, es in den frühen 1740ern wagte, einer Bürgertochter einen Heiratsantrag zu machen, folgte auf die Abweisung öffentliche Häme, etwa in Form gereimter Verfolgung durch den selbst viel verfolgten Johann Ernst Philippi: Herrn M. Amo, eines gelehrten Mohren, galanter Liebes-Antrag an eine schöne Brünette, Madem. Astrine, ergänzt durch Der Mademoiselle Astrine Parodische Antwort auf solchen Antrag eines verliebten Mohren. Darin wird festgehalten: »Den teutschen Jungfern ist ein Mohr was unbekanntes«, nur »eine Mohrin ist blos deines Hertzens werth« und »Bey Europäern wirst du schwerlich glücklich seyn.« Das war neben der Schmähung auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Amos Lebensspuren verlieren sich, nachdem er im letzten Drittel der 1740er Jahre an die Goldküste im heutigen Ghana zurückkehrte.[8]
Das globale Sklavensystem war als Dreieckshandel zwischen Afrika, Europa und Amerika organisiert. Die Afrikaner waren die Menschenware, europäische Aktiengesellschaften wie die holländische Westindienkompanie die Großhändler, europäische Plantagenbesitzer in den kolonisierten Gebieten Amerikas die Kunden. Der von den Sklaven gewonnene Rohrzucker und die von ihnen gepflückte Baumwolle wurden nach Europa verschifft und dort weiterverarbeitet. Der Erlös ließ sich in den Ankauf weiterer Sklaven reinvestieren, der Kreislauf begann von vorn.
Die ›Global Players‹ (wie man heute sagen würde) dieses interkontinentalen Geschäfts waren die Holländer, die Franzosen und die Engländer. Aber auch Brandenburg versuchte, sich einen Anteil zu sichern. Am 1. Januar 1683 ließ an der Küste des heutigen Ghana der preußische Major Otto Friedrich von der Gröben unter Paukenschlägen und Schalmeienklang die Fahne mit dem roten Adler aufziehen und legte den Grundstein der Festung Groß-Friedrichsburg, benannt nach Kurfürst Friedrich Wilhelm (der ›große Kurfürst‹). Parallel dazu wurde eine »Brandenburgisch-Africanisch-Amerikanische Companie« in Emden etabliert, jedoch bereits 1706 wieder aufgelöst. 1717 schließlich überließ der Soldatenkönig die Festung der Westindienkompanie. Die Holländer bezahlten 72000 Dukaten, mussten ihre Neuerwerbung aber auch neu erobern, weil ein Aschanti-Häuptling die Festung nach dem Abzug des preußischen Gouverneurs besetzt hatte.
In den drei Jahrzehnten des Brandenburger Sklavenhandels wurden an die 19000 Menschen von Afrika nach Amerika verschifft. Gleichwohl war die mitteleuropäische Provinzmacht dem globalen Abenteuer nicht gewachsen. Es fehlte an Geld, Kompetenz und Leuten, um auf dem amerikanischen Kontinent ein eigenes Plantagensystem zu installieren und es mit afrikanischen Sklaven zu bewirtschaften, wie es den Holländern in ›Surinam‹ gelungen war, einem fünfzig Kilometer breiten Küstenstreifen am Atlantischen Ozean. Das gewaltige südamerikanische Hinterland blieb lange unerschlossen, aber an der Küste zogen sich endlos die Zuckerplantagen hin. Sie wurden mit indianischen Sklaven und importierten ›Negersklaven‹ bewirtschaftet. Seit sich die Holländer in den 1670ern bei der Kontrolle des Gebiets gegen die Engländer durchgesetzt hatten, wurden schätzungsweise 300000 Menschen aus Afrika dorthin verschleppt, darunter ein Bruder Amos.
Die unerhörten ›Importzahlen‹ kamen auch deshalb zustande, weil sich die schwarzen Sklaven als ›robuster‹ erwiesen als die indianischen. Maria Sibylla Merian, die im Juni 1699 zu einer zweijährigen Reise nach Surinam aufbrach, um Material für ihr wunderschönes Insektenbuch zu sammeln, und die nicht nur ein Auge für die Schönheit der Raupen, Blätter und Blüten hatte, sondern auch für das Elend auf den Plantagen – diese großartige Forschungskünstlerin schrieb in ihrer Erläuterung der Bildtafel zur Heilpflanze Flos Pavonis: »Ihr Samen wird gebraucht für Frauen, die Geburtswehen haben und die weiterarbeiten sollen. Die Indianer, die nicht gut behandelt werden, wenn sie bei den Holländern im Dienst stehen, treiben damit ihre Kinder ab, damit ihre Kinder keine Sklaven werden, wie sie es sind. Die schwarzen Sklavinnen aus Guinea und Angola müssen sehr zuvorkommend behandelt werden, denn sonst wollen sie keine Kinder haben in ihrer Lage als Sklaven.« Noch Voltaire prangerte im Candide die Zustände auf den Plantagen in Surinam an. Die einem Sklaven in den Mund gelegte Klage mündet in die Bemerkung: »Und das ist der Preis, um den Ihr Europäer Zucker esst!« Das war über ein halbes Jahrhundert nach Merians Rückkehr aus dem Land, ›wovon die Holländer viel Zucker holen‹, wie die Singende Geographie kolportiert.
Foto: Abdruck des Gemäldes von Antoine Pesne: Friedrich der Große als Kronprinz und seine Schwester Wilhelmine / SPSG / Foto: Jörg P. Anders mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.
Friedrich der Große, als er noch klein war, und seine Schwester Wilhelmine auf einem Gemälde des preußischen Hofmalers Antoine Pesne von 1714. Im Hintergrunddunkel posiert ein Kammermohr.
Singende Geographie
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts machte sich in Hildesheim der Gymnasialdirektor Johann Christoph Losius Gedanken darüber, wie man den Schülern (Schülerinnen saßen nicht in den Bänken) Eselsbrücken bauen könne, damit sie den Lernstoff besser behielten. Losius unterrichtete auch das Fach Geographie, und so begann er damit, dafür ein Lehrbuch zusammenzustellen, in dem Metaphern, allgemeine Erläuterungen, Aufzählungen und Merkreime den Stoff gliederten.
Die Metaphern leiteten sich von der Gestalt der Länder auf den Karten her. Amerika mit seiner Einschnürung in der Mitte wird als Sanduhr beschrieben, Europa überraschend als Tod, der auf Asien reitet und nach dem Herzen Afrikas zielt: Wir »wollen Europa als das Bild des Todes, Asia als des Todes Pferd, Africa als ein Hertz, darnach der Tod zielet, und America als desselben Stunden-Glas betrachten.« Der phantasiebegabte Schulmann las eine apokalyptische Reiterin aus dem Kartenbild Europas heraus und gab damit die mörderische Machtpolitik der europäischen Kolonialmächte treffender wieder als ihm selbst bewusst gewesen sein dürfte.
Zu den allgemeinen Erläuterungen zählten die über die Religionen in Europa, das »sind die Christliche, darzu die Griechische, Römische, Evangelische und Reformirte gehören, die Muhammedische bey denen Türcken und Tartern, die Jüdische, welche hin und wieder gedultet wird, und die Heydnische, welche an einigen Orthen noch nicht gar können getilget werden.« Mit einer Aufzählung wird das europäische Staatensystem wiedergegeben: »Nach der Politischen Eintheilung zehlet man 1. Drey Kayserthüme, das Römische, Türckische und Reussische [russische]. 2. Zehen Königreiche als Groß-Britanien, Schweden, Dännemarck, Pohlen, Ungarn, Böhmen, Franckreich, Spanien, Portugal und Preussen. 3. Zehen Republiquen, als die Vereinigte Niederlande, die Schweitz, Graubündten, das Waliser Gebieht, Genf, Venedig, Genua, Lucca, S. Marino im Urbinischen und Ragusa [Dubrovnik]«. Mit einem köstlich kindgerechten Reim schließlich wird den Schülern Deutschland nähergebracht: »Wer will Teutschland tüchtig wissen / Mags behalten bey sechs Flüssen / Als der Donau und dem Rhein / Weser, Oder, Elb und Mayn.«
Das Werk erschien 1708 im Druck, wurde aber schon vorher im Unterricht benutzt. Die Schuljungen lernten Stadt, Land, Fluss nicht nur durch gereimtes Aufsagen auswendig, sondern auch durch gemeinsames Hersingen, obwohl das Lehrbuch trotz des Titels keine Noten enthält.
In der Bach-Kantate Schleicht, spielende Wellen (BWV 206) übrigens singen nicht die Schüler, sondern die Flüsse. Es fechten Weichsel (für Polen), Elbe (für Sachsen), Donau (für Habsburg) und Pleiße (für die Stadt Leipzig) einen Sängerwettstreit aus um die Vorrechte an Friedrich August, sächsischer Kurfürst und König in Polen. Die Kantate endet versöhnlich im gemeinsamen Chor: »Die himmlische Vorsicht der ewigen Güte / beschirme dein Leben, durchlauchter August. / So viel sich nur Tropfen in heutigen Stunden / in unsern bemoosten Kanälen befunden, / umfange beständig dein hohes Gemüte / Vergnügen und Lust.«
Die Vertonungen der Singenden Geographie stammen von Telemann, der um die Jahrhundertwende ein Schüler von Losius am Hildesheimer Andreanum war. In einem der von ihm melodisch unterlegten Verslein plätschert neckisch ein Bach – ein akronymischer: »Wer erklärt mir die Gedancken? / BAWM und BACH die sind in Francken.« BAWM für »Bamberg, Aichstadt, Würtzburg, Mergetheim« und BACH für »Bareut, Anspach, Coburg und Henneberg«. Als der jugendliche Telemann dazu die Noten schrieb, konnte er von Johann Sebastian noch nichts wissen, schon gar nicht, dass Bach Jahrzehnte später in der Kunst der Fuge in Gestalt der Tonfolge B-A-C-H selbst mit seinem Namen spielen würde.
Die Schulmeister- und Schülerscherzlein der Singenden Geographie hatten im Unterricht vermutlich ihren Reiz in der Art von »Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin«, das ältere Generationen unserer Zeit an die Erdkundestunden ihrer Kindheit erinnert. Den politischen Machtverhältnissen im europäischen Staatensystem waren die Losius-Reime samt Telemanns Vertonungen nicht gewachsen, und sollten es auch nicht sein, trotz der Aufzählung von ›Kayserthümern‹ und Königreichen.
Die fünf – nicht gleichrangigen – Großmächte in Europa um 1700 waren Frankreich mit knapp 19 Millionen Einwohnern, England mit knapp 10 Millionen, das Habsburger Reich mit 8 Millionen, das riesige, aber unterentwickelte Russland mit etwas über 17 Millionen, dessen Aufstieg mit dem Niedergang Schwedens unmittelbar zusammenhing, und schließlich das überschaubare, ebenfalls unterentwickelte, dafür frischgetaufte oder besser frischgesalbte Königtum Brandenburg/Preußen, das mit seinen 2 Millionen Einwohnern erst am Beginn seines Aufstiegs zur mitteleuropäischen Macht stand.
Die Rivalität zwischen Frankreich und England beeinflusste maßgeblich das europäische System der Kräfte. Diese Rivalität zog wechselseitige Einmischungen in die inneren Konflikte nach sich und führte zu einer Reihe von Interventionsversuchen. So wagte im Jahr 1745 ein Enkel von James II. mit französischer Unterstützung eine Invasion der Inseln. Der katholische James wiederum war im Zuge der »Glorreichen Revolution« von 1688 durch eine Invasion des frankreichfeindlichen protestantischen Wilhelm III. von Oranien entmachtet worden und hatte im Jahr darauf mit militärischer Unterstützung Ludwigs XIV.. eine Invasion Irlands versucht.
Ludwig XIV.., der Sonnenkönig, verfügte im Jahr 1710 über eine riesige Armee von 350000 Mann. Zugleich lebte die Hälfte der Bevölkerung Frankreichs in Armut, jedenfalls hatte das wenige Jahre zuvor der alte Festungsbaumeister des Königs, Sébastien Le Prestre de Vauban, in seiner Schrift über die Notwendigkeit einer Steuerreform geschätzt. Die innere finanzielle Aushöhlung des französischen Staates, die Vauban zu Beginn des Jahrhunderts öffentlich diagnostizierte, sollte sich gegen Ende dieses Jahrhunderts als wichtigster Auslöser der Französischen Revolution erweisen.
Die britischen Verhältnisse ließ der in Irland geborene Jonathan Swift im Jahr 1726 durch den Mund Gullivers dem Riesenkönig von Brobdingnag und zugleich seinen Lesern erklären. Gulliver doziert, »dass unser [das britische] Herrschaftsgebiet aus zwei Inseln bestehe, die drei mächtige Königreiche unter einem Souverän umfassen[9], unsere Ansiedlungen in Amerika nicht gerechnet. […] Sodann sprach ich ausführlich über die Zusammensetzung des englischen Parlaments. Dieses bestehe zum Teil aus einer erlauchten Gruppe, die man das Haus der Lords nenne, Personen adligsten Geblüts mit den ältesten und größten Vermögen. […] Der andere Teil des Parlaments bestehe aus einer Versammlung, die man das Haus der Bürger nenne. Diese seien alle führende Männer, frei gewählt und vom Volk wegen ihrer großen Fähigkeiten und ihrer Vaterlandsliebe ausgesucht, um die Weisheit der gesamten Nation darzustellen. Und diese beiden Häuser bildeten die erlauchteste Versammlung in Europa.«
Das liest sich gar nicht so schlecht, doch darf man nicht vergessen: Der Roman ist eine Satire! Gulliver selbst gesteht dem konsternierten Monarchen von Brobdingnag den unaufhörlichen inneren Zwist: »Der Adel kämpft oft um die Macht, das Volk um die Freiheit und der König um die absolute Herrschaft.« Swift lässt den König der Riesen recht grob auf Gullivers Auskünfte reagieren: Man könne »nicht umhin zu folgern, dass die Mehrzahl deiner Mitbürger die schädlichste Rasse kleinen abscheulichen Ungeziefers ist, der die Natur je gestattet hat, auf der Erdoberfläche herumzukriechen.«
Die über Generationen währende Konkurrenz zwischen der britischen See- und der französischen Kontinentalmacht hatte – mitunter schwer durchschaubare – Folgen sowohl für die überseeische Kolonialpolitik als auch für die Kräfteverhältnisse zwischen den kleineren mitteleuropäischen Fürstenstaaten. Der kriegerische Aufstieg Preußens beispielsweise wäre ohne die englischen Subsidien nicht möglich gewesen. Der Flötenspieler von Potsdam, dem Bach gegen Ende seines Lebens ein »musikalisches Opfer«[10] brachte, hätte ohne Inselgeld seine Feldzüge zur Eroberung und Erhaltung der Provinz Schlesien nicht finanzieren können.
Die kolonialen Konflikte wiederum fanden nicht auf den Weltkarten statt, auf denen man Landnahmen, Grenzverschiebungen und Küstenlinien nachzeichnete, sondern an den Küsten und auf den Meeren selbst. Dabei wurden nicht nur Kriegsschiffe zerstört, sondern auch Kauffahrer. So gingen dem Robinson-Erfinder Daniel Defoe, der eine Zeit lang im Warenhandel zwischen dem Mutterland und den englischen Kolonien in Amerika engagiert war, Schiffe verloren, an denen er Beteiligungen hielt. Wenn einem französische Kanonen das Geschäft verderben, kann einem der Appetit auf französische Weine vergehen: »Es wäre besser für England«, ärgerte sich Defoe, »wenn wir alle Rübenwein oder sonst einen Wein tränken, als dass wir den besten Wein in Europa tränken, diesen aber aus Frankreich holten.«
Der ›Südseeschwindel‹
Zwischen England und Frankreich liegt nur ein Rinnsal, verglichen mit der atlantischen Weite, die Europa von ›Übersee‹ trennt. Aber Baumwolle und Zuckerrohr, Teeblätter und Kaffeebohnen wurden in einem Teil der Welt geerntet, in einem anderen Teil weiterverarbeitet und in wieder einem anderen Teil verkauft. Viele Märkte wurden durchlaufen, bevor ein Endprodukt beim Kunden landete und konsumiert wurde, und auf jeder Zwischenstation der Zirkulation durch die weltweiten Märkte ließ sich Gewinn und wieder Gewinn und noch einmal Gewinn machen. »Man bedenke die Summen, die an Tee und Kaffee verdient werden«, schrieb der in London lebende holländische Arzt Bernard Mandeville in einem Kommentar zu seiner Bienenfabel, in provokanter Offenheit die menschliche Habsucht und Machtgier bloßlegend, nicht etwa, um sie moralisch zu verurteilen, sondern um sie als soziale Antriebskräfte zu preisen. Ohne den Interessen-Egoismus der Einzelnen käme das gesellschaftliche Leben als Ganzes zum Erliegen. Welch »enormer Handel wird getrieben, wie vielerlei Arbeit, von der Tausende von Familien leben, wird ausgeführt, bloß dank dem Bestehen zweier närrischer, wenn nicht gar widerlicher Gewohnheiten, des Schnupfens und des Rauchens, die beide sicherlich den ihnen Ergebenen unendlich mehr schaden als nutzen.«[11] Und eine weltumspannende Folge von Tätigkeiten ist notwendig, um aus rohem Material ein tragbares Kleidungsstück zu machen: »Welche Geschäftigkeit muss in verschiedenen Gegenden der Welt entwickelt werden, ehe ein schönes scharlach- oder rosenrotes Tuch hergestellt ist, und wie viele Handwerke und Gewerbe müssen hierbei herangezogen werden! Nicht bloß solche, die sich von selbst verstehen, wie Wollkämmer, Spinner, Weber, Tuchwirker, Wäscher, Färber, Packer usw., sondern auch andere, ferner stehende, die nicht daran beteiligt zu sein scheinen, wie der Maschinenbauer, der Metallgießer, der Chemiker, die sämtlich ebenso wie eine große Zahl anderer Handwerke notwendig sind, um die zu den bereits genannten Gewerben erforderlichen Werkzeuge, Substanzen und sonstigen Materialien zu beschaffen.« Hinzu kommt, »was für Anstrengungen und Fährnisse in fremden Ländern überstanden werden müssen, welche Wasserflächen zu durchqueren und verschiedene Klimata zu ertragen sind […] Wie weit sind die Drogen und anderen Ingredienzien, die zusammen in einen Kessel hineingehören, über den ganzen Erdball zerstreut!«
Als die Briten 1714 einen König aus Hannover importierten[12], war der Spanische Erbfolgekrieg gerade zu Ende. Dieser Krieg, dessen kontinentale Schauplätze wie beim Dreißigjährigen Krieg in den deutschen Gebieten lagen, kann zugleich als der erste europäische Krieg um die Welt beschrieben werden, mit Kämpfen in Mittel- und Westeuropa, in Nordamerika, Indien und auf den Meeren. England ging als Sieger über Frankreich hervor und stieg mit der Festigung seiner Überlegenheit im Siebenjährigen Krieg (1756–1763) zur ersten globalen Wirtschaftsmacht der Geschichte empor.
Die Finanzierung der imperial-ökonomischen Feldzüge oblag seit 1694 der zu diesem Zweck gegründeten »Bank of England«. Obwohl wie in Frankreich auch in England die Last der Staatsschulden stetig wuchs, konnte die Verschuldung hier im Unterschied zu Frankreich am Haushaltskollaps vorbei gemanagt werden, als 1719 und 1720 in der ersten europäischen Finanzkrise der Neuzeit die Blasen platzten. Viele der kleineren überspekulierten Gesellschaften für den Handel zwischen den Kontinenten brachen zusammen, und schließlich geriet auch die große »South Sea Company« ins Wanken, in deren ›Obhut‹ – wenn sich das so sagen lässt – der Sklaventransport von Afrika nach Amerika lag. Allerdings wurden von der Gesellschaft nur wenige Sklaven gehandelt und gar keine Gewinne gemacht. Die spekulativen Erwartungen liefen dem tatsächlichen Aufbau einer Infrastruktur der Gewalt, die für den Handel mit Menschen nun einmal nötig ist, weit voraus.
Das Platzen der Mississippi-Blase in Frankreich ließ die Aktienkurse in London zunächst weiter steigen, weil die vor dem Pariser Kollaps realisierten Spekulationserlöse nun in London investiert wurden. Nachdem offenbar geworden war, dass die »South Sea Company« die versprochene Dividende nie würde zahlen können, verfielen auch deren Kurse schneller, als sie gestiegen waren. Die Anleger – darunter Georg Friedrich Händel und Isaac Newton – sahen sich von der eigenen Gier übertölpelt und sprachen gekränkt vom ›Südseeschwindel‹. Mandeville dürfte sich darüber nicht gewundert haben. Die Gewinner pflegen den Gewinn stets der eigenen Cleverness zuzuschreiben, die Verlierer den Verlust einem widrigen Schicksal und die betrogenen Betrüger den Betrug einem allgemeinen Verfall der Moral.
Der französische Staat war 1715, als die Regierungszeit des Sonnenkönigs endete, wegen der ungeheueren Kosten des Spanischen Erbfolgekrieges dermaßen überschuldet, dass ein Nürnberger Flugblatt im Krisenjahr 1720 höhnen konnte: »Die Größe des lezt verstorbenen Königs in Franckreich Ludwigs XIV.. welchem die Seinigen noch bey seinen Leben [Lebzeiten] mit dem Tittul des Grossen beehret, erhellet unter andern auch aus der grossen Schulden-Last […], welche er seinem Urenckel und Nachfolger auf den Thron K. Ludwig XV. zu bezahlen hinterlassen.«
Um diese ›grosse Schulden-Last‹ abzuwerfen, bediente sich Philipp II. von Orléans, der anstelle des noch unmündigen Ludwig XV. regierte, der 1716 gegründeten »Banque Générale«. Die Bank gab Papiergeld aus, um damit die staatlichen Schuldverschreibungen zurückzukaufen. Die auf diese Weise abgefundenen privaten Gläubiger konnten mit dem neuen Geld zunächst weder Land noch Häuser erwerben, es jedoch in die »Compagnie d’Occident« investieren, auch »Mississippi-Gesellschaft« genannt. Deren Aufgabe bestand in der vielversprechenden ›Bewirtschaftung‹, will sagen Ausbeutung, Louisianas. Diese und weitere Gesellschaften wurden 1719 in der »Compagnie des Indes« zusammengefasst. Der Kurswert von deren Aktien stieg bis Anfang 1720 auf das 30-Fache des Nennwertes. Über diese beispiellose Hausse schrieb am 31. August 1719 Liselotte von der Pfalz, die Mutter des Regenten Philipp II. von Orléans, in einem Brief, es sei »gar nichts Neues vorgegangen, als viel Sachen in den Finanzen, so ich nicht verzählen kann, denn ich begreife es nicht. Nur das weiß ich, dass mein Sohn ein Mittel gefunden mit einem Engländer, so Monsieur Law heißt […] dies Jahr alle des Königs Schulden zu bezahlen.« Ende 1720 waren die Aktien wertlos und des Königs Schulden nur zum kleinen Teil bezahlt. ›Monsieur Law‹, ein Schotte, flüchtete nach Venedig. Und in Frankfurt machte sich der allzeit rührige Telemann in einer Suite seiner Tafelmusik über das monetäre Desaster lustig. Sie trägt den Titel »La Bourse« (»Die Börse«), ihr letzter Satz heißt »L' éspérance de Mississippi« (»Die Mississippi-Hoffnung«.)
Mit dem Platzen der Mississippi-Blase und dem Ende des ›Südseeschwindels‹ hörte die Spekulation nicht auf. Zu verlockend war (und ist) die Vorstellung, aus Geld viel Geld und aus viel Geld noch mehr Geld zu machen. Kaum hatte ein zusammengebrochener Markt den Leuten die Köpfe zurechtgerückt, begannen sie sich auf einem anderen Markt schon wieder zu drehen. Es wurden Hyazinthenzwiebeln gekauft, bis die Preise durch die Decke gingen wie schon beim Tulpenfieber im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. 1736 platzte auch diese Blase. Das irrwitzig überteuerte Spekulationsobjekt, das man kaufte, um es zu verkaufen, wurde wieder zur Blumenzwiebel, die man erwarb, um sie in die Erde zu stecken.
Deutschland nach der Verheerung
Den »Dreißigjährigen Krieg« gab es nicht – nicht in der Art der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts mit tagesgenauen Datumsgrenzen zu Beginn und am Ende[13]. Man mag den Aufstand der protestantischen Stände in Böhmen mit dem »Prager Fenstersturz« am 23. Mai 1616 an seinen Anfang setzen und den »Westfälischen Frieden« von 1648 an sein Ende. Der Friede selbst zeigt durch die Vielzahl der Verträge, die zu seiner Herbeiführung zwischen Mai und Oktober in Münster und Osnabrück abgeschlossen werden mussten, dass es sich um eine ebensolche Vielzahl von Feldzügen und Kriegen handelte, von denen einer, der zwischen Spanien und den Niederlanden, nicht dreißig, sondern achtzig Jahre gedauert hatte und von denen ein anderer, der zwischen Spanien und Frankreich, sich noch bis 1659 hinzog.
Die Schlachten, die Belagerungen, die Brandschatzungen und Plünderungen, aber auch die schieren Bewegungen riesiger Massen an Menschen, Vieh und Wagen richteten gewaltige Verheerungen an – im Wortsinn. Entlang der Heerstraßen breiteten sich entvölkerte Wüsteneien aus, unabhängig davon, ob in den entsprechenden Gebieten gekämpft wurde oder nicht. Andere Regionen oder Städte blieben vom Krieg nahezu unberührt oder profitierten sogar davon wie die Hafenstadt Hamburg. Auch Münster, die Stadt des Friedensvertrages, war nicht zerstört, während andere Landstriche Westfalens entsetzlich gelitten hatten. Württemberg wiederum verlor drei Viertel seiner Einwohner, während die Bevölkerung der Schweiz sogar wuchs. Auch Mecklenburg wurde stark verheert, ebenso Thüringen und viele Gebiete Sachsens. Das Handwerk in den Städten kümmerte, Dörfer und Höfe verödeten, die Äcker lagen brach. Selbst der Bergbau brach zusammen. Es war niemand mehr da, der hätte in die Gruben steigen können. In der Grafschaft Mansfeld, in der schon Luthers Vater aktiv gewesen war, lebten vor dem Krieg zweitausend Bergleute; im Geburtsjahr Bachs, nahezu vier Jahrzehnte nach dem Westfälischen Frieden, waren es keine drei Dutzend und weitere vier Jahrzehnte päter immer noch erst sechshundert.
Das Herzogtum Preußen weiter im Osten war nahezu unverwundet davongekommen, das Kurfürstentum Brandenburg in Mitteldeutschland indessen lag zertrampelt da, große Teile seiner Bevölkerung waren umgekommen oder geflohen. Kurfürst Friedrich Wilhelm nahm die calvinistischen Hugenotten, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahr 1685 aus dem katholischen Frankreich flohen, nicht nur wegen der ›Toleranz‹ auf, sondern vor allem zur Stärkung des Handwerks, der Belebung der Wirtschaft und der Wiederbevölkerung seines Territoriums. Die ›Peuplierung‹ war von machtpolitischer Überlebensnotwendigkeit. Ein Land ohne Leute konnte nur auf dem Papier als Staat gelten, und ein Herrscher ohne Untertanen war bloß ein Popanz im Hermelinmantel. Im 1655 erstmals erschienenen und über drei Generationen immer wieder aufgelegten Teutschen Fürstenstaat des Veit Ludwig von Seckendorff hieß es, »dass an der Menge der Unterthanen das gröste Glück des Regenten gelegen und dass solche der recht Schatz des Landes sey«.
Wie alle Zahlen jener Zeit kann auch die der umgekommenen Soldaten nur geschätzt werden. Diese Zahl ist jedoch, gemessen an der ›Entvölkerungsrate‹, vergleichsweise niedrig, übrigens auch gemessen an den ›Mortalitätsraten‹ späterer Kriege. Im ›Teutschen Krieg‹, wie die Zeitgenossen den ›Dreißigjährigen‹ nannten, sollen 600000 Soldaten gefallen oder an Verwundungen, unbehandelten Krankheiten und Seuchen gestorben sein. Zwei Generationen später im Spanischen Erbfolgekrieg, der nicht halb so lange dauerte, waren es 100000 mehr.
Die Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg waren keine Friedenszeit. Eine ununterbrochene Folge regionaler Feld- und europäischer Kriegszüge bedrängte und bedrückte die Bevölkerung der deutschen Gebiete unmittelbar vor, während und nach der Lebenszeit Bachs, vom Schwedisch-Brandenburgischen Krieg (1675–1679) mit dem Sieg des Großen Kurfürsten in der Schlacht bei Fehrbellin (1675) bis zum Siebenjährigen Krieg (1756–1763), in dem Friedrich der Große das 1740 annektierte Schlesien als Beute festhalten konnte. 1686 belagerten die Dänen – wenn auch vergeblich – die reichsfreie Hansestadt Hamburg; während des Pfälzischen Kriegs (1688–1697) wird am Niederrhein, in der Kurpfalz, in Schwaben und Franken gekämpft, im zweiten Kriegsjahr brennen abziehende französische Truppen die Städte Bingen, Heilbronn, Mannheim, Heidelberg, Worms und Speyer nieder; im Nordischen Krieg (1700–1721) versucht Schweden, sich im Ostseeraum gegen das aufsteigende Russland zu behaupten; im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) kämpfen die Großmächte England und Frankreich, jeweils unterstützt durch zahlreiche Partikularmächte, um die politische Dominanz in Europa und die ökonomische Superiorität an den Küsten des Atlantiks; im Krieg Brandenburg-Preußen gegen Schweden (1715/16) verlieren die Schweden Usedom, Rügen, Stralsund und Wismar; im Streit um den polnischen Thron nach dem Tod Augusts des Starken kommt es zum Reichskrieg gegen Frankreich (1734/35); der Einmarsch Friedrichs des Großen in Schlesien löst eine Folge von Kriegszügen aus, die zum gesamteuropäischen Österreichischen Erbfolgekrieg eskalieren (1740–1748), dem Vorspiel des Siebenjährigen Krieges.
Während dieser blutigen Jahrzehnte – die Aufzählung ist nicht vollständig, es fehlen beispielsweise die Türkenkriege und die russischen Feldzüge in Osteuropa – konnten die deutschen Territorialfürsten ihre Macht festigen und ausbauen. Die nun einsetzende Entwicklung der Fürstenherrschaft zum staatlichen Absolutismus war untrennbar verbunden mit der Organisation stehender Heere und mit dem Aufbau einer ordnungschaffenden und selbst ordentlichen Verwaltung. Das Heer seinerseits war, zumal in Friedenszeiten, eine riesige Verwaltungseinheit, in der alles am Soldat, vom Scheitel bis zur Sohle, vom Dreispitz bis zum Stiefel, eindeutig geregelt und als eindeutig geregelt auch durchgesetzt werden musste.
Mit dem Aufstieg der Territorialstaaten, an deren Spitze ein Souverän stand – nur im Notfall eine Souveränin wie bei Maria Theresia von Österreich, bei Zarin Elisabeth oder später bei Katharina von Russland –, ist untrennbar verbunden die Entwicklung einer alle Bereiche des Lebens durchdringende Sozial-, Rechts- und Finanzordnung. Nur auf diese Weise ließ sich ein Gebiet, ein Territorium in historischer Perspektive zu so etwas auf- und ausbauen wie einen Staat im modernen Sinn. Die ›Policey‹, wie die Zeitgenossen sagten, war eines der Stichwörter, mit dem sich große Teile dieser Vorgänge zusammenfassen lassen und mit dem schon die Zeitgenossen sie zusammengefasst haben. Das Universal Lexicon Zedlers[14] erläuterte, die Policey »ist entweder so viel als das gemeine Wesen, Republick, Regiments-Forme oder auch die Gesetze, Anstalten und Verordnungen, so einer Stadt oder Lande gegeben und vorgeschrieben, dass jedermann im Handel und Wandel sich darnach achten, mithin alles ordentlich und friedlich zu gehen« habe.
Die ›Polizierung‹, wie man in Analogie zur ›Bürokratisierung‹ sagen könnte, griff dermaßen um sich, dass sie sogar in die Küche Einzug hielt. Das barocke Titelblatt von Paul Jacob Marpergers Küch- und Keller-Dictionarium verspricht neben vielem anderen »Allerhand nützliche Haushaltungs- Gesundheits- Lebens- und Policey-Regeln mit Moralischen Anmerckungen«. Dabei geht es auch um »Grosser Herren Banquets, solenne Festins und Tractirungen«. Ohne Bankette, Feste und traktierendes Bewirten war fürstliche Repräsentation nicht möglich. Nicht immer ging es dabei so nachholend verschwenderisch zu wie beim brandenburgischen Friedrich, der im Herzogtum Preußen zum König avancierte, oder bei August von Sachsen, dem Ähnliches in Polen gelang. Aber auch das, was den Zeitgenossen als halbwegs erträgliches mittleres Maß beim Zurschaustellen von Macht und Herrlichkeit vorkam, wirkt heute als unerhörte Verschwendung. Und selbst der Soldatenkönig, berüchtigt für seinen Geiz bei allem, was nicht die Armee betraf, musste Hof halten und sich vom Exerzierplatz ins Paradezimmer bequemen. Die Musik übrigens blieb dabei buchstäblich auf der Strecke, obwohl der König sich gelegentlich Stücke von Händel vorspielen ließ – auf Marschtrompeten.
2. Die Fürsten machen Staat
Friedrich von Brandenburg setzt in Königsberg eine Krone auf – Ein ›Hannoveraner‹ auf dem englischen Thron – Antichambrieren bei Herzog Anton Ulrich in Wolfenbüttel – Herzog Carl Rudolf von Württemberg unterzeichnet das Todesurteil über Süß Oppenheimer – August der Starke inszeniert das Zeithainer Lustlager – Der Soldatenkönig lässt in Potsdam exerzieren – Der Philosophenkönig reitet in Breslau ein – Der ›Herr der fünf Kirchen‹ krönt in Frankfurt seinen Bruder zum Kaiser
Friedrich von Brandenburg setzt in Königsberg eine Krone auf
Als der Kurfürst von Brandenburg im Dezember 1700 in Berlin eine Prunkkutsche bestieg, um in einem festlichen Zug zur Selbstkrönung in seine Geburtsstadt Königsberg zu reisen, gehörte das Herzogtum Preußen nicht zum Heiligen Römischen Reich. Dieses Herzogtum, seit 1657 unter der auch von Polen anerkannten Oberhoheit der Brandenburger, war ursprünglich als polnisches Lehen in die Hände der Hohenzollern gelangt. Die westpreußischen Gebiete indessen befanden sich weiterhin unter polnischer Herrschaft. Friedrich konnte sich demnach nicht zum König von, sondern nur zum König in Preußen machen[15], ganz ähnlich wie Kurfürst August der Starke von Sachsen sich 1697 nur zum König in Polen, nicht zum König von Polen hatte wählen lassen können.
Obgleich das neue preußische Königtum außerhalb des Reiches lag, war Friedrich I. auf die Anerkennung seiner Königswürde durch den Kaiser in Wien angewiesen. Man baute Schlösser, etwa seit 1693 das Berliner Stadtschloss, organisierte ein stehendes Heer und siedelte fremde Leute in verödeten Gegenden an. Man stritt mit den Landständen über obrigkeitliche Rechte, mit den Junkern auf den Gütern um die Herrschaft über die Bauern und mit den Räten in den Städten um die Durchsetzungskraft fürstlicher Verordnungen. Aber trotz der Konsolidierung der landesherrlichen Souveränität im Verlauf all dieser zähen Auseinandersetzungen in »Seiner Königlichen Majestät Staaten und Provinzen«[16], wie die Berliner Kanzleien es angesichts der territorialen Zersplitterung ausdrückten, bedurfte der aufsteigende fürstliche Herr einstweilen noch der Akzeptanz durch die alte kaiserliche Macht. Diese Akzeptanz ließ sich nicht erzwingen, sondern musste diplomatisch in Wien vorbereitet, wenn auch nicht mehr vom Papst in Rom abgesegnet werden.
Wien hatte sich im Juli 1700 gegen die ›Lieferung‹ von 8000 Soldaten für den Spanischen Erbfolgekrieg bereit erklärt, keine Einwände gegen die königliche Würde zu erheben, und so konnte ein Spektakel stattfinden, das sich, beginnend mit dem Aufbruch in Berlin am 17. Dezember, über die Krönung am 18. Januar 1701 in Königsberg bis zum feierlichen Einzug in Berlin am 6. Mai und dem Ausklang der Feierlichkeiten, über ein halbes Jahr hinzog. Der kurfürstlich-königliche Oberhofzeremonienmeister Johann von Besser beschrieb in seiner Preußischen Krönungs-Geschichte die prachtvolle Ausfahrt in vier Abteilungen mit Hunderten von Karossen und Rüstwagen und Tausenden von Pferden: In »der zweiten Abteilung fuhr das kurfürstliche Paar mit 200 Personen Gefolge. Die Festlichkeiten, zu denen der Kurfürst selbst den Plan entworfen hatte, begann mit einem Umritt der Hofbeamten und Kavaliere, die von vier Herolden in goldgestickten Kleidern, von Trompetern, Paukenschlägern und Dragonern geleitet wurden.«
Wo immer die Macht auftritt, wird auf Pauken gehauen und in Trompeten geblasen[17].