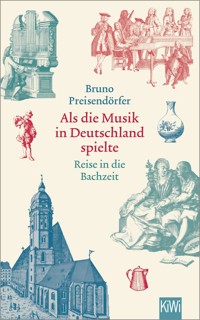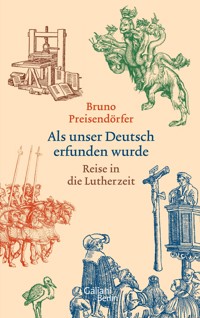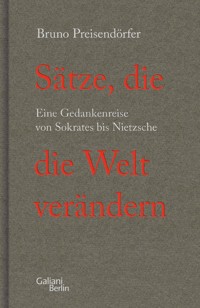
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt diese Sätze, die jeder kennt. Kein Wunder, dass sie unser Weltbild bis heute beeinflussen. Nur: Kaum jemand weiß, woher sie stammen, wie sie ursprünglich gemeint waren – und was ihnen im Laufe der Zeit zugestoßen ist. Bruno Preisendörfer begibt sich auf eine erstaunliche und spannende Spurensuche. Berühmten Zitaten geht es oft wie literarischen Figuren: So wie diese ihren Herkunftsbüchern entlaufen, verlassen jene ihre Entstehungskontexte und beginnen bei ihrer jahrhundertelangen Wanderung durch die Köpfe der Menschen ein Eigenleben. Manche werden dabei fett vor Bedeutungen, die sie ursprünglich gar nicht hatten, andere magern bis zur Bedeutungslosigkeit ab. Manchmal richtet das kaum Schaden an, wie bei der Behauptung, über Geschmack ließe sich nicht streiten; die Konsequenzen können jedoch auch äußerst unheilvoll sein, wie bei Darwins »Überleben des Stärksten«; mitunter wird ein Satz auch einem Autor untergeschoben, obwohl der ihn nie geschrieben hat. Von wem stammt noch gleich »Zurück zur Natur« …? Immer wieder schlägt Preisendörfer elegante Haken zu Kuriosem und Unerwartetem. So wird sein Buch zu einem ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Wunderding irgendwo zwischen philosophischem Handbuch, historischem Panoptikum und zeitdiagnostischem Essay.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bruno Preisendörfer
Sätze, die die Welt verändern
Eine Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bruno Preisendörfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bruno Preisendörfer
Bruno Preisendörfer hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, u.a. Der waghalsige Reisende über Johann Gottfried Seume. Seine »Zeitreise-Bücher« über die Goethe-, Luther-, Bach- und Bismarckzeit waren Bestseller. 2016 erhielt er den NDR Kultur Sachbuchpreis. Er lebt als freier Schriftsteller in Berlin und betreibt die Internetzeitschrift fackelkopf.de.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Berühmten Zitaten geht es oft wie literarischen Figuren: So wie diese ihren Herkunftsbüchern entlaufen, verlassen jene ihre Entstehungskontexte und beginnen bei ihrer jahrhundertelangen Wanderung durch die Köpfe der Menschen ein Eigenleben. Manche werden dabei fett vor Bedeutungen, die sie ursprünglich gar nicht hatten, andere magern bis zur Bedeutungslosigkeit ab. Doch immer hat es Folgen, wenn ein Gedanke außerhalb des geistigen Ökosystems, in dem er entstanden ist, weiterwandert und weiterwirkt.
Manchmal richtet das nicht wirklich Schaden an, wie etwa bei der Behauptung, über Geschmack ließe sich nicht streiten, oder sie regt niemanden mehr auf, wie diejenige vom Tod Gottes. Aber es kommt auch vor, dass sich eine beiläufige Bemerkung wie die von der »unsichtbaren Hand« zum Kern einer ganzen Welt- und Wirtschaftsauffassung verfestigt; oder dass eine Haltung wie die des »Zurück zur Natur« einem Autor in die Schuhe – oder besser: unter die Feder – geschoben wird, in dessen Werk sich die Parole gar nicht findet. Und im Fall der Wendung vom »Überleben des Stärksten« hatte die Gedankenmutation vernichtende Auswirkungen bis hin zur Selektion an der Rampe von Auschwitz.
Bruno Preisendörfer geht berühmten Sätzen und Wendungen nach und erforscht, was ihnen im Laufe der Jahrhunderte zwischen Sokrates bis Nietzsche alles zustieß. Immer wieder schlägt er dabei elegante Haken zu Kuriosem und Unerwartetem. So wird sein Buch zu einem ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Wunderding irgendwo zwischen philosophischem Handbuch, historischem Panoptikum und zeitdiagnostischem Essay.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Lektorat: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31031-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Einleitung
Sokrates weiß, dass er nichts weiß
Würden wir ihn erkennen ...
Lebensbild
Bauwerke altern langsamer als ...
Francis Bacon weiß, Wissen ist Macht
Philosophen reden gern übereinander. ...
Lebensbild
In Neu-Atlantis konzipiert Bacon ...
René Descartes denkt, dass er ist, weil er denkt
Unsere Welt entsteht zwischen ...
Lebensbild
Die beiden Philosophen des ...
Thomas Hobbes fürchtet den Krieg aller gegen alle
Am Anfang steht die ...
Lebensbild
Öffentliche Kritik am ›eingesetzten ...
Jean-Jacques Rousseau will nicht zurück zur Natur
Was für Anfänge! »Der ...
Lebensbild
Die Freiheit der Menschen ...
Adam Smith erwähnt beiläufig die unsichtbare Hand
Wie der Leviathan des ...
Lebensbild
Menschliches Verhalten lässt sich ...
Immanuel Kant streitet über Geschmack
Im Alltagsgespräch meinen die ...
Lebensbild
Der eher nonchalante David ...
Zwischenstück: »Was du nicht willst, das man dir tu«
Zuerst eine Warnung. Sie ...
Ludwig Feuerbach ist, was er isst
Dass der Mensch ist, ...
Lebensbild
Was Feuerbach und die ...
Karl Marx bestimmt Sein und Bewusstsein
Wenige Behauptungen waren so ...
Lebensbild
Da sind sie, die ...
Charles Darwin lässt die Stärksten überleben
Wenn es ums Überleben ...
Lebensbild
Der ›Kampf ums Dasein‹ ...
Friedrich Nietzsche erklärt Gott für tot
Es ist leicht, sich ...
Lebensbild
In Zur Genealogie der ...
Anhang
Nachweise
Quellenverzeichnis
Personenregister
»Bedenke, dass die Jahre vergehen, und achte darauf, nicht immerfort das Gleiche zu tun.«
Francis Bacon[1]
Einleitung
Manche Sätze verändern die Welt, manche verändern die Art und Weise, wie über die Welt gesprochen wird, und wieder andere verändern die Welt, indem sie verändern, wie über sie gesprochen wird. Und meistens geschieht das alles mit- und durcheinander. Dabei ergeht es denjenigen unter den einflussreichen Gedanken, die in kompakten Sentenzen gespeichert sind, ganz ähnlich wie berühmten literarischen Figuren: Wie diese Helden ihren Herkunftsbüchern entlaufen, verlassen solche Gedanken ihre Entstehungskontexte und beginnen ein Eigenleben. Und so wenig etwa der sprichwörtliche Windmühlennarr Don Quijote mit der komplexen Romanfigur des Cervantes zu tun hat, so weit haben sich viele der berühmten Sentenzen nach langer Wanderung durch die Köpfe der Menschen von ihren Ursprüngen entfernt. Einige sind dabei fett geworden von Bedeutungen, die sie ursprünglich gar nicht hatten. Andere sind abgemagert bis zur Bedeutungslosigkeit und haben unterwegs ihren einstigen Sinn verloren. Doch immer hat es Folgen, wenn ein Gedanke außerhalb des geistigen Ökosystems, in dem er entstanden ist, weiterwandert und weiterwirkt. Manchmal richtet das kaum Schaden an, wie etwa bei der Behauptung, über Geschmack ließe sich nicht streiten, oder es regt niemanden mehr auf, wie bei derjenigen vom Tod Gottes. Aber es kommt auch vor, dass sich eine beiläufige Bemerkung wie die von der ›unsichtbaren Hand‹ zum Kern einer ganzen Welt- und Wirtschaftsauffassung verfestigt; oder dass eine Haltung wie die des ›Zurück zur Natur‹ einem Autor in die Schuhe oder besser unter die Feder geschoben wird, in dessen Werk sich die Parole gar nicht findet. Und im Fall der Wendung vom ›Überleben des Stärksten‹ hatte die Gedankenmutation vernichtende Auswirkungen bis hin zur Selektion an der Rampe von Auschwitz.
Die hier aufgegriffenen Behauptungen, Sentenzen und Phrasen sind nicht ausgewählt worden, um überzeitliche Wahr- und Weisheiten gegen die ›Vergänglichkeit der Zeiten‹ zu verteidigen, sondern um exemplarisch von ebendieser Vergänglichkeit zu erzählen. Diese Gedankengeschichten handeln nicht von Anekdotenkarrieren, wie etwa der von Caesars »Auch du mein Sohn Brutus«, oder von historischen Fake News wie bei »Hier stehe ich und kann nicht anders«, das Luther vor dem Reichstag in Worms gar nicht gesagt, sondern ein Drucker nachträglich in dessen Rechtfertigungsrede gesetzt hat. Auch ›Gretchenfragen‹ und andere ›geflügelte Worte‹, wie sie der Philologe Georg Büchmann im 19. Jahrhundert zum ›Zitatenschatz‹ der deutschen Literatur versammelte, werden hier so wenig thematisiert wie abgenutzte Begriffsmünzen in der Art von ›Paradigmenwechsel‹ und ›Quantensprung‹, die noch immer in Umlauf sind, oder wie ›Idealtypus‹, in den 1980ern feuilletongängig, aber inzwischen im geistigen Zahlungsverkehr kaum noch anzutreffen.
In diesem Buch geht es um Wendungen und Behauptungen, die nicht bloß als Bildungszierat weiter- und wiederverwendet werden, sondern die philosophisch, ideologisch, politisch folgenreich waren und immer noch sind. Und da Gedanken nicht frei herumlaufen, sondern – einstweilen – auf Münder und Köpfe angewiesen bleiben, werden auch die Köpfe und Münder in diesem Buch eine Rolle spielen, die diese Gedanken denken und aussprechen. Das gilt nicht nur für das Kapitel über den diskussionsfreudigen (manche sagten geschwätzigen) Sokrates oder für dasjenige über Ludwig Feuerbach, der behauptete, man ist, was man isst.
Die hier getroffene Auswahl ist exemplarisch, kann aber nicht vollständig sein, denn »Zeit ist Geld«. So fehlt ebendieses sprichwörtlich gewordene Diktum Benjamin Franklins aus dessen Ratschläge für junge Kaufleute von 1748. Zu Franklin fällt vielen zuerst der Blitzableiter ein und dann der Staatsmann, der zu den ›Gründungsvätern‹, wie man sagt, der amerikanischen Demokratie gehörte. Zugleich war dieses Multigenie einer der einflussreichsten Ideologen wirtschaftlicher Selbstvernutzung. Dass dessen Sentenz der unausweichlichen Auswahlbeschränkung der »Gedankenreise« zum Opfer fiel, lag an der Vorzugsentscheidung für die ›unsichtbare Hand‹ von Adam Smith, wie Franklin dem 18. Jahrhundert angehörend und wie dieser stark mit ökonomischen Fragen beschäftigt.
Der notwendigen Beschränkung zum Opfer gefallen ist auch eine Sentenz Ciceros, jenes zu Lebzeiten viel gehörten Rhetors und posthum noch mehr gelesenen Denkers, der so tiefes Vertrauen in die Geschichte als Lehrmeisterin des Lebens hatte: »historia magistra vitae«. Die Phrase wird noch immer gedroschen, obwohl der historische Wandel selbst ihr viel von dem Sinn entzogen hat, der ihr zu Ciceros Zeiten zukam, als die Welt sich viel langsamer veränderte als heute. Wenn ›die Geschichte‹ eine Lehrmeisterin ist, dann eine höchst unzuverlässige, der es immer schwerer fällt, mit ihren alten Augen das Neue zu erkennen.
Übrigens wurde der seiner Historia so nahestehende Cicero später – beinahe zweitausend Jahre später – ausgerechnet von einem Historiker, von Theodor Mommsen, als politisch haltloser Opportunist und oberflächlicher Einsammler fremder Ideen beschimpft. Das blieb seinerseits nicht unwidersprochen. Immerhin hatte Cicero seine wortgewaltigen Reden gegen die Errichtung einer neuen Diktatur nach dem erfolgreichen Messerstecherattentat auf Caesar mit dem Leben bezahlt. Die böse Fulvia, mit einem der Todfeinde Ciceros verheiratet, soll die Zunge des geköpften Rhetors mit einer Haarnadel durchbohrt haben. Aber das hat sich Historia wohl nachträglich ausgedacht.
Von Fulvia ist eine gängig gewordene Sentenz nicht überliefert, schade, und generell haben in diesem Buch die Männer das Sagen, wenigstens was die wandernden Zitate angeht, um die es hier zu tun ist. Das liegt nicht an einer Betriebsblindheit des männlichen Verfassers, eher an einer Überlieferungsblindheit von Lehrerin Historia selbst. Jedenfalls gibt es in dem hier bereisten Zeitraum von Sokrates bis Nietzsche kein Zitat von vergleichbarer Aura und Allgemeinberühmtheit, das von einer Frau stammen würde. Umso schlimmer für die Männer? Mag sein. Doch änderte sich die Sach- und Satzlage erst im 20. Jahrhundert. Exemplarisch sei auf die Formel von der »Banalität des Bösen« verwiesen, die Hannah Arendt, übrigens in anderer Hinsicht nachfolgend öfter zu Wort kommend, im Zuge ihrer Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in Jerusalem geprägt hat.
Wie eine Geschichte erzählt wird, hängt immer davon ab, wer sie erzählt und wer sie sich erzählen lässt. Dabei geht es manchmal zu wie bei der »Stillen Post«. Eine Person flüstert einer anderen etwas ins Ohr, die es an die nächste weitergibt und diese wiederum an die nächste. Ist die Reihe durch, wird verglichen, was die erste Person gesagt und die letzte gehört hat. Meistens weicht beides erheblich voneinander ab. Ganz ähnlich ist es in der Geschichte des Denkens. Im Symposion beispielsweise erzählt Platon, wie Apollodoros erzählte, wie ihm Aristodemos erzählt habe, wie Sokrates erzählt habe, was Diotima ihn gelehrt habe. Cicero wiederum schrieb, Platon hätte geschrieben, Sokrates habe gesagt: »Ich weiß, dass ich nichts weiß.« Aber die Sache war viel komplizierter.
Sokrates
»Denn von mir selbst wußte ich, daß ich gar nichts weiß, um es geradeheraus zu sagen«.
Sokrates in der von Platon verfassten Apologie
Athen – Hebamme, Geburtshilfe – Sokratischer Dialog – Orakel von Delphi – Sophisten – Sparta – Akropolis – Hanswurst oder leutseliger Herr – Annabelle und die Intellektuellen – Sokratische, romantische, postmoderne Ironie – Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit – Humanismus – Meinung und Wahrheit – Philosophie und Macht – Gewissen – Das Sterben und ein Hahn – Leib und Seele – Glaube und Aufklärung
Alkibiades, Perikles – Platon – Rousseau – Xenophon, Aristophanes, Aristoteles – Russell – Jaspers – Jesus, Buddha, Konfuzius – Kant – Schleiermacher – Bloch – Sartre – Nietzsche – Marx – Mey – Erhard – Schelsky – Hegel – Scheler – Arendt – Freud – Sophokles – Hippokrates – Montaigne – Paulus, Lukas
Würden wir ihn erkennen auf den Märkten Athens, wo er sich herumtrieb und mit seinem dauernden Gerede die Leute von der Arbeit abhielt? Was für ein komischer Kauz vom Scheitel bis zur Sohle, hässlich wie ein alter Satyr, mit hervorquellenden Augen, einer Wampe und mit nackten, vom ewigen Barfußlaufen verhornten schmutzigen Füßen. Die Leute auf dem Markt und in den Werkstätten kannten ihn – meinten, ihn zu kennen – und machten sich über ihn lustig: Sokrates, der Schwätzer, der alle Welt belehren will und sich unter dem Gelächter der Leute von seiner Frau Xanthippe mit Zungenhieben und Faustschlägen nach Hause treiben lässt.
Das Arbeitsvolk mit seinen Alltagssorgen bekam nicht mit, dass ein Teil der aristokratischen Jugend, für Kinderspiele schon zu alt und für Staatsaufgaben noch zu jung, sich um ihn drängte. Mancher drängte sich auch an ihn, wie Alkibiades, der zwielichtige Neffe des Perikles. Platon lässt ihn im Symposion betrunken bei einem Gastmahl erscheinen und den Anwesenden, darunter Sokrates selbst, erzählen, wie er sich einmal dem Meister angeboten hat, wie er in der Nacht unter dessen Decke schlüpfte und am nächsten Morgen so unberührt aufwachte, wie er sich hingelegt hatte.
Viele junge Herrchen aus der Oberschicht waren begierig auf das Training der Selbsterkenntnis, das sie sich vom Umgang mit diesem seltsamen Mann versprachen, einem ehemaligen Bildhauer, der zum Leidwesen seiner Frau nur wenige Bildnisse gehauen hat und schon länger überhaupt nicht mehr arbeitete. Er war freier Stadtbürger, keiner der rund 115.000 Sklaven, die auf Attika lebten, auch keiner der knapp 30.000 Metöken, Frauen und Kinder mitgerechnet, die als freie Fremde ohne Bürgerrecht und ohne Land im 100.000 Einwohner zählenden Athen Handel trieben oder einem Gewerbe nachgingen.
Sokrates erwähnte gern, dass seine Mutter Hebamme war, eine ›Maia‹, wenn er auf seine Methode zu sprechen kam, den Leuten mit seiner Fragerei so lange zuzusetzen, bis sie nicht mehr ein noch aus wussten. Er behauptete, mit seinen Fragen das Wissen aus den Köpfen der Menschen herauszuholen und zur Welt zu bringen, genauso wie eine Hebamme dabei hilft, ein Kind aus dem Mutterschoß zu holen. ›Maieutik‹ nannte er das, Geburtshilfe.
Der ›sokratische Dialog‹ muss jedoch auf den Märkten Athens anders stattgefunden haben als in den Texten Platons, in denen diese ›Dialoge‹ überliefert sind. Bei den meisten von ihnen handelt es sich um Protokolle langer Monologe, hin und wieder unterbrochen durch Bestätigungsfloskeln der Belehrten. Einer davon ist ein gewisser Simmias, anwesend beim Sterben des Sokrates im Phaidon. Sokrates fragt, ob »der Philosoph gerne die Seele von der Gemeinschaft mit dem Leib lösen wird, eher als alle anderen Menschen«, und Simmias antwortet: »Ja, das zeigt sich.« Sokrates fährt fort, Simmias antwortet: »Du hast vollkommen recht.« Nach der nächsten Ausführung fragt Sokrates: »Bist du nicht auch dieser Meinung?« Simmias: »Gewiß.« Nach einer weiteren Bemerkung des Sokrates sagt Simmias: »Du hast recht.« Dann stellt Sokrates erneut eine seiner Scheinfragen, die wir als ›rhetorisch‹ bezeichnen würden, weil sie gar keine Fragen sind, sondern Aufforderungen zur Zustimmung. Simmias: »Ja.« Nach noch einer weiteren Bemerkung von Sokrates bestätigt Simmias wieder: »Ja, so ist es.« In dieser Art verlängert sich der ›sokratische Dialog‹, der in Wahrheit ein Selbstgespräch ist, bis Simmias, ein wenig erschöpft, zugibt: »Ja, Sokrates, was du sagst, ist über alle Maßen richtig.« Nennt man das einen Dialog? Die Antwort steht auf einem der Zettel, die im Nachlass von Immanuel Kant gefunden wurden: »Der Sokratische Dialog ist kein Gespräch, weil immer einer als Lehrer betrachtet wird. Im Gespräch ist keiner Lehrer oder Schüler.«
Sokrates behauptete, weiser zu sein als alle anderen, und berief sich dabei auf die Pythia im Orakel von Delphi. Von ihr sei ihm beschieden worden, er sei der Weiseste unter den Lebenden. Alle anderen würden sich zwar einbilden, Bescheid zu wissen, hätten aber bloß Meinungen, noch dazu solche, die sie schlecht oder gar nicht begründen könnten. Er dagegen wisse immerhin, dass er nichts wisse. Das bedeutete allerdings nicht, wie Rousseau in seiner Abhandlung über die Wissenschaften und Künste glauben machen will, »daß der weiseste unter den Menschen […] der Unwissenheit eine Lobrede hält!«. Vielmehr konfrontierte sein provozierendes Wissen ums Nichtwissen die Unwissenheit seiner Gegner mit deren eigener Ignoranz.
Im Übrigen ließ er nicht davon ab, sogar den Menschen vom Fach deren Gewerbe zu erklären. Der Schuster macht Schuhe, aber Sokrates setzt ihm auseinander, wie es damit zugeht. Die Sänger singen, die Dichter dichten, die Machthaber herrschen, aber Sokrates beweist ihnen, dass sie nicht wissen, was es auf sich hat mit dem Singen, dem Dichten und dem Herrschen. Sogar einer Hetäre will er einreden, dass er weiß, was sie wissen müsste, um noch mehr Kundschaft anzulocken. Er weiß, dass er nichts weiß, und immerzu weiß er alles besser.
Die Leute auf den Marktplätzen und in den Werkstätten amüsierte das. Wenn es ihnen zu viel wurde, ließen sie ihn reden und wandten sich ab. Sie hatten von den Sophisten gehört, wortmächtigen Männern, die gegen Geld Schriftstücke fürs Gericht aufsetzten oder Reden für Versammlungen abfassten. Bei diesem Geschäft kam es nicht auf Wahrheit, Recht oder Gerechtigkeit an, sondern auf Geschicklichkeit und Überzeugungskraft. Manche hielten Sokrates für einen dieser Wortverdreher, die man anheuern konnte, nur dass er sich eben ein Vergnügen daraus machte, anderen ungefragt und unbezahlt die Köpfe zu verdrehen. Über dieser merkwürdigen Lust am Auskosten seiner Überlegenheit vernachlässigte er wohl seine Aufträge. Viel Geld schien er jedenfalls nicht zu verdienen, nach dem zu urteilen, wie er herumlief. Man konnte die arme Xanthippe verstehen, so krawallkomisch ihre Auftritte auch waren, wenn sie sich wünschte, dass er endlich, endlich die Klappe hielt und wieder den Meißel in die Hand nahm. Oben auf der Akropolis hätte es genug Arbeit für ihn gegeben, bei den vielen Statuen, die während der letzten Jahre dort aufgestellt wurden.
Dann hörten die öffentlichen Balgereien mit Xanthippe auf. Sokrates taperte unbehelligt über die Märkte, stets nach Opfern Ausschau haltend. Die Polis war in einer schwierigen Phase. Sparta hatte Athens Flotte zerstört und die athenische Dominanz über die anderen griechischen Städte gebrochen. Das Polissystem zerfiel, das Volk war in Aufruhr, die Oligarchen intrigierten. Tyrannen rissen die Macht an sich und verloren sie bald wieder. Die Demokratie kehrte zurück, aber nicht die Ordnung, auch nicht die Rechtssicherheit. Die ›klassische Zeit der griechischen Antike‹, so werden später die Gelehrten sagen, ging ihrem Ende zu. Es fiel mit dem Lebensende des alten Mannes zusammen, der jahrzehntelang zwischen den Leuten aus dem Volk herumgestrichen war und zugleich die aristokratische Jugend belehrt hatte und der nun seinen Prozess erwartete. Auf dem Felsplateau über Athen leuchtete knallbunt der Parthenon. Er sah überhaupt nicht ›klassisch‹ aus. Erbaut einige Jahrzehnte nach der Zerstörung der Stadt durch die Perser im Jahr 480, war er noch jung, jünger als Sokrates mit seinen bald siebzig Jahren, und die Farben waren frisch.
Sokrates, damals übrigens ein recht häufiger Name, kam im vierten Jahr der 77. Olympiade zur Welt, nach unserer Zählung also im Jahr 470 oder 469 vor Christus. Während seiner Lebenszeit war mit der Neubebauung der Akropolis begonnen worden, nachdem die Perser die Stadt Athen mitsamt ihrer alten Befestigungsburg zerstört hatten. Die erste Lebenshälfte des Sokrates war vom Aufstieg der Stadt unter Perikles geprägt, der 429 an einer Seuche starb, die vier Jahre lang in Athen wütete, die zweite Lebenshälfte vom Niedergang der Stadt im 431 beginnenden Peloponnesischen Krieg, der schließlich zur Vernichtung der Flotte durch die Spartaner und 404 zur Kapitulation Athens führte.
Der Sohn eines Steinmetzes und einer Hebamme gehörte zur Schicht der freien Bürger und nahm als Hoplit an drei Feldzügen teil. Das deutet darauf hin, dass er nicht arm gewesen sein kann, wie gelegentlich behauptet. Hopliten waren Fußsoldaten, die ihre Ausrüstung – Helme, Brustpanzer, Beinschienen und Schilde – selbst besorgten und bezahlten. Freie Bürger, die dazu nicht in der Lage waren, gingen als Theten, Ruderer, auf die Schiffe.
Der Hoplit Sokrates scheint ein tapferer Soldat gewesen zu sein, abgehärtet gegen Kälte, Hunger und Durst, dabei trinkfest unter Kameraden und furchtlos vor dem Feind. Einmal soll er einen Reiter, der verwundet vom Pferd gefallen war, auf die Schulter genommen und vom Schlachtfeld getragen haben. Allerdings stimmen die überlieferten Zeugnisse nicht überein. Platon lässt im Symposion den Alkibiades erzählen, Sokrates habe ihm während einer Schlacht auf diese Weise das Leben gerettet. Xenophon wiederum berichtet, er selbst sei von Sokrates aus dem Kampfgetümmel geschleppt worden.
Als freier Bürger Athens hatte Sokrates mindestens zweimal Ämter inne, entweder legitimiert durch Wahl oder durch das Los. Er lebte weder ›zurückgezogen‹ noch in teilnahmsloser Privatheit wie jene an der Polis desinteressierten Bürger, die Perikles idiotai nennt. Platon hat allerdings dem Perikles nach dessen Tod nachgerufen, die Bürger Athens seien durch ihn nicht besser geworden. Hatten die ›Idioten‹ also doch recht, die öffentlichen Angelegenheiten zu meiden und sich nur um die eigenen zu kümmern? Sokrates gehörte nicht zu ihnen, strebte jedoch auch keine Karriere in der Polis an. Außerdem geriet er immer wieder in Konflikt mit den Mächtigen der Stadt. Im Jahr 406 stimmte er unter der Demokratie bei einem Sammelprozess gegen die zehn Befehlshaber einer Seeschlacht als Einziger nicht für die Todesurteile, weil derartige Sammelurteile dem athenischen Recht widersprachen. Unter der Tyrannenherrschaft 404/403 wiederum ließ er die willkürlich angeordnete Verhaftung eines Bürgers nicht ausführen.
Im Jahr 399 schließlich, die demokratische Herrschaft war erneut etabliert, musste er sich einer Anklage wegen Leugnung der Stadtgötter und wegen des Aufbringens der Söhne gegen ihre Väter stellen. Der Prozess endete mit dem Todesurteil, nicht zuletzt wegen seiner provozierenden Reden vor Gericht, von denen eine es auf die Verurteilung anlegte und eine weitere, bei der es um die Strafbemessung ging, mit ihrem höhnischen Ton die Hinrichtung geradezu herausforderte. Die ihm von seinen Anhängern ermöglichte und wohl auch von seinen Gegnern stillschweigend gewünschte Flucht lehnte er ab und zelebrierte stattdessen im Kreis seiner Freunde das Leeren des vom Gerichtsboten dargereichten Schierlingsbechers.
Bauwerke altern langsamer als Menschen. Aber die Gedanken der Menschen altern manchmal noch langsamer als Bauwerke. So ist es bei Sokrates. Sein Denken geistert seit beinahe zweieinhalb Jahrtausenden durch die Köpfe der Philosophen. Dabei hat er nichts geschrieben, immer nur geredet, geredet und geredet. Alles, was wir von ihm wissen, wissen wir von Platon, dem herrschsüchtigsten aller Philosophen der Antike, von Xenophon, dem Feldherrn und Memoirenschreiber, von Aristophanes, dem üblen Nachredner auf großer Bühne, der in seiner Wolken-Komödie Sokrates als Erforscher der Sprungweite von Flöhen verhöhnte, und von Aristoteles, dem Platon-Schüler, der selbst alles nur vom Hörensagen kannte.
Platon stellte in seiner Apologie, einer arrangierten Darbietung der drei Reden, die Sokrates während des Prozesses gehalten hatte, der zu seinem Todesurteil führte, die Gedankengänge seines Lehrers dar und setzte das in vielen kunstvoll komponierten Dialogen fort. Er vermischte dabei die sokratischen Ideen so sehr mit seinen eigenen, dass kaum zwischen Sokratischem und Platonischem zu unterscheiden ist. Über den Sokrates in Platons Textgewand meinte der geniale mathematische Vernunftmensch Bertrand Russell: »In der Beweisführung ist er unaufrichtig und sophistisch, und in seinem persönlichen Denken setzt er seinen Intellekt ein, um zu den ihm angenehmen Schlußfolgerungen zu kommen, nicht im Interesse des uneigennützigen Strebens nach Erkenntnis. Er hat etwas Selbstzufriedenes und Salbungsvolles an sich.« Xenophon wiederum war für Russell »kein sonderlich begabter Kopf« und »hatte im großen und ganzen konventionelle Ansichten«.
Der Philosoph Karl Jaspers wiederum, der Sokrates mit Jesus, Buddha und Konfuzius zu den vier über alle Zeiten hinweg ›maßgebenden Menschen‹ rechnete, urteilte über die antiken Zeugen: »Xenophon schildert einen etwas pedantischen Rationalisten, der an das Nützliche denkt, Plato den im Denken vom Eros Gelenkten, der das Licht des schlechthin Guten denkend berührt.« Unterhaltsam, sich vorzustellen, wie Sokrates im Gespräch mit Jaspers herauszufinden sucht, wie man Licht berühren kann, und sei es das »des schlechthin Guten«.
Noch interessanter wäre es, eine Begegnung zwischen Sokrates und Kant zu simulieren. Man male sich aus, wie der Streuner Sokrates in einer Logik-Vorlesung des Königsberger Professors sitzt. Was hätte er wohl davon gehalten, dass man Kant gelegentlich sogar mit ihm verglich? Beide dachten weniger über die Natur und die Götter nach als über sich und ihresgleichen, über den Menschen in seiner Not und Nacht – und über das Licht der Vernunft, das diese Nacht durchdringt, ob man es nun ›berühren‹ kann oder nicht. In der Apologie lässt Platon seinen Sokrates vor Gericht erklären, »solange ich noch Atem und Kraft habe, werde ich nicht aufhören, der Wahrheit nachzuforschen und euch zu mahnen und aufzuklären«. Das war provozierend und anmaßend, noch dazu von einem, der gleichzeitig erklärte, der Einzige zu sein, der wisse, dass er nichts wisse. Das Wort ›aufklären‹ allerdings kann Sokrates nicht benutzt haben. Es ist dem deutschen Übersetzer und dessen Zeit geschuldet: Friedrich Schleiermacher, der als romantischer Theologe noch immer von der Aufklärung geprägt war, gegen die und gegen deren überragenden Philosophen Kant er anzudenken und anzuglauben versuchte.
»Die wichtigste Epoche der griechischen Philosophie hebt endlich mit dem Sokrates an«, dozierte Kant, mit dem selbst eine wichtige Epoche der neuzeitlichen Philosophie anhob. »Denn er war es, welcher dem philosophischen Geiste und allen spekulativen Köpfen eine ganz neue praktische Richtung gab. Auch ist er fast unter allen Menschen der einzige gewesen, dessen Verhalten der Idee eines Weisen am nächsten kommt.« Hatte nicht Sokrates selbst schon gesagt, dass dies das Delphische Orakel verkündigt habe, weil er der Einzige sei, der wisse, dass er nichts wisse? Aber vielleicht hat Sokrates gelogen? Oder Sokrates hat die Wahrheit gesagt, und das Orakel hat gelogen?
Zweitausend Jahre später spielt das keine Rolle mehr. René Descartes, für uns Heutige der erste Methodendenker der Neuzeit, beschrieb das Befragen und Bezweifeln des Hergebrachten als Ausdruck der Fähigkeit, überhaupt zwischen Wissen und Nichtwissen unterscheiden zu können: Wenn »Sokrates sagt, ich zweifle an allem, so folgt daraus notwendig: so erkennt er wenigstens dies, daß er zweifelt, und gleichfalls: also erkennt er, daß etwas wahr oder falsch sein kann«.
Rund anderthalb Jahrhunderte nach Descartes erinnerte Kant, der die Selbsterkenntnis der Vernunft als »das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte« bezeichnete, noch einmal daran, dass das Wissen ums Nichtwissen keine Trivialität ist: »Sokrates sagte, er habe durch vieles Forschen gefunden, daß er noch nichts weiß. Dieser tiefsinnige Ausspruch ist von seichten Köpfen herum geworfen, ohne daß sie ihn eingesehen. Es gibt zwei Arten des Bewußtseins der Unwissenheit: 1. indem man sich an den Gegenständen mißt und dadurch sieht, daß man sie nicht kennt; 2. oder materialiter indem man die Gegenstände selbst nicht kennt. Aber einzusehen, daß unser Wissen nichts sey; das ist scientifisch. Die Grenzen seiner Erkenntnis, den Umfang derselben einzusehen, und dadurch zu erkennen, daß ich nichts weiß; das ist sehr tiefe Philosophie.« Und eine dialektische, wenn man Ernst Bloch folgen will: »Immerhin ist der Satz des Sokrates: ›Ich weiß, daß ich nichts weiß‹ insofern echt dialektisch, als er nicht bei sich stehenbleibt; der Widerspruch in ihm treibt zur Auflösung fort.« Und noch forcierter Jean-Paul Sartre: »Behaupten, daß ich nicht[2] weiß, heißt behaupten, daß ich weiß, daß ich erkennen kann […]. Wenn Sokrates sagt: Ich weiß, daß ich nichts weiß, dann ist diese Bescheidenheit zugleich die radikalste Behauptung des Menschen, denn das setzt voraus, daß alles wißbar ist.«
Das Wissen um das Nichtwissen wird zur Antriebsenergie des Fragens. In den Worten des hermeneutischen Philosophen Hans-Georg Gadamer: »Es gehört zu den größten Einsichten, die uns die platonische Sokratesdarstellung vermittelt, daß das Fragen – ganz im Gegensatz zu der allgemeinen Meinung – schwerer ist als das Antworten. Wenn die Partner des sokratischen Gesprächs, um Antworten auf die lästigen Fragen des Sokrates verlegen, den Spieß umdrehen wollen und ihrerseits die vermeintlich vorteilhafte Rolle des Fragers beanspruchen, dann scheitern sie damit erst recht.« Um wirklich fragen zu können, darf man – überspitzt gesagt – keine Meinung haben: »Es ist die Macht der Meinung, gegen die das Eingeständnis des Nichtwissens so schwer erreichbar ist.«
Es bedarf mehr als der Einsicht in die gegenwärtige, künftig überwindbare Beschränktheit wissenschaftlicher Erkenntnis, es bedarf der selbstkritischen Hinnahme der prinzipiellen Fragwürdigkeit menschlichen Erkennens überhaupt. Und zwar weniger bei wissenschaftlichen Problemen, die nach und nach gelöst oder wenigstens eingegrenzt und praktikabel gemacht werden können, als in moralischen Fragen, die Menschen immer wieder neu stellen und stellen müssen, solange sie in Gruppen, Familien, Verbänden, Stämmen und Staaten zusammenleben. Es ist die Anerkenntnis der unaufhebbaren Vorläufigkeit des Wissens über uns selbst, die das sokratische Wissen um das Nichtwissen philosophisch attraktiv und zugleich alltagsmenschlich so schwer erträglich macht.
Anders als Aristophanes mit seiner höhnischen Flohgeschichte in den Wolken behauptete, strebte Sokrates nach ›Tugend‹ und ›Weisheit‹, nicht nach empirischem Wissen über die Natur. Die »Felder und die Bäume wollen mich nichts lehren, sondern nur die Menschen in der Stadt«, heißt es in Platons Dialog Phaidros. Nicht ›die Natur‹, die heutigen Stadtmenschen so am Herzen liegt, dass sie Bäume flüstern und Felder stöhnen hören, beunruhigte und beschäftigte ihn, sondern das, was den sozialen Menschen ausmacht: Wer sind wir, wenn wir nicht allein sind? Wie wollen wir leben? Wie sollen wir sterben?
Weil er der Erste war, von dem dergleichen bezeugt ist, gilt er bis heute als personifizierter Anfang des Philosophierens. Seit der Romantik bezeichnen die Geisteshistoriker diejenigen, die ihm vorausgingen, als ›Vorsokratiker‹. Und alle, die nach ihm kamen, standen in seinem Schatten, auch wenn sie wie Nietzsche mit diesem Schatten boxten, mit »dieser fragwürdigsten Erscheinung des Altertums«, diesem »Hanswurst, der sich ernstnehmen machte«. Nur der sehr junge Marx tat unbeeindruckt und meinte in einem Studienheft zur Vorbereitung seiner Dissertation über die Naturphilosopie Epikurs und Demokrits, der Sokrates sei »ein leutseliger Herr« gewesen. Immerhin trifft das insofern zu, als Sokrates ohne Leute wirklich nicht selig wurde.
Die Leute wiederum wurden mit Sokrates nicht froh. Die Handwerker und Händler wandten sich kopfschüttelnd ab, wenn es ihnen zu viel wurde. Aber die gebildeten und rhetorisch geschulten Sophisten fühlten sich professionell herausgefordert und existenziell infrage gestellt. Möglicherweise verstanden sie ihn auf schlechte Weise besser, als Sokrates wissen wollte. »Du möchtest immer nur andere ausfragen und in die Enge treiben und selbst niemand Rede stehen und über nichts deine Meinung preisgeben«, lässt Xenophon einen von ihnen sagen.
Aus der Perspektive der Sophisten, der gewerbsmäßigen Redner und Redenschreiber, die ›nur ihren Job machten‹, war Sokrates mit seinem Denkverhalten geschäftsschädigend. So gesehen könnte man ihn als ›kritischen Intellektuellen‹ bezeichnen, auch wenn Typus und Begriff erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich entstanden. Wie dieser Sozialtypus am treffendsten zu definieren sei und welche Bedeutung der Begriff hatte oder haben sollte, war umstritten, und zwar je mehr, desto weiter sich die Rede von ›den Intellektuellen‹ in Europa verbreitete. Ursprünglich als Schimpfwort in die Welt gesetzt und dann von den Beschimpften als Ehrentitel adaptiert, konkurrierten die Wertungen je nach dem, in welcher Beziehung die Wertenden zu den Bewerteten standen. Vom intellektuellen Selbsthass bis zur geistigen Selbstüberhebung reichen die Haltungen, die Intellektuelle gegenüber sich und ihresgleichen einzunehmen fähig sind, zwischen sprachloser Bewunderung und redseliger Verachtung bewegt sich das, was die Einschätzung durch andere färbt. Und so konnte ›Intellektualität‹ anmaßend als geistige Exorbitanz in Anspruch genommen und zugleich als Beleidigung den theoretischen Köpfen an ebendiese geworfen werden, sogar noch im Song eines Liedermachers, der mitunter selbst als ›zu intellektuell‹ kritisiert wurde: »Annabelle, ach Annabelle/Du bist so herrlich intellektuell«.
Doch längst hat sich die Aufregung verflüchtigt, vielleicht weil die Rolle ›des Intellektuellen‹ ausgespielt und sein Ruf nicht einmal mehr ein schlechter ist. Heute würde sich bei uns kein Machtmensch mehr dazu herablassen, aus Verärgerung über doch eigentlich ohnmächtige Kritik »zwischen verantwortungsbewußter Geistigkeit und einem blutleeren Intellektualismus ohne Substanz und ohne Gesinnung« zu unterscheiden, wie Ludwig Erhard das 1965, frustriert im letzten Jahr seiner Kanzlerschaft, getan hat.
Der nach all dem Getöse nur noch zu erahnende intellektuelle Provokationsappeal kommt nicht mehr über den des beamteten Philosophen hinaus, der in Professorengestalt belehrend vor die Studierenden und als Experte fürs Allgemeine kritisierend vor die Kameras tritt oder der als freischaffender Lebenskunstberater eines großen Publikums Erfolg hat. So wäre aus dem philosophischen Streuner mit seiner ewigen Fragerei ein akademischer Antwort- beziehungsweise medialer Ratgeber geworden?
Der Philo-soph, derjenige, der die Weisheit liebt, ging den Leuten nicht nur auf die Nerven oder verdarb ihnen den Spaß an ihren Meinungen, sondern er zerbrach die Gewissheiten des Alltags und störte die sozialen Abläufe. Die Arbeit tun die anderen hieß ein Bestseller des ›Anti-Soziologen‹ Helmut Schelsky, erschienen Mitte der 1970er-Jahre, nicht lange nachdem Reinhard Mey die Annabelle zum ersten Mal geklampft hatte. In diesem Buch prangerte Schelsky die angebliche ›Priesterherrschaft‹ der Denkspezialisten an, die immer nur analysieren und sich nie die Hände schmutzig machen. Seitdem ist der Typus des am Rand stehenden Kritikers auf dem Weg funktioneller Integration nach und nach im medialen Betriebssystem verschwunden. Das honorarfähige ›Schwimmen gegen den Strom‹ wurde zu einer Form des Mitmachens. Muss also konstatiert werden, dass der jahrtausendealte Rollenkonflikt zwischen den sokratischen Störenfrieden und den Gesellschaften, die sie jeweils umgaben, historisch ein für alle Mal überholt ist? Signalisierte das ›reflektierte Mitspielen‹, das in den ironisch modernen (man sagte ›postmodernen‹) 1980ern und 1990ern als intellektuelle Haltung modisch war, das Erlöschen der philosophischen Flamme, an der sich die Menschen seit alters her die Finger verbrannten?
Vielleicht hat die ›sokratische Ironie‹ an ihrer elaborierten Wirkungslosigkeit selbst einen Anteil. Einst entwickelt als Distanzierungsmethode zum Gegenüber (oder als Dummstellerei vor den anderen, wie der Vorwurf der Sophisten lautete), hat sie sich seit der Romantik zu einer inneren Haltung subjektiviert, von der aus alles, aber auch wirklich alles, infrage gestellt und außer Geltung gesetzt werden kann. Was vor einer Generation dem postmodernen ›anything goes‹ angelastet wurde, hatte Georg Wilhelm Friedrich Hegel schon der ›romantischen Ironie‹ vorgeworfen: »Die Ironie ist das Spiel mit allem; dieser Subjektivität ist es mit nichts mehr Ernst, sie macht Ernst, vernichtet ihn aber wieder und kann alles in Schein verwandeln.«
Hegel nahm die sokratische Ironie vor der romantischen in Schutz, wenn auch beiläufig und etwas matt. Nietzsche indessen machte Sokrates dafür verantwortlich, dass sich nach dessen Auftreten nichts mehr von selbst verstehe und alles erklärt werden müsse. Die Instinktsicherheit des Handelns, das es bis dahin gar nicht nötig gehabt hätte, sich selbst zu verstehen, sei durch die quälende Fragerei der Vernunft zerstört worden. Mit Sokrates sei der »Typus des theoretischen Menschen« in die Welt gekommen.
Nietzsche war nicht der Einzige, der den Gewissheitsverlust beklagte. Max Scheler, der sich mit einer ›philosophischen Anthropologie‹ abmühte, erklärte 1928, man erlebe jetzt »das erste Zeitalter, in dem sich der Mensch völlig und restlos problematisch geworden ist; in dem er nicht mehr weiß, was er ist, zugleich aber auch weiß, daß er es nicht weiß«.
Nietzsche schrieb gegen den Rationalismus und Szientismus seiner eigenen Gegenwart an, gegen die herrschende Zeittendenz einer wissenschaftlichen Vernünftigkeit und technischen Machbarkeit. Der ›Typus Sokrates‹ war für ihn die erste Personifizierung dieser Tendenz, obwohl der historische Sokrates kein Empiriker, sondern Ethiker gewesen ist. Aber selbst dies wirft Nietzsche ihm vor. Wie die Aufklärer des 18. Jahrhunderts und die Rationalisten des 19. Jahrhunderts habe Sokrates an Humanisierung durch Vernunft geglaubt, obwohl der Mensch diese Humanisierung gar nicht nötig habe.
Die ›alten Griechen‹ waren allerdings keine Humanisten, so wenig, wie ihre Demokratie eine in unserem Sinn gewesen ist. Im Alltag einer Sklavenhaltergesellschaft geht es anders zu als im Griechischunterricht der gymnasialen Oberstufe. Aber eine Gemeinsamkeit zwischen der Demokratie in der Polis und der Demokratie in der modernen Mediengesellschaft gibt es doch: die Übermacht der Meinung und die Gefährdung der Demokratie durch Demagogie. Das Recht auf demokratische Teilnahme hängt mit Meinungsfreiheit zusammen, nicht jedoch mit Kenntnissen oder Fähigkeiten. Das Gefährliche daran hat kritische Geister schon immer beschäftigt und beunruhigt, nicht bloß Anhänger der Eliteherrschaft, sondern auch solche mit demokratischen Überzeugungen. Weder sachliche Wahrheit noch ethische Richtigkeit hängen von Mehrheiten ab, die politische Willensbildung aber schon. Das kann mehr als Reibungsverluste mit sich bringen und bei ungünstigen Umständen zu scheinbar oder wirklich unlösbaren Konflikten führen.
Wenn eine Meinung und die Wahrheit zusammenpassen, ist das mehr dem Zufall geschuldet als der Erkenntnis. Das lässt sich niemand gerne sagen, weder auf den Märkten Athens noch in den Medien unserer Tage. Und schon gar nicht von Leuten wie Sokrates, die selbst keine Experten sind, sich geradezu weigern, Experten zu sein. Sokrates selbst gibt zu, was ihm »bereits viele vorgeworfen«, also »daß ich andere zwar fragte, selbst aber nichts über irgend etwas antwortete, weil ich nämlich nichts Kluges wüßte zu antworten, darin haben sie recht«. Aber wie sollen dann Entscheidungen getroffen werden? Und von wem? Wenn der gesunde Menschenverstand an mangelnder Selbsterkenntnis krankt, woran soll man sich orientieren? Es gibt »ein Mittleres zwischen Weisheit und Unwissenheit«, sagt Diotima in Platons Symposion. »Was ist das?«, fragt Sokrates. »Das Meinen des Richtigen, ohne Rechenschaft darüber geben zu können«, antwortet Diotima.
Wahrheit ohne Meinung artet ins Totalitäre aus, wenn sie keine Rücksicht auf die Leute nimmt und auf deren Zustimmung, wie einsichtsbeschränkt die auch sein mag. Wenn die Wahrheit allein als Expertentum vor die Menschen tritt, läuft sie Gefahr, technokratisch zu werden; ist sie ideologisch orientiert, wird sie doktrinär; ist sie religiös motiviert, wird sie dogmatisch. In jedem Fall erniedrigt sie sich zur Dienerin von Interessen jenseits der Erkenntnis. Allerdings fehlt ohne Interessen und Ziele der Handlungstrieb, ohne den das Wissenwollen in Kontemplation versinkt.
Umgekehrt wird Meinung ohne Wahrheit – genauer: ohne Wahrheitsvorbehalt – gleichgültig. Das Meinen resultiert aus Bedürfnissen, und die Meinungsäußerung hat ihre sachliche Rechtfertigung durch Tatsachenkenntnis gar nicht mehr nötig. Alle haben eben ihre Meinung, und alle Meinungen sind gleich gültig.
Meinung ohne Wahrheit und Wahrheit ohne Meinung können beide mörderisch sein. Es gibt nur eine Konsens-, aber keine Kausalverbindung zwischen Wahrheit, Meinung und Mehrheit.
Die Faszination, die Sokrates und sein Schicksal bis heute ausüben, rührt auch vom Drama seines Prozesses und seines Sterbens her. Dieser Prozess lässt sich interpretieren als eine Art Urszene vom »Konflikt zwischen dem Philosophen und der Polis«, wie Hannah Arendt es in Vita activa ausdrückte. An Karl Jaspers schrieb sie: »Es gibt seit dem Prozeß des Sokrates, d.h. seit die polis dem Philosophen den Prozeß machte, einen Konflikt zwischen Politik und Philosophie.«
Das individuelle Denken und die politische Macht kollidieren auch in der Demokratie. Schließlich wurde Sokrates von einer durch demokratische Abstimmung ermittelten Mehrheit für schuldig erklärt, und nach fortgesetzten rhetorischen Provokationen des schuldig gesprochenen Angeklagten legte eine sogar noch gewachsene Mehrheit als Strafe den Tod durch den Schierlingsbecher fest.
Es war völlig in Ordnung, dass der Prozess so ausging, der Prozess musste sogar so ausgehen. Jedenfalls erklärte das Hegel in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie seinen verblüfften Zuhörern. Die griechische Polis konnte sich von einem Einzelnen, und sei dieser Einzelne Sokrates, nicht auf der Nase herumtanzen lassen, so wenig wie der preußische Staat, in dessen Dienst Professor Hegel stand, sich von einzelnen Besserwissern auf der Nase herumtanzen lassen konnte.
Hegel drückte sich philosophischer aus und kam auf die beiden Anklagepunkte zu sprechen: Sokrates leugne die Götter Athens, und er verführe die Jugend. Beide Anklagen seien zu Recht erhoben worden: weil er durch sein Infragestellen hergebrachter Meinungen Zwietracht zwischen Eltern und Kindern gesät und weil er durch die Berufung auf seine »innere Gewissheit« die Götter entwertet habe. »Sokrates hat dem richterlichen Ausspruch sein Gewissen entgegengesetzt, sich vor dem Tribunal seines Gewissens freigesprochen. Aber kein Volk, am wenigsten ein freies Volk […], hat ein Tribunal des Gewissens anzuerkennen.« Wo kämen wir hin, wenn jeder sich mit Berufung auf sein Privatgewissen gegen das Gesetz stellen könne? Hegel gerät bei dieser Vorstellung ganz außer sich: »Diese elende Freiheit, zu denken und zu meinen, was jeder will, findet nicht statt.«
Allerdings war Sokrates nicht irgendein Querulant oder Sonderling. Seine Tragik als »welthistorische Person« bestehe darin, »daß ein Recht gegen ein anderes auftritt, – nicht als ob nur das eine Recht, das andere Unrecht wäre, sondern beide sind Recht, entgegengesetzt, und eins zerschlägt sich am anderen«. Eine Auflösung des Konflikts sei unter dem noch nicht ausgereiften Weltgeist während der griechischen Polis unmöglich gewesen. Dann kommt der schwäbische Meisterdenker in Berlin zum Schluss: »Wir sind so mit Sokrates fertig. Ich bin hier ausführlicher geworden, weil alle Züge so in Harmonie sind und es überhaupt der große geschichtliche Wendepunkt ist. Sokrates ist […] 399/400 v.Chr., wo er 69 Jahre alt war, gestorben, – eine Olympiade nach Beendigung des Peloponnesischen Krieges, 29 Jahre nach dem Tode des Perikles und 44 Jahre vor Alexanders Geburt. Er hat die Herrlichkeit Athens und das Beginnen des Verderbens erlebt; er hat die höchste Blüte und den Anfang des Unglücks mit genossen.«
Die ›innere Stimme‹ des Sokrates, sein Daimonion, hat viel Neugier auf sich gezogen und Denker aller Richtungen, nicht nur den Weltgeistdialektiker Hegel, zu Projektionen verführt, aber auch Spott veranlasst. Adam Smith meinte süffisant, »die große Weisheit eines Sokrates« wäre »doch nicht groß genug, um ihn an der Einbildung zu verhindern, er empfange häufig insgeheim gewisse Winke von einem unsichtbaren, göttlichen Wesen«.
Wenn Sokrates’ ›innere Stimme‹ wirklich die des Gewissens war, wie wir es heute auffassen, dann kann sie nur die eines schlechten Gewissens gewesen sein. In der Apologie lässt Platon seinen Sokrates vor Gericht erklären: »Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen, eine Stimme nämlich, welche jedesmal, wenn sie sich hören läßt, mir von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet aber hat sie mir nie.« Außerdem meldet sich dieser innere Warner nur bei Kleinigkeiten und bleibt bei wesentlichen Fragen stumm. Kommt es also bei diesen Fragen allein auf die ›Stimme der Vernunft‹ an? Alles in allem war das Daimonion des Sokrates etwas viel Kleineres und Unbedeutenderes als unser Gewissen oder als Kants ›moralisches Gesetz in uns‹ oder als Freuds Über-Ich.
Von diesem ›Dämon‹ allein kann die Standhaftigkeit von Sokrates während seines Prozesses und danach nicht herrühren. Er selbst nennt neben dem Anerkennen eines formal immerhin korrekt zustande gekommenen Urteils noch einen pragmatischen Grund für seine Weigerung, sich der Vollstreckung dieses Urteils durch Flucht zu entziehen: Was könne er als alter Mann am Endes seines Lebens im Exil noch anfangen?
Sein Gleichmut beim Sterben beeindruckte viele Menschen, besonders die Philosophen. Als Seneca gut viereinhalb Jahrhunderte später von Kaiser Nero den Selbstmordbefehl erhielt, ließ er sich aus dem Phaidon vorlesen, bevor er sich das Leben nahm. Dagegen ist Professor Hegels Vorlesungsbemerkung über die Todesbeschreibung im Phaidon eher herablassend: »Platons Erzählung der schönen Szenen seiner letzten Stunden, obgleich nichts Ausgezeichnetes enthaltend, ist ein erhebendes Bild und wird immer die Darstellung einer edlen Tat sein.« Es folgt noch der verächtliche Zusatz: »Die letzte Unterredung des Sokrates ist Populärphilosophie.« Ärgerte Hegel sich etwa über den Gag mit dem Hahn? Sokrates hat das Gift getrunken, seine Glieder erkalten, und bevor das Herz stehen bleibt, kann er gerade noch sagen, »wir schulden dem Asklepios einen Hahn«.
Asklepios (oder Äskulap) mit dem schlangenumwundenen Stab war in der griechischen Mythologie der Gott der Heilkunst. Sein Kult wurde vermutlich um 420 von Sophokles in Athen eingeführt. Ein anderer Zeitgenosse des Sokrates, der Arzt Hippokrates, über den Sokrates im Phaidros eine anerkennende Bemerkung macht, galt als Nachfahre des vergöttlichten Asklepios. Zum Asklepios-Kult gehörte die Gewohnheit, dem Gott nach überstandener Krankheit einen Hahn zu opfern. Wenn Sokrates mit seinen letzten Worten daran erinnert, dem Asklepios einen Hahn zu schulden, will er damit sagen, er sei nun von der tödlichen Krankheit des Lebens genesen? Auf diese Weise deutet es Nietzsche: »Dieses lächerliche und furchtbare ›letzte Wort‹ heißt für den, der Ohren hat: ›[…] das Leben ist eine Krankheit!‹ Ist es möglich! […] Sokrates hat am Leben gelitten!« Und allerdings gibt Sokrates verschiedentlich vor, sich auf das Leben nach dem Tod zu freuen, auf die Begegnung mit guten Göttern und mit besseren Menschen, als sie auf Erden anzutreffen seien. Die Vorstellung ewiger Gespräche auf höchstem Niveau wirkt tröstlich auf alle, die hauptsächlich denken und darüber reden wollen, aber doch auch leben und handeln müssen. 1957 schrieb Hannah Arendt an Karl Jaspers: »Wenn Sie mal in den Himmel kommen, und es geht da so zu, wie Sokrates es sich vorgestellt hat, daß man nur fortfährt, sich zu unterhalten, aber nun mit den Besten aller Zeiten, dann wird der alte Kant sich zu Ihren Ehren vom Sitz erheben und Sie umarmen.« Arendt drückte sich etwas schalkmädchenhaft aus, trotz ihrer 51 Jahre, meinte es in der Sache aber nicht unernst.