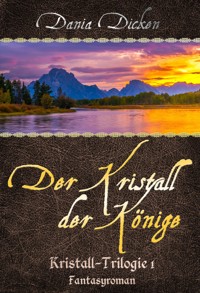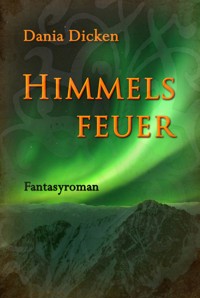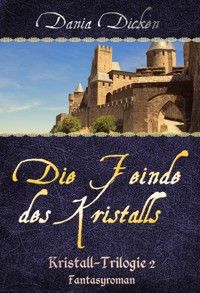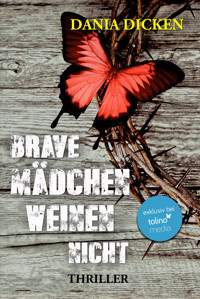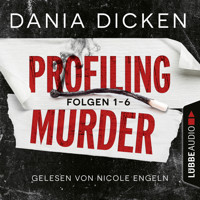4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Adriana hat Zuflucht bei den Freedom Fighters in den Rocky Mountains gefunden. Während Rebellenführer Derek Broadus weitere Angriffe auf die Regierung plant, verfolgt Adriana andere Pläne: Sie will unbedingt ihren Sohn Anthony finden und mit ihm zu ihrem Bruder nach Kanada fliehen. Nachrichtentechniker Sam unterstützt sie bei ihrer Suche und tatsächlich können sie Anthonys genauen Aufenthaltsort in Erfahrung bringen. Allerdings müssen sie ihn dort immer noch befreien und anschließend über die Grenze nach Kanada fliehen – kein einfaches Vorhaben, wenn man sich in einem totalitären Staat ohne Reiseerlaubnis bewegt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dania Dicken
Als die Freiheit starb
Rebellion
Dystopischer Roman
BBC World News, 14.6.36
„Regierungschefs aus aller Welt drückten öffentlich ihre Bestürzung und Ablehnung bezüglich der Internierungslager für schwangere Frauen aus, deren Existenz die Regierung der Vereinigten Republik von Amerika nicht länger leugnen kann. Der französische Staatschef sprach von einer ‚schwarzen Stunde für Menschenrechte im Allgemeinen und Frauenrechte im Besonderen‘, während die kanadische Premierministerin noch weiter ging und von einer ‚Kriegserklärung gegen die Menschlichkeit‘ sprach. Der deutsche Bundeskanzler zog einen klaren Vergleich zu den Konzentrationslagern der Nazis, die vor rund hundert Jahren in Deutschland errichtet und in die Millionen Menschen deportiert wurden.
Nach Aussagen der Rebellengruppierung Freedom Fighters sind die ersten Internierungslager für Frauen, die von der Regierung der amerikanischen Republik beschönigend ‚Health Institute for Expecting Mothers‘ genannt werden, vor einem guten halben Jahr in Betrieb genommen worden. Die Regierung konnte ihre Existenz so lange erfolgreich verbergen, weil den Frauen in den Internierungslagern jeder Kontakt zur Außenwelt verwehrt wird und nach ihrer Entlassung wurde Druck auf sie ausgeübt, niemandem die Wahrheit über die dortigen Zustände zu sagen.
Erste Informationen über die Lager kamen ans Tageslicht, als die schwangere Ehefrau des Rebellenführers Derek Broadus von der Security Agency in ein Lager in Kansas gebracht wurde. Broadus, der nichts unversucht ließ, um den Aufenthaltsort seiner Frau in Erfahrung zu bringen, avancierte innerhalb kürzester Zeit zu einem Anführer der bis dahin noch nicht besonders strikt organisierten Rebellengruppe. Seit seiner Machtübernahme üben die Freedom Fighters systematisch Druck auf die Regierung aus und versuchen, den Regierungsapparat durch gezielte Terrorakte zu schwächen, etwa durch den Bombenanschlag auf die Überwachungszentrale der Security Agency in Arlington im April mit weit über dreitausend Todesopfern oder den Angriff auf das Kapitol und den Supreme Court vor rund zwei Wochen.
Letzte Woche ist es einigen Frauen aus dem Lager in Kansas, in dem auch Broadus‘ Frau interniert war, gelungen, durch ein hineingeschmuggeltes Handy Kontakt zu den Freedom Fighters aufzunehmen, die daraufhin gestern Nacht gegen drei Uhr Nachts Ortszeit einen Großangriff mit Panzern und Raketenwerfern auf das Lager gestartet haben, um die dort inhaftierten Frauen zu befreien. Fast alle Frauen konnten gerettet werden, von Maria Broadus fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Das Lager im südwestlichen Kansas wurde bei dem Angriff nahezu dem Erdboden gleichgemacht, Angaben zu Verlusten liegen noch nicht vor.
Nach der erfolgreichen Evakuierung der Frauen an einen geheimen Ort machten die Freedom Fighters Bildmaterial öffentlich, das weltweit eine Welle der Empörung hervorruft. Nach eigenen Angaben planen die Freedom Fighters nun Angriffe auf weitere Lager und beabsichtigen ebenso, die Kinder der internierten Frauen zu finden, die ihnen nach der Geburt weggenommen und an unbekannte Orte gebracht wurden. Der britische Premierminister nannte diese Vorgehensweise einen ‚unmenschlichen Akt der Unterdrückung‘.
Seit der Implementierung des Klassensystems vor zwei Jahren wurden die Bürgerrechte und die Bewegungsfreiheit in der amerikanischen Republik zunehmend eingeschränkt und Diskriminierung und Unterdrückung weiter vorangetrieben. Frauen beklagen den Verlust ihrer körperlichen Selbstbestimmung seit Inkrafttreten des Abtreibungsverbots und der Einschränkung des Zugangs zu Verhütungsmitteln, People of Color erfahren Rassismus wie zuletzt in den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die schwedische Regierungschefin nannte die Vereinigte Republik von Amerika erst kürzlich eine ‚faschistische Diktatur‘.
‚Wir werden das beenden‘, sagte Derek Broadus am Ende eines der Videos, die die Freedom Fighters gestern verschiedenen Nachrichtenstationen weltweit zugespielt haben. ‚Als ich geboren wurde, war das hier noch The Land of the Free. Ich möchte, dass mein Kind in einem freien Land aufwächst und nicht in einem Staat, der seine Rechte mit Füßen tritt, nur weil es die falsche Hautfarbe hat.‘ Im gleichen Atemzug kündigte Broadus weitere Angriffe gegen staatliche Organe an. Präsident Grant konterte, indem er Broadus einen Terroristen nannte, der die staatliche Ordnung gefährde. Er forderte Broadus auf, die Waffen niederzulegen und sich zu stellen, doch Beobachter rechnen mit einem baldigen Angriff auf ein weiteres Internierungslager.“
1. Kapitel: Zwei Wochen später
Die leichte Brise, die mit meinen Haaren spielte, kam von den Bergen herab und fühlte sich ein wenig kühl an. Das hohe Gras wogte sanft im Wind, ich wischte eine Strähne meines Haares aus dem Gesicht. Darüber hinaus rührte ich mich nicht. Beim Blick auf das schlichte Kreuz, das auf dem Grab meiner Tochter stand, war ich innerlich wie erstarrt. Diese Taubheit war ohnehin das vorherrschende Gefühl, das mich in den letzten Monaten begleitete.
Mein Leben war in einer solchen Geschwindigkeit auseinandergefallen, dass es mir schwerfiel, damit überhaupt Schritt zu halten. Ich hatte nicht vergessen, wie frustriert und verzweifelt ich gewesen war, als ich meinen Job verloren und versucht hatte, meinen Sohn allein zu Hause zu beschulen – dabei war das nur der Anfang gewesen. Seitdem hatte sich alles in einer Spirale immer weiter bergab gedreht.
Ich hatte mein Zuhause verloren. Man hatte mir meinen Sohn weggenommen. Und mein Mann und meine Tochter waren tot.
Ich hatte sie Estella genannt, Stern. Weil sie ein Sternenkind war und weil mir der Name gefiel.
Es kamen keine Tränen mehr. Jedenfalls nicht im Moment. Ich stand einfach nur da, erfüllt von innerer Leere und einer Traurigkeit, die alles mit einer bleiernen Schwere überdeckte.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich weitermachen sollte. Ich wollte auch gar nicht. Mir war jeder Lebensmut abhandengekommen. Das Einzige, was mich aufrecht hielt, war der Gedanke an meinen Sohn Anthony.
Er hatte nur noch mich und ich schuldete es ihm, ihn nicht allein zu lassen. Aber das war dann auch schon alles.
So konnte ich nicht leben.
Meine Gedanken drehten sich immer wieder im Kreis. Ständig musste ich daran denken, dass alles anders hätte kommen können, wenn wir einfach rechtzeitig nach Kanada gegangen wären. Zu meinem Bruder Mateo und seinem Freund Corey. Dann könnte Eric jetzt noch leben. Dann hätte man mir Anthony nicht weggenommen. Vielleicht wäre ich auch nie schwanger geworden und es wäre mir erspart geblieben, jetzt am Grab eines Kindes zu stehen, das ich ursprünglich gar nicht gewollt hatte. Dass es nie hatte leben dürfen, traf mich dennoch bis ins Mark.
Vielleicht hätte ich Estella nicht verloren, wäre ich beim Angriff der Freedom Fighters nicht verletzt worden. Auch mein Mann könnte noch leben, hätten die Freedom Fighters nicht seinen Arbeitsplatz in die Luft gesprengt.
Ich hätte jeden, wirklich jeden Grund gehabt, sie abgrundtief zu hassen. Sie hatten mir fast alles genommen, was mir wichtig war.
Und mir gleichzeitig die Freiheit geschenkt.
Estella Cabello, 13.6.36 stand auf dem Kreuz. Ausgerechnet ein Freitag. Ich war nicht abergläubisch, aber trotzdem fand ich das irgendwie passend. Für mich war es auch ein sehr schwarzer Tag gewesen.
In letzter Zeit fühlten sie sich alle schwarz an. Oder grau. Oder irgendwas dazwischen. Wie ein Nebel, der sich nicht lichten wollte. Würde sich das je wieder ändern?
Ein Sonnenstrahl kämpfte sich durch die Wolken und rüttelte mich aus meiner Lethargie wach. Nachdem ich noch einen letzten Blick auf das Kreuz geworfen hatte, wandte ich mich zum Gehen.
Estella war nach wenigen Tagen begraben worden. Jemand bei den Freedom Fighters hatte sogar in aller Eile einen klitzekleinen Sarg gezimmert. Ich hatte die Anteilnahme sehr tröstlich gefunden, auch wenn sie an den Tatsachen nichts änderte. Man kümmerte sich gut um mich – ich wurde ärztlich versorgt, hatte Eisentabletten gegen den Blutverlust bekommen, sogar ein leichtes Beruhigungsmittel hatte man mir angeboten. Ich hatte es abgelehnt, weil ich ohnehin schon das Gefühl hatte, gar nichts mehr wirklich zu spüren. Vermutlich war das eine Schutzreaktion meiner Psyche, die einfach nur überfordert mit allem war.
Langsam ging ich zurück zum Camp. Alle nannten es Camp, auch wenn es eigentlich mehr war als das. Allerdings mussten auch viele Menschen in Zelten schlafen, obwohl es nachts noch recht kalt werden konnte, einfach weil in den Gebäuden nicht ausreichend Platz war. Aktuell versuchten die Freedom Fighters, die Rückführung der geretteten Frauen nach Hause zu organisieren, doch nicht alle Frauen waren überhaupt uneingeschränkt reisefähig und es musste auch sichergestellt werden, dass ihnen kein Ärger drohte, wenn sie nach Hause zurückkehrten. Solange das nicht der Fall war, blieb es voll im Camp.
Ich schlief noch immer auf der Krankenstation, auch wenn das eigentlich gar nicht nötig war. Allerdings war sonst nirgendwo Platz und ich war dankbar dafür, es warm und trocken zu haben. Gerade war nicht die Zeit, Ansprüche zu stellen.
Aber eigentlich hatte ich auch keine. Eigentlich wollte ich nichts – nur Dinge, von denen ich wusste, dass ich sie nicht haben konnte.
Ich folgte einem kleinen steilen Weg einen Abhang hinauf bis zum Haupthaus, in dem auch die Krankenstation untergebracht war. Inzwischen konnte ich wieder fast normal laufen, wofür ich dankbar war. Meine Stauchung war schon beinahe vollständig zurückgegangen.
Eigentlich wollte ich gerade hineingehen, als mein Blick auf Leona und Randy fiel, die unweit des Haupteingangs standen und die Sonnenstrahlen genossen. Leona hatte sich rücklings an ihren Mann gelehnt, der seine Arme um sie gelegt hatte und mit einer Hand über die Rundung ihres Bauches strich. Die beiden standen seitlich zu mir und bemerkten mich nicht, wofür ich dankbar war.
Für einen kurzen Moment blieb ich wie angewurzelt stehen und betrachtete die beiden, die einen winzigen Augenblick der Zweisamkeit und Freude teilten. Darum beneidete ich sie unaussprechlich. Leona hatte die Augen geschlossen und strahlte übers ganze Gesicht. Als Randy ihr einen Kuss aufs Haar gab, beeilte ich mich, ungesehen im Gebäude zu verschwinden.
Während ich hastig dem Gang folgte, spürte ich, wie der Kloß in meinem Hals immer dicker wurde und mir Tränen in die Augen schossen. Privatsphäre war aktuell ein seltenes Gut, aber ich hatte in den vergangenen Tagen eine kleine Nische auf dem Flur ausfindig gemacht, in die sogar jemand mal einen Ohrensessel, einen Stuhl und einen Beistelltisch gestellt hatte. Das war mein Ziel und ich war so damit beschäftigt, nicht unterwegs schon in Tränen auszubrechen, dass ich gar nicht darauf achtete, wie jemand aus dem Technikraum links von mir kam. Weil ich so hastig unterwegs war, stieß ich ungebremst mit ihm zusammen und erkannte da erst Sam, den Nachrichtentechniker.
„Oh“, machte er überrascht und lächelte freundlich, während ich mich verlegen abwandte und tief Luft holte, um die Tränen zurückzuhalten.
„Tut mir leid“, sagte ich gepresst und das Zittern meiner Stimme verriet mich.
„Kein Grund, gleich in Tränen auszubrechen“, sagte er halb im Scherz, doch das alles traf mich so unvermittelt, dass alle Dämme brachen und ich mich beschämt abwandte, als die Tränen einfach kamen.
„Hey, alles in Ordnung?“, fragte er besorgt, als er merkte, was los war.
Hastig wischte ich mir über die Wangen. „Tut mir leid. Hat nichts mit dir zu tun.“
„Möchtest du reden?“
Nach kurzem Zögern hob ich den Kopf und sah ihn an. Beim Blinzeln löste sich noch eine Träne aus meinem Auge.
Diese Frage überforderte mich. Ich wusste nicht, was ich wollte. Es hatte auch schon länger keine Rolle mehr gespielt. Mein Blick verlor sich im Nichts. Ich kannte Sam kaum, hatte bislang nur zwei- oder dreimal mit ihm zu tun gehabt, wenn es darum gegangen war, Mateo zu kontaktieren.
„Ich weiß, wir kennen uns kaum“, sprach er meine Gedanken laut aus, „aber ich glaube, ich weiß sehr genau, wie du dich fühlst. Ist nur ein Angebot, aber mir hätte es nach dem Tod meiner Frau geholfen, mit jemandem zu reden, der das kennt.“
Ich schniefte kurz und fing mich langsam wieder. „War da niemand?“
„Zum Reden? Doch, das schon, aber niemand, der selbst diese Erfahrung gemacht hatte. Alle haben versucht, möglichst hilfreich zu sein, aber wie fundamental dieser Verlust die eigene Welt aus den Angeln hebt, versteht niemand, der das nicht selbst erlebt hat.“
„Das glaube ich auch“, sagte ich leise. „Hast du denn überhaupt Zeit?“
„Ja, im Moment ist nicht viel los.“ Ermutigend nickte er mir zu und lud mich in den Technikraum ein. Sein Kollege war nicht da, sodass wir unter uns waren.
Sam schob mir einen Drehstuhl hin und setzte sich auf seinen eigenen gleich vor einem Schreibtisch, auf dem mehrere Bildschirme, Lautsprecher und andere technische Geräte standen. Hier hatte ich auch die Videotelefonate mit Mateo geführt.
„Danke ... das ist wirklich nett“, sagte ich.
Sam lächelte. „Dein Schicksal ist vielen nah gegangen, die das mitbekommen haben. Ich könnte verstehen, wenn du wütend auf die Freedom Fighters wärst.“
„Sollte ich sein, oder?“
„Warum bist du es nicht?“
Das war eine gute Frage. „Vielleicht, weil ich weiß, dass es bei dem Anschlag aufs Pentagon nie um die Menschen dort ging. Es ging darum, die Regierung zu schwächen. Dass mein Mann für die SAR gearbeitet hat, hat mir ja selbst nicht gefallen.“
„War er überzeugt davon?“
„Nein, gar nicht. Er hat es getan, weil ihm die Alternativen fehlten und er darüber unseren Status sichern wollte. Er wollte mitbekommen, was die Regierung so alles plant.“
„Nicht dumm“, fand Sam.
„Ja, einerseits schon. Andererseits hat es ja auch etwas mit ihm gemacht. Es tat ihm nicht gut. Es war der Pakt mit dem Teufel.“
„Vielen von uns geht es tatsächlich ganz ähnlich“, sagte Sam. „Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie viele Mitglieder der SAR tatsächlich insgeheim Rebellen sind.“
„Dann gibt es ja noch Hoffnung.“
„Ich denke, schon. Das wäre schön.“ Er lächelte freundlich.
Ich holte tief Luft. „Vorhin war ich am Grab meiner Tochter.“
„Verstehe“, sagte Sam. „Das ist ja noch mal ein anderer Schmerz.“
„Stimmt. Ist es.“ Für einen kurzen Moment zögerte ich, bevor ich fragte: „Hast du das auch erlebt?“
„Ja“, erwiderte er und holte tief Luft. „Meine Frau hieß Jenny. Wir haben uns auf der Uni kennengelernt und uns gleich ineinander verliebt. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben nach unserem Abschluss geheiratet und bald ein Haus gekauft, das groß genug war für die Familie, die wir gründen wollten. Leider hat es dann erst mal eine ganze Weile gedauert, bis sie schwanger wurde. Vor zweieinhalb Jahren hat es endlich geklappt.“
„Mutig, dass ihr das in diesem politischen Klima angegangen seid“, fand ich.
„Ja, das finde ich jetzt auch“, stimmte Sam mir zu und sein Blick wanderte in die Ferne, während er sprach. „Damals habe ich nicht darüber nachgedacht. Bis sie eines Tages, da war sie in der neunzehnten Woche, plötzlich über Schmerzen und Übelkeit klagte. Sie konnte die Schmerzen erst gar nicht genau lokalisieren, aber klar war, es geht ihr nicht gut. Wir sind zu ihrem Frauenarzt gegangen, der uns prompt ins Krankenhaus geschickt hat. Dort nahm die Katastrophe dann ihren Lauf.“ Sam schüttelte den Kopf, als könne er es selbst immer noch nicht fassen. Ich sagte nichts, sondern wartete stumm ab, bis er fortfuhr.
„Sie hatte Schmerzen im Oberbauch, Kopfschmerzen und Sehstörungen, aber auch Übelkeit und Verdauungsbeschwerden. Deshalb dachten die Ärzte erst, dass sie sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen hat. Auf die Blutabnahme mussten wir bestehen, aber als die Blutwerte da waren, sagten sie, es sei das HELLP-Syndrom.“
Ich nickte verstehend. Beim HELLP-Syndrom handelte es sich um die schwerste Form der Präeklampsie. Unbehandelt konnte es tödlich verlaufen.
„In dem Moment hätte sofort ein Kaiserschnitt gemacht werden müssen, um ihr Leben zu retten. Das wollte aber niemand tun, denn das hätte ja zu diesem Zeitpunkt den Tod unseres Babys bedeutet“, fuhr Sam fort.
Ich schluckte schwer. „Die Beendigung einer Schwangerschaft ist doch erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.“
„Das stimmt – aber das war erst nicht so ganz klar und der behandelnde Arzt sagte, dass er keinen Kaiserschnitt machen würde, solange unser Kind einen Herzschlag hat. Zu dem Zeitpunkt, als es keinen mehr hatte, hing Jenny schon mit Nierenversagen an der Dialyse. Es ging ihr so schlecht, dass sie gar nicht mehr mitbekommen hat, dass unser Kind tot war. Als dann endlich der Kaiserschnitt gemacht wurde, war es zu spät. Jenny ist nie mehr aus der Narkose erwacht, ihre Organe haben der Reihe nach versagt. Am nächsten Tag war sie tot.“ Zum Ende hin brach seine Stimme und seine Augen füllten sich mit Tränen.
Was für ein unfassbarer Schmerz. Ich hatte eine grobe Vorstellung davon, wie Sam sich damals gefühlt haben musste, und seufzte tief. Mitfühlend sah ich ihn an, war aber nicht sicher, ob er das überhaupt bemerkte.
„Meine Frau ist tot, weil diese Idioten das nicht ernst genommen haben. Die hatten Angst, sich strafbar zu machen, wenn sie das Kind zu früh holen. Die haben sie lieber sterben lassen. Ich kann das bis heute nicht verstehen – wie kann man einem Leben, das noch gar nicht fertig ist, einen höheren Stellenwert einräumen als dem, das schon vor einem steht? Es macht mich so wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe die Ärzte angezeigt, wollte ihnen die Approbation entziehen lassen. Nichts ist passiert. Die haben meine Jenny sterben lassen und sind einfach davongekommen. Angeblich hätten sie nach bestem Gewissen und im Einklang mit den Gesetzen gehandelt.“ Sein Mund wurde zu einem dünnen Strich. „Das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, ein Freedom Fighter zu werden.“
Unsere Blicke trafen sich. „Es tut mir so leid“, sagte ich.
Sam nickte und wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. „Danke.“
„Das ist furchtbar. Du hast auch an einem einzigen Tag deine ganze Familie verloren.“
Sam nickte langsam. „Ja. Deshalb glaube ich, dass ich verstehe, wie es dir geht.“
Das tat er wohl wirklich. Eigentlich waren wir uns noch vollkommen fremd, aber uns einte ein Schmerz, der diese Fremdheit überwand. Zu wissen, dass ein anderer Mensch den eigenen Schmerz komplett nachvollziehen konnte, war verdammt tröstlich.
Ich zögerte einen Augenblick, aber dann stellte ich meine Frage doch. „Wie hast du das überlebt?“
Sam machte ein wissendes Geräusch und nickte. „Gute Frage. Anfangs wohl, weil da dieser Trotz war und ich so besessen davon war, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Und es gab auch so viel zu tun ... ich musste meine Frau und mein Kind beerdigen lassen und alles organisieren, was damit zusammenhängt. Ich wusste auch immer, dass sie bestimmt nicht gewollt hätte, dass ich mich hängen lasse. Aber es war schwer. Besonders das erste Jahr. Alle wichtigen Daten zum ersten Mal allein erleben – den errechneten Geburtstermin, ihren Geburtstag, meinen, unseren Hochzeitstag ... Da hat man immer ein Bild vor Augen, wie es hätte sein sollen, und dann steht man da mit dieser Leere und es ist völlig anders. Zwischendurch war ich auch völlig verzweifelt und wollte eigentlich nur aufgeben. Aber als ich dann von den Freedom Fighters hörte und davon, dass sie auch gegen solche Ungerechtigkeiten kämpfen, dachte ich mir, dass ich das unterstützen will. Ich wollte mithelfen, damit das nicht wieder passiert und Jenny nicht so völlig sinnlos gestorben ist.“
„Kann ich verstehen“, sagte ich. „Aktuell suche ich noch nach einem Sinn ... nach einem Grund, um weiterzumachen. Nach etwas, das über die Sorge um meinen Sohn hinausgeht.“
Sam nickte verständnisvoll. „Bei dir ist es noch so frisch. Lass dir Zeit. Ich weiß, das ist schwierig, denn Trauer ist so schwer und lähmend und eigentlich möchte man nur, dass sie vergeht. Wollte ich auch. Ich weiß noch, dass ich in ein Loch gefallen bin, als die Beerdigung vorüber war und die ersten Dinge organisiert waren. Besonders die stillen Abende zu Hause nach der Arbeit waren die Hölle. Damals habe ich es kurz für eine gute Idee gehalten, den Schmerz mit Alkohol zu betäuben, was auch erst funktioniert hat – aber danach kam er nur umso stärker zurück und hat mich fast überwältigt. Da habe ich verstanden, dass ich wohl einfach da durch muss. Trauer will gelebt werden.“
Ich seufzte tief, denn gerade hätte ich lieber etwas anderes gehört. „Du machst mir ja Mut ...“
„Ich sage dir nur, wie es ist. Wir leben jetzt beide ein Leben, das wir uns so nie ausgesucht haben und ich bin ehrlich – ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Aber es wurde besser, als ich angefangen habe, es wieder gestalten zu wollen und nicht mehr zuzulassen, dass mir die Dinge einfach passieren. So hat sich das vorher nämlich angefühlt. Aber dann war das erste Jahr vorbei und mir kam die Idee, zu den Freedom Fighters zu gehen, weil ich so frustriert darüber war, dass ich niemanden wegen Jennys Tod zur Rechenschaft ziehen konnte. Sie haben mich ja auch gern genommen, Nachrichtentechniker können sie hier gut brauchen. Und so habe ich mein altes Leben aufgegeben, das ohnehin kaputt war, und bin jetzt hier.“ Er zuckte mit den Schultern.
„Wer weiß, wohin mich das führt? Es vergeht noch immer kein Tag, an dem ich nicht an die Zukunft denken muss, von der ich immer dachte, dass sie vor mir liegt und die ich nun unwiederbringlich verloren habe. Ich vermisse Jenny und ich weine um mein Kind, aber ich habe inzwischen verstanden und akzeptiert, dass ich die beiden nicht zurückbekomme. Das ist auch gar nicht mehr mein Ziel. Aber es braucht Zeit, um sich davon lösen zu können und neue Ziele. Und bei dir ... du hast ja noch ein Ziel. Du hast deinen Sohn.“
„Ich weiß nur, dass er in Montana ist, in einem Kinderheim. Das hat ein netter Wärter im Lager für mich recherchiert – derjenige, der uns irgendwann auch das Handy gegeben hat. Mehr konnte er leider nicht herausfinden.“
Sam nickte wissend. „Die Information ist schon bei uns gelandet, damit wir dem nachgehen. Leider ist es ein ganzer Stapel von Rechercheanfragen, da kommen wir aktuell kaum hinterher. Derek sitzt uns im Nacken, damit wir rausfinden, wohin man Maria gebracht hat und wir recherchieren auch, wie wir die hier gestrandeten Frauen am besten nach Hause bringen.“
„Sind denn die ersten nicht schon zu Hause?“
„Doch, natürlich. Aber es gibt viele, bei denen nicht ganz klar ist, wo sie hin können und auch das Wie ist nicht geklärt. Es gibt viel zu tun. Tatsächlich ist auch dein Junge gar nicht der Einzige, der in diesem Heim in Montana ist. Es haben sich noch zwei weitere Frauen aus deinem Lager gemeldet, deren Kinder in einem Heim sind. Wir konnten auch bei diesen beiden Kindern herausfinden, dass sie wohl in Montana sind, aber der genaue Ort dieses Heims ist wirklich streng geheim. Wir kamen bislang einfach nicht dazu.“
„Schon gut. Du musst dich mir nicht erklären“, sagte ich schnell. „Ich habe hier schon so viel Unterstützung erfahren ...“
„Sicher, aber es ist mir ja auch ein Bedürfnis, dass die Dinge vorangehen. Ich weiß auch aus der Führungsriege, dass es Planungen gibt, nicht bloß Maria zu finden, sondern auch mit der Suche nach weiteren Frauen und auch Kindern ein Zeichen zu setzen.“
Überrascht zog ich die Brauen hoch. „Wie meinst du das?“
„Derek überlegt, weitere Lager anzugreifen und eben auch solche Orte wie das Kinderheim, in dem sich dein Sohn befindet. Den Angriff auf euer Lager hat zum Glück niemand kommen sehen, da haben wir sie kalt erwischt. Erschreckend ist nur, dass die anderen Lager ja immer noch in Betrieb sind.“
Ich konnte es nicht fassen. „Die halten immer noch daran fest?“
Sam nickte. „Sieht so aus.“
„Warum?“
„Ganz einfach: Weil sie es können. Würden sie die jetzt aufgeben, käme das ja einem Eingeständnis gleich, dass es ein Fehler war. Und diese Regierung macht keine Fehler, wie du weißt.“
Ich lachte kurz. „Ja, schon klar. Daran erinnert sie uns ja auch ständig.“
„Ja, leider. Jedenfalls wollte ich nur sagen – wir sind an der Sache dran. Sei unbesorgt. Ich verspreche dir, dass ich deinen Sohn finden werde. Ich kann dir nur noch nicht versprechen, wann.“
„Danke“, sagte ich und lächelte gedankenverloren. Das war immerhin ein Lichtblick.
Sam bemerkte meinen abwesenden Blick. „Alles okay?“
Ich nickte langsam. „Ja ... mir kam da gerade nur ein Gedanke, aber du hast sicher Besseres zu tun.“
„Worum geht es denn?“
„Es gibt noch jemanden, den ich suche. Wahrscheinlich nützt es mir sowieso nichts, zu wissen, wo sie ist, aber ...“
„Warum?“
„Weil ich vermute, dass man sie an die Mauer geschickt hat.“
„Das dürfte immerhin leichter rauszufinden sein“, sagte Sam. „Wie heißt sie denn?“
„Molly Perkins. Sie ist Ende März festgenommen worden.“
Wortlos griff Sam nach einem Zettel und schrieb ihren Namen auf. „Weißt du vielleicht noch das genaue Datum?“
„Dazu müsste ich in einen Kalender sehen“, sagte ich. Sam öffnete einen am Computer und ich versuchte, aus dem Kopf zu rekonstruieren, wann Stan bei mir gewesen war und mir von Mollys Festnahme berichtet hatte. Schließlich notierte Sam auch dieses Datum und sagte: „Damit sollte es eigentlich nicht allzu schwierig sein, herauszufinden, wo sie steckt. Häftlinge unterliegen nicht derselben Geheimhaltungsstufe wie beispielsweise dein Sohn.“
„Das wäre toll ... wie gesagt, wahrscheinlich nützt es mir nicht mal was, zu wissen, wo sie ist. Aber ich wüsste gern, was aus ihr geworden ist. Ob es ihr gut geht. Sie wurde festgenommen, weil sie mir helfen wollte.“
„Verstehe. Ich schaue mal, was ich herausfinden kann.“
„Danke“, sagte ich und stand auf. „Das hilft alles sehr.“
Wieder huschte ein Lächeln über seine Lippen. „Schön. So soll das sein.“
„Wir sehen uns“, sagte ich und verließ den Technikraum. Jetzt fühlte sich alles nicht mehr ganz so schwer an.
2. Kapitel
„Es macht mich so wütend, wenn ich mir überlege, dass sie das einfach machen. Ich meine, wer gibt ihnen das Recht dazu? Leona und ich haben uns nie etwas zuschulden kommen lassen. Unser einziges Verbrechen besteht darin, dass wir einfache Leute sind. Und deshalb wollten sie uns unser Kind wegnehmen.“ Wütend und gleichzeitig verständnislos schüttelte Randy den Kopf und nahm noch einen Bissen. Leona hatte sich ihm gegenüber neben mich gesetzt und legte ihre Hand auf seine.
„Reg dich nicht auf. Es ist ja vorbei.“
„Das regt mich aber auf! Es wird wirklich Zeit, dass sich was ändert. Ich will nicht, dass mein Kind in einer Diktatur aufwächst.“
„Wir könnten nach Kanada gehen“, sagte Leona.
„Ich will aber einfach hier in Freiheit leben! Ich will nicht nach Kanada. Ich will einfach, dass diese Regierung verschwindet.“
„Das wäre schön“, sagte Leona nachdenklich.
„Allerdings“, stimmte ich zwischen zwei Bissen zu und nickte. „Wobei ich definitiv nach Kanada möchte. Ich hoffe, ich finde meinen Sohn irgendwie wieder ... und dann möchte ich mit ihm zu meinem Bruder nach Vancouver.“
„Das kriegen wir hin“, sagte Randy zuversichtlich. „Das ist es ja, was Derek als nächstes Ziel gesetzt hat – er möchte weitere HIFEM angreifen und natürlich auch solche Kinderheime. Da müssen ja einige Kinder sein, die ihren Eltern weggenommen wurden. Das ist falsch. Aktuell finden Gespräche mit Regierungsvertretern aus Kanada und Mexiko statt.“
„Wozu das?“, fragte ich.
„Um herauszufinden, wie sie uns unterstützen können. Nicht nur in Sachen Flüchtlinge – das ist ja aktuell schon ein großes Thema und da sind beide Regierungen ja wirklich sehr entgegenkommend. Derek hofft aber auch, von ihnen Unterstützung in militärischer oder politischer Hinsicht zu bekommen.“
„Hat Kanada nicht schon ein Handelsembargo verhängt?“, fragte ich.
„Ja, das ändert sich je nach Tagesform. Zuletzt waren sie da ja wieder etwas zurückgerudert, weil wir ja schließlich auch ein wichtiger Handelspartner sind, aber seit dem Bekanntwerden der HIFEM ist eine Verschärfung im Gespräch. Derek will jetzt darauf einwirken, dass sie es auch tatsächlich umsetzen.“
„Das wäre ja mal was“, murmelte Leona.
„Ja, fände ich auch. Mexiko wird da ja nicht so viel Einfluss haben ... aktuell laufen auch Gespräche mit Regierungsvertretern einiger NATO-Staaten.“
„Derek scheint sehr aktiv zu sein“, sagte ich.
„Ja, das ist er. Er ist einfach ein unglaublich sturer, entschlossener Mensch. Ich verstehe ihn, seine Motivation ähnelt meiner ja sehr – er will seine Frau und sein Kind zurück. Er ist auch ein charismatischer Mensch und bevor er dabei war, waren die Freedom Fighters ja noch so ein verstreuter, unorganisierter Haufen, der zwar öfter mal irgendwo demonstriert hat, aber das war es ja dann auch schon. Es kam erst durch Derek, dass alles etwas organisierter und zielgerichteter wurde.“
„Wobei er ja durchaus auch nicht vor Gewalt zurückschreckt.“
„Nein. Es ist aber ja auch nicht so, als würde die Regierung uns da die Wahl lassen. Wir müssen sie da treffen, wo es weh tut.“
„Randy ...“ sagte Leona scharf und machte eine Kopfbewegung in meine Richtung.
„Schon gut“, sagte ich. „Eric war zur falschen Zeit am falschen Ort. Dass ihr die SAR-Zentrale angegriffen habt, war ja clever. Es ist ja keiner von euch losgezogen mit dem Ziel, meinen Mann zu töten.“
„Nein ... Adriana, wirklich, versteh mich nicht falsch – mir tut das wahnsinnig leid. Ehrlich. Ich weiß, dass nicht jeder, der dort gearbeitet hat, das aus Überzeugung getan hat. Es gab Opfer, die vielleicht vermeidbar gewesen wären und ehrlicherweise hat uns das Ausmaß dieses Anschlags selbst überrascht. Aber leider war es auch sehr effektiv. Die SAR war nachhaltig geschwächt, das hält teilweise noch bis jetzt an. Für unsere Sache war das verdammt hilfreich.“
„Ich weiß“, sagte ich. „Es ist auch müßig, drüber zu diskutieren. Eric ist tot und kommt nicht mehr zurück. Wenn ich aber dran denke, wie sein Kollege, sein eigentlicher Freund, zu mir kam und mir diese Nachricht überbracht hat, nur um mich dann wegzubringen und mir meinen Sohn wegzunehmen ...“ Ich hatte einen dicken Kloß im Hals und schüttelte den Kopf. Es dauerte einen Moment, bis ich mich gesammelt hatte und weitersprechen konnte. „Das alles hat die Regierung getan. Die SAR. Die haben sich absolut unmenschlich verhalten. Meinem Mann hat der Mut gefehlt, sich dagegenzustellen und mit meinem Sohn und mir zu fliehen, als es noch ging. Aber wir hätten das tun sollen. In der Zeit seit seinem Tod habe ich erst recht erlebt, was ich dieser Regierung wert bin. Und deshalb finde ich es gut, dass ihr dagegen vorgeht.“
Sowohl Randy als auch Leona sahen mich überrascht an, aber ich meinte es so. Natürlich war ich im ersten Moment auch wütend gewesen, dass die Freedom Fighters mir durch diesen Anschlag meinen Mann genommen hatten.
Aber es war passiert, weil Eric noch für die SAR gearbeitet hatte.
Es war passiert, weil wir nicht gemeinsam nach Kanada geflohen waren.
Es war passiert, weil Eric alles die ganze Zeit einfach hatte laufen lassen. Ich erinnerte mich gut an unsere Diskussionen darüber, wie die Zukunft aussehen sollte. An seine mangelnde Risikobereitschaft.
Und mit den Konsequenzen leben musste ich jetzt.
Nein, das war nicht die Schuld der Freedom Fighters.
„Es ist viel zu lange nichts gegen diese Regierung unternommen worden“, sagte Randy. „Das fängt ja schon an mit der Wahl. Nicht nur, dass Grant entgegen des Popular Vote ins Amt gehoben wurde – nein, es haben auch noch zufällig genau so viele Wahlmänner anders abgestimmt als geplant, dass das überhaupt möglich war. Wenn ihr mich fragt, ist die Wahl manipuliert worden und die nächste wird es sicher auch.“
„Dass überhaupt eine stattfinden soll, überrascht mich“, gab ich zu.
„Ja, mich auch. Aber Grant wird schon dafür sorgen, dass das Ergebnis zu seinen Gunsten ausfällt. Das müssen wir unbedingt verhindern.“
„Das ist euer Ziel?“
„Am besten wäre es, man könnte ihn ausschalten. Aber das ist schwierig bis unmöglich und außerdem ist er ja nur die Spitze eines Krebsgeschwürs. Selbst wenn wir ihn erwischen würden, hat er ja noch genügend treue Gefolgsleute. Wir müssen das anders angehen. Wir wollen seine Machenschaften weltweit publik machen, wollen dafür sorgen, dass außenpolitisch Druck auf ihn gemacht wird. Innenpolitisch natürlich auch – unser Angriff auf euer Lager hat ja schon Wellen geschlagen und für erste Widerstände gesorgt, aber das war erst ein Funken. Wir brauchen mehr, um ein Lauffeuer in Gang zu bringen. Irgendwann wird er einsehen müssen, dass er dem Druck von allen Seiten nicht standhalten kann.“
„Clevere Strategie“, fand ich.
„Und was machst du, wenn das alles nicht funktioniert? Ich habe noch drei Monate bis zur Geburt. Alles, was ich mir wünsche, sind Frieden und Sicherheit. Ich möchte an einem Ort sein, wo unserem Kind und mir keine Gefahr mehr droht, verstehst du? Was hast du gegen Kanada?“, fragte Leona überraschend.
„Ich habe gar nichts gegen Kanada, aber ich bin Amerikaner und mag meine Heimat. Ich möchte, dass unser Kind auch einfach hier geboren werden kann. Du etwa nicht?“
Leona senkte den Kopf und zog skeptisch die Brauen hoch, während sie ihn ansah. „Und du glaubst ernsthaft, dass es hier in drei Monaten so sicher ist, dass unser Kind hier zur Welt kommen sollte?“
„Glaubst du denn, dass es eine gute Idee ist, jetzt das Land zu verlassen? Du bist schwanger, das ist doch auch alles anstrengend und riskant. Jetzt bist du doch wieder bei mir und in Sicherheit.“
„Ach, so wie vor vier Monaten auch, ja?“ Gereizt warf Leona ihr Besteck aufs Tablett und sprang so heftig auf, dass der Stuhl hinter ihr umfiel. Randy wollte ihr nachsetzen, aber da hatte sie den Versammlungsraum schon verlassen.
„Ich sehe mal nach ihr“, sagte ich, weil mir nicht entging, wie hilflos Randy auf einmal wirkte. Er nickte bloß, während er den Stuhl unter den Augen aller wieder hinstellte, und ich ging schnurstracks zum Ausgang. Das tat ich so entschlossen, dass ich zu fest auftrat und ein Schmerz durch meinen Knöchel zuckte. Es war nicht schlimm, erinnerte mich aber daran, dass ich es nicht übertreiben durfte.
Als ich auf den Flur trat, fiel eine der Ausgangstüren bereits zu. Leona war also draußen. Sehen konnte ich sie in diesem Moment nicht, ich entdeckte sie erst, als ich ebenfalls aus dem Gebäude trat und zur Seite blickte.
Sie stand oberhalb der Treppen, die Hände zu Fäusten geballt und schwer atmend. Ich sah sie von der Seite, deshalb stach mir die zunehmende Rundung ihres Bauches gleich ins Auge. Ausgerechnet war sie für Anfang September. Die Zeit drängte – und ich verstand ihre Angst.
Ich stellte mich neben sie und wartete ab. Im Augenwinkel sah ich, dass ihre Lippen bebten und Tränen in ihren Augen glitzerten.
„Ich habe einfach solche Angst, dass sie uns noch mal trennen“, sagte sie mit erstickter Stimme. „Mich und Randy ... und vor allem mich und das Baby. Weißt du, ich sehe dich jeden Tag und es zerreißt mich, wenn ich mir das vorstelle, dabei ist mein Baby ja noch gar nicht geboren. Wie hältst du das eigentlich aus?“
„Bleibt mir denn eine Wahl?“, erwiderte ich schlicht.
„Da hast du auch wieder Recht.“
„Ich ertrage das, weil ich es muss“, sagte ich nach kurzem Zögern. „Nichts von dem, was gerade mein Leben ausmacht, habe ich mir ausgesucht. Gar nichts. Ich habe alles verloren. Meinen Mann, meinen Sohn, meinen Job, mein Haus. Gerade habe ich nur mich und die Kleidung an meinem Körper. Und ja, mir kam schon der Gedanke, dass das jetzt so ist, weil Eric der Mut gefehlt hat. Mir infolgedessen auch, denn ich wollte nicht ohne ihn gehen. Aber das bereue ich jetzt. Für Eric hatte der Gedanke an Flucht niemals dieselbe Dringlichkeit wie für mich. Er hat das nicht verstanden.“
„Und Randy versteht mich jetzt auch nicht.“
„Ich verstehe dich aber“, sagte ich und legte eine Hand auf ihren Oberarm. „Das ist der Nestbautrieb. Natürlich möchtest du dich sicher und geschützt fühlen, wenn dein Kind geboren wird. Jede werdende Mutter möchte das! Und Randy sollte dem Ganzen auch Gehör schenken.“
„Manchmal denke ich, ich erkenne ihn nicht wieder. Alles, wovon er spricht, sind die Freedom Fighters und ihre nächsten Schritte. Dabei dachte ich eigentlich, ich wäre ihm das wichtigste ...“
Ich sah sie geradewegs an, als ich sagte: „Das bist du auch. Vermutlich ist er immer noch so in allem drin, weil es das war, was er die ganzen letzten Monate gemacht hat. Und trotzdem ... es gibt genügend Freedom Fighters, die das Land retten können. Das muss nicht dein Mann machen. Er sollte dir jetzt die Priorität einräumen, die dir zusteht.“
„Denkst du ...“ Leona suchte nach Worten. „Ach, ich weiß auch nicht.“
„Sag ihm das. Ich kann das auch tun, falls dir das lieber ist. Aber an deiner Stelle würde ich auch das Land verlassen wollen. Wollte ich ja seinerzeit auch. Mein Mann hat es auch nicht für dringlich genug gehalten. Und jetzt stehe ich da und muss mit den Konsequenzen leben.“
Ich hatte sehr entschlossen, geradezu wütend begonnen, doch zum Ende hin begann meine Stimme zu zittern und ich hatte Tränen in den Augen.
Alles war verloren. Alles. Und ich gab Eric und seiner Mutlosigkeit die Schuld dafür.
Ich hatte es nicht zu meinem Thema machen wollen, aber jetzt übermannten mich schon wieder meine Gefühle. Ich hasste es. Manchmal kam ich mir vor wie ein nervliches Wrack. Aber Leona war die Freundin, die sie immer war, und umarmte mich einfach.
„Du hast Recht“, sagte sie. „Du stündest auch nicht hier, wenn dein Mann mutiger gewesen wäre. Ich möchte nicht, dass mir das auch passiert. Ich werde das mit Randy besprechen.“
Schniefend wischte ich mir die Tränen ab und nickte. „Mach das. Man denkt ja immer, man hätte noch Zeit. Wichtige Dinge haben nicht die Priorität, die sie haben sollten. Man glaubt auch immer, dass alles irgendwie gut wird ... dabei passiert das nicht von selbst auf magische Weise.“
Leona nickte ernst. „Das stimmt. Ich werde das jetzt selbst in die Hand nehmen. Du willst doch nach Kanada, oder?“
„Ja. Was soll ich hier? Ich will nach Kanada, wenn Anthony wieder bei mir ist. Ich will mit ihm zu meinem Bruder.“
„Das will ich auch. Nach Kanada, meine ich. Du hast Recht – es muss nicht mein Mann an vorderster Front mitkämpfen. Ich brauche ihn gerade mehr.“
„Und ob du das tust“, sagte ich.
„Es sieht alles gut aus“, sagte Dr. Asher, während er den Ultraschallkopf noch mal an eine andere Stelle bewegte. „Es scheinen keinerlei Reste verblieben zu sein. Haben Sie denn noch Blutungen?“
Ich nickte langsam. „Ja, das schon. Sie werden seit ein paar Tagen schwächer, sind aber immer noch da.“
„Ja, das ist normal. Was Sie da erlebt haben, war ja auch eine richtige Geburt. Nur eben sehr, sehr früh. Wie geht es Ihnen jetzt damit?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Wie soll es mir damit gehen? Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Eigentlich wollte ich das Kind ja gar nicht, aber es macht was mit einem, zu wissen, dass es da ist. Und allein die Hormone ... Es zu verlieren war dann doch ziemlich schlimm.“
„Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja vollkommen normal, dass Sie schon eine Bindung aufgebaut haben. Es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?“
Ich schüttelte den Kopf. „Haben Sie vielen Dank.“
Der junge Arzt nickte mir zu, während er aufstand. Nachdem ich meine Hose zugeknöpft hatte, setzte ich mich aufrecht. Dr. Asher hatte noch einmal kontrolliert, ob nach meiner Totgeburt alles in Ordnung war, aber das schien es zu sein.
Wenigstens etwas.
Der Blick auf die Uhr verriet mir, dass ich noch ein wenig Zeit hatte, bevor ich zu den Technikern gehen und mit Mateo sprechen konnte. Weil ich keine Ahnung hatte, was ich mit meiner Zeit anstellen sollte, machte ich mich auf die Suche nach Leona.
Auf der Krankenstation war sie nicht, auch nicht im großen Aufenthaltsraum. Während ich überlegte, wo ich noch nachschauen konnte, sah ich Randy aus Richtung des Technikraums kommen und ging zu ihm, um ihn zu fragen. Er wirkte gestresst, nickte mir aber dennoch freundlich zu.
„Wo ist denn deine Frau?“, fragte ich, woraufhin er stehen blieb.
„Wollte spazierengehen. Du hast ihr ja einen ziemlichen Floh ins Ohr gesetzt mit deiner Idee, nach Kanada zu gehen.“ Er klang sehr gereizt, als er das sagte, was in mir einen Verdacht aufkommen ließ.
„Darauf ist sie ganz allein gekommen“, erwiderte ich.
„Aber du hast sie darin sehr bestärkt. Hältst du das echt für eine gute Idee? Hier ist sie sicherer, als wenn wir die Passage durch die Salish Sea versuchen.“
Seine Worte trafen bei mir einen Nerv. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und legte den Kopf schief. „Weißt du, das hat mein Mann auch andauernd zu mir gesagt. Ich weiß, dass es nicht ohne Risiko ist, aber er hat dieses Risiko so gescheut, dass er es erst in Erwägung gezogen hat, als ich ungewollt schwanger wurde. Bis dahin war Aussitzen seine Devise. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin diejenige, die jetzt alles verloren hat. Man hat mir meinen Sohn weggenommen, ich habe kein Haus mehr, keine Arbeit, ich musste meine Tochter beerdigen – und bei meinem Mann bekam ich gar nicht die Chance dazu. Und das alles, weil ihm der Mumm gefehlt hat, mal was zu riskieren. Ich würde das rasend gern mit ihm diskutieren, aber das geht nicht, denn er ist tot. Er muss die Konsequenzen des Ganzen nicht mehr tragen.“
„Ich bin sicher, er wäre lieber noch am Leben“, sagte Randy, lieferte mir damit aber nur eine weitere Steilvorlage.
„Dann hättet ihr vielleicht nicht das Pentagon in die Luft sprengen dürfen!“
Randy erbleichte schlagartig, als ihm der Fehltritt bewusst wurde, und er suchte nach Worten. „Adriana ... es tut mir leid. Das weißt du. Das war blöd ...“
„Stimmt. Ziemlich sogar. Ja, Eric wäre bestimmt lieber noch am Leben, aber er ist es nicht und es ist eine Tatsache, dass er es sein könnte, wären wir einfach rechtzeitig geflohen. Mach du nicht denselben Fehler. Ich wäre bedeutend lieber in Kanada, als jetzt hier mit absolut nichts zu stehen. Ich hätte es gern riskiert.“
Sprachlos wie ein Fisch stand Randy nur da und ich spürte, wie gern ich noch viele weitere Dinge gesagt hätte, aber ich wollte ihn nicht unnötig verletzen und ging deshalb schweigend an ihm vorbei.
Zu meiner Erleichterung ließ er mich ziehen. Ich stürmte am Technikraum vorbei bis zu der kleinen Sitzecke, in der ich kürzlich noch Zuflucht gefunden hatte, aber gerade war sie besetzt. Ich ging weiter bis zum Fenster am Ende des Ganges und schaute hinaus.
Auf den nahen Gipfeln der südlichen Rockies lag ganz oben immer noch ein wenig Schnee. Zelte säumten die kleinen Ferienhäuser am Waldrand. Die Leute hatten sich einfache Klappstühle hingestellt und sich damit in die Sonne gesetzt. Zwischen zwei Ferienhäusern war eine Wäscheleine gespannt und mit Kleidung behängt worden. Zwei junge Männer patrouillierten vorbei – beide trugen dunkelblaue T-Shirts mit dem orangen Emblem, das kürzlich für die Freedom Fighters gestaltet worden war. Außerdem waren beide bewaffnet. Das zu sehen, sorgte bei mir aber für ein Gefühl der Sicherheit.
Es wirkte fast wie ein Flüchtlingscamp und eigentlich war es das auch. Ich fragte mich, wie lang das noch so weitergehen sollte.
Mit Blick auf die Uhr stellte ich fest, dass die Zeit nicht mehr reichte, um Leona zu suchen. Stattdessen ging ich zurück zum Technikraum und wartete auf dem Gang, bis die Tür geöffnet wurde. Eine andere Frau kam heraus und lächelte mir flüchtig zu, dann ging ich hinein und wurde freundlich von Sam begrüßt.
„Hey“, sagte er und lächelte. „Wie geht es dir?“
Ich zuckte unbestimmt mit den Schultern. „Muss ja.“
„Stimmt. Na, dann wollen wir mal.“ Er reichte mir ein Paar Kopfhörer mit Mikrofon, die ich mir passend einstellte, während er das Programm öffnete und eine Nachricht an Mateo schickte. Die Antwort folgte prompt, sodass wir eine Verbindung zu ihm herstellten. Wie üblich sah man am Anfang nur einen Pixelbrei, der allerdings recht zügig besser wurde. Wenigstens konnte ich ihn auf Anhieb gut verstehen.
„Adriana“, sagte mein Bruder und rang sich ein Lächeln ab, dem es jedoch nicht vollständig gelang, seinen besorgten Gesichtsausdruck zu überspielen. „Wie geht es dir?“
„Es wird besser“, sagte ich. „Vorhin war ich hier beim Arzt, der noch mal einen Ultraschall gemacht hat. Alles okay.“
„Das ist schön. Gemeint habe ich eigentlich alles.“
Ich verstand und erwiderte: „Es ist okay. Klingt vielleicht verrückt, aber hier bei den Freedom Fighters fühle ich mich freier und sicherer als noch vor ein paar Monaten, obwohl wir uns hier verstecken müssen. Hier gilt Lagerfeuerverbot, damit niemand mitbekommt, was hier los ist. Aber ansonsten ... ich bin endlich frei. Ich habe zwar alles verloren, aber ich fühle mich frei, obwohl ich nicht mal eine ID-Karte habe.“
Betreten hörte Mateo mir zu und sagte: „Ich weiß, was du meinst.“
„Du bist doch sowieso frei.“
„Sicher, aber irgendwie erinnert mich das an mein Coming Out. Weißt du noch, wie ich damals im Jahr vor dem Highschool-Abschluss von diesen Idioten vermöbelt worden bin und sie mir mit wasserfestem Filzstift Tunte auf die Stirn geschrieben haben?“
Ich lachte widerwillig und nickte. „Hab ich nicht vergessen. Du hattest ein blaues Auge, einen halb ausgeschlagenen Zahn und trotzdem haben alle bloß auf deine Stirn gestarrt, als Dad mit uns in die Notaufnahme gefahren ist.“
Mateo lächelte versonnen. „Ja ... das war schon abenteuerlich. Ich war so wütend auf diese homophoben Spinner, das kannst du dir nicht vorstellen. Und trotzdem – ich wollte lieber offen schwul leben und riskieren, verprügelt zu werden, als immer zu unterdrücken und zu verstecken, wer ich bin. Das war hundertmal schlimmer.“
„Daran erinnere ich mich gut. Ich habe ja die ganze Zeit gemerkt, dass etwas mit dir nicht stimmt und du todunglücklich bist. Ich weiß auch noch, wie dein Coming Out mich überhaupt nicht überrascht hat.“
„Ja, das stimmt. Deine Reaktion war toll.“
Ich war die erste Person, mit der Mateo darüber gesprochen hatte – ein Vertrauensbeweis, auf den ich bis heute stolz war. Es war mir vollkommen logisch erschienen, als er mir offenbart hatte, dass er sich in einen Jungen verliebt hatte. Ich hatte bloß genickt und ihn gefragt, ob dieser Junge seine Gefühle erwiderte, was er glücklicherweise auch getan hatte.
Mateo war völlig überrascht gewesen und hatte mich gefragt, ob ich denn sonst nichts dazu zu sagen hätte, doch darüber hatte ich erst nachdenken müssen und dann den Kopf geschüttelt. Es war, als hätte ich immer instinktiv gespürt, dass mein Bruder schwul war, ohne je bewusst darüber nachzudenken. Überhaupt war es mir eigentlich völlig egal, denn er war und blieb mein Bruder, ganz gleich, mit wem er ins Bett ging.
Aber ich verstand, was er mir sagen wollte. Er war unglücklich gewesen, solange er versucht hatte, gegen seine Natur zu leben.
So war ich auch. Es hatte mich kreuzunglücklich gemacht, von dieser Regierung auf die Tatsache reduziert zu werden, dass ich Ehefrau und Mutter war. Das machte meine Identität aber nicht aus. Das war nur ein Teil davon. Und nun hatte man mir beides weggenommen. Ich hatte zwar nur noch mich selbst, konnte nun aber für mich allein frei entscheiden. Alles, was auch mich lange von einer Flucht abgehalten hatte, war nun nicht mehr da. Es gab nur noch mich und Anthony und keinen Druck mehr, mich an ein System anpassen zu müssen, das mich unterdrücken wollte. Ich hatte diesem System schon längst den Stinkefinger gezeigt.
Und ich würde es weiter tun.
Ich seufzte tief und sagte: „Du fehlst mir.“
„Du fehlst mir auch, Große. Mehr, als ich sagen kann. Ich wäre jetzt so gern für dich und Anthony da, aber ich bin so weit weg ...“ Betreten holte er Luft. „Alles, was ich hier tun kann, ist bürokratischer Natur. Ich habe schon bei der Einwanderungsbehörde politisches Asyl für dich und Anthony angemeldet und einen Antrag darauf gestellt, dass ihr hier wohnen dürft, wenn ihr erst mal hier seid. Das alles wird schneller genehmigt, wenn ich mich vorab darum kümmere. Ich muss jetzt bloß noch wissen, wie es weitergeht. Wenn ich weiß, wann und wie du fliehen willst, kann ich den Fluchthelfern hier Bescheid geben, die euch entgegenkommen und euch unterstützen können.“
„Verstehe ... ich habe nur leider immer noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Ohne Anthony werde ich nicht fliehen, ich weiß aber immer noch nicht, wo er ist. Und ich brauche ja auch Hilfe dabei, ihn zu holen.“
„Bekommst du die denn?“
„Es klang so, ja. Sie planen ja weitere Angriffe auf diese unsäglichen Lager ... und ja, sie sind dran, Anthony zu finden und auch dort wollen sie hin. Es ist natürlich nur sehr viel auf einmal.“
„Ja, kann ich mir denken. Aber dann ist ja gut.“
„Ich werde wahrscheinlich morgen mehr erfahren – für morgen Abend hat Derek Broadus zu einer Versammlung aufgerufen. Irgendwie muss es ja weitergehen, die Umstände hier im Camp sind schwierig.“
„Kann ich mir denken. Die Regierung hier wird wohl wieder ein Embargo erlassen, um Grant unter Druck zu setzen. Ich glaube zwar nicht, dass ihn das beeindruckt, aber es ist zumindest ein richtiges Signal.“
Ich nickte zustimmend. „Es kann so nicht weitergehen. Das ist ja verrückt.“
„Ja, allerdings. Ich frage mich vor allem die ganze Zeit, was sie sich davon versprechen. Wo wollen sie denn mit ihrer ganzen Politik hin?“
Das hatte ich mich bislang noch nicht gefragt, weil es mir eigentlich egal war. Aber vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht war es sinnvoll, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, um die nächsten Schritte des Gegners vorausahnen zu können.
„Ich weiß es nicht, aber ich will hier einfach nur noch weg. Wenn Anthony wieder bei mir ist, versuche ich, nach Seattle zu kommen und dann zu dir.“
„Ja. Ist okay. Ich habe mich im Übrigen auch schon mal schlaugemacht, was Hilfe für Anthony angeht. Ich habe jetzt die Adresse einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, die einen richtig guten Ruf hat. Dort habe ich schon mal angerufen und unseren Fall geschildert. Sie sagte, wir sollen uns melden, wenn ihr hier seid. Sie schaut ihn sich dann gern mal an.“
„Ehrlich? Matty, du bist großartig. Danke. Am liebsten würde ich dir jetzt um den Hals fallen!“
Er lächelte gerührt. „Ist doch klar. Viel mehr kann ich nicht tun, dann tue ich wenigstens das.“
„Du tust genug. Den Rest muss ich schon selbst erledigen. Ich war vorhin so wütend ...“ Meine Stimme begann, leicht zu zittern und ich spürte einen Kloß im Hals. „Als mir wieder bewusst geworden ist, dass es nicht so weit hätte kommen müssen. Wir hätten einfach nur rechtzeitig zu dir kommen müssen. Dann wäre das alles nicht passiert. Dann wäre Eric noch am Leben und ...“ Ich schüttelte den Kopf. „Das macht mich so wütend, verstehst du? Er hat sich nicht getraut, aber ich muss jetzt mit den Folgen leben.“
Mateo nickte ernst. „Kann ich verstehen. Wirklich. Ich habe sein Zögern auch nie wirklich verstanden, aber vielleicht war das auch bloß, weil es für ihn nie war wie für uns, verstehst du?“
„Ehrlich gesagt, nein. Was meinst du?“
„Eric war ein Weißer. Ein Regierungsmitarbeiter. Ein heterosexueller Mann. Er war all das, was in diesem System begünstigt wird. Am Ende des Tages war es für ihn doch gar nicht so dringend wie für dich.“
„Es war ihm nicht egal.“
„Nein, natürlich nicht. Das sage ich ja auch gar nicht. Aber es ist was anderes, ob man selbst am Spieß über dem Feuer geröstet wird oder ob man nur daneben sitzt und die Hitze spürt, verstehst du?“
„Das war jetzt aber eine schöne Metapher.“
„Ja, aber so ist es doch nun mal. Und ... versteh mich nicht falsch, ich mochte Eric. Wirklich. Ich hatte ihn sehr gern. Aber in eurer Beziehung warst du immer diejenige, die den stärkeren Antrieb hatte.“
„Das stimmt ...“
„Ich meine, er hat es bis an die FBI Academy geschafft ... ich weiß noch, wie er erzählt hat, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist. Und trotzdem war er da. Das hat er geschafft. Und was ist er dann geworden, weil er selbst es wollte? Nicht Special Agent – er ist Analyst geworden.“
„Ja, und? Ist daran was verkehrt?“
„Nein, daran ist gar nichts verkehrt. Aber es beschreibt ihn einfach sehr gut. Ihm hat der Biss gefehlt, um Agent zu werden und mit Dienstmarke und Waffe rauszugehen und zu ermitteln. Er wollte das nie, verstehst du? Und ich hatte bei ihm auch immer das Gefühl, dass es genau das war, was ihn an dir so fasziniert hat – dass du nie zu bremsen warst.“
Dass ich nie zu bremsen war ... Wenn ich mal überlegte, wie die letzten paar Jahre für mich verlaufen waren, wurde mir innerlich ganz kalt. Ich war nur mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Eigentlich war das nicht ich.
Mateo hatte Recht. Und es tat weh, mir das einzugestehen.
Gerade wurde mir das zu viel. Ich tat demonstrativ so, als würde ich auf die Uhr blicken und sagte: „Wir müssen langsam zum Ende kommen.“
„Ja, ich verstehe. Alles klar. Ich hoffe, beim nächsten Mal weißt du mehr.“
„Ich melde mich“, versprach ich.
„Halt die Ohren steif, Große. Ich hab dich lieb.“
Ich schluckte hart, spürte erneut einen dicken Kloß im Hals. „Ich dich auch. Bis dann.“
Mit einer fahrigen Bewegung griff ich nach der Maus und drückte den Button, um das Gespräch zu beenden, bevor ich mir hastig das Headset vom Kopf zog und eine Spur zu unsanft auf den Schreibtisch knallte. Betreten verzog ich das Gesicht und versuchte, die aufsteigenden Tränen und das Zittern zu unterdrücken.
„Alles in Ordnung?“, fragte Sam, der irgendwo hinter mir an einem Serverschrank beschäftigt war.
Ich antwortete erst nicht, weil ich einfach nicht losheulen wollte. Sam befestigte einige Kabel mit einem Kabelbinder und tat noch ganz konzentriert, aber ich spürte, dass das nur vorgetäuscht war.
Während ich noch überlegte, was ich antworten sollte, kam er mir zuvor. „Ich will nicht indiskret sein und ich habe auch nicht absichtlich zugehört, aber ich war vorhin nun mal im Raum und habe mitbekommen, was du über deinen Mann gesagt hast.“
„Das war nicht nett.“
Sam zog den Kabelbinder fest und drehte sich zu mir um. „Es war doch vollkommen okay. Es war menschlich. Und soll ich dir was sagen? Es war völlig normal. Es war gut.“
Irritiert sah ich ihn an, während ich das Kabel des Headsets zwischen den Fingern zwirbelte. „Gut? Was war denn daran gut, dass ich mich über meinen verstorbenen Mann beklage?“
Sam lächelte wohlwollend, was mich noch mehr irritierte. „Kennst du das Modell mit den verschiedenen Trauerphasen?“
Ich nickte. „Ja, grundsätzlich schon ...“ Noch konnte ich ihm nicht ganz folgen.
„Ich habe mich nach dem Verlust meiner Frau ein wenig damit beschäftigt. Ich weiß noch, dass sie auch fließend ineinander übergehen und man durchaus auch etwas überspringen oder wieder zurückfallen kann ... sie wiederholen sich. Aber ganz grob dachte ich vorhin, dass du jetzt in der Phase der Wuttrauer angekommen bist.“
Auf die Idee, das so zu sehen, war ich bislang noch gar nicht gekommen – aber Sam hatte es kaum ausgesprochen, als ich mir dachte, dass er vermutlich Recht hatte.
„Die erste Phase ist die Verleugnung“, sagte er. „Da will man es einfach nicht wahrhaben. In der zweiten Phase ist man einfach nur wütend. Man gibt auch gern schon mal dem Verstorbenen die Schuld für das, was passiert ist. Hab ich damals auch getan ... und ja, es hat sich für mich auch sehr verstörend angefühlt.“
„Das glaube ich dir. Ich schäme mich gerade immer dafür, wenn ich wütend auf Eric bin.“
„Das glaube ich dir. Es ist aber ganz normal. Ich war damals besessen von dem Gedanken, dass Jenny eher zum Arzt hätte gehen sollen. Das war natürlich Unsinn und hätte gar nichts geändert, denn gestorben ist sie ja, weil die Ärzte sie nicht rechtzeitig behandelt haben. Als mir das klar wurde, richtete meine Wut sich ausschließlich auf die Ärzte und blieb auch dort. In dieser Phase hatte ich auch zum ersten Mal die Idee, zu den Freedom Fighters zu gehen.“
„Gemacht hast du es später?“
„Ein wenig später, ja. Ich habe mich erst mal darauf konzentriert, die Ärzte zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Zu den Fighters bin ich gegangen, als das gescheitert ist.“
„Verständlich“, fand ich.
„Trauer ist unglaublich anstrengend und zehrend, aber man muss da durch. Versucht man, sie zu verdrängen oder abzukürzen, kommt sie nur noch vehementer zurück und verlangt ihr Recht. Ich weiß noch, wie oft ich damals versucht habe, mit dem Schicksal zu verhandeln, erfolglos natürlich ... und als meine Versuche, die Ärzte zu belangen, gescheitert sind, bin ich in die Depression gerutscht. Da wurde mir alles zu viel und alles erschien mir sinnlos. Aber dann habe ich von einer Aktion der Freedom Fighters gelesen und schon war die Idee geboren, doch einfach zu ihnen zu gehen und hier mitzumachen. Damit bin ich in die Akzeptanz gekommen und habe begonnen, mein Leben neu zu gestalten. Da muss man hin ... aber der Weg ist steinig.“
„Gefühlt habe ich das alles schon irgendwie durchlaufen.“
„Ja, wie gesagt, das verläuft nicht einfach schön phasisch hintereinander. Es kann sehr verwirrend und anstrengend sein und auch heute habe ich noch Momente, in denen ich schier verzweifle und Jenny unendlich vermisse.“ Er seufzte tief, als er das sagte, und zuckte mit den Schultern. „Aber was will ich tun? Ich kann nichts tun. Sie ist tot und kommt nicht mehr zurück. Ich weiß nur, dass sie nicht gewollt hätte, dass ich mich aufgebe. Deshalb mache ich weiter.“
Das hätte Eric wohl auch nicht gewollt. Er hätte mit Sicherheit gewollt, dass ich weitermache, mein Leben in die Hand nehme – und mich um Anthony kümmere.
Anthony.
„Im Moment ist der Gedanke an meinen Sohn das Einzige, was mich am Leben hält“, sagte ich. „Einfach dieses Pflichtgefühl ... er hat doch nur noch mich.“
„Du wirst bestimmt auch wieder andere Dinge im Leben finden, die dir Freude bereiten und allem einen Sinn verleihen“, sagte Sam.
„Aber nur, wenn ich aus diesem Land rauskomme.“
„Würdest du nicht bleiben wollen? Nicht mal, wenn die Dinge sich hier ändern?“
„In Kanada ist mein Bruder. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, genausowenig wie meine Eltern ... aber mein Bruder ist auch mein Freund.“
„Das ist schön“, sagte Sam, doch das Lächeln verschwand gleich wieder von seinen Lippen.
„Was ist los?“, fragte ich. „Hast du was über Anthony in Erfahrung bringen können?“