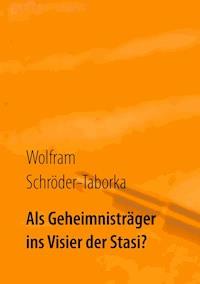
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit weiblicher Logik brachte es Frau Studienrätin auf den Punkt, ihr geliebter Patensohn habe seine wissenschaftliche Karriere nur aufgegeben, um ohne Risiko in den Schoß der Familie zurückkehren zu können. Handelte ich wirklich mit dem Vorsatz, durch Karriereverzicht aus meiner bisherigen Welt in die Welt meiner Patentante zu gelangen? Einem Wechsel zwischen Welten, die sich - welch Novum - sogar innerhalb einer Stadt unversöhnlich gegenüberstanden, die meine im östlichen, die ihre im westlichen Teil Berlins. Ich wohnte in Kaulsdorf, sie in Steglitz, heute trennt uns lediglich eine knappe Autostunde, damals eine scharf bewachte Mauer. - Den "Antifaschistischen Schutzwall" zu überwinden glich reinstem Selbstmord, das wusste auch Frau Studienrätin, die tantenhaft interessiert den Werdegang ihres Patensohns verfolgte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kindheit bis Studienbeginn
Herkunft
Kindheitstraum
Flucht nach „Westen“
Wieder in Demmin
Kleiner Zirkusartist
Schule und Kirche
Lehre
Studium
Motivation zum Studium
Studium
Reservistenausbildung
„Romeo und Julia“
Krafttraining
Geheimnisträger
Zum sportartspezifischen Krafttraining
Leistungssport als Politikum
Karriereabstieg
Freizeit- und Erholungssport
Sylvia
Fitnesstrainer im Sport- und Erholungszentrum
„Immer ich!“
Patente
Wie wurde ich Artist?
Ute
Höherstufung der FANGANOS
Kreativität
Abb.: Der Perché-Darbietung
Erste Versuche
Longe
Helmut Hellas
CIRCUS AEROS
Galas, Galas, Galas
Ulan Bator
Das Telefonat
Privat oder Staatszirkusartist?
Entsendung
Antrag zur Entsendung
Frau Schröder
Letzte Zweifel vor der Überfahrt
Zollkontrolle
Unser ganzer Stolz
Gespräch mit den Norwegern
Durch Schweden
Zur Botschaft in Stockholm
Nach Hamar
Ernst Huber und die Ängste der „West“-Artisten
CIRKUS AGORA, Artisten und Episoden
Direktor Jan Ketil
„Cotys Comic Car“
„Los Tonios“
„Madame Vivi“
„Abdul Gomari Tumbling Troupe“
Lebensunterhalt in Norwegen
Anglerglück
Mittsommernacht
Autokauf
Milo
Demokratieverständnis
Als Norweger zurück in die DDR
Wiedervereinigung
Gala im Kalibergbau
Unseriöse Zirkusunternehmen
Circus Medrano
Zirkus „Aeros“
Zirkus „???“
Zirkus „C. A…….“
Engagements im Ausland
Circus Monti
Luftakrobatik
In den folgenden Jahren
Svetlana
Epilog
Weitere Buchtitel des Autors
Die Olympischen Spiele in der Antike
»So verstehen sich Mensch und Hund«
Missverständnisse zwischen andersartigen Partnern
Statement
„Gesund & fit im besten Alter“
„Drei totalitäre Ideologien habe ich erlebt: Den ‚Bolschewismus‘, den ‚Nationalsozialismus‘ und die ‚Political Correctness‘. Und alle sind mir als Konservativem, der Freiheit über alles schätzt, zuwider.“ (Frederick Forsyth)
Prolog
Mit weiblicher Logik brachte Frau Studienrätin es auf den Punkt, ihr geliebter Patensohn habe seine wissenschaftliche Karriere nur aufgegeben, um ohne Risiko in den Schoß der Familie zurückkehren zu können. Handelte ich wirklich mit dem Vorsatz, durch Karriereverzicht aus meiner bisherigen Welt in die Welt meiner Patentante zu gelangen? Einem Wechsel zwischen Welten, die sich – welch Novum – sogar innerhalb einer Stadt unversöhnlich gegenüberstanden; die meine im östlichen, die ihre im westlichen Teil Berlins. Ich wohnte in Kaulsdorf, sie in Steglitz; heute trennt uns lediglich eine knappe Autostunde, damals eine scharf bewachte Mauer. Den „Antifaschistischen Schutzwall“ zu überwinden glich reinstem Selbstmord; das wusste auch Frau Studienrätin, die tantenhaft interessiert den Werdegang ihres Patensohns verfolgte.
Kindheit bis Studienbeginn
Herkunft
Zwei Adelstöchter teilten sich einst eine Burg: „Dat Hus is din un min!“ („Das Haus ist deins und meins!“): Daraus soll „Demmin“, der Name meines Geburtsortes, entstanden sein.
Doch wer kennt schon Demmin? Im Wissen um die Bedeutungslosigkeit unserer Stadt verlegten wir Demminer sie scherzhaft ins „Dreistromland“, sprachlich dem historischen „Zweistromland“ Mesopotamiens angenähert, in dem vormals die Wiege menschlicher Zivilisation stand. Demmin ist tatsächlich von den „Strömen“ Peene, Trebel und Tollense umgeben; einst mögen sie feindlichen Übergriffen wehrhaftes Hindernis und kleineren Handelsschiffen passierbare Wasserwege gewesen sein. In der Zeit der Hanse nutzten Generationen meiner Vorfahren sie, um durch Getreidehandel, den sie mit den Küstenstädten von Lübeck bis Stettin führten, zu einigem Wohlstand zu gelangen.
Meine Erinnerungen beginnen im „Tausendjährigen Reich“. Dem Zeitgeist folgend, benutzte mein Großvater immer seltener den Getreide-Speicher am Hafen, dafür aber das Magazin am Bahnhof, in dem - anstelle des einst umgeschlagenen Getreides - jetzt die Vorräte von Drogerie, Tankstelle und Fotoatelier zwischenlagerten.
Wo tankte man damals? Für gewöhnlich an der Drogerie, seinerzeit genügte den wenigen Fahrzeughaltern dieser spartanische Service. Unmittelbar an der Straße stand sie, die damals übliche Tanksäule. In Kopfhöhe befanden sich zwei Glaszylinder, die mittels einer Handpumpe abwechselnd mit je fünf Liter Benzin gefüllt, gemächlich ihren Inhalt über einen Schlauch in den Auto-Tank fließen ließen. Eine aus heutiger Sicht umständliche Prozedur, die viel Geduld erforderte. Offenbar eine Tugend, die sich wohlhabende Autobesitzer leisten konnten, denen die heutige Hektik fremd blieb.
Derzeitige Drogerie-Märkte lassen die Fotos ihrer Kundschaft von Spezialfirmen entwickeln; unsere Drogerie wartete mit eigenem Fotoatelier auf, das die Bildbearbeitung nach modernsten Finessen damaliger Technik ermöglichte. Das motivierte meine Mutter, jedes nur halbwegs geeignete Motiv in ansprechende Fotos zu verwandeln, die in zahlreichen Alben archiviert, mir bleibende Erinnerungen an meine Kindheit und deren Umfeld sind.
Als Vierjähriger „half“ ich eifrig den bis zu zwölf Angestellten meines Großvaters; gern ließen sie mich gewähren, wenn ich Seifenstücke zu riesigen Reklamepyramiden auftürmte. Anfangs auf den Verkaufstischen, später sogar im Schaufenster, wobei mir eingeschärft wurde, die hereinschauenden Kunden nicht anzusehen, damit diese sich beim Begutachten der Auslagen ungestört fühlen – meine erste Lektion in Verkaufsstrategie.
Natürlich durfte ich naschen so viel ich wollte. Es gab fingerdicke Lakritzstangen, Süßholz, Salmiakpastillen, Bonbons gegen Husten und Heiserkeit, kurzum vieles was süß schmeckte. Letzteres traf auch für den Dextrinleim zu, den man eigentlich zum Tapezieren benutzte, der mir aber trotz dieser Zweckbestimmung ausgezeichnet mundete, weil seine Bestandteile auf Kohlehydraten basieren, also ebenfalls süß schmeckten. Das Leimessen gefiel meinem Großvater gar nicht, er hielt mich fortan mehr unter Kontrolle. Es wäre doch entsetzlich, sollte er sein bis dahin einziges Enkelkind wegen eines unrettbar verklebten Magens verlieren. Dass ich steinharten Hundekuchen ebenfalls mit Vorliebe knabberte, toleriert er; Großvater kannte deren Inhaltsstoffe: BSE-übertragende Tiermehle gab es zu jener Zeit noch nicht!
Mein Großvater blieb mir so dauerhaft in Erinnerung, weil er nach dem Tode meines Vaters, mir diesen zu ersetzen suchte. Überdies sah er in mir den ersehnten Stammhalter; was erklärt, dass er sich zum Leidwesen meiner Schwester und meiner Cousinen vorwiegend mit mir beschäftigte.
Für die „Kommissköppe“ der kaiserlichen Armee schien ein Drogist Sinnbild für Sanitätsartikel zu sein, folgerichtig landete mein Großvater bei seiner Einberufung in einer Sanitätskompanie. Als Sanitäter brauchte er nicht mit der Waffe in der Hand zu kämpfen; oberflächlich betrachtet ein Vorteil, musste er sich doch nicht am sinnlosen Morden beteiligen, sondern sammelte stattdessen „nur“ Verwundete ein, ihnen erste medizinische Hilfe leistend. Selbst wenn im Ersten Weltkrieg noch einige „Spielregeln“ der Haager Landkriegsordnung eingehalten wurden, mein Großvater sah im Umgang mit den Verwundeten wohl mehr Leid, als ein Mensch ertragen kann – gewiss später sein Beweggrund, keinen Gefallen an den händelsüchtigen Nazis zu finden.
Nie sah ich den „Deutschen Gruß“ bei meinem Großvater, dieses
„Heil Hitler“, mit dem das Volk dem Führer seine Ehrerbietung erweisen musste. Als alteingesessener Bürger meinte er, sich diese Unterwürfigkeit weitgehend verkneifen zu können. In der Schule, dieser Erziehungsanstalt der jeweiligen Macht, hämmerte man uns ABC-Schützen ein, künftig genannten Gruß zu verwenden. Großvater, mir sonst Vorbild und Lehrer in allen Dingen, beobachtete mit innerem Vergnügen, wie ich grüßend entweder den linken oder den rechten Arm hob, weil ich rechts von links noch nicht zu unterscheiden gelernt hatte. Er dachte überhaupt nicht daran, meinen obrigkeitswidrigen Lapsus zu korrigieren, ließ mich, vertrauend auf die entschuldbare kindliche Naivität seines Enkels, das entwürdigende Ritual verarschen.
Rechts von links zu unterscheiden begriff ich erst, als mein Großvater mir beibrachte, wie es für einen Drogisten üblich ist, Arzneimittel anzurühren, nämlich entgegen dem Uhrzeigersinn, von rechts nach links, immer dem Herzen zu. Oder später als Jugendlicher, wenn mein Großvater mit mir politisierte und, obwohl bürgerlich konservativ, mich lehrte, auch die Sorgen und Nöte der Arbeitenden zu verstehen.
Menschen mit einem „Davidsstern“ an der Kleidung oder einer Armbinde mit der Aufschrift „Jude“ brachten meinen humanistisch gesinnten Großvater in Erklärungsnot. Wie sollte er seinem Enkel bedeuten, in diesen Menschen nichts Böses zu sehen, ohne zu riskieren, dass ich diese Meinung an unrechter Stelle verlautbare? Er, der mir sonst alles erklärte, der – wenn nötig – dafür in sein großes Bücherregal griff, einen Band des „Brockhaus“ aufschlug und anhand von Abbildungen oder verständlichen Texten meine Neugierde befriedigte, blieb mir damals eine einleuchtende Erklärung schuldig, meinte ausweichend, das könne er mir nicht erklären!
Zu den erfreulichen Erfahrungen, die mein Großvater als Ulan sammelte, gehörte der Umgang mit Pferden. Die Ausbildung zum reitenden Sanitäter mag das Einzige gewesen sein, was er am Militärdienst billigte. Die Demminer Ulanengarnison, obwohl militärisch längst antiquiert, blieb noch Jahre nach dem Ersten Weltkrieg bestehen; dies erlaubte dem ehemaligen Ulan und seinem pferdenärrischen Enkel, die Einrichtung jederzeit zu besuchen. Als Kleinkind durfte ich die Pferde bloß anschauen, füttern und streicheln, als Sechsjähriger ritt ich bereits mit Großvater aus; stolz saß ich vor ihm auf dem Rücken des Pferdes, wenn wir gemächlich durch die „Tannen“, unserem Lieblingswald, trabten. Nach gemeinsamem Ausritt saß ich sogar allein auf dem Pferd, derweil es zum Abschwitzen in der Reithalle herumgeführt wurde.
War mir danach, „fuhr“ ich auf unserem Grundstück das Auto meiner Eltern. Völlig der Illusion des Fahrens ergeben, nahm ich überhaupt nicht wahr, dass einige Angestellte schiebend den Motor ersetzten, damit der verwöhnte Bengel des Chefs seinen Willen bekam.
Bei schlechtem Wetter spielte ich im Büro meines Großvaters, der sich dort, hatte er nicht geschäftlich zu tun, in seine Lektüre vertiefte oder sich mit mir beschäftigte. Einmal brachte ich meinen Freund, den Sohn des Oberpostdirektors, mit. Im Eifer des Spiels wollte dieser meinem Großvater den neuesten „Verteidigungsgriff“ zeigen, den er den Hitlerjungen abgesehen hatte, wobei er mich als Objekt seiner Vorführung benutzte. Ehe ich mich versah, hatte er mich von den Beinen gerissen, wodurch ich unglücklicherweise mit dem Kopf gegen die Ofentür fiel, was zu einer größeren Platzwunde führte. Während mein Großvater die Wunde fachmännisch behandelte, tolerierte er bewusst das Ungeschick meines Freundes, nicht ihm schien er den Frevel anzulasten, sondern denen, die unschuldigen Kindern solches beibrachten.
Solange es sein kurzes Leben zuließ, beschäftigte sich mein leiblicher Vater mit mir. Geboren in einer Fischerfamilie, die in Kolberg (Kolobrzek) zu Hause war, hatte er die Metallbearbeitung als Dreher erlernt. Wie viele seiner Altersgenossen blieb er nach der Lehre arbeitslos und damit ein willkommener Kandidat für die heimliche Reserve des deutschen Heers, das durch den Versailler Vertrag ursprünglich auf Hunderttausend begrenzt war und über keine schweren Waffen, U-Booten sowie Luftwaffe verfügen durfte. Unkontrollierbar für die Entente-Mächte, stockten revanchelüsterne Kräfte diese „Reserve“ durch verschleierte Ausbildungsformen zu mehreren Hunderttausend auf.
Der Form halber besuchte mein Vater eine Sportschule; ein dies „beweisendes“ Foto zeigt ihn inmitten seiner Kameraden im Outfit eines Boxers. Tatsächlich bildete man die „Sportstudenten“ insgeheim zu Piloten einer künftigen Luftwaffe aus. Die Piloten waren für Eingeweihte nur an einem kleinen Abzeichen erkennbar, das den „Duce“ zeigte, wie Hitlers italienischer Partner sich als „Führer“ nennen ließ.
Beim illegalen Einsatz im Spanienkrieg „durften“ die jungen Offiziere der „Legion Condor“ mit ihren Heinkel-He-51 sowie mit den Bombern Dornier-Do-17 und der Junkers-Ju-52/3m ihre ersten Kriegserfahrungen sammeln, bevor sie später, im Zuge des Expansionsstreben Hitlers und seiner Gönner aus der Industrie, verheizt wurden.
Als man meinte, gegen England militärische Stärke mittels Bombenterror demonstrieren zu müssen („Luftschlacht gegen England“), flog mein Vater einen Bomber, mit dem er im Spätsommer 1941 beim Anflug auf London über dem Dover-Kanal abgeschossen wurde. Vermutlich hatten die englischen Abfangjäger leichtes Spiel mit seiner JU 88, der wegen Treibstoffmangels (oder Zugunsten der Vorbereitung auf das „Unternehmen Barbarossa“?) ein strategisch wirkungsvoller Begleitschutz durch Jagdflugzeuge versagt blieb. (Von 1576 Bombern der deutschen Luftwaffe gingen bei diesem sinnlosen Unternehmen 1014 verloren.) – Dieser entsetzliche Krieg nahm mir den Vater, hinterließ nur wenige Erinnerungen an ihn.
Ein Kind im Alter von vier Jahren behält offenbar nur Erlebnisse im Gedächtnis, die es besonders beeindruckten: Manchmal nahm mich meine Mutter mit, wenn sie meinen Vater auf dem Flugplatz besuchte, der sich nur 15 Kilometer von Demmin in Tutow befand, was ich aber aus Gründen der Geheimhaltung nicht wissen durfte. Dieser Flugplatz, dessen Landebahnen mit den Abbildern von Häusern und Gartenanlagen getarnt war, diente später als geheimer Stützpunkt für Abfangjäger, deren Aufgabe darin bestand, die Raketenschmiede Peenemünde vor feindlichen Luftangriffen zu schützen. Eben wegen dieser strategisch wichtigen Geheimhaltung hatten meine Eltern mir eingeschärft, bei unserem Besuch befänden wir uns in Frankreich, was für mich umso glaubhafter war, weil das schmackhafte Weißbrot, das ich auf dem Flugplatz zu essen bekam, mir bis dahin in Deutschland unbekannt war. – Offenbar blieb dieser Flugplatz während des ganzen Krieges unentdeckt! Anwohner berichteten später, die gegen Kriegsende anrückenden Rotarmisten seien überrascht gewesen, als einige noch intakte Abfangjäger kurz vor ihnen aufflogen.
Als wohlerzogenes Kind eines Offiziers der Luftwaffe war es mir nicht erlaubt, mit „Straßenkindern“ zu spielen, wie meine Mutter den Nachwuchs von Herrn Stein bezeichnete, der sich „nur“ als Maurer verdingte und dessen Kinder „Kraftausdrücke“ gebrauchten, die nicht zu meinem Wortschatz gehören sollten. Aber was soll´s, trotz dieses Verbotes spielte ich zu gerne mit meinem Freund Heini und dessen jüngeren Bruder. Heimlich kletterte ich während des von Muttern angeordneten Mittagsschlafs aus dem Fenster des Kinderzimmers, freudig erwartet von meinen Spielkameraden, die das beneidenswerte Privileg besaßen, mittags nicht schlafen zu müssen.
Nach unerlaubtem Spiel rechtzeitig zum „Mittagsschlaf“ zurückgekehrt, verrieten meine schmutzigen Füße, wo ich mich barfuß herumgetrieben hatte. Als ich dann noch eifrig erzählte, dass Heini Stein ein schlechtes Wort gesagt hätte, war das Maß voll. Auf Geheiß meiner Mutter stellte mich mein eben vom Flugplatz zurückkehrender Vater zur Rede. Wie ich zuvor meiner Mutter berichtete, sagte ich auf Vaters Frage, „Was hast Du gesagt?“ völlig arglos, „Scheiße!“, denn so und nicht anders lautete das schlimme Wort. Eine schallende Ohrfeige kam als Antwort. Erneute Frage meines Vaters, „Was hast Du gesagt?“, von mir wieder wahrheitsgemäß, „Scheiße!“, erneut eine Ohrfeige.
Mein Vater mochte ein lieber Mensch gewesen sein, aber pädagogisch schien er total überfordert. Seine immer gleiche Fragestellung: „Was hast Du gesagt?“ Ließ nur mein treuherziges „Scheiße!“ zu und brachte weiteren Verdruss. Deshalb blieb mir dieser Vorfall mehr im Gedächtnis, als die vielen schönen Dinge, die ich mit meinem Vater erlebte, längst Vergessenes, an das mich meine Mutter anhand zahlreicher Fotos erinnerte.
Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester, meiner Patentante, war meine Mutter in ihrer Kindheit ein bewegungshungriges „Springinsfeld“. Meine Großeltern zogen ihr vorzugsweise auffällige Kleidung an, damit sie ihre Tochter besser orten konnten, wenn diese mit anderen Kindern in der Umgebung Demmins herumstromerte. Trug sie beispielsweise einen roten Pullover, brauchte mein Großvater nur auf das Dach unseres alles überragenden Hauses zu steigen, um auf den Wiesen des umliegenden Urstromtales nach seiner auffällig gekleideten Tochter Ausschau zu halten.
Als Teenager zählte meine Mutter zu den „sportverrückten“ Mädels der Stadt, reitend, schwimmend und radelnd erkundete sie die schöne Umgebung Demmins. Sie, die „blonde Germanin“, zeitgemäß wegen ihrer wasserstoffblonden Haare so genannt, war mir und meiner Schwester eine treu sorgende Mutter.
Als ihr im Mai 1937 geborener Sohn höre ich sie immer wieder betonen, dass ich ein Friedenskind sei und, weshalb es meiner drei Jahre jüngeren Schwester nicht mehr vergönnt war, zum Essen noch Bananen zu bekommen. Dass mit den Bananen schien mir einleuchtend, doch glaube ich heute, die Betonung lag auf „Friedenskind“, es erinnerte meine Mutter an die zwar kurze aber dafür wohl schönste Zeit ihres Lebens an der Seite meines Vaters.
Sicherlich fiel es ihr damals schwer, ihren Kummer wegen des vorzeitigen Todes unseres Vaters zu verbergen, ein so trauriges Ereignis, das wir Kleinkinder wohl kaum verstanden hätten. Welch ungeheuren Schmerz sie in ihrem Inneren verbarg, entdecke ich zufällig anhand eines Porträts, versteckt hinterm Kachelofen. Es zeigte unseren Vater lebensgroß, dargestellt nach einer Fotografie von einem begabten Künstler; unbemerkt von meiner Schwester Sigune und mir trauerte unsere Mutter vor diesem Bild. Als ich, um ihr eine Freude zu bereiten, einmal „Rohrbomben“, die auffälligen Fruchtträger des Schilfs, mit nach Haus brachte, schienen diese ihr überhaupt nicht zu gefallen. Wie sie mir später erklärte, hätte sie eben diese Rohrkolben, ohne ein Unheil zu ahnen, am Todestag meines Vaters gepflückt. Abergläubisch wie sie war, mochte sie seitdem „Rohrbomben“ nicht mehr.
Als amtlichen Trost bekam unsere Mutter außer dem üblichen Schreiben, das sie zur „Heldenwitwe“ eines Luftwaffenoffiziers erklärte, eine ausreichende Rente, die es ihr ermöglichte, völlig für uns da zu sein. Gemäß der Ideologie des Nationalsozialismus hätte sie uns zu Nachwuchshelden erziehen sollen.
Wir lebten zu dieser Zeit in der Stadt Neubrandenburg, auf deren Flugplatz mein Vater zuletzt stationiert war. Hinter unserem Einfamilienhaus befand sich ein großer Garten, in dem unsere Mutter, als bewusste Naturköstlerin auf reichlichen Vitaminverzehr bedacht, allerlei Obst und Gemüse anbaute. Zum Umgraben des Gartens bekamen wir zeitweise einen Polen aus dem nahe gelegenem Gefangenenlager. „Anton“, wie alle Polen der Bequemlichkeit halber genannt wurden, hatte andauernd Hunger, erbat darum „Süßstoff“; offenbar der Meinung, mit diesem chemischen Süßungsmittel seinen Bedarf an lebensnotwendigen Kohlehydraten stillen zu können. Als studierte Drogistin wusste unsere Mutter es jedoch besser. Durch meinen Großvater zur Menschlichkeit erzogen und verbittert durch den sinnlosen Tod meines Vaters, spürte sie das Unrecht, das wir Deutschen anderen Völkern antaten: Ohne Skrupel steckte sie „Anton“ heimlich anstelle von Süßstoff richtige Lebensmittel zu, wobei sie uns einschärfte, davon um Himmels willen niemand etwas zu verraten!
Die ebenfalls dienstverpflichteten polnischen Frauen nannten wir „Franchen“, weil sie jene für uns ungewohnten Kopftücher trugen, die an den Rändern mit Fransen verziert waren. Ich, nun nicht mehr der kleine, Fragen stellende Bub, der Großvater mit der Frage nach diskriminierten Menschen in Verlegenheit brachte, ging diesen Menschen „pflichtschuldig“ aus dem Weg, während die Menschen mit dem „Davidsstern“ schon lange nicht mehr auf den Straßen zu sehen waren. Ich denke, meine um drei Jahre jüngere Schwester bekam diese und andere Ungerechtigkeiten des damaligen Regimes noch nicht bewusst mit. – Ihr gegenüber besaß ich zwar den Vorzug, als Baby Bananen bekommen zu haben, dafür blieb ihr aber manches erspart, was mich für die Zukunft prägen, meinen bereits vom Großvater vorgelebten Gerechtigkeitssinn verstärken sollte: Einem Hang zur Gerechtigkeit, der mir das Dasein in einer ungerechten Welt zeitlebens erschweren sollte.
Im Sommer fuhren wir bei schönem Wetter an den Tollensesee. Ich hinten auf dem Gepäckträger, in dessen Packtaschen sich alles für die Ausfahrt Nötige befand, Sigune im Körbchen am Lenker, so radelte unsere Mutter mit uns zu einer geheimen Badestelle. Der Picknickkorb enthielt für die Hauptmahlzeit vorzugsweise Kartoffelsalat, was mich glauben lässt, meine junge Mutter war keine besonders gute Köchin. Zur Abwechslung gab es dazu viel Obst und Gemüse, weil eine gesunde Ernährungsweise sowie sportliche Betätigung seit je her zur Lebensweise unserer Familie gehörte, was uns Kinder nachhaltig beeinflusste.
Beim Umherstreifen am See entdeckte ich einen „riesigen Drachen“, gemäß meiner Einbildungskraft mochte er der „Jung Siegfried Sage“ entsprungen sein. Aufgeregt lief ich Mutter und Sigune holen. Als wir gemeinsam meinen „Drachen“ suchten, war dieser bereits verschwunden. – Erstaunlich, wie die Fantasie und der Blickwinkel des Kindes einen harmlosen Feuersalamander zum Drachen verwandelt.
Manchmal kam mein Großvater aus dem fünfzig Kilometer entfernten Demmin zu Besuch. Mit dem Fahrrad fuhren wir in den Wald, um in einer blechernen Milchkanne Beeren zu sammeln, wozu ich naschsüchtiger Bub nur wenig beitrug. Während der Heimfahrt passierte es, an einer unwegsamen Stelle kippte Großvater samt mir und den Blaubeeren vom Fahrrad. Erstaunt musste er feststellen, was für hässliche Schimpfwörter sein Enkel im Umgang mit dem „Straßenjungen“ Heini Stein gelernt hatte.
Wie andere Kinder meines Alters sollte ich eigentlich einen Kindergarten besuchen. Erstmals versuchte es meine Mutter in Demmin, mich in einen solchen einzuführen. Jedoch, das schien wohl der falsche Ort, in Demmin ging ich lieber mit Opa zum Reiten, „half“ in der Drogerie oder Oma beim Kuchenbacken.
Oma backte in der kleinen Küche hinter der Tabakhandlung, die sie zur Zeit des Krieges aushilfsweise führte. Zuerst rührte sie Zucker in zerlassene Butter – kam ein Kunde, durfte ich weiterrühren, was natürlich nicht ohne Probieren abging. Mit den Eiern, die Oma als nächstes zufügte, schmeckte die Vorstufe des Rührkuchens bereits besser, wie ich beim nächsten Kunden feststellte. Der Zusatz von Milch und Backpulver beeinträchtigte den köstlichen Geschmack, erst als Mehl das bisherige Gemisch zum Teig verwandelte, fand ich erneut Gefallen am Naschen, ermöglicht durch wiederholten Kundenbesuch. – Bei jedem Rührkuchen, die Oma mit meiner Hilfe backte, wunderte sie sich, wieso dieser so klietschig, trocken oder wenig locker ausfiel. Eigentlich hing das davon ab, von welchen der Zutaten, die sie jeweils nach Rezept bemaß, ich wie viel vernascht hatte.
Um auf den Kindergartenbesuch zurückzukommen. Dort feierte man gerade ein Fest, was meine Mutter für günstig hielt, um ihren verhätschelten Sohn komplikationslos einzugliedern. Wie erwartet, ließ ich mich von all dem Neuen gefangen nehmen, doch als es mich nach einiger Zeit langweilte, ich zudem meine Mutter vermisste, machte ich mich mutterseelenallein auf den Weg nach Hause.
Einen zweiten Versuch startete meine Mutter in Neubrandenburg. Im dortigen Kindergarten gefiel mir, der ich so oft mit Großvater ausritt, ein Schaukelpferd, das in Statur und Größe fast einem richtigen Pferd entsprach. Während ich völlig hingerissen schaukelte, stahl sich meine Mutter unbemerkt davon. Zu Hause angekommen, staunte sie, denn ich befand mich bereits dort. – Für den schnelleren Nachhauseweg hatte ich den kürzeren Weg über die gefährlichen Gleise des Bahnhofs gewählt, war ihr gegenüber also im Vorteil.
Muttern gab es auf, mich mit weiteren Kindergärten anfreunden zu wollen, mein jeweils eigenmächtiges Heimkehren erschien ihr doch zu gefährlich: Damit hatte ich mich bereits als kleiner Bub gegen eine Erziehungsform durchgesetzt, die mir in meinem späteren Leben für die komplikationslosere Eingliederung in ein Kollektiv dienlich hätte sein können.
Fortan durfte ich ungehemmt mit den „Straßenkindern“ spielen, was unter den Umständen der allgegenwärtigen Kriegshysterie den „Ellenbogen“ geradezu herausforderte. Zeitgemäße Kriegsspiele verdrängten arglose Kinderspiele; als Straßenbande gegen Straßenbande spielten wir nur noch Krieg. Das blieb harmlos, solange wir uns quer über unsere Straße hohe Schutzwälle aus Schnee bauten und durch diese geschützt, dem gegnerischen „Kugelhagel“, den wir mit Schneebällen nachempfanden, heldenhaft widerstanden.
Gefährlicher wurde es in der schneefreien Zeit, in ihr „schossen“ wir aus Mangel an Schneebällen mit Glühbirnen, die wir in einer zerbombten Lagerhalle fanden. Die Birnen zerplatzten beim Aufprall mit lautem Knall, ihre Glassplitter „zischten“ wie die Splitter von Granaten durch die Gegend, vorerst unsere Vorstellung von einem realistischen Kriegseinsatz befriedigend.
Als das nicht mehr den erstrebten Kick brachte, klauten wir das zur Befeuerung der Bahn-Signale benutzte Karbid, steckten es blitzschnell in eine wassergefüllte Bierflasche und warfen diese, ähnlich unseren Vorbildern, den Granaten werfenden Soldaten, auf den „Feind“. Der Druck des Acetylens ließ die Flasche in scharfe Glassplitter bersten, die wie kleine Geschosse durch die Gegend zischten. Ein wahres Wunder, dass sich bei dieser verrohten Spielform niemand verletzte. Solche, dem Zeitgeist geschuldeten Spiele, sah die damalige „Obrigkeit“ gern, wohl in der Hoffnung, uns gut eingestimmt beim „Endsieg“ verheizen zu können. Mein Glück, ich war noch zu jung, um als „Kanonenfutter“ unserem „Führer“ das Leben zu verlängern: Oder blieb mir dies Los durch die Weitsicht meiner Mutter erspart?
Kindheitstraum
Oftmals bestimmen Erlebnisse frühester Kindheit den späteren Berufswunsch. Unter dem Einfluss meines Großvaters und nach dem Flugzeugabsturz meines Vaters verlor ich das Interesse an unseren Kriegsspielen, nicht mal Flugzeugführer – mein vordem favorisierter Kinderwunsch – wollte ich werden.
Zeitweilig hatte ich, wie wohl die meisten Jungen meines Alters, den Wunsch, als Lockführer den Zug zu fahren, der uns an den Wochenenden zu meinen Großeltern brachte. Jede Station der fünfzig Kilometer langen Eisenbahnstrecke konnte ich, ähnlich dem Stationsvorsteher, namentlich ausrufen. Noch beeindruckender die riesige Dampflok, derentwegen meine Mutter mit mir immer vorzeitig auf dem Bahnsteig sein musste, damit ich das stählerne Ungeheuer vor der Abfahrt bewundern konnte.
Wie viele meiner Altersgenossen besaß ich eine funktionstüchtige Spielzeugdampfmaschine, deren mit Brennspiritus beheizter Kessel den energieliefernden Dampf erzeugte. Dieser setzte über eine ausgeklügelte Ventilsteuerung den Kolben in Bewegung und ließ vermittels einer Pleuelstange das Schwungrad kreisen, mit dem über einen Riemenantrieb kleinere Maschinen angetrieben werden konnten. Größer geworden, baute ich mit Unterstützung meines Großvaters aus einem Stabil-Baukasten ein Fahrgestell für die Dampfmaschine, deren eigenständige Fortbewegung mir spielerisch den Traum vom Lockführer erfüllte.
Bei mir kippte ein anderer, offensichtlich stärkerer Eindruck den vormals favorisierten Traumberuf. Soweit ich mich erinnere, geschah dies in meinem sechsten Lebensjahr. Es gab damals noch nicht die Angst vor Kindesmissbrauch oder Kidnapping, darum durfte ich als Schüler der ersten Klasse noch ohne schützende Begleitung zur Schule gehen. Dabei überquerte ich für gewöhnlich einen freien Platz, auf dem sonnabends Markttag und einmal im Jahr Kirmes war. Diesmal versperrte mir ein bunter Zaun den Weg, hinter dem zahlreiche Zirkuswagen dicht gedrängt um ein riesiges Zelt standen. Des nachts hatte ein Zirkus aufgebaut. Laute, mir teilweise unbekannte Tierstimmen steigerten meine Neugierde.
Am liebsten wäre ich über den niedrigen Zaun geklettert, woran mich jedoch meine Erziehung hinderte, die da hieß: „Mein 1941 über dem Doverkanal abgeschossener Vater sieht vom Himmel alles Unrechte, das ich tue.“ – Dies schärfte mir meine Mutter mit Nachdruck ein. Heute stelle ich fest, dass die Vorstellung, mein Vater könne vom Himmel jeden meiner Schritte beobachten, mich zu jener Zeit mehr beeindruckte, als dies ein anonymer Gott jemals vermocht hätte; ein Gott, der im „Tausendjährigen Reich“ sowieso kaum Stellenwert besaß. Als Halbwüchsiger modifizierte ich diese Vorstellung später in meinem Sinne; fortan bildete ich mir ein, meine jeweilige Freundin könne mein Tun beobachten.
Wollte ich in den Augen meines vom Himmel herabschauenden Vaters nichts Unrechtes tun, dann musste ich einen erlaubten Einlass in das geheimnisvolle Reich des Zirkus finden. Der Umweg, zu dem mich der Zirkuszaun zwang, führte mich zu einem prachtvoll geschmückten Wagen, der in zwei großen Schaukästen zahlreiche Fotos artistischer Darbietungen sowie mannigfaltiger Tiernummern präsentierte und erahnen ließ, welch interessantes Programm dem Publikum bevorsteht. In der Mitte des Wagens sah ich den Eingang, daneben ein geöffnetes Fenster über dem sich die Aufschrift KASSE befand; letzteres machte mir Abc-Schützen keinen Sinn, weshalb ich ohne Arg den geöffneten Einlass passieren wollte. Daran hinderte mich eine energische Stimme, sie gehörte der stattlichen Dame an der Kasse, die ich wohl bemerkt, aber in meiner Naivität nicht für die Gebieterin über den Einlass hielt.
„Wenn Du zur Tierschau möchtest, musst Du bei mir bezahlen!“, kam es freundlich aber bestimmt. Konnte die Dame sich nicht vorstellen, dass ein Schulkind in dieser Zeit normalerweise keinen Pfennig in der Tasche hatte? − Stünde statt meiner der dicke Gerhard hier, sähe das anders aus. Gerhard, der in Zeiten strenger Lebensmittelrationierung wohlbeleibte Bäckerjunge, der ständig über ein ausreichendes Taschengeld verfügte, durfte nur dann mit uns spielen, wenn er uns mit Kuchen, später genügten sogar schon Brötchen, versorgte.
Zaghaft trat ich an das Schalterfenster, hinter dem die Herrin über „Einlass oder nicht“ thronte, „Was könnte ich Ihnen anbieten, ich habe kein Geld für die Tierschau, möchte aber unbedingt hinein?“ Wahrscheinlich imponierte der „Zirkuskönigin“ mein höfliches Auftreten oder, so mein kindlicher Glaube, besaß sie vielleicht ebenfalls Kinder meines Alters? Aufmerksam taxierte sie meine Habseligkeiten, die aus dem Schulranzen nebst Brottasche bestanden. Schließlich erfasste ihr Blick den Schwamm, der an einer Schnur aus dem Ranzen baumelte. Mit ihm säuberte ich im Unterricht meine Schiefertafel, jetzt aber schien die Dame eine andere Verwendung für den Schwamm gefunden zu haben. „Gib mir deinen Schwamm, mit ihm kann ich mir beim Geldzählen die Finger anfeuchten!“ Leichtfertig trennte ich mich von dem wertvollen Stück; für den Besuch der Tierschau hätte ich alles gegeben.
Jetzt, nachdem mir der Eintritt offiziell erlaubt war, ging ich stolz durch den imposanten Zirkuseingang, der mit seinen farbenprächtig gestalteten Zirkusmotiven mein kindliches Gemüt auf diese geheimnisvolle Welt einstimmte. Aus einem hohen Stallzelt kamen Töne, die von übenden Trompetern stammen konnten. Jedoch anstelle von Musikanten empfingen mich sechs riesige Elefanten, die mich fröhlich trompetend anschauten. Bisher sah ich Ihresgleichen nur im Film „Zirkus Renz“, in dem waghalsige Artisten mittels eines Sprungbrettes die gigantischen Tiere übersprangen.
Diese Elefanten schienen weniger erstaunt über meinen Besuch, ihre Neugierde galt etwas Fressbarem, wie sie es mit bettelnd vorgestrecktem Rüssel andeuteten. Wer kann es mir verdenken, sorgfältig teilte ich meinen für die damalige Zeit wertvollsten Schatz, mein Frühstücksbrot, mit ihnen. Brach es in sechs möglichst gleiche Bissen und reichte jedem sein Teil. Erstaunlich, wie vorsichtig sie mit ihrem weichen Rüssel das Leckerli entgegennahmen und es mit gekonntem Rüsselschwung in ihrem großen Maul verschwinden ließen.
Mit nunmehr leeren Händen gelangte ich ins nächste Stallzelt, konnte aber nichts Fressbares mehr vorweisen, was mir die bettelnden Ponys offensichtlich übelnahmen; ihr bei meinem Eintreten gezeigtes Interesse wich zugunsten üblicher Beschäftigung. Manche stritten sich, wobei sie ihren Gegner bissen oder ihn mit den Hufen auskeilend abwehrten. Andere standen sich Kopf über Hals gegenüber und bearbeiteten, einander wohltuend, den Hals des Partners mit den Zähnen.
Ein verdächtig freundlicher Stallarbeiter fragte: „Na Kleiner, möchtest Du die Ponys füttern?“ Was ich gar nicht schnell genug bejahen konnte. Mit einer Forke versehen, holte ich frisches Heu von einem Ballen und warf es in das Gatter der Ponys. Danach durfte ich mit einem Schlauch den Trog mit Wasser füllen und glaubte nun, ein perfekter Stallarbeiter zu sein. Wozu allerdings noch das sehr zeitaufwendige Striegeln der Ponys und das Ausmisten gehörte, was mir der listige Stallbursche sicher nicht verwehrt hätte; doch laute Stimmen im Zirkuszelt schienen mir interessanter. Ich schlich also durch den Sattelgang in diesen geheimnisvollen Teil des Zirkus.
Von den Probierenden unbemerkt, setzte ich mich still auf einen der Logenstühle. Jetzt wurde es erst richtig interessant. Überall in der Manege übten fleißige Artisten; erst nach längerem Hinschauen bemerkte ich, was jeder so eifrig probierte. Ein Jongleur versuchte mal mehr, mal weniger erfolgreich, drei Bälle zu jonglieren. Gleich daneben ein Mädchen, das es ihm mit den Füßen gleichtat, nur dass sie dazu auf dem Rücken lag und einen sehr großen Ball spielerisch bewegte. Nicht weit von ihr ließ ein großer, kräftiger Mann ein graziles Mädchen auf seinem Kopf einen Handstand probieren, wobei er sie ständig ermahnte, sie solle „Fest bleiben!“, damit er sie besser balancieren könne. Über allen, gegen das Herabfallen mit einer Longe gesichert, übte ein anderes Mädchen schwierige Passagen am Trapez.
Ich wusste gar nicht, wohin ich zuerst schauen sollte, als eine mir nur allzu wohlbekannte Stimme mich aus andächtigem Staunen riss: „Wolf, was machst du hier?“ – Die ärgerliche Frage meiner empörten Mutter riss mich aus meinen Träumen. – Ich hatte nicht nur die Schule geschwänzt, sondern ihr dazu noch Kummer bereitet, weil ich nicht zur gewohnten Zeit nach Hause kam.
Nach diesem Erlebnis stand für mich fest, später werde ich ein berühmter Artist. Unbewusst bestärkte meine Mutter diesen Wunschtraum, war sie doch so lieb, mit mir die abendliche Zirkusvorstellung zu besuchen.
Flucht nach „Westen“
Hitlers Durchhaltebefehl für die Soldaten der Ostfront versetzte die Zivilbevölkerung in Angst und Schrecken:
„Zum letzten Mal ist der jüdisch-bolschewistische Todfeind mit seinen Massen zum Angriff angetreten. Er versucht, Deutschland zu zertrümmern und unser Volk auszurotten. Ihr Soldaten aus dem Osten wisst zu einem hohen Teil heute bereits selbst, welches Schicksal vor allem den deutschen Frauen, Mädchen und Kindern droht. Während die alten Männer und Kinder ermordet werden, werden Frauen und Mädchen zu Kasernenhuren erniedrigt. Der Rest marschiert nach Sibirien.“
Solche und ähnliche Parolen versetzten unsere Mutter in Angst und Schrecken; als ehemalige BDM-Maid und spätere Offizierswitwe, die mit ihren Kindern nahe dem Flugplatz in einer Offizierssiedlung lebte, fürchtete sie, der Rachsucht der Angreifer besonders ausgesetzt zu sein. Andauernd erlebten wir heftige Luftangriffe, erfuhren demoralisierende Hiobsbotschaften von der Front und sahen Flüchtlinge gen Westen strömen. Meine Mutter hielt es darum für sinnvoller, ebenfalls mit uns zu fliehen; immerhin gehörte Neubrandenburg wie Demmin mit zu den ersten deutschen Städten, die jene von der faschistischen Propaganda verteufelten Russen erobern würden. Das Nötigste in Koffer und Rucksäcke gepackt, Sigune und mich mit zusätzlicher Reserve an Wäsche bekleidet, flüchteten wir per Bahn über Leipzig gen „Westen“. Beim Umsteigen in Leipzig gelangten wir mit Müh und Not in den total überfüllten Zug, der wegen eines Luftangriffs überhastet abfuhr. Einen Teil unseres Gepäcks mussten wir in der Hektik auf dem Bahnsteig zurücklassen, nur mit dem Nötigsten versehen, erreichten wir das Bayrische.
Unser Ziel nannte sich „Groß Armschlag“, der inmitten dichten Waldes eingebettete Weiler bestand aus einem Sägewerk weit oben am Berg, einem verlassenen Gehöft in Bergesmitte sowie einer Wassermühle im Tal. Jahrzehnte später suchte ich vergebens dieses „Groß Armschlag“ auf allen möglichen Landkarten. Nur Sigune konnte sich erinnern, dass der abgeschiedene Ort sich symbolisch so nannte, weil man sich zum Aussteigen beim Lockführer mit einem Armschlag aus dem Abteilfenster bemerkbar machen musste.
Das Sägewerk gehörte zwei Kameraden aus der Bomberbesatzung meines Vaters, ihre Frauen nahmen uns Flüchtlinge bei sich auf. In diesem Teil Deutschlands wollten wir das Kriegsende in der Hoffnung abwarten, von den hier einrückenden Amerikanern mit weniger Vergeltungswut behandelt zu werden als durch die Russen, die weit mehr unter den Kriegsgräuel zu leiden hatten als die Amerikaner.
Bald nach unserer Ankunft versetzte das ferne Rattern von Panzerketten, unterbrochen von einzelnen Schüssen uns auch hier in Angst und Schrecken. Davon unbeeindruckt zeigte sich der kriegserfahrene Großvater meines Freundes; seinem üblichen Tagewerk nachgehend, wollte er auf der Alm nach den Kühen sehen, die er dort vor der Beschlagnahme durch die Nazis und jetzt vor den Amerikanern versteckt hielt. Wie gewohnt, begleiteten wir Jungen ihn.
„Nehmt eine weiße Fahne mit“ so die auf gewaltfreie Kapitulation bedachten Frauen. – Ein Hinweis, der für ein unmittelbares Zusammentreffen mit den Amerikanern gut sein mochte, aber bei einer Begegnung mit flüchtenden SS-Angehörigen oder unverbesserlichen Nazis lebensgefährlich sein konnte, weil diese eine Kapitulation der Zivilbevölkerung durch abschreckende Maßnahmen, zu denen Erschießen und Erhängen gehörte, hinauszögern wollten, um sich selbst in Sicherheit bringen zu können. – Verschmitzt deutete Opa auf die weißen Ränder unserer Unterhosen, die wir auf sein Geheiß aus den Krachledernen hervor lugen ließen. Dank Opas Ortskenntnis gelangten wir über nur ihm bekannte Pfade unbehelligt auf die Alm, von der wir die heranrückenden Amerikaner beobachten konnten.
Aus seinem Rucksack zauberte Opa ein größeres Fernglas hervor, das er gewiss nicht zum Zählen der Kühe mitgenommen hatte. Durch das Glas erkannten wir deutlich die Amerikaner, die auf der Höhe des gegenüberliegenden Berges behutsam mit ihren Panzern vorrückten. An einer Straßenbiegung hatten sich einige zum Endsieg aufgewiegelte Hitlerjungen verschanzt, nur mit Handfeuerwaffen ausgerüstet, sollten sie den Feind aufhalten. Einige Schüsse aus der Kanone des Führungspanzers brachten ihnen jenen „Heldentod“, den ihr Führer sich in Berlin feige versagte. Tage später kamen die ersten Amerikaner zum Baden an den Stausee des Sägewerkes. Uns Kindern schenkten sie Schokolade und machten in aller Freundschaft mit den Frauen das, wovor diese bei den „bösen“ Russen Angst hatten.
Um wie viel schrecklicher musste die Kapitulation Demmins für meinen Großvater gewesen sein. Für den „Volkssturm“, Hitlers letztes Aufgebot, schon zu alt, musste er Panzergräben ausheben, mit ansehen, wie deutsche Pioniere die stadteinwärts führenden Brücken mitsamt den darauf befindlichen russischen Panzern sprengten und Hitlerjungen, verschanzt im mittelalterlichen Luiesentor, Rotarmisten abknallten. Verständlich die Wut der russischen Soldaten, die alle Häuser, die als Widerstandsnester dienen konnten, zerstörten und mit Waffengewalt Großvater daran hinderten, sein vom Brand bedrohtes Anwesen zu löschen. Es sollte ein lebenslanger Schock für meinen Großvater sein, all seine Habe unrettbar verloren zu sehen.
Noch in Bayern besuchte ich eine Einklassenschule, in der nach Bankreihen gestaffelt, die einzelnen Schuljahre von nur einem Lehrer unterrichtet wurden. Am ersten Unterrichtstag grüßten wir, Schüler samt Lehrer, gewohnheitsgemäß mit „Heil Hitler“ – erschrocken bemerkte unser Lehrer, dass dies wohl nicht mehr zeitgemäß sei; fortan galt wieder das für die Region typische „Grüß Gott – Herr Lehrer!“, womit in dieser Schule die Vergangenheit bewältigt war! Gelernt habe ich in der bayrischen Einklassenschule, in der sich der Lehrer mit jeder Klassenstufe nur flüchtig beschäftigen konnte, sehr wenig. Dies offenbarte mein sich später anschließender Schulbesuch in der „Sowjetischen Besatzungszone“.
Für die Bayern waren wir „Saupreußen“, ein Schimpfwort, das aus der historischen Gegnerschaft Preußens und Bayerns herrührte. Ich war überdies anders erzogen als die Bauernjungen, mit denen ich befreundet war. Gemeinsam rissen wir beim Kirschenklauen aus, als der Bauer uns wutschnaubend dabei entdeckte. Für die bayrischen Jungs war das ein seit Generationen übliches Vergehen, selbst der Bauer ließ sich im Jungenalter nicht beim Kirschenklauen erwischen. Ich aber musste auf Geheiß meiner Mutter Abbitte tun, schließlich wurden wir Flüchtlinge im Ort nur geduldet. - Alles andere als wohl zu Mute, bat ich gesenkten Hauptes bei der Bauernfamilie um Verzeihung für meine Missetat. Über so viel Reue erstaunt, schenkte mir die Bäuerin eine riesige Scheibe Brot, dick beschmiert mit frischem Quark, der zudem zahlreiche Butterklumpen enthielt, einer kalorienreichen Aufwertung, die sich in dieser Zeit nur reiche Bauern leisten konnten. Stolz brachte ich den Lohn meiner Verfehlung mit nach Hause, um ihn mit Sigune und Muttern zu teilen. – Was lernte ich daraus: Im Nachkriegsbayern musste man wohl erst Kirschen klauen, um zu so einer „göttlichen“ Speise zu gelangen.
Was Gott anbelangt, hatten mich die vielen Kruzifixe, an denen ich auf meinem Schulweg vorbeikam sowie das landesübliche „Grüß Gott!“ neugierig gemacht. Aus diesem Grunde bat ich unsere Wirtsleute, sie zu ihrem Gottesdienst begleiten zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit konnte ich, als protestantisch Getaufter, im erzkatholischen Bayern eine prunkvoll ausgestattete Dorfkirche bestaunen, mich durch die figürlich und bildhaft dargestellten Überlieferungen zum Entstehen und zur Verherrlichung des Christentums überraschen lassen. Alles sehr beeindruckend, wäre nicht diese langweilige Predigt gewesen, der die Gläubigen inbrünstig lauschten. Ich verstand kein Wort, glaubte aber, den anderen ginge es ebenso, sie waren nur seit Generationen an diesen Ritus klerikaler Bevormundung gewöhnt.





























