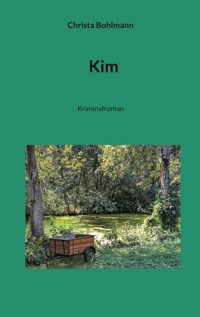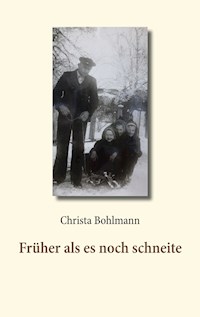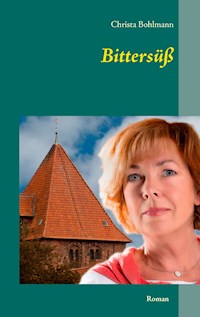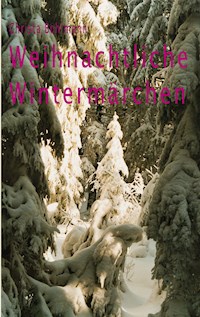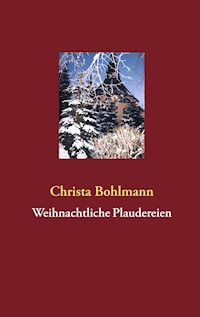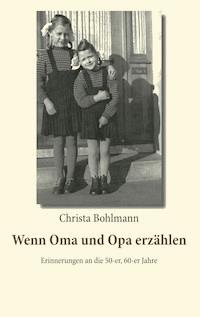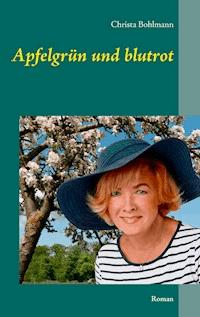Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Oma noch Kind war Ein liebevoller Rückblick auf das Leben und Treiben in den 50-er und 60-er Jahren. Häufig spielt in den Kurzgeschichten der Tubben (eine Zinkwanne) eine Rolle, die damals vielseitig Verwendung fand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Hol mal eben
Mit dem Zug unterwegs
Schule
Bonbons & Co.
Baderitual
Waschtag
Unterwäsche
Schlachtfest
Der Obstgarten
Wein
Holz, Kohle, Brikett
Lebensmittel und Müll
Haare
Federvieh
Großreinemachen
Hobby, Spiel und Unterhaltung
Ausflüge
Stille
Der große Garten
Landwirtschaft
Noch eine Tubben-Geschichte zum Abschluss
Vorwort
„Hol mal eben den Tubben runter!“ Diese Worte meiner Mutter kamen mir neulich wieder in den Sinn, ich hatte sie als Kind häufig gehört. Was für ein seltsames Wort: Tubben? War das ein Spezialausdruck in unserem Haus gewesen oder war dieses Wort gebräuchlich? Früher jedenfalls, denn heute braucht man kaum noch einen Tubben.
Tubben? Oder auch Tuppen?
Wie gut, dass man doch googeln kann. Tubben ist das plattdeutsche Wort für einen Bottich oder einen Zuber, als Herkunft dieses Wortes wird Hoya genannt. Ich suchte weiter und fand die Übersetzung für das englische Wort „tub“: Wanne.
Da haben wir’s! Wenn Mutti also sagte: „Hol mal eben den Tubben runter“, dann meinte sie eine der drei Zinkwannen, die auf dem Hausboden standen. Die Tubben wurden für viele Gelegenheiten benötigt, die unterschiedlicher kaum sein konnten.
Als diese Worte zum ersten Mal an mich gerichtet wurden, fühlte ich mich richtig stark. Doch ich wunderte mich, denn sogar der kleinste Tubben hatte ein ordentliches Gewicht. Ich hielt ihn an einem Griff fest und versuchte, die ovale Zinkwanne nach unten zu jonglieren, doch sie bekam seitliches Übergewicht und nahm klack-klack-klack zu jeder der frisch gestrichenen gedrechselten Holzstäbe des Treppengeländers Kontakt auf, wobei von jedem dieser Stäbe etwas der weißen Lackfarbe absplitterte.
Diese Tubben brachten mich gedanklich zurück in meine Kinderwelt, in der doch alles noch so ganz anders war. Wie ist die Zeit vergangen! Mir ist es, als wäre es erst gestern gewesen.
Ich lade ein, in die eigene Vergangenheit einzutauchen und sich an die gute alte Zeit der 50-er und 60-er Jahren zu erinnern. Machen wir uns dennoch das Hier und Jetzt bewusst und genießen Fortschritt und Weiterentwicklung der dazwischen liegenden Jahre.
Ein Wort noch zum Tubben: Als wir nach dem Tod meiner Eltern einige Jahre wieder in meinem Elternhaus wohnten, hatte ich die Idee, ihn mit Sommerblumen zu bepflanzen und kaufte ein paar Sack Blumenerde. Schnell sah ich, dass diese Menge nicht ausreichend war und packte erst eine dicke Lage Strauchwerk und anderes Füllmaterial in die Wanne. Dann pflanzte ich rote stehende und hängende Geranien in die frische Erde. Nie wieder habe ich eine solche Blütenpracht und so kräftige Pflanzen gesehen. Hat bestimmt an unserem Tubben gelegen.
Wo er jetzt wohl sein mag?
Ein herzliches Dankeschön an meine Helfer:
Alfred für die aufgenommenen Fotos und die Bearbeitung der alten Bilder Biene für das finale Korrekturlesen Eckhard für die Lösung technischer Probleme Heinz für seine Geduld und sein Urteil Marlene für die Bereitstellung des Tubbens und weiterer Zeitzeugen aus den 50-er und 60-er Jahren Petra für ein schönes „Tubben-Motiv“ aus der Jetzt-Zeit Rosi für das Lektorat. Hat richtig Spaß gemacht, weil wir die Erinnerungen teilen konnten.
Hol mal eben
„Hol mal eben eine Zwiebel und etwas Petersilie aus dem Garten“ oder „Hol mal eben ein Glas Bohnen aus dem Keller, aber sei vorsichtig!“
Diese oder ähnliche Sätze hörte ich häufig von meiner Mutter, aber das ist schon lange her. Ich erhielt oft derartige Aufträge und nahm meiner vielbeschäftigten Mutter so manchen Weg ab. Natürlich wurde auch meine knapp drei Jahre ältere Schwester Rosi damit beauftragt. Sie hatte mir dadurch viel voraus, denn sie durfte unsere Mutter eben schon knapp drei Jahre länger unterstützen. Es war an der Zeit, dass auch ich häufiger ins Geschehen eingreifen durfte. Manchmal fiel sogar ein Lob oder ein Wort der Anerkennung für uns dabei ab.
„Hol mal eben die Kassette“, wie glücklich war ich, als diese Worte zum ersten Mal an mich gerichtet waren. Es war fast wie ein Ritterschlag für mich. Wenn das kein Vertrauensbeweis war! Ich erinnere mich noch genau an die dunkelgrüne Geldkassette, die viele wichtige Dinge, aber auch Bargeldvorräte enthielt. Sie spielte auch eine große Rolle, wenn nachts ein starkes Gewitter wütete und wir alle angezogen mit der besagten Kassette auf der Treppe sitzend warteten, bis „die Luft wieder rein war“. Oma hielt in solchen Situationen ihr Gesangbuch fest in den Händen.
„Das Gewitter kommt bestimmt noch mal zurück, es kann nicht über die Weser!“ An diesen Satz erinnere ich mich noch häufig, denn ich fragte mich damals immer, ob das Gewitter wohl in Nienburg oder Hoya über die Brücke wollte. Im Grunde war es mir auch egal, Hauptsache, es hörte bald auf, so grässlich zu blitzen und zu donnern. Oft zog es meine Eltern, meistens meinen Vater, nach solch einer ungewollten Störung der Nachtruhe aufs stille Örtchen, das am Ende des Stalles zu finden war. Keiner kann ermessen, wie sehr ich Papas Rückkehr herbeisehnte. So richtig beschützt fühlte ich mich erst wieder, wenn wir alle auf der Treppe saßen, bereit, das Haus fluchtartig verlassen zu können, sollte ein Blitz es treffen. Zum Glück mussten wir das nie erleben.
Mit dem Zug unterwegs
Noch einmal zurück zur dunkelgrünen Kassette, als mein Auftrag lautete: „ Hol mal eben die Kassette.“ Die hatte ihren Platz, so lange ich denken konnte, im Kleiderschrank hinter der rechten Tür auf dem Schrankboden.
Aber was war das? Ich war baff, denn auf der Kassette stand ein Paar Puppenschuhe, ebenfalls grün, allerdings eher gelbgrün. Wie um alles in der Welt kamen die dahin? Aufgeregt brachte ich meinen Fund zu Mutti, die aus heutiger Sicht recht cool reagierte. Es war kurz vor Weihnachten und diese Puppenschuhe waren als Weihnachtsgeschenk vorgesehen. Mutti hatte versäumt, die Schühchen besser zu verstecken. Ich bekam sie sofort, was für ein Glück! An die Erklärung für ein so schönes unerwartetes Geschenk kann ich mich heute nicht mehr erinnern.
„Hol mal eben die Kassette“, hieß es sicher auch, wenn wir mit dem Zug nach Bremen fahren wollten. Es gab verschiedene Anlässe, in die Großstadt zu reisen: es konnte ein Arztbesuch sein und in dem Fall waren meine Mutter und ich allein unterwegs. Um Verwandte zu besuchen, fuhren wir mit der ganzen Familie nach Syke, Hemelingen oder nach Bremen. Seltsamerweise hat es uns nie in die andere Richtung – nach Diepholz oder Osnabrück – gezogen. Die schönsten Erinnerungen gelten aber den Fahrten mit dem Ziel „Bremer Freimarkt“. Am steinernen Elefanten war Treffpunkt mit meinem Vater, der von der Arbeit kam. Mutti, Rosi und ich warteten geduldig, bis Papa der richtigen Straßenbahn entstieg und bald durften wir Karussell fahren und schleckern, bis sich fast der Magen umdrehte – aber das nahmen wir gerne in Kauf. Welch eine Freude, das Marktgeschehen von oben aus dem Riesenrad zu sehen!
Die Zugfahrten selbst waren schon ein besonderes Erlebnis. An der Zugspitze war das schwarze Ungetüm, vor dem ich mächtig Respekt hatte: die dampfende und polternde Lokomotive. Damals gab es noch drei unterschiedliche Klassen. Wir fuhren in der 3. – in der Holzklasse. Wie der Name es schon sagte, waren die Sitzbänke aus Holz, vorgeformt für Körper Erwachsener. Für uns Kinder war das weniger bequem, denn wir konnten uns nicht anlehnen.
Mit dem Zug unterwegs ca 1940
Ich erinnere mich noch an die oberhalb angebrachten, geflochtenen Koffernetze, die manchmal schon ziemlich ausgefranst herunterhingen. Um die Fenster öffnen zu können, musste man an einem breiten stabilen Ledergurt ziehen, so ließen sich die Scheiben ein Stück oder auch ganz heben oder senken. Kleine weiße emaillierte Schilder auf der Fensterkante warnten in verschiedenen Sprachen vor dem Hinauslehnen aus dem Zugfenster. „Ne pas se pencher au dehors“ – das war französisch und ich war stolz, die Bedeutung dieser fremd klingenden Worte zu kennen.
Lange hatte ich die Vorstellung, dass es in ganz Bremen so aussah wie in der Obernstraße. Ich vermutete, jedes Haus wäre so groß wie all die, welche ich von der Straßenbahn aus, die auch die „Elektrische“ genannt wurde, bestaunen konnte. Ich wurde eines besseren belehrt, als wir die Familie eines Kollegen meines Vaters besuchten. Der wohnte eher am Stadtrand, hatte ein Alt-Bremer Haus mit einem großen Garten dahinter. Im Schatten der alten Apfelbäume gab es sogar einen Kaninchenstall – so etwas Idyllisches hatte ich in der Großstadt nie vermutet.
Auch das Fahren mit der Straßenbahn hatte einen besonderen Reiz. Die quietschte ganz schön laut, wenn sie um die Kurve fuhr. Der Schaffner kassierte von jedem Fahrgast, dabei entnahm er das Wechselgeld einem vor seinem Bauch hängenden Zaubergerät, das auf Daumendruck einzelne Münzen ausspuckte.
Sogar in der Straßenbahn gab es Raucher- und Nichtraucherabteile. Obwohl selbst leidenschaftlicher Zigarrenraucher, verzichtete unser Vater auf das Fahren in der allzu blauen Luft. Es war für uns Kinder eine Selbstverständlichkeit, unseren Platz für ältere Fahrgäste zu räumen, wenn für sie keine Sitzmöglichkeiten zur Verfügung standen.
Interessant war ja schon das ganze Geschehen vor Antritt einer Zugfahrt. Meist waren wir recht früh am Bahnhof, denn wir mussten die Fahrkarten lösen. Der hinter einer Glasscheibe sitzende Mann in dunkelblauer Uniform verkaufte uns kleine braune Pappkarten und legte sie samt Wechselgeld in ein Behältnis auf seiner Seite, Mutti hatte dagegen das Fahrgeld in die ihr zugewandten Mulde jenseits der Scheibe gelegt. Der Beamte betätigte eine Kurbel und schon konnte jedem das Seinige zugeordnet werden. Wir bekamen die Fahrkarten und der Dunkelblaue erhielt sein Geld.
Danach warteten wir geduldig vor der Sperre, bis ein weiterer wichtig aussehender Uniformierter die eiserne Kette öffnete, denn nur Menschen, die eine gültige Fahr- oder Bahnsteigkarte vorweisen konnten, durften die Sperre passieren, nach dem der Beamte jede Karte abgeknipst hatte. Kurzum, er hatte mittels einer Zange die Pappkarten mit einem Loch versehen.
Meistens hatten meine Eltern Reiseproviant mitgenommen, an das ich bereits in Bramstedt erinnerte. So eine Scheibe Brot, eingewickelt in Pergamentpapier, schmeckte mir im Zug besonders gut.
Noch leckerer schmeckte das Brot aus Vatis Brotdose, das er manchmal von der Arbeit wieder mit zurückbrachte. Häufig holten wir ihn vom Bahnhof ab, warteten geduldig vor den rot-weißen Schranken, bis der Schrankenwärter uns das Wiedersehen mit Vati ermöglichte. Oft warteten wir vergeblich, denn Überstunden waren an der Tagesordnung. Ich erinnere mich an das Glücksgefühl, wenn Vati wirklich pünktlich mit dem Zug kam und, wenn er uns erblickte, in die lederne Arbeitstasche griff, um uns das „Hasenbrot“ zu geben. Manchmal war abends mehr Kochkäse im Pergamentpapier als auf dem Brot. Wenn Muttis berühmte Topfsülze die Strecke Bassum-Bremen zweimal angetreten hatte und schon richtig weich war, schmeckte sie uns besonders gut.
Schule
Gleich der erste Schultag verlief nicht so, wie ich ihn mir erträumt hatte.