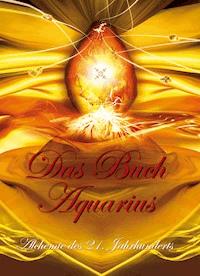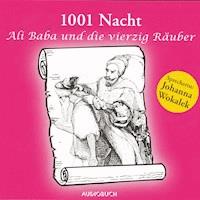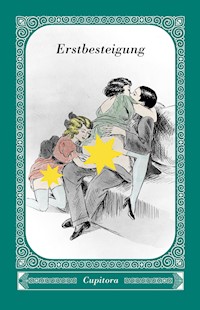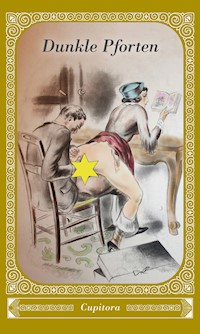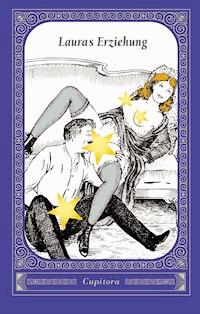3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Altdeutsches Dekameron gab es im Mittelalter nicht, allerdings gingen zwischen 1200 und 1500 etwa 200 „decameronische“ Geschichten als Schwank oder Märe in deutscher Sprache von Mund zu Mund, die in Sammelhandschriften zusammengefasst wurden. Diese lassen sich aber kaum vergleichen mit dem Vorbild des italienischen Decameron des Giovanni Boccaccio von 1348 bis 1353, da fast jede Novelle ihre Eigenheit durch das Erzählgut unterschiedlicher Autoren und der verändernden Wirkung mündlicher Überlieferung hat. Auch in Frankreich entstanden ähnliche Novellen oder „fabliaux“, wie die Cent nouvelles nouvelles zwischen 1456 und 1461, oder in England von Geoffrey Chaucer die Canterbury Tales zwischen 1387 und 1400. Möglicherweise sind so „Wanderstoffe“ zwischen den Volksliteraturen entstanden. Gemeinsam ist den Erzählungen im Original die Versform und der Paarreim, wobei die Länge variiert. Die Inhalte vermitteln den Eindruck eines Spiegels des Volkslebens im Gegensatz zur feudalhöfischen Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Die niederen Stände und erotische Themen halten Einzug in die Literatur. Stolz auf die Leistung deutschsprachiger Volkskultur, nimmt sich die Sammlung die Einteilung Boccaccios im Decamerone, dem 10-Tage-Werk, d.h. der Erzählung von zehn Geschichten an zehn Tagen, zum Vorbild. So gelingt eine Akzentuierung beliebter Themen, Motive, Stoffe, die eine Vorstellung von den Eigenarten mittelalterlicher deutscher Kleinepik vermitteln. Die sprachliche Wiedergabe dieser versgebundenen Dichtung, die im Original nur noch Spezialisten verständlich ist, erfolgt in Prosa wegen der besseren Lesbarkeit und einem Gewinn an Wirkung beim Leser. Beidem dient auch die Entscheidung, bei der Übersetzung nacherzählend zu arbeiten, dabei aber dem Original gerecht zu werden. Aufbaueigentümlichkeiten und originalgegebene Stoffanordnung bleiben unangetastet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 975
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ANONYM
ALTDEUTSCHESDEKAMERON
ERZÄHLUNGEN
ALTEDEUTSCHES DEKAMERON ist eine Zusammenstellung mündlich und schriftlich überlieferter Erzählungen und Schwänke aus dem deutschen Mittelalter.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2022
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96130-535-3
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
Altdeutsches Dekameron
Impressum
Mit den Augen des Volkes
Die unsichtbaren Gemälde
Das brennende Tuch
Der entblößte Ritter
Der nackte Bote
Der tapfere Bauer und der ungetreue Amtmann
Der Richter und der Teufel
Der Riese
Die reiche Stadt
Der Ratgeber
Von einem jungen Ratgeber
Unheilige Heilige
Der kluge Knecht
Die Wolfsgrube
Der Priester in der Reuse
Der Herrgottschnitzer
Die drei Mönche von Kolmar
Der Liebeszehnte
Der vertauschte Müller
Der Teufel im Kloster
Der Pfaffe im Käsekorb
Der durstige Einsiedel
Hochmut kommt vor dem Fall
Des Muses Lehre
Der nackte Kaiser
Der Bauer und die Prinzessin
Die halbe Birne
Das Häschen
Das roßlederne Kleid
Die Heimholung
Der Spiegel
Der Rosenbusch
Hausfrau und Magd
Siege der Klugheit
Die zwei Könige
Priester und Bischof
Das erzwungene Gelübde
Das Rädchen
Tumult im Bürgerhaus
Die Martinsnacht
Der Reiher
Der entlaufene Hasenbraten
Der Winzers Frau
Die drei Wünsche
Wunder wahrer Liebe
Die Nachtigall
Der Mönch als Liebesbote
Der arme Heinrich
Die Tochter des Kaisers Lucius
Das Herz
Frauentreue
Der Bussard
Sociabilis
Die Liebesprobe
Die Rache der betrogenen Frau
Die treue Gattin
Das Auge
Der Balken
Ritter Alexander
Friedrich von Auchenfurt
Die getreue Kaufmannsfrau
Die Versuchung
Der Edelmann mit den vier Frauen
Die Königin von Frankreich und der treulose Marschall
Ehefrau und Buhlerin
Der Siegesgürtel
Die Ehebrecherin
Das Kerbelkraut
Die Hose des Buhlers
Die Schnur am Zeh
Der Ritter mit den Nüssen
Der Ritter unter dem Zuber
Der Chorherr und die Schustersfrau
Die Pächterin mit der Ziege
Der Schreiber
Liebesdurst
Die List der Magd
Das böse Weib
Die Beichte
Der Zahn
Die böse Adelheid
Der lebendig begrabene Ehemann
Drei listige Frauen
Die leichtherzige Witwe
Die genasführten Liebhaber
Die Rache der listigen Schönen
Die eingemauerte Frau
Das heiße Eisen
Närrische Liebe
Die beiden Freundinnen
Die Vertreibung des Teufels
Der angeklagte Zwetzler
Der Sperber
Der närrische Müller
Der wahrsagende Baum
Das Gänschen
Der schwangere Mönch
Das Liebespaar auf der Linde
Das untergeschobene Kalb
Allerlei Schelmereien
Der Schinkendieb als Teufel
Die beiden Freunde und der Bär
Der betrügerische Blinde
Die Vergeltung
Das Schneekind
Das Almosen
Drei listige Gesellen
Der Kuhdieb
Der Wettstreit der drei Liebhaber
Der fünfmal getötete Pfarrer
Anhang
Quellennachweise
Anmerkungen
Zu dieser Ausgabe
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
MIT DEN AUGEN DES VOLKES
DIE UNSICHTBAREN GEMÄLDE
Nachdem der Priester Amis unversehens zu Wohlstand gekommen war, wurde er übermütig und wälzte kühne Pläne, wie er noch größeren Reichtum häufen könne. Er ritt nach Frankreich, in die Hauptstadt Paris, und drang bis zum König des Landes vor. Unterwürfig sprach er zu ihm: »Wenn Ihr Euch meiner vielen Künste bedienen wolltet, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden.«
Der König fragte: »Welche Künste beherrscht Ihr denn, Meister?«
»Ich kann zum Beispiel so herrliche Gemälde schaffen, daß alle Welt des Lobes voll ist über meine Pinselführung. Dabei ist es mir möglich, einen Kunstgriff anzuwenden, den niemand außer mir kennt; ich habe ihn nämlich selbst ersonnen: So könnte ich Euch einen Palast oder einen Saal mit den Bildnissen aller zahmen und wilden Tiere ausschmücken. Wenn alles fertig ist, lasse ich Ritter und Edeldamen ein, damit sie meine Bilder betrachten können. Aber kein Mensch – er sei noch so tüchtig, klug und rechtschaffen – kann meine Gemälde sehen, wenn er nicht ehelich geboren ist. Wer unehelich geboren ist, sieht von meiner Kunst keinen Strich und keinen Schimmer. Wenn Ihr mein Können erproben wollt, zeige ich Euch mit Freuden, daß ich ein Meister meines Faches bin.«
»Aber natürlich, gern!« stimmte der König zu, und er führte den großen Künstler auf der Stelle in einen prächtigen, weiträumigen Palast, wo er ihn Umschau halten ließ. Danach fragte er ihn, welches Honorar er für das Ausmalen des Palastsaales fordern würde.
Der Priester Amis erwiderte listig: »Alle Welt ist voll von Euerm Ruhm, so daß es Euch gewiß nicht schwerfallen wird, mir für mein Werk dreihundert Goldstücke zu geben. Bei meinen hohen Aufwendungen wird ohnehin alles für das Beschaffen von Material draufgehen, so daß mir kaum etwas übrigbleibt.«
Der König versicherte eifrig: »Braucht Ihr mehr, bekommt Ihr's ohne weiteres! Lieber wollte ich selbst die höchsten Forderungen erfüllen als auf eine Probe Eurer Kunst verzichten. Ich möchte Euch nur herzlich bitten, Euer Werk möglichst bald zu vollenden! Für solche Künste ist mir nichts zu teuer!«
Der Priester sprach bedächtig: »Gut, ich male Euch diesen Saal aus, aber nur unter einer Bedingung: Solange ich arbeite, darf niemand den Saal betreten. Ich denke, daß ich dann mein Werk nach höchstens sechs Wochen vollendet habe. Befehlt also allen Euern Höflingen, daß in dieser Zeit kein Mensch die Schwelle dieses Saales überschreiten darf.«
Der König sagte sofort zu: »Ich bin mit dieser und mit allen anderen Forderungen einverstanden. Macht nur die Tür fest zu. Ich stelle Euch außerdem zwei Posten davor, die niemanden einlassen. Auch ich werde mich während der sechs Wochen nicht sehen lassen. Dann aber will ich der erste sein, der Euer Werk bewundert, und ich bringe alle meine Ritter mit. Für diesen Tag erteile ich Euch die Erlaubnis, von einem jeden Ritter, der den Saal betritt, eine Eintrittsgebühr zu erheben. Bin ich an diesem Tag noch gesund und munter, so müssen alle meine Ritter hinein! Jeder von ihnen soll offenbaren, ob er ehelich geboren ist oder nicht! Wer aber illegitimer Abkunft ist, dem entziehe ich – bei Gott! – alle seine Lehen!«
Mit diesen Worten ritt der König an der Spitze seines Gefolges davon und erzählte jedem, der's nur hören wollte, von seinem Handel. Der Priester aber ging mit seinen Helfern in den Saal und begann mit seiner Malerei. Hört zu, wie er's anfing: Alle Saalfenster wurden verdunkelt, und niemand außer seinen Helfern durfte in den Saal. Fleisch, Fisch, Met, Wein und alles, was sein Herz begehrte, wurde in Hülle und Fülle hereingeschleppt. Laßt euch sagen, was er nun begann: Er wälzte sich träge aufs Lager und tat keinen einzigen Pinselstrich! So hauste er in dem Saal, bis die festgesetzte Frist verstrichen war und der König mit vielen Rittern erschien. Kein einziger Edelmann, der ihm in den vergangenen sechs Wochen begegnet war, hatte wegbleiben können; alle mußten mit in den Saal! Als der König mit Pomp und Gepränge erschien, trat der Meister aus der Tür des Saales und hieß ihn herzlich willkommen: »Tretet erst Ihr herein und laßt die Ritter draußen warten. Ich möchte Euch in Ruhe die Details der Gemälde erklären und dann Euer Urteil hören.«
Der König war begeistert. Er trat in den Saal und schloß hinter sich sofort die Tür. Doch als er voller Spannung und Erwartungsfreude die Blicke über die Wände schweifen ließ, sah er überall nur leere Flächen. Was Wunder: Kein Pinsel hatte die Wände berührt! Der König erschrak so heftig, daß er fast in Ohnmacht gefallen wäre. Während er hilflos und verzweifelt im Saal umherschaute, wurde sein Herz immer schwerer, denn er hätte darauf schwören mögen, daß der Künstler den Palast tatsächlich ausgemalt hatte. So dachte er kummervoll: Die Ehre meiner Mutter und die meine sind dahin! Erkläre ich, ich könnte keinen Pinselstrich entdecken, werden alle, deren Augen die Gemälde des Künstlers sehen können, sofort sagen, ich sei illegitim geboren. Da ich wie blind bin und nichts entdecken kann, ist erwiesen, daß ich einer Mesalliance entstamme. Ich muß also behaupten, alles sehen zu können, dann ist meine Ehre gerettet. Es drückt mir das Herz ab, daß Ritter, Edelmann und Knappen die Gemälde sehen können, während sie meinen Blicken entzogen sind. Das ist ja schlimmer als der Tod! Schließlich wandte er sich an den Künstler: »Meister, erklärt mir bitte, welche Themen Ihr hier so vortrefflich gestaltet habt!«
Amis begann salbungsvoll: »Ich behandle hier den Stoff von Salomon, von seinem Vater David und dem schweren Zerwürfnis zwischen ihm und Absalom. Ihr wißt von der Geschichte, als er ihn verfolgte und dabei mit dem langen Haar an einem Ast hängenblieb, so daß er sich selbst henkte. – Hier geht's um den König Alexander, wie er Darius und Porus von Indien besiegte und was er sonst noch für Taten vollbrachte. – Hier sind Leben und Taten der römischen Könige festgehalten. – Hier wiederum ist das Leben und Treiben zu Babylon gestaltet bis zu dem Zeitpunkt, da Gottes Strafgericht über die Stadt hereinbrach und die Bewohner auf einmal vielerlei Sprachen zu sprechen begannen. – Oben seid Ihr mit Euren Rittern dargestellt, Ihr seht, wie Ihr mit ihnen in den Saal tretet und die Gemälde bewundert. Einige, die nichts sehen, schlagen sich vor Verzweiflung die Fäuste an die Brust; die aber alles sehen können, strahlen vor Glück und Begeisterung.«
»Nun habe ich alles in Ruhe betrachten können«, sprach der König, obwohl er damit eine dicke Lüge auftischte. »Wer's nicht sehen kann, soll's mit sich selber abmachen. Jedenfalls habe ich noch nie einen Saal gesehen, der herrlicher ausgemalt wäre.«
Der Meister meinte nun: »Geht hinaus und laßt die Ritter eintreten. Vergeßt auch nicht, ihnen zu sagen, welche Vergünstigung Ihr mir zugestanden habt.«
Der König schloß die Tür auf und sprach zu seinen Rittern: »Jeder Ritter, der heute den Saal betritt, hat bei dem Künstler eine Eintrittsgebühr zu entrichten. Sonst bleibt er draußen! Ich selbst habe dem Meister die Erlaubnis dazu erteilt.«
Nun drängten die Ritter heran. Die einen gaben ihr Gewand hin, die anderen Geld. Einige überließen ihm gar ihre Pferde oder ihre Schwerter, so daß am Ende ein ungeheurer Reichtum zusammenkam. Lärmend schoben sich die neugierigen Ritter in den Saal, und es war keiner unter ihnen, der nicht beim Anblick der kahlen Wände fürchterlich erschrak – ohne diesen Eindruck natürlich einzugestehn. Jeder dachte an seine Ehre und behauptete überzeugend, alle Gemälde zu sehen und sie vortrefflich zu finden. Alle aber waren sehr bedrückt und leichenblaß vor Angst, denn sie fürchteten, durch ein offenes Eingeständnis ihrer Blindheit um ihre Lehen zu kommen und elendiglich verderben zu müssen. Daß sie die Gemälde nicht sehen konnten, erfüllte sie mit solchem Gram, daß sie sich dem Tode nahe wähnten. Nun hörten sie, wie der König (ganz nach der Beschreibung des Meisters) erläuterte, dies wäre hier, das wäre dort zu sehen, und alle murmelten im Chor: »Jawohl, ausgezeichnet getroffen!« Dabei empfand jeder Schmerz und Scham, auf diese Weise von der Schmach einer unehelichen Abkunft zu erfahren. Zugleich versicherte natürlich jeder dem anderen, alles ganz genau zu erkennen, ja, er hätte ohne Zögern einen Eid darauf geleistet So mancher fühlte aber auch steigenden Grimm gegen seine Mutter, die es offenbar mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen hatte. Nachdem sich alle satt gesehen und lauthals verkündet hatten, es sei eine ganz vorzügliche Arbeit, bat der Meister den König um den ausbedungenen Lohn. Nachdem er alles erhalten hatte, verabschiedete er sich und ritt davon. Ihm hatte diesmal wirklich das Glück gelächelt, denn die erhobene Eintrittsgebühr hatte ihm nochmals zweihundert Goldstücke eingebracht. Er schickte alles mit eilenden Boten nach Hause und ließ ausrichten, man solle es während seiner Abwesenheit den Gästen daheim an nichts fehlen lassen.
Nachdem die Ritter den Saal betrachtet hatten, stellte sich am anderen Tag die Königin mit ihren Edeldamen ein. Alle erschraken ebenso wie die Ritter, ja eher noch mehr, als sie rein gar nichts sehen konnten; alle beteuerten aber auch wie die Ritter, die Gemälde in allen Einzelheiten sehen zu können. Schließlich drängten die Knappen in den Saal, und auch sie sprachen voller Beschämung und Furcht, die Gemälde wären ganz herrlich, sie hätten noch nie im Leben schönere gesehen. Nur ein Einfaltspinsel schüttelte verwundert den Kopf: »Ich hab doch keine Glasaugen! Gäb's da etwas zu sehen, müßte ich's doch sehen können!«
Die um ihre Ehre besorgten Knappen fuhren ihn aber an: »Aha, du bist also ein Bastard! Nur Bastarde sehen diese herrlichen Gemälde nicht!«
Der einfältige Bursche blieb jedoch stur und hartnäckig: »Egal, wessen Kind ich bin! Selbst wenn ihr mich für einen Bastard haltet, sage ich klipp und klar: Hier ist kein Pinselstrich zu sehen! Und auch ihr seht hier bestimmt nicht mehr als ich! Und wer das Gegenteil behauptet, bekommt's noch heute mit mir zu tun!«
Nun entbrannte zwischen den Knappen ein großes Wortgefecht, bis sich schließlich noch andere fanden, die erklärten, nichts von irgendwelchen Gemälden sehen zu können. Wer behaupten wolle, an den Wänden Malereien zu entdecken, sei ein ausgemachter Narr. Nun besannen sich auch die Gewitzteren und Vorsichtigeren, und da sie in der Tat nichts sehen konnten, schlossen sie sich den unvorsichtigeren Gesellen an. Schließlich waren alle Knappen einer Meinung, und als die Ritter davon hörten, gab's auch unter ihnen unterschiedliche Ansichten. Schließlich siegte die Wahrheit über die Lüge, und der gesamte Hofstaat erklärte einhellig, es sei ein einziger großer Betrug. Nur der König blieb bei seiner Behauptung. Er schwieg so lange, bis er merkte, daß sein ganzes Volk anderer Meinung war als er. Als er sicher war, mit seinem königlichen Wort auf keinen Widerspruch zu stoßen, schloß er sich der Meinung aller an und sagte, er könne – bei Gott! – aber auch gar nichts sehen! Da gab's natürlich bei Hofe großen Lärm und Spottreden die Fülle. Schließlich aber waren sich alle einig: »Dieser Priester ist wirklich ein Schlaukopf! Auf so raffinierte Weise solchen Reichtum zu ergattern!«
DAS BRENNENDE TUCH
Dem Priester Amis war bekannt, daß die Frau eines Ritters von schwachem Verstand war. Einst, als ihr Mann ausgeritten war, tauchte er bei ihr auf und bat um Herberge für die Nacht. Die wurde ihm gern gewährt, und als er sie durch die Wiedererweckung eines angeblich toten Hahns von seiner Heiligkeit und Wundertätigkeit überzeugt hatte, gab sie ihm zum Dank ein feines, weißes Tuch von hundert Ellen Länge. Nun machte Amis, daß er fortkam. Kurz darauf kehrte der Ritter zurück, und die Hausfrau erzählte ihm verzückt, ein Heiliger sei bei ihr eingekehrt und habe ein Wunder gewirkt.
»Was hat er dir abgeluchst?« fuhr der Ritter sie an.
»Es wäre sicher gut gewesen, wenn ich ihn reich beschenkt hätte. Leider hatte ich nur hundert Ellen feines Tuch; die habe ich ihm gegeben.«
»Wer eine blöde Gans sucht, hat's bei dir nicht weit«, schrie der Ritter. »Weiß Gott, das Tuch muß wieder her!« Er war nämlich ein jähzorniger und geiziger Mann. Schleunigst sprang er auf seinen schnellfüßigen, kräftigen Renner und galoppierte dem Priester nach. Nun war aber Amis ein ganz durchtriebener Schelm, der diese Wendung der Dinge bereits bedacht und befürchtet hatte, daß der zurückkehrende Ritter von der Sache mit dem Tuch hören würde und es ihm wieder abjagen wollte. Als er den Verfolger von ferne sah, hatte er im Nu Feuer geschlagen und eine glühende Kohle ins Tuch geschoben. Mit zorngerötetem Antlitz sprengte der Ritter heran und brüllte wütend: »Ihr betrügerischer Schuft! Meint Ihr wohl, mich freut's, daß Ihr mein Weib betrogen habt? Führt andere Leute hinters Licht! Ihr habt mich bestohlen, und da ich Euch dabei ertappt habe, sollt Ihr dafür büßen!«
Ängstlich barmte der Priester Amis: »Herr, was habt Ihr schon davon, wenn Ihr Euch an einem Priester rächt? Ihr könnt mir glauben, Eure Frau hat mir dieses Tuch geradezu aufgedrängt! Gewiß, ich bin Euch hilflos ausgeliefert, Ihr könnt mich um Besitz und Leben bringen, wenn Euch nicht Ehre, Rittertugend und Gottes Gebot daran hindern.«
Zwar war der Ritter fürchterlich ergrimmt, doch als der gewitzte Betrüger ihn so flehentlich umschmeichelte, ließ er ihn ungeschoren weiterreiten; nur das Tuch nahm er ihm ab. Nachdem er eine tüchtige Strecke Weges zwischen sich und den Priester gebracht hatte, begann das Tuch zu brennen. Als er es aufwickelte, war es innen schon völlig verkohlt, und das Feuer fraß unaufhaltsam weiter. Vor Schreck wurde der Ritter leichenblaß. Er war davon überzeugt, dies sei die Strafe für seine Sünde, dem heiligen Manne den gottgewollten Lohn wieder abgejagt zu haben. Ihn überfiel eine schreckliche Furcht, mit dem Leben büßen zu müssen, wenn er nicht auf der Stelle ersetzen würde, was er Gott und seinem Knecht geraubt hatte. Er warf den Tuchballen auf den Rasen, ließ sein Eigentum verbrennen und sprengte doppelt so schnell wie zuvor dem Priester hinterher. Unterwegs bereute er tief die Sünde, dem Heiligen das Tuch abgenommen zu haben. Als er ihn erreichte, beschwor er ihn bei der Ehre Gottes und seinem Christenglauben, seine herzliche Reue und Buße anzunehmen. Er fiel vor ihm auf die Knie und flehte ihn um Vergebung seiner schweren Sündenschuld an.
Priester Amis sprach sanftmütig: »Ich vergebe Euch Eure Sünde. Vor mir seid Ihr ohne Schuld, und wenn Ihr gegen Gott und sein Gebot gefrevelt habt, so möge er Euch dies in seiner unendlichen Güte vergeben. Bei Eurer Ritterehre, sagt mir doch, wie kommt's zu diesem Sinneswandel? Ich habe Euch ohne Widerstand und Zorn das Tuch wiedergegeben und Euch auch keinen Fluch hinterhergeschleudert.«
Da erzählte der Ritter, zur Strafe für seine Sünde sei nachgerade das ganze Tuch verbrannt: »Erlaubt, daß ich's Euch doppelt ersetze.« Ob es dem Priester lieb war oder nicht, er mußte mit dem Ritter zurück auf seine Burg. Als der Ritter daheim eintraf und seine Frau hörte, was mit dem Tuch geschehen war, sprach sie: »Nun hast du endlich einmal gesehen, daß du ein Sünder und von christlichem Leben weit entfernt bist!«
»Liebe Frau, steh mir bei und hilf, daß ich's wieder gutmache!« jammerte der Ritter.
Da trug sie ihren ganzen Kleiderschatz zum Pfandleiher und bekam dafür zehn Pfund Silber, die sie dem Priester Amis gab. Außerdem erzählte der Ritter seinen Nachbarn diese wunderbare Geschichte, die daraufhin alle des Priesters Fürbitte erkauften, was Amis natürlich höchst angenehm war.
DER ENTBLÖßTE RITTER
Einn Ritter, der sich auf einer weiten Reise befand, gelangte zu einem Burgsitz und wurde vom Hausherrn gastfreundlich aufgenommen. Obwohl der Burgherr seinen Gast nie zuvor kennengelernt hatte, war ihm doch zu Ohren gekommen, daß er ein vornehmer Edelmann sei, und er empfing ihn daher um so ehrerbietiger. Der Gast – völlig durchfroren und platschnaß vom Regen – war froh, einen Unterschlupf zu finden. Sein Gastgeber wiederum fühlte sich durch die Anwesenheit des vornehmen Fremden hoch geehrt, und er gab seiner Freude dadurch Ausdruck, daß er seiner Ehefrau und seinen Töchtern gebot, den Gast mit einem Willkommenskuß zu ehren. Man schärfte dem Koch ein, zum Abendbrot leckere Gerichte vorzubereiten, und nachdem ein hell loderndes Feuer angefacht worden war, setzte man sich in der Stube in froher Runde zusammen. Der Hausherr hatte drei wunderschöne Töchter, die den Fremdling mit fröhlichen Plaudereien erheiterten. Das Feuer im Kamin strahlte eine wohlige Wärme aus, doch nachdem es eine geraume Weile gebrannt hatte, wurde es in der Stube derart heiß, daß den Anwesenden vor lauter Hitze die Schweißtropfen von der Stirn rannen. Nun tat der Gastgeber ungezwungen wie ein Mann, dem es daheim um seine Behaglichkeit zu tun ist: Er winkte einen Knecht herbei und ließ sich von ihm das Obergewand abstreifen. »Ich möchte nicht, daß jemand in der Runde während des Abends unnötig Unbequemlichkeiten duldet«, sprach er. Und zu seinem Gast gewandt: »Laßt auch Ihr Euch vom Obergewand befreien. Die Schweißtropfen perlen ja bereits von jeder Locke Eures Hauptes!«
Der Gast aber erwiderte: »Ich finde es ganz behaglich und möchte lieber mein Obergewand am Leibe behalten.«
»So laßt es Euch doch abnehmen!« drängte der Hausherr. »Ich bitte Euch darum, ja, ich gebiete es Euch geradezu, denn ich möchte, daß Ihr es Euch recht bequem macht.«
Der Gast wandte sich an den Hausherrn: »Wenn Ihr es gut mit mir meint und Eure drei Töchter liebhabt, so drängt mich nicht zu solch einer Unhöflichkeit. Lieber läge ich auf dem Krankenlager, als daß ich mein Obergewand ausziehe, und wäre es auch noch so heiß.«
Der Hausherr blieb aber hartnäckig: »Sträubt Euch doch nicht länger. Ich weiß ohnehin, daß Ihr ein feingebildeter Edelmann seid. Lieber wollte ich mich zweimal mit einer Krankheit herumschlagen, ehe ich duldete, daß Ihr Euch aus übertriebener Höflichkeit derart plagt. Ihr hättet allen Grund, mir zu grollen, ließe ich es zu, daß Ihr hier bei mir Unbequemlichkeiten auf Euch nehmen müßt.«
Nachdem er heimlich mit seinen Knechten geflüstert hatte, schritten sie plötzlich auf den Gast zu und zogen ihm trotz allen Sträubens das Obergewand über den Kopf. Da zeigte sich aber, daß der Hausherr seinen Gast durch seine übertriebene Liebenswürdigkeit um alles Ansehen gebracht hatte, ja, der Fremde fiel vor Beschämung fast in Ohnmacht, denn er saß unversehens splitterfasernackt – wie ein geschälter Weidenzweig – auf seinem Stuhl. Er trug nämlich unter seinem Obergewand weder Hemd noch Hose. Als die Damen des Hauses unerwartet einen nackten Mann vor sich sahen, erschraken sie. Der Gast war allerdings noch mehr entsetzt als sie, denn bislang hatte er sich stets und immer um vornehmes Auftreten bemüht. Auch dem Hausherrn fuhr angesichts dieser vertrackten Situation ein gewaltiger Schreck in die Glieder. So saßen denn alle in peinlicher Beklommenheit da. Der Gast sah sich um alles Ansehen gebracht, und die erlittene Schmach empörte ihn so sehr, daß er seinen Gastgeber am liebsten erschlagen hätte, wäre sein Roß nur schnellfüßig genug gewesen. Es war jedoch zu erschöpft, so daß an Flucht nicht zu denken war. Er zog also sein Obergewand wieder an und verließ den Hausherrn in solcher Wut, daß er in Zukunft keinen einzigen freundlichen Gedanken mehr an ihn verschwendete.
Dies diene allen gastfreundlichen Hausherrn zur Lehre: Der Gastgeber soll stets alles tun, was sein Gast wünscht, doch mehr auch nicht. Wenn er ihm gegen seinen Willen Freundlichkeiten oder Gefälligkeiten aufdrängt, erreicht er unter Umständen das Gegenteil dessen, was er eigentlich beabsichtigte. Darum mag er lieber darauf verzichten. Eine Gefälligkeit, mit der man keinen Dank erntet, schadet weit mehr, als sie nützt.
DER NACKTE BOTE
Wie man sich erzählt, ritt eines schönen Tages ein Edelmann seine Straße und schickte bei Anbruch der Dunkelheit (wie dies so üblich ist) seinen Knappen voraus, um einem seiner Lehensleute ankündigen zu lassen, er wolle in dessen Haus die Nacht verbringen. Wie es sich gehört, befolgte der Knappe die Weisung. Er ritt dem Edelmann weit voraus und gelangte schließlich an das Hoftor des Gastgebers, das er weit geöffnet fand. Auf dem Hofe entdeckte er einzig ein Kind, und er fragte es, ob der Hausherr daheim sei.
»Ei freilich!« entgegnete das Kind. »Geht nur in die Badestube. Dort drin sitzt er, denn dort ist es schön warm.«
Der Knappe bemerkte gar wohl, daß das Kind nicht nur ärmlich, sondern auch ziemlich einfältig aussah, aber da er selbst ein rechter Einfaltspinsel war, stellte er keine weiteren Fragen und setzte einfach voraus, der Hausherr weile in der Badestube, um zu baden und sich zu scheren. Dabei dachte er: Das hätte ich auch nötig, und was mir mein Herr aufgetragen hat, kann ich ebensogut in der Badestube vorbringen. Voller Vorfreude auf das Bad, das in Aussicht stand, sprang er vom Pferd und entledigte sich rasch seiner Kleider. Dem Kinde aber trug er auf: »Setz dich hier auf dies Gewand, nimm die Zügel in die Hand und gib acht, daß man mich während des Bades nicht bestiehlt. Ich will dich dafür gut belohnen.«
Das Kind tat gehorsam, was man von ihm erwartete. Es widersprach nicht und setzte sich auf den Kleiderhaufen.
Es war aber Herbstzeit, in der oft schon der kalte Reif liegt und die Winde umschlagen. Daher heizte das Hausgesinde tagtäglich den Baderaum. Es gab zwar noch einen anderen heizbaren Raum, die gute Stube nämlich, doch der Ritter, der dort Hausherr war, wollte sie nicht heizen lassen, bevor nicht der Sommer vollends zu Ende gegangen und der kalte Winter angebrochen war, damit sich erst einmal die Fliegen verzögen und nicht in die Stube kämen. Diese feine Lebensart war also der Grund dafür, daß der Hausherr die gute Stube ungeheizt ließ und ihre Benutzung untersagte. Gesinde und Hausfrau hielten sich in der Badestube auf. So konnte man darin gar viele liebreizende Gesichter sehen, denn die Hausfrau, ihre Töchter und Mägde nutzten sie als Arbeitsraum.
Der Knappe, der baden wollte, kam nun splitterfasernackt an die Tür der Badestube. Oben auf dem Türrahmen hatte man Badewedel geschichtet, was ihm sehr zustatten kam. Als er nämlich gerade einen genommen hatte, sah er einen wütenden Hofköter heranstürmen, der ihn beißen wollte. Er setzte sich mit dem Badewedel wacker zur Wehr, doch der Hund war so hartnäckig, daß er schließlich keinen anderen Ausweg sah, als mit der Kehrseite voran in die Badestube zu flüchten. Er hatte es brandeilig, die Tür zu öffnen, einzutreten und sich vor dem Hunde in Sicherheit zu bringen. Als die Frauen auf einmal einen nackten Mann vor sich erblickten, erschraken sie und schlugen voller Schani die Hände vors Gesicht. Ganz anders der Hausherr, der sich rasch faßte, in Wut geriet und brüllte: »Schmach und Schande, wer ist das!« Jetzt erst drehte sich der Knappe um und erkannte voller Entsetzen seine peinliche Lage. Blitzschnell riß er die Tür wieder auf und war schneller draußen, als er hineingekommen war. Er fürchtete um sein Leben und war nur darauf bedacht, sein Gewand an sich zu bringen und sich auf sein Pferd zu schwingen. Fast hätte er es nicht mehr erreicht. Er hatte es eilig, den Weg zurückzureiten, den er gekommen war, und hetzte sein Pferd so ab, daß es fast zusammenbrach.
Der Hausherr – das schamlose Verhalten und die Flucht des einfältigen Knappen vor Augen – hätte darauf schwören mögen, daß man ihn voller Absicht beleidigen wollte. Er glaubte es seinem Ansehen schuldig zu sein, sofort Vergeltung zu üben, und er schrie seinen Knechten zu, schnell sein Pferd zu bringen und ihm unverzüglich zu folgen. Dies gebot er seinen vertrauenswürdigsten Leuten. Nachdem man ihm Schild und Lanze gebracht hatte, schwang er sich auf das Pferd und folgte dem Knappen auf jener Straße, auf der er ihn hatte davonreiten sehen.
Unmittelbar darauf sah der Edelmann seinen Knappen in wilder Flucht heransprengen und wollte wissen, was geschehen war. »Heraus damit! Was soll dieser Aufzug? Was ist los mit dir? Wer verfolgt dich?«
Der Knappe wagte keine Antwort, denn er hatte Furcht vor noch größerem Unheil. So sprengte er wortlos einfach weiter. Da kam auch schon der Ritter herangaloppiert und hieß seinen Lehensherrn herzlich willkommen. Hastig sprach er dann: »Lieber Herr, laßt den Kerl nicht entkommen! Er hat mich heute um alle Freude und um meinen guten Namen gebracht. Kommt er ungestraft davon, verwinde ich es nimmermehr!«
Da entgegnete sein Lehensherr: »Der Mann, den Ihr verfolgt, ist mein Knappe. Er soll es büßen, wie sich's gehört! Sagt mir, was er verbrochen hat! Wenn er Euch wirklich so schwer beleidigt hat, geht's ihm an den Kragen!«
»Stellt Euch nur vor, lieber Herr: Als er in die Badestube trat, in der ich mich mit meinen Töchtern und meiner Gattin aufhielt, hatte er genau wie eben keinen Fetzen mehr auf dem Leibe. Das schlimmste an der Sache aber ist, daß er uns beim Eintreten den Hintern zeigte!«
Der Lehensherr sagte: »Das soll er büßen!« Und dann rief er dem Mann, der sein Pferd führte, zu: »Bringt mir sofort mein Roß!« Es war ein schnellfüßiger, hochgebauter Renner, auf den er sich schwang, um dann hinter dem Knappen her zu galoppieren. Als er ihn eingeholt hatte, packte er ihn beim Schopf und führte ihn zurück, um ihn dann wütend niederzuwerfen. Zur Sühne wollte er ihn verstümmeln, und er hätte es beinahe getan, wenn nicht der arme Knecht in seiner Herzensangst gerufen hätte: »Herr, um Gottes und der Gerechtigkeit willen, laßt mich die Sache aufklären!«
Der Ritter, der sich über die zugefügte Schmach beklagt hatte, stand dabei und meinte: »Herr, laßt ihn den Grund für sein Tun sagen! Mag er erklären, was ich ihm angetan habe und was er gegen mich vorzubringen hat.«
Da fuhr der Edelmann den Knappen an: »Sprich! Doch ohne Rücksicht darauf wirst du von nun an bis zu deinem Lebensende blind sein!«
»Herr, ich stieß in seinem Hof auf ein Kind. Das fragte ich nach dem Hausherrn. Da wies es mich zu einer Badestube. Er wäre hineingegangen, da es dort schön warm sei. Da glaubte ich, er nehme drinnen ein Bad, und wollte ebenfalls baden. Als ich gerade in die Stube treten wollte, kam ein wütender Hofhund und zwang mich zu meinem Bedauern dazu, rücklings einzutreten. Der Köter ist daran schuld, daß ich den notwendigen Anstand vermissen ließ, doch er hätte mich beinahe mit den Zähnen gepackt, so daß ich es eilig hatte und keinen Blick hinter mich warf. Auf diese Weise kam es zu meinem ungebührlichen Benehmen.«
»Wahrhaftig!« rief der Ritter erleichtert. »Ich werde ewig froh darüber sein, daß ich Euch nicht erschlagen habe. Wenn sich die Sache so verhält, will ich Euch nicht mehr gram sein. Ihr braucht von mir nichts mehr zu befürchten. Ich hatte Euch im Verdacht, mich bewußt beleidigt zu haben.« So bewirkte er, daß der Knappe verschont blieb, dem er zuvor so sehr gezürnt hatte.
Wäre dem Knappen ein Leid widerfahren, so hätten wir nicht behaupten dürfen, daß der Herr schuldlos daran war. Statt ruhig und überlegt den wahren Sachverhalt zu ermitteln, hatte er sich vom Schein leiten lassen. Von solchen falschen Verdachtsmomenten läßt sich so mancher irreführen. Wer dies nicht bedenkt, verstrickt sich am Ende so sehr in trügerische Vorstellungen, daß er ehrlos wird und zudem schweren Schaden erleidet. Wer sich überflüssigerweise auf den Schein verläßt und dann irregeht, ist selbst daran schuld.
DER TAPFERE BAUER UND DER UNGETREUE AMTMANN
Wie ich in alter Überlieferung las, lebte einmal ein hochangesehener, mächtiger und reicher König. In seinem Dienst standen zwei Amtmänner mit unterschiedlichem Charakter und verschiedenartigem Aufgabenbereich. Der jüngere hatte die Verantwortung für die Ritter des Herrschers, der ältere kümmerte sich um das übrige Hofgesinde, Frauen und Männer, und er versah sein Amt mit Ernst und Sorgfalt. Wie es so geht, stellten sich im Verhältnis zwischen den beiden Amtmännern Mißgunst, Neid und Haß ein, von denen bekanntlich selbst der friedfertigste Mann nicht verschont bleibt. Die Sache nahm ihren Ausgang bei jenem Amtmann, der zu den Rittern gehörte. Er hetzte beim König: »Herr, das Verhalten Eures alten Amtmannes ist durchaus nicht in jeder Hinsicht makellos und ehrenhaft, und er hat schon den Unwillen aller Edelleute und Knappen erregt. Er verschwendet Euer Eigentum, er stiehlt und raubt in einem fort, damit seine Verwandten sich in hohen Ämtern spreizen können. Bei Gott, das lasse ich nicht mehr zu! Ich will ihn zum Kampf herausfordern und auf diese Weise seinem verbrecherischen Tun – das lange genug gewährt hat – ein Ende bereiten. Ich werde ihn zwingen, damit aufzuhören!«
Der greise, in Wirklichkeit völlig unschuldige Amtmann geriet durch dieses Vorgehen seines Widersachers in große Bedrängnis, denn er mußte mit dem Schlimmsten rechnen. Tatsächlich verdankte er die Herausforderung nur der Mißgunst und dem maßlosen Haß seines Gegners. Da er – durch sein Alter bedingt – schwach und kraftlos war und sich nicht selbst zum Kampfe stellen konnte, suchte er nach einem Helfer, der an seiner Statt fechten sollte. Nun wurde ihm aber deutlich vor Augen geführt, daß er weder bei Verwandten noch bei Freunden auf Hilfsbereitschaft rechnen konnte. Als er selber Hilfe brauchte, fand er keine bei denen, die oft genug seine Unterstützung erfahren hatten; sie ließen ihn in seiner Bedrängnis im Stich.
Da kam ein Bauersknecht daher und erklärte sich bereit, des bedrohten Amtmannes Kampfeshelfer zu sein. Er dachte nämlich bei sich: Wenn Gott der Unschuld seinen Beistand nicht versagt, werde ich den Ritter besiegen! So betrat er denn zur festgesetzten Zeit unbeschwerten Mutes den Kampfplatz.
Der kampferprobte, furchteinflößend daherschreitende Ritter rief ergrimmt: »Das ist ja spaßig, daß ein Bauerntölpel mich zu verspotten wagt! Aber sein Hohn soll ihm heimgezahlt werden!« Wütend und mit voller Wucht schlug er mit dem Schwert zu. Der Bauer parierte ruhig und besonnen, so daß ihm der Hieb kein Härchen krümmte. Ohne seinerseits anzugreifen, stand er abwartend da. Der gereizte Ritter wollte den Bauern nun unbedingt umbringen und schlug zum zweiten Male zu. Der Bauer parierte wiederum gelassen und mit großer Umsicht. Nun aber ließ er seinerseits die Waffe aufblitzen, die dem Ritter tief durch den Leib fuhr, so daß er vor Schmerz aufbrüllte. Nie wieder sollte er fortan das Schwert gegen einen anderen erheben, denn sein unheilschwangeres Geschick hatte sich erfüllt: Seine gehässige Mißgunst kostete ihn das Leben. Der alte Amtmann aber wurde für unschuldig erklärt.
So ließ Gott die Gerechtigkeit triumphieren und die Bosheit zunichte werden.
Wenn irgendwer einem anderen verräterisch an den Kragen will, so findet er Gründe in Fülle, und wenn dann der Bedrohte in Bedrängnis gerät, so hat er auf einmal weder Verwandte noch Freunde. Erst in der Gefahr zeigt sich der wahre Freund. Hat man aber einen verläßlichen Freund und ist man sich seiner Unschuld bewußt, so kann man guten Mutes sein. Das Recht sei Schutz und Schirm des Gerechten, doch verräterischen Schuften sei keine Schonung gewährt! Ich habe selbst in der Überlieferung gelesen, daß die Lüge vor der Wahrheit zergeht wie Schnee in der Sonne, und dies ist nicht mehr als recht und billig! Der Bauersknecht erschlug den Ritter, und da er brav und tüchtig war, trat er das Erbe des Besiegten an. So kann man's bei Äsopus lesen. Gott gebe uns allen ungetrübtes Glück im Leben!
DER RICHTER UND DER TEUFEL
In einer Stadt lebte einst ein Richter, der so viele Sünden begangen hatte, daß ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Seine Sündenbürde war so groß und schwer, daß sich alle Leute baß verwunderten, warum ihn nicht längst schon die Erde verschlungen hatte. Er war aber nicht nur wegen seiner beispiellosen Sündhaftigkeit, sondern auch wegen seines ungeheuren Reichtums bekannt.
Eines Tages, als gerade Markttag war, wollte er ausreiten, um seinen schönsten Weinberg zu besichtigen. Da beschloß der Teufel, ihm frühzeitig aufzulauern, und als der Richter von seinem Weinberg zurückritt, kam ihm der Teufel auf der Straße entgegen. Er trug kostbare Kleider vom schönsten Schnitt, so daß ihn der Richter für einen Mitmenschen hielt, begrüßte und danach fragte, wer er sei und woher er komme. »Das möchte ich wirklich gern von Euch erfahren.«
»Das geht Euch gar nichts an!« entgegnete der Teufel.
»Ihr habt mir Rede und Antwort zu stehen!« rief der Richter zornig. »Sonst ist es um Euch geschehen! Ich habe hier die Macht und kann mit Euch nach Gutdünken verfahren, ohne daß mir jemand dreinzureden hätte!« Voller Wut schwor er viele heilige Eide, daß er ihn um Besitz und Leben bringen würde, wenn er ihm nicht sofort gestehe, wer er sei und woher er komme.
»Nun gut, bevor Ihr mir so übel mitspielt, will ich Euch lieber meinen Namen und mein Geschlecht bekennen!« erklärte der Satan. »Ich bin der Teufel in eigener Person!«
Da fragte ihn der Richter, was er in seinem Bezirk zu suchen habe.
»Das sollst du erfahren. Ich gehe jetzt in die Stadt, denn am heutigen Tage ist mir unrettbar verfallen, was man mir allen Ernstes verspricht.«
Da rief der Richter vergnügt: »Das muß ich sehen! Gestatte mir, daß ich zuschaue, was man dir an diesem Markttag alles in die Klauen wirft!«
»Das geht nicht!« erwiderte der Teufel.
Da donnerte ihn der Richter an: »Ich befehle dir, daß du mir heute nicht von der Seite weichst und mich zusehen läßt, was du alles anstellst. Ich gebiete es dir bei Gott und seinem Donnerwort, das euch alle in die ewige Verdammnis gestürzt hat! Ich gebiete es dir bei der Allmacht Gottes, bei seinem Zorn und bei seinen Geboten, die für die Ewigkeit bestimmt sind, gegen die dein und deiner höllischen Gesellen Widerstand völlig sinnlos ist. Ich gebiete es dir bei Gottes Gericht, daß du mich Zeuge sein läßt, wenn man heute irgend etwas deiner Gewalt überliefert!«
»Wehe, daß ich je geschaffen ward!« krümmte sich der Teufel. »Du hast mich in so unzerreißbare Bande geschlagen, daß mir noch nie solch harter Zwang auferlegt wurde. Soviel ich aber auch nachdenke, ich komme nicht darauf, was du davon hast! Erlasse mir das, wozu du mich zwingen willst, denn es bringt dir ja doch keinen Nutzen!«
Der Richter aber beharrte auf seinem Willen: »Ich denke nicht daran! Ich will mit eigenen Augen sehen, wie es ist, wenn jemand dem Teufel verfällt, was immer mir geschehen mag!«
Da meinte der Teufel achselzuckend: »Nun gut, so sollst du deinen Willen haben. Es bedrückt und verdrießt mich aber, daß du so hartnäckig darauf bestehst Wärest du klug, so ließest du die Finger davon. Du weißt doch, daß zwischen dem Menschengeschlecht und uns teuflischen Geistern ewige Feindschaft besteht. Es gibt keine Versöhnung, und es könnte dir leicht etwas zustoßen, wenn du mich nicht meiner Wege ziehen läßt!«
Da lachte der Richter. »Du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen, daß ich auf deiner Begleitung bestehe. Wann immer dir heute etwas aus freien Stücken überliefert wird, will ich dabei sein und zusehen, wie du es ergreifst, selbst wenn ich selber dabei Haare lassen sollte. Ich denke nicht daran, dich zu entlassen. All dein Gerede ist vergeblich!«
»Brauchst nicht gleich zornig zu sein!« murrte der Böse. »Du wirst schon merken, wie das zugeht!«
Der Richter aber war vor Schadenfreude ganz erwartungsvoll, denn er konnte sich nichts Ergötzlicheres vorstellen als das nie erlebte Schauspiel einer Höllenfahrt.
So begaben sich die beiden gemeinsam in die Stadt. Da Markttag war, wimmelte es von Leuten. Als man den Richter daherkommen sah, reichte man ihm allenthalben den Becher. Da niemand seinen Begleiter kannte, bot man ihm keinen Trunk, so daß der Richter ihm selbst einen Becher reichte. Der Teufel aber lehnte ab.
Nun geschah folgendes: Eine Frau ärgerte sich über ihr Schwein und trieb es voller Zorn vor das Haustor. Dabei wütete sie: »Fahr zum Teufel! Hoffentlich holt er dich noch heute!«
Der Richter hetzte eilfertig: »Nun mein Freund, greif dir das Schwein! Ich habe gehört, man schenkt es dir!«
Der Teufel aber lehnte ab: »Sie meint es leider nicht im Ernst. Wäre es so, griffe ich es herzlich gern. Doch wenn ich es wirklich mit mir nähme, täte es ihr leid.«
Und weiter schritten sie durch das Marktgewühl. Nun weiß ich nicht, was eine andere Frau an ihrem Rinde ärgerte, daß sie rief: »Hol dich der Teufel! Wenn er dich doch heute noch umbrächte!«
Wieder stachelte der Richter: »Du hörst doch, das Rind ist dein!«
»Wie neunmalklug!« meinte verdrießlich der Teufel. »Wenn ich es wirklich mit mir nähme, lebte sie ein ganzes Jahr in Trauer. Ich kann nichts darauf geben, wenn etwas unbedacht dahergeschwätzt wird, sofern es nicht wirklich ernst gemeint ist. Ich habe kein Recht auf das Rind!«
Wenig später zankte eine Frau ihr Kindchen aus: »Nie willst du auf mich hören! Wenn dich doch der böse Teufel holte!«
Der Richter stieß den Teufel an: »Los, nimm das Kind!«
»Ich habe kein Recht darauf«, knurrte der Teufel erbost. »Nicht einmal zweitausend Pfund Silbers brächten sie dazu, auf das Kind zu verzichten und es mir zu überlassen. Ich packte es herzlich gern, wenn ich nur dürfte.«
Weiter drängten sie sich durch die Marktbesucher, bis sie zur Mitte des Marktplatzes gekommen waren, wo das Gedränge am dichtesten war. Sie konnten nicht weiter und mußten stehenbleiben. Da schleppte sich ihnen eine kranke, alte, ganz von Kräften gekommene Witwe entgegen, die sich nur mit Mühe vorwärtsbewegen konnte und sich auf einen Stock stützen mußte. Als sie den Richter erblickte, brach sie in bittere Tränen aus und schluchzte: »O Richter, was hast du dir nur gedacht! Du bist steinreich, ich bettelarm. Dennoch hast du mir erbarmungslos, gegen alles göttliche und irdische Recht, mein einziges Kühlein aus dem Stall holen lassen, von dessen Milch ich armes Weib mein Leben gefristet habe! Ich bin zu krank und zu schwach, mir mein bißchen Brot um Gottes willen zusammenzubetteln. Du aber hast mich noch verspottet und verhöhnt! So flehe ich denn zu Gott beim Sterben Christi und bei dem furchtbaren Leid, das er in Menschengestalt für uns arme Erdenkinder auf sich nahm: Möge er mich armes Weib erhören und dich samt deiner Seele vom Teufel holen lassen!« Da wandte sich der Teufel hohnlachend an den Richter: »Die meint es ernst! Und nun sollst du etwas erleben!« Er packte ihn beim Schopf und riß ihn vor den Augen aller Marktbesucher mit sich empor in die Lüfte. Das mochte eine grauenvolle Reise sein, weit fürchterlicher, als wenn der Adler ein Huhn mit sich fortführt. Während der Teufel blitzschnell davonfuhr, starrten ihm alle wie vom Donner gerührt nach. Er verschwand irgendwo in der Ferne, und was dann passiert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Damit ist die Geschichte zu Ende.
DER RIESE
Einst gerieten zwölf Männer in einen finsteren Wald und verirrten sich darin. Dies sollte ihnen zum Unheil gereichen. In großer Eile hasteten sie vorwärts, bis sie endlich in tiefer Nacht einen Lichtschein erblickten. Unverzüglich gingen sie darauf zu und entdeckten ein Haus, in dem sich eine hübsche Frau befand. Nachdem sie das Haus betreten hatten, hörten sie fern im Wald einen Riesen. Er kam mit so fürchterlichem Gebrüll herbeigerannt, daß sie alle mutlos wurden.
»Weh mir!« rief die Frau. »Mein Mann wird euch umbringen! Klettert dort in den Verschlag hinauf! Ich will nicht, daß ihr in euer Verderben stürzt, und möchte euch gern retten, wenn ich nur einen Ausweg wüßte!« Damit ließ sie alle zu dem hochgelegenen Verschlag emporklimmen.
Als der Riese in das Haus gestürmt kam, fuhr er die Frau heftig an, wo die Menschen geblieben wären. Sie wollte sie aber nicht verraten und sagte: »Es ist niemand hier!«
Er jedoch schrie: »Wenn hier jemand sein sollte, werde ich rasch genug dahinterkommen!« Er suchte überall herum, bis er sie schließlich hoch oben stehen sah.
»Einen von euch muß ich unbedingt haben!« rief er hinauf.
»Werft ihn mir sofort herunter, oder ich bringe euch alle um!«
Da taten sie, was er von ihnen verlangte, und warfen den Schwächsten hinab. Im Handumdrehen hatte ihn der hinterlistige Menschenfresser verschlungen. Darauf schrie er wütend: »Gebt mir einen zweiten heraus!« Wiederum warfen sie ihm einen aus ihrer Mitte hinab, und er verschlang ihn mit Haut und Haar.
»Ihr kommt noch alle an die Reihe!« verhieß das gräßliche Ungeheuer. Einen nach dem anderen ließ er sich herabwerfen, um sie über dem Feuer zu braten, bis er ohne Gnade und Erbarmen alle außer einem einzigen umgebracht hatte. Dem befahl er, herunterzukommen. Doch jener hoch oben rief: »Dies wird nie geschehen!« – »Dann hole ich dich selbst«, brüllte der Riese, »denn ich will dich fressen!«
»Dagegen werde ich mich wohl zu wehren wissen!« erwiderte flugs der letzte der zwölf Männer.
»Hoho, dafür ist es nun zu spät!« hohnlachte der unersättliche Riese. »Ja, als ihr noch zu zwölft wart, hättest du dich zur Wehr setzen sollen. Dann hättest du dich retten können. Nun aber bist du mir gegenüber wehrlos!« Er sprang zu ihm hinauf und verschlang ihn wie die anderen.
So wie der Riese handelt ein habgieriger, mächtiger Edelmann, der ein anderes Geschlecht von seinem Besitz vertreiben will. Er beginnt mit den Feindseligkeiten bei dem schwächsten Manne. Wenn dann die anderen voller Furcht dessen Vertreibung hinnehmen, um sich nur selbst der Gunst des Mächtigen zu versichern, so überzieht er sofort den nächsten mit grimmer Fehde. Er verschont keinen einzigen und vertreibt sie allesamt. Keiner von ihnen bleibt ungeschoren, sie alle erleiden das gleiche Schicksal. Sobald sie auch nur einen aus ihrer Mitte verloren haben, wird ihre Kraft, sich zu wehren, geschwächt. Wer männlich-kühn seine Haut retten will, muß beizeiten zu den Waffen greifen und darf nicht zögernd abwarten, bis man ihn mit Übermacht überfällt. Ihm frommt viel mehr, wenn er sich rechtzeitig zur Gegenwehr entschließt, bevor ihn noch der Riese in die Knie zwingen kann. Ist es erst so weit, kommt jeder Widerstand zu spät.
DIE REICHE STADT
Es war einmal eine reiche und mächtige Stadt, in der die Bürger einander unablässig und völlig überflüssigerweise mit Neid und Mißgunst das Leben schwer machten. Einer haßte den anderen, ohne eigentlich zu wissen, warum. Plötzlich brach in einem Haus Feuer aus. Obwohl es alle anderen Bürger merkten, fing aus lauter Haß und Mißgunst niemand zu löschen an, bis schließlich ein zweites Haus Feuer fing. Auch jetzt begann man nur schwerfällig und widerwillig mit der Brandbekämpfung, so daß die Flammen schließlich auf ein drittes Haus übergriffen. Nun hätten sie allesamt das Feuer gern unter Kontrolle gebracht, doch es war schon zu spät. Es hatte schon soviel Nahrung gefunden, daß es mit unwiderstehlicher Wut auf die ganze Stadt übergriff und alle Häuser in Schutt und Asche sanken.
Den Bürgern dieser Stadt gleichen – wie mir scheint – die Bewohner eines Hauses, die einander ohne Grund und Rechtsursache feind sind und in sinnlosem Haß gegeneinander wüten. Der Hausherr nützt die Lage aus und fügt einem der Hausbewohner Schaden zu. Wer sich dann vor Schadenfreude kaum zu lassen weiß, muß damit rechnen, daß er unversehens selbst Grund zum Weinen hat. Wenn einer von ihnen Unrecht erfährt und die anderen ihm ihre Hilfe verweigern, so wütet der Hausherr bald wie eine Feuersbrunst. Dem einen spielt er in diesem Jahr übel mit, dem anderen im nächsten, und so geht es weiter. Wenn sie dann noch etwas retten wollen, so ist es zu spät. Der Herr hat an diesem Verfahren Geschmack gefunden und giert nach immer mehr, ob es ihnen nun gefällt oder nicht. Wie viele sie auch sein mögen, er vernichtet sie – gleich dem Feuer, das in der wohlhabenden Stadt wütete.
DER RATGEBER
Ein König war in hohem Ansehen zu Jahren gekommen. Er wurde so vom Glück begünstigt, daß ihm nie ein Leid widerfuhr. Alle seine Untertanen im ganzen Reich waren darauf bedacht, stets nach seinem Wunsch und Willen zu handeln. Dies war der Lohn seiner tüchtigen und wohlwollenden Regentschaft: Er erfüllte bereitwillig alle berechtigten Wünsche seiner Untertanen. Als der edle und gütige König starb, erreichte es sein Sohn, daß er sein Nachfolger wurde. In Erinnerung der vorbildlichen Regentschaft seines Vaters ordnete man sich ihm willig unter und war zu allen erforderlichen Diensten bereit. Dieses Entgegenkommen wurde jedoch von dem neuen König schlecht gelohnt. Voller Hochmut grüßte er keinen Menschen, und auch um das Wohl und Wehe seiner Untertanen kümmerte er sich keinen Deut. So geriet er in seinem ganzen Reich im Handumdrehen in solchen Verruf, daß er allenthalben auf Ablehnung stieß. Er war den Menschen so widerwärtig, daß die Bauern achtlos am Straßenrand sitzen blieben, wenn er an ihnen vorbeiritt, und als er darüber in Wut geriet, blieben sie erst recht bei ihrer Mißachtung. Als er im Zorn nichts erreichen konnte, bat er einen klugen Mann um Rat. Er solle ihm doch sagen, aus welchem Grund man ihm mit solcher Abneigung begegne und warum er den Menschen so zuwider sei.
Der Weise hob daraufhin an: »Herr, ich weiß sehr wohl, warum man Euern Vater so hoch in Ehren hielt und warum Ihr den Menschen so verhaßt seid. Euer Vater besaß einen Edelstein. Sobald der – von der Sonne angestrahlt – die Blicke der Untertanen auf sich zog, unterlag man dem geheimen Zwang, Euerm Vater mit der größten Ehrerbietung zu begegnen. Er trug ihn stets an seinem Hut. Wenn Ihr einverstanden seid, soll er in Zukunft Euern Hut zieren, dann kann Euch nichts mehr fehlschlagen. Euer Vater liebte diesen Stein, verdankte er ihm doch Ansehen und Glück. Ihr solltet Euch dazu entschließen, diesen Stein zu tragen. Denkt daran, daß mein Rat Euerm Vater oft genug zustatten gekommen ist, und heftet den Stein an Euern Hut. Im Grunde ist er noch viel wundertätiger, als ich es geschildert habe. Ich rate Euch, ihn fortan zu tragen, denn er sichert Euch Glück und die Ehrerbietung der Menschen. Wenn Ihr es wollt, so könnt Ihr ihn von mir haben.«
»Gib mir diesen Stein!« rief der junge König. »Ich will erproben, ob er wirklich so starke geheime Kräfte besitzt. Wenn er tatsächlich so heilbringend ist, wie Ihr versichert habt, so will ich ihn stets und immer bei mir tragen.«
Der einfallsreiche Ratgeber verließ den König und hieß, einen Edelstein von herrlicher Farbe zu beschaffen. Er ließ ihn von einem Goldschmied einfassen und an einem Hut befestigen. Dabei war er nicht knausrig, so daß sich der Edelstein in seiner Goldfassung ganz prachtvoll ausnahm und einem König wohl anstand. Er brachte ihn seinem Herrn und sprach: »Seht selber, ob ich die Wahrheit gesagt habe! Wenn Ihr diesen Stein tragt, so wird Euch jeder, der ihn erblickt, mit Achtung begegnen.«
Der Herrscher erwiderte: »Dann ist er ganz vortrefflich!« Er setzte sofort den Hut auf, schwang sich aufsein Pferd und ritt los. Zum Ratgeber, der ihn begleitete, meinte er: »Nun will ich erproben, ob du die Wahrheit gesprochen hast!«
»Herr«, sprach darauf der weise Ratgeber, »Ihr müßt aber Euer Haupt ein wenig neigen, damit alle Menschen den Stein auch deutlich erkennen. Dann werden sie Euch alle Glück wünschen und Euch Ehrfurcht entgegenbringen!«
Der König verfuhr so. Sobald er irgendwelchen Leuten begegnete, neigte er sein Haupt, so daß man sein Neigen für einen freundlichen Gruß hielt. Da zeigten sich alle Menschen sehr erleichtert. Sie dankten Gott im Himmel, sprangen auf und riefen: »Laßt uns die große Ehre preisen, die uns widerfahren ist. Gott hat den Sinn des Königs gewandelt, denn er hat uns seinen Gruß gegönnt! Gott hat bewirkt, daß er seine Überheblichkeit und Gleichgültigkeit endlich ablegt!« Alle zeigten sich angenehm berührt und erfreut von dem empfangenen Gruß.
Der König fand solches Gefallen an dem ehrerbietigen Betragen seiner Untertanen, daß er sich allen Menschen, die ihm begegneten, entgegenneigte, ob sie saßen, standen, ritten oder gingen. Als er vor ihnen allen sein Haupt beugte, gefiel dies den Leuten vortrefflich, und sie dankten Gott für den Sinneswandel des Königs. »Nun wollen wir auch unsere Klagen vorbringen. Er hat so häufig und so freundlich gegrüßt, daß er auch gegen Unrecht und Gewalttätigkeit einschreiten wird, mit denen wir in reichem Maße heimgesucht sind.«
Als sie so miteinander sprachen und der kluge Ratgeber davon hörte, sprach er zu dem König: »Herr, wenn Euch der Stein auch nur ein winziges bißchen wert ist, so sorgt dafür, daß er seine geheimen Kräfte nicht verliert. Ihr macht sie unwirksam, wenn Ihr Euch nicht so verhaltet, wie es erforderlich ist. Wenn jemand vor Euch tritt und über eine Gewalttat klagt, die ihm ein anderer wider alles Recht zugefügt hat, so müßt Ihr sogleich einen gerechten Urteilsspruch fällen. Tut Ihr dies nicht, so verliert der Stein seine geheimen Kräfte, und Ihr geratet überdies persönlich in arge Bedrängnis. Die Menschen würden Euch nicht mehr als Herrscher anerkennen, und wenn Ihr nicht zurücktretet, schlagen sie Euch tot. Selbst die geringsten Untertanen würden nach Eurem Leben trachten, und wenn der Stein Euch nicht mehr hilft, so hättet Ihr es gar mit den mächtigsten zu tun!«
Der Herrscher bat: »So steh mir bei und sage mir stets, was ich tun muß, um die verborgenen Gesetze des Steines nicht zu verletzen. Ich möchte ihnen stets entsprechen, damit er seine Kräfte nie verliert.«
»Sehr gern!« sprach der alte Ratgeber. Auf diese kluge Art brachte der weise Mann den König zu großem Ansehen und Ruhm. Er war ein gerechter Richter, zeigte sich seinen Untertanen gegenüber stets wohlwollend und hilfreich und starb schließlich in hohen Ehren.
Auch heute noch sollten kluge Ratgeber ihren Herren empfehlen, ihr Haupt zu neigen und den Edelstein zu zeigen, und die Regenten sollten dem jungen König nacheifern. Niemand erringt den Segen Gottes, er verdiene ihn denn durch barmherzige Taten an den Armen. Voll Mitgefühl möge er ihre Klagen anhören, sich ihnen wohlwollend zeigen und ihnen getreulich helfen. Solches Verhalten ist wie der kostbare Edelstein, der je aus goldener Fassung strahlte. Verlangt jemand nach einem gerechten Richterspruch, so soll er sich Gott zu Ehren bereitfinden und ihn nach bestem Wissen fällen, dann behält der Edelstein seine Kraft. Wer ungerecht Urteile fällt, muß dies dereinst teuer bezahlen, denn am Jüngsten Tag wird ihm die Königskrone vom Haupt geschlagen, und er verliert unweigerlich sein Königreich. So wie er sich hier auf Erden um die Klagen der Armen kümmerte, wird er dereinst nach dem Tode beurteilt werden. Wenn ein christlicher Richter den Qualen der Hölle entgehen will, muß er die Sache derjenigen, die seinen richterlichen Spruch suchen, gerecht entscheiden. So wie er das Recht auf Erden pflegt, wird im Jenseits über ihn gerichtet werden.
VON EINEM JUNGEN RATGEBER
Ein König hatte einst einen Ratgeber von fürstlichem Rang, an dessen Rat er sich stets hielt. An Untertanen, Burgen und Ländereien nannte dieser Ratgeber so viele sein eigen, wie es seinem fürstlichen Stand entsprach. Der König wußte seinen klugen Rat zu schätzen, denn er gereichte ihm zum Vorteil und erhöhte sein Ansehen. Der Ratgeber war in jeder Hinsicht vom Glück begünstigt, und es fehlte ihm weiter nichts als die Jugend. Er hatte alle charakterlichen Vorzüge, die den Ruhm eines Edelmannes begründen. Daher besaß er die Zuneigung des Königs, der ihm – wäre es sein Eigen gewesen – ohne Zögern alles Gold der ganzen Welt anvertraut hätte, und man kann sicher sein, daß der Ratgeber diese Schätze nur zum Vorteil und zur Ehre seines Königs verwendet hätte. So lebte er denn ehrenfest und in hohem Ansehen bis an den Tag, da ihn der Tod hinwegnehmen sollte. Noch an seinem letzten Erdentag ließ er seine Klugheit erkennen, denn er bat seinen Herrscher zu sich und sprach zu ihm: »Herr, ich habe Euch zu mir gebeten, weil mein Ende naht und ich mein Lehen und allen mir anvertrauten Besitz in Eure Hände zurücklegen will. Ich habe alles gut verwaltet, und Ihr werdet mir beipflichten müssen, daß es noch weit mehr ist, als Ihr glaubt. Es ist aber nur recht und billig, daß alles wieder in Eure Hände gelangt, denn ich habe es nur dank Eurer Gnade hüten und mehren können. So gebe ich Euch alles gern und willig zurück, was immer Ihr damit tun mögt. Nehmt also meinen Sohn und all mein Eigentum – Burgen, Untertanen und Ländereien – in Besitz. Ach, alles, was mich nun erwartet, bedrückt mich nicht so sehr wie die Tatsache, daß ich Euch verlassen muß. Mein größtes Glück war stets, an Eurer Seite zu weilen, Euch sehen und Eure Stimme hören zu können. Alle Wohltaten, die ich in meinem Leben empfangen habe, habt Ihr mir erwiesen. Daß ich nicht mehr bei Euch sein soll, verdoppelt meinen Todesschmerz. Doch quält mich auch die Ungewißheit, wie es meinem Sohn ergehen wird. Wenn Ihr Euch seiner nicht – in dankbarer Erinnerung an mich – freundlich annehmt, so ist es um ihn geschehen. Mein letzter Rat an Euch sei schließlich, mein Amt nur einem Manne anzuvertrauen, der sich durch große Weisheit und Lebenserfahrung auszeichnet.«
Da sprach der König: »Diesen Rat nehme ich nicht an. Du hast an mir stets so redlich und uneigennützig gehandelt, daß ich um meine Verpflichtung wohl weiß und es deinen Kindern lohnen will. Du hast mir so selbstlos gedient, daß ich dafür deinen Sohn erhöhen werde. Er soll mir Ersatz sein für dich, denn er wird gewiß die gleichen Tugenden aufweisen wie sein Vater.«
»Nein, mein Herrscher, er ist noch zu jung«, widerriet der getreue Ratgeber, »und wenn seine Lebenserfahrung nicht ausreicht, wird er bei Euch unweigerlich in Ungnade fallen. Damit wäre sein Schicksal besiegelt. Daher solltet Ihr es gar nicht erst riskieren!«
»Schweigt still!« schnitt ihm der König das Wort ab. »Weiß Gott, ich bin froh, daß ich ihn habe.« Er nahm Abschied von seinem Getreuen, dem bald darauf der Tod die Augen schloß. Sein Sohn aber richtete dem edlen Toten ein so prachtvolles Begräbnis aus, daß man ihn allenthalben dafür lobte. Wer immer Zeuge wurde, wie hoch er Gott und seinen Vater ehrte, der wußte des Rühmens kein Ende. Man berichtete dem König, daß selbst er sich kein ehrenvolleres Begräbnis wünschen könnte. Der König aber freute sich von Herzen, daß man den Sohn seines toten Ratgebers so günstig beurteilte, und er meinte: »Ich wußte doch, daß er ein ebenso hervorragender Mann ist wie sein Vater! Ich will ihm meine Staatsgeschäfte anvertrauen und ihn zu meinem ersten Ratgeber machen.« Kurzerhand schickte er zu dem Jüngling einen Boten, der ihm mitteilte, daß ihn der König in das Lehen und in alle Rechte seines Vaters einsetze.
Er war noch nicht lange in seinem Amt, da brach eine so furchtbare Hungersnot herein, wie sie das Reich noch nie erlebt hatte. Nun hatte sein Vater in den königlichen Vorratshäusern viel Korn gespeichert, um kriegerischen Einfällen anderer Könige und eventuellen Hungersnöten vorzubeugen, wie schwer die Heimsuchungen auch sein mochten. Die vornehmsten Edlen des Reiches stellten dem jungen neuen Ratgeber ihr Elend und ihre Verzweiflung vor Augen. Sie wüßten nicht mehr, wovon sie leben sollten, und sie müßten das Land verlassen, wenn ihnen nicht über dieses schlimme Jahr geholfen würde. Da beruhigte er sie, sie sollten ohne Sorge an ihrem Platz verharren, er wolle ihnen schon ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, und dies so lange, bis das schlimme Jahr vorüber oder das Korn aus den königlichen Speichern erschöpft sei. Vor Dankbarkeit fielen sie vor ihm auf die Knie und küßten seine Hände. Er aber ließ Speicher für Speicher leeren, bis alles Korn verzehrt war, um alle die zu retten, die des Reiches Ruhm mehrten und dem König treu ergeben waren. Alle glaubten, daß im folgenden Jahr solch eine Hungersnot nicht wieder zu befürchten sei.
Aber ihre Hoffnung sollte sich als trügerisch erweisen, denn als das Jahr vorbei und die Kornspeicher des Königs erschöpft waren, begann ein dreimal so schlimmes Hungerjahr.
»Nun kann uns niemand mehr vor dem grimmen Tode erretten!« sprachen die Edlen des Landes. Da begütigte der junge Ratgeber: »Ich will euch helfen, wenn es nur irgend möglich ist!« Er öffnete die Schatzkammer des Königs und holte den königlichen Schatz hervor. Nun sandte er Boten in alle umliegenden Reiche, um Korn einzukaufen, und er nahm so lange von dem Schatz, bis er erschöpft war. So ging auch dieses schlimme Jahr zu Ende, und es folgte ein so fruchtbares Jahr, daß man allenthalben meinte, noch nie ein Jahr so voller Überfluß erlebt zu haben.
Nun hört aber, was die gehässigen und gewissenlosen Neider für Gerüchte in die Welt setzten, als sie sahen, wie er den Schatz des Königs aufbrauchte und hinweggab. Sie gifteten: »Da haben wir es! Nun wird es den König reuen, das große Lehen uns selbstlosen und ehrenfesten Männern vorenthalten und es einem leichtfertigen Narren überlassen zu haben, der sein ganzes Korn verschwendet hat und jetzt auch noch seinen Schatz verjubelt. Dafür muß er ihn zur Rechenschaft ziehen! Wollen wir dem König ein Licht aufstecken?«
Die Verschlagensten aber widerrieten: »Aber nein doch! Wir wollen im Gegenteil froh sein über den Schaden, den er dem König zufügt. Der wird über den Verlust des Schatzes noch mehr wüten als über den des Kornes. Laßt erst den ganzen Schatz in alle Welt hinaustragen. Erst danach wollen wir dem König reinen Wein einschenken. Wenn er dann in Wut gerät, so wird er den Verlust des Schatzes und des Kornes um so fürchterlicher rächen.«