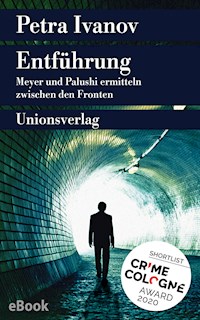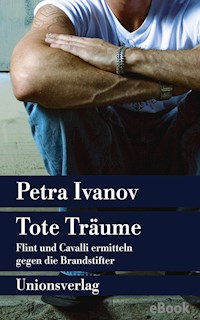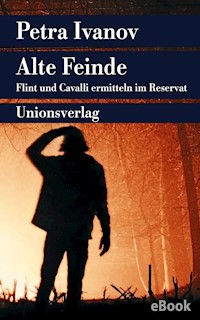
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Haus des erschossenen Albert Gradwohl macht die Spurensicherung eine seltsame Entdeckung: Die abgefeuerte Patrone stammt aus einer Waffe des amerikanischen Bürgerkriegs, ein Original aus dem 19. Jahrhundert. Die Hinweise führen die Staatsanwältin Regina Flint in die USA. Dort ermittelt bereits Bruno Cavalli in einem Cherokee-Reservat in den Smoky Mountains. Er soll einen Killer stellen, der seine Opfer mit vergifteten Pfeilen tötet. Doch schon seit Monaten hat Cavalli kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Auf der Suche nach ihm stößt Regina Flint auf mysteriöse Hinweise, die sie tief in die Vergangenheit führen. Erst als sich ihre Ermittlungen kreuzen, finden die beiden wieder zueinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Mord mit einer Waffe aus dem amerikanischen Bürgerkrieg führt die Staatsanwältin Regina Flint in die USA. Dort ermittelt bereits seit Monaten Bruno Cavalli in einem Reservat in den Smoky Mountains – ohne jegliches Lebenszeichen. Auf der Suche nach ihm stößt Regina Flint auf mysteriöse Hinweise, die sie tief in die Vergangenheit führen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Petra Ivanov verbrachte ihre Kindheit in New York. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz absolvierte sie die Dolmetscherschule und arbeitete als Übersetzerin, Sprachlehrerin sowie Journalistin. Ihr Werk umfasst Kriminalromane, Thriller, Liebesromane, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Kolumnen.
Zur Webseite von Petra Ivanov.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Petra Ivanov
Alte Feinde
Kriminalroman
Ein Fall für Flint und Cavalli (8)
E-Book-Ausgabe
Mit 2 Bonus-Dokumenten im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 5 Dokumente
© by Petra Ivanov 2018
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Tim Scharner (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31009-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 09:40h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ALTE FEINDE
1 – North Carolina, 9. April2 – Zürich, 26. Juli3 – North Carolina, 9. April4 – Rhodes Island, 6. Mai 18615 – Zürich, 27. Juli6 – Zürich, 27. Juli7 – Virginia, 15. April 18628 – North Carolina, 13. April9 – Zürich, 29. Juli10 – 29. Juli 201611 – Zürich, 1. August12 – Chickahominy River, 1. Juni 186213 – North Carolina, 17. April14 – North Carolina, 5. Mai15 – Richmond, 3. Juni 186216 – Zürich, 4. August17 – Andersonville, 29. Juli 186418 – Zürich, 9. August19 – North Carolina, 18. Juni20 – North Carolina, 16. Juli21 – Zürich, 12. August22 – Washington, 10. November 186523 – Washington, D. C., 14. August24 – Providence, 24. Juni 200525 – Asheville, 15. August26 – Asheville, 16. August27 – Georgia, 16. August28 – Baltimore, 10. Januar29 – Georgia, 16. August30 – North Carolina, 16. August31 – Baltimore, 17. August32 – Baltimore, 17. August33 – Bern, 24. Juni34 – Robbinsville, 18. August35 – Cherokee, 18. August36 – Robbinsville, 19. August37 – Zürich, 27. Juli38 – Robbinsville, 19. August39 – Cherokee, 20. August40 – EpilogDankeMehr über dieses Buch
Petra Ivanov: Making of »Alte Feinde«
Petra Ivanov: »Die Bühne muss stimmen!«
Über Petra Ivanov
Petra Ivanov: »Meine Figuren sind lebendig. Wenn ich nicht schreibe, verliere ich den Kontakt zu ihnen.«
Petra Ivanov: »Mein Weltbild hat sich zum Besseren verändert, seit ich Krimis schreibe.«
Mitra Devi: Ein ganz und gar subjektives Porträt von Petra Ivanov
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Petra Ivanov
Zum Thema Schweiz
Zum Thema USA
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Indianer
Für meine Mutter
»Es war ein bewegendes Erlebnis,in Andersonville erstmals den Namen Henry Wirzauf Denkmal, Erinnerungstafeln, Druckschriften undim Ortsmuseum zu lesen.«
Heinrich L. Wirz, Oberst und Militärpublizist, Bern
1
North Carolina, 9. April
Der Geruch fiel Bruno Cavalli zuerst auf. Eben war da noch der Duft nach Steak, Süßkartoffeln und geschmolzener Butter. Nun drängten Abgas und Feuchtigkeit in den Raum. Er versuchte herauszufinden, woher der Geruch kam, vergeblich.
Das Granny Bee’s war bis auf den letzten Platz besetzt. Die meisten Gäste in dem Familienrestaurant waren Einheimische, nur wenige Touristen besuchten um diese Jahreszeit das Reservat der Cherokee-Indianer oder den angrenzenden Nationalpark. Cavalli betrachtete Emma Longhorn. Mit ihrem schwarzen Haar und dem dunklen Teint fiel sie hier nicht auf. Doch der nervöse Blick, mit dem sie immer wieder hinter sich schaute, passte nicht zu der gedämpften Stimmung im Lokal.
»Wie lange wird es noch dauern?«, fragte sie.
»Er kann heute auftauchen, vielleicht aber auch erst morgen oder in einer Woche«, sagte Cavalli. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das FBI wird dich nicht aus den Augen lassen.«
Emma schob eine Kartoffel auf ihrem Teller hin und her. »Die Agenten verstecken sich gut. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich nicht glauben, dass sie hier sind.«
Cavalli teilte ihre Meinung. Als Polizist hatte er oft Personen observiert, doch er bezweifelte, dass es ihm gelingen würde, über Tage hinweg völlig unbemerkt zu bleiben. Vor allem, wenn die Zielperson Bescheid wusste. Er gab sich Mühe, seine Unruhe zu verbergen. Vor zwei Tagen hatte er Emma sagen müssen, dass ein Killer hinter ihr her war. Sie hatte erstaunlich ruhig reagiert, unter ihren Augen lagen jetzt aber dunkle Schatten.
Die Schwingtür ging auf, und die Kellnerin trat aus der Küche, ihr Arm schwer beladen mit Tellern, die bis zum Rand gefüllt waren. Sie bahnte sich einen Weg durch den Raum und blieb am Tisch nebenan stehen. Die sechsköpfige Familie, die dort saß, verstummte erwartungsvoll. Da hörte Cavalli das leise Rauschen des Oconaluftee Rivers, der am Restaurant vorbeifloss. Er blickte zum Eingang. Stand ein Fenster offen? Kaum hatte sich die Kellnerin abgewandt, nahmen die Gäste das Gespräch wieder auf. Besteck klapperte, jemand rief nach Ketchup.
Emma legte die Gabel auf den Tisch. »Ich kann nicht essen.«
»Wenn er merkt, dass wir etwas ahnen, wird er untertauchen«, sagte Cavalli. »Du musst dich so normal wie möglich verhalten.«
»Vielleicht hat er gar nicht mich im Visier. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Jeder hier im Reservat könnte das nächste Opfer sein.«
Cavalli war jetzt klar, dass er sie mit einem Teil der Wahrheit konfrontieren musste. »Ist dir der Anakonda-Plan ein Begriff?«
»Aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg?«
Cavalli nickte. »Die Nordstaaten wollten die Südstaaten isolieren. Sie errichteten Blockaden, schnitten Handelswege ab, sperrten Straßen. Wie eine Würgeschlange, die ihre Beute umwickelt. Daher der Name Anakonda.«
»Was hat der Bürgerkrieg mit dem Killer zu tun?«
»Der Killer macht dasselbe. Er hat nichts gegen Indianer, wie ich ursprünglich vermutet hatte. Nur gegen einen. Er zieht einen weiten Kreis um sein Opfer. Langsam und bedacht. Er muss schon vor …« Cavalli verstummte.
»Was ist?« Emma riss die Augen auf. »Ist er hier?«
Er gab ihr ein Zeichen zu schweigen und neigte den Kopf. Etwas im Raum hatte sich verändert. Doch was? Auf den ersten Blick wirkte alles gleich, dann merkte Cavalli, dass einer der Gäste am Nebentisch ein wenig zu interessiert auf einen Punkt hinter ihm starrte. Und auch das junge Paar, das vor der Theke am Eingang auf einen freien Tisch wartete.
Schlagartig fügten sich die Teile zu einem Ganzen. Das Rauschen des Flusses. Der Geruch von Abgas. Die Blicke.
Der Liefereingang war offen.
Ein FBI-Agent hätte sich nicht hereingeschlichen. Er hätte sich unter die Gäste gemischt, um den Raum im Auge zu behalten. Cavalli sprang vom Stuhl und riss Emma zu Boden. Ein Wasserglas kippte, Eiswürfel rutschten über den Tisch. Emma schrie überrascht auf. Der Schrei brach jäh ab, als sich ein Gegenstand in ihre Stuhllehne bohrte.
Ein Pfeil.
Cavalli wusste, dass er aus einem Blasrohr stammte und mit Gift getränkt war. Beta-Antiarin, ein Pfeilgift, das noch stärker wirkte als Curare. Sieben Milligramm reichten, um einen Herzstillstand herbeizuführen. Cavalli packte Emma am Arm, zerrte sie auf die Füße. Die Gäste saßen wie benommen auf ihren Stühlen. Auf einmal begann Lynne Swimmer vom Souvenirladen zu kreischen, und Chaos brach aus. Zwei Frauen sprangen auf, stießen zusammen. Eddie Sheppard von der Handelskammer schnappte seine Tochter und schob sie hinter sich. Gäste strömten zur Tür, Geschirr fiel zu Boden, Fenster wurden aufgerissen. Die alte Thelma Binney stürzte, Darrell, der jüngste der drei Beaver-Brüder, eilte ihr zu Hilfe.
Wo blieben die Spezialeinheiten?
Emma grub ihre Finger in Cavallis Arm. Aus der Küche drang Rauch. Ein Schatten tauchte neben dem Liefereingang auf. Cavalli hörte das Knirschen von Glasscherben. Vorsichtige Schritte, leise Atemzüge.
Er erwartete Agenten in Schutzausrüstung. Sie kamen nicht. Kurz überlegte er, was schiefgelaufen sein konnte. Darüber würde er sich später den Kopf zerbrechen. Jetzt musste er Emma in Sicherheit bringen.
Ihr Blick jagte hin und her. Sie hatte den Schatten ebenfalls gesehen. Cavalli zeigte zur Küche und begann, mit den Fingern zu zählen. Auf drei rannten sie los.
Cavalli hörte ein Scheppern, spürte einen Ruck, als Emma stolperte. Die Küche war verlassen, auf dem Herd stand eine Pfanne, aus der Rauch quoll. Cavalli schob das Fenster auf und half Emma hinaus. Sie verschwand in der Dunkelheit. Cavalli sprang ebenfalls hinaus, lief ihr hinterher, hielt sie zurück. Niemand folgte ihnen. Also wartete der Täter draußen. Emmas Ford stand auf dem Parkplatz hinter dem Restaurant. Um den Wagen zu erreichen, mussten sie das Gebäude umrunden. Das Granny Bee’s lag zwischen dem Fluss und einer steilen Böschung, die zum Wald hinaufführte. Für den Killer wäre es ein Leichtes, sich dort zu verstecken.
Cavalli stieg wieder durchs Fenster. Emma folgte ihm. Vorsichtig spähte er um die Ecke. Stühle lagen auf dem Boden, Tische standen schräg im Raum. Einige Gäste hatten Taschen oder Kleidungsstücke zurückgelassen.
Cavalli bedeutete Emma, hinter ihm zu bleiben. Leise betrat er das Restaurant. Er hörte Emmas Atem neben seinem Ohr, spürte die Hitze, die von ihr ausging. Der Liefereingang lag direkt gegenüber, am Ende eines schmalen Flurs, in dem sich auch die Toilette befand. Die Tür stand leicht offen. Cavalli sah kein Blasrohr. Er gab Emma ein Zeichen, stehen zu bleiben, und lauschte. Nichts.
Ob sie es zum Ford schaffen würden? Der Wagen stand nur wenige Schritte vom Ausgang entfernt, keine Straßenlaternen beleuchteten den Parkplatz. Es klimperte, als Emma ihren Autoschlüssel hervorholte. Sie hatten bereits die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als er es hörte. Ein Rascheln im Gebüsch, ein Zweig, der knackte. Emma rannte los. Cavalli blieb nichts übrig, als ihr zu folgen. Solange sie rannte, war sie sicher. Nur ein hervorragender Schütze traf ein bewegliches Ziel in der Dunkelheit. Allerdings wusste der Killer, wohin sie lief. Wenn er geschickt war, zielte er bereits auf die Fahrertür ihres Wagens.
Um ihn abzulenken, spurtete Cavalli quer über den Platz. Er hörte, wie Emma die Autotür zuschlug, dann heulte der Motor auf. Die Räder spulten auf dem Kies, die Reifen griffen, der Ford setzte zurück. Cavalli rannte zur Beifahrertür.
Er hatte sie fast erreicht, als die Scheinwerfer des Fords die Böschung streiften. Metall blitzte auf. Kein Blasrohr. Eine Pistole. Sie war auf die Windschutzscheibe gerichtet.
Cavalli hatte keine Zeit zu überlegen. Er trat zwischen Waffe und Wagen. Der Killer feuerte.
Die Kugel traf ihn mit der gleichzeitigen Erkenntnis, dass er die ganze Zeit einer falschen Fährte gefolgt war.
2
Zürich, 26. Juli
Das Einschussloch befand sich mitten auf der Stirn des Toten. Martin Angst presste ein Stück Fließpapier auf die Wunde, um Schmauchspuren zu sichern. Staatsanwältin Regina Flint schaute schweigend zu. Auf dem weißen Schutzanzug des Kriminaltechnikers hatten sich Schweißflecken gebildet. Am Nachmittag war das Thermometer auf über dreißig Grad geklettert, und auch jetzt, fast zwei Stunden nach Sonnenuntergang, war es außergewöhnlich warm. Trotzdem hatten sich erst wenige Fliegen auf der Leiche niedergelassen. Der Todeszeitpunkt lag höchstens zwei bis drei Stunden zurück, vermutete Regina. Eher weniger. Sie betrachtete die Leiche. Sie schätzte den Mann auf Anfang siebzig. Die Wade, die aus dem hochgerutschten Hosenbein schaute, war kräftig, die Haut gebräunt. Beide Augenbrauen waren angesengt. Neben dem Toten lag ein Pfirsich.
»Habt ihr eine Waffe gefunden?«, fragte sie.
»Nein.«
»Also war es kein Suizid?«
»Sieht nicht danach aus, nein.« Angst fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn, stand auf und reichte einem Kollegen das Fließpapier.
»Was ist mit den Augenbrauen des Mannes geschehen?«, fragte Regina.
»Vermutlich kam es bei der Schussabgabe zu einer Stichflamme.«
Regina hatte schon vieles gesehen, das aber nicht.
»Der Abstreifring passt zu einem relativen Nahschuss«, sagte Angst. »Aber auch dann sind die Schmauchspuren nicht normal.«
»Habt ihr die Hülse gefunden?«
Er schüttelte den Kopf.
Ob der Täter sie mitgenommen hatte? Regina betrachtete den Parkettboden. Der Tote lag im Wohnzimmer, zwischen einem Lesesessel und einer Standuhr. Viel Blut war nicht geflossen. »Steckschuss?«
»Vermutlich. Eine andere Erklärung finde ich nicht.« Angst schien darüber genauso erstaunt wie Regina. Aus einer so kurzen Distanz trat das Projektil in der Regel hinten am Kopf wieder aus. »Vielleicht war es ein kleines Kaliber«, meinte er.
Regina hörte ihm an, dass er selber nicht daran glaubte.
Er kniete sich wieder hin und begann, Fingernagelschmutz zu sichern. Der Tatort war bereits fotografiert und vermessen worden, noch war der Rechtsmediziner aber nicht eingetroffen.
»Weißt du, wer heute Brandtour hat?«, fragte Regina.
»Uwe Hahn, glaube ich.«
Regina mochte den Arzt. Er neigte zwar zu langen Ausschweifungen, seine Schlussfolgerungen waren aber nachvollziehbar, seine Gutachten hervorragend.
Eine junge Frau betrat den Raum. Mit ihren blassen Augen, den langen Gliedern und der gewölbten Stirn sah sie aus wie eine weibliche Ausgabe von Uwe Hahn. Regina fiel ein, dass der Rechtsmediziner über die Berufswahl seiner Tochter Sabine geklagt hatte. Stets hatte er versucht, den Tod von seinen vier Töchtern fernzuhalten. Er nahm keine Unterlagen mit nach Hause, sprach selten mit seiner Familie über die Arbeit, dennoch hatte Sabine beschlossen, in seine Fußstapfen zu treten. Regina ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu.
»Regina Flint, von der Staatsanwaltschaft IV. Sie müssen Sabine Hahn sein.«
Die Assistenzärztin schüttelte ihr die Hand. »Die Verwandtschaft ist kaum zu übersehen, ich weiß. Wir haben uns schon einmal getroffen. Vor drei Jahren, als mein Vater nach dem Herzinfarkt operiert wurde.«
Regina dachte daran, wie sie mit Hahns Familie im Warteraum gesessen und um das Leben des Kollegen gebangt hatte. »Tut mir leid, an Ihr Gesicht erinnere ich mich nicht. Ich konnte damals nur an Ihren Vater denken.«
»Wir haben uns beim Vornamen genannt.« Sabine Hahn lächelte. »Bleiben wir doch dabei.«
Während Angst die Rechtsmedizinerin auf den neusten Stand brachte, verließ Regina das Wohnzimmer, um mit dem Brandtouroffizier der Kantonspolizei zu sprechen. Hans-Peter Thalmann stand vor dem Eingang des Reihenhauses und telefonierte.
Als er Regina sah, legte er auf und schob seine Brille die Nase hoch. Er erklärte ihr, dass der Tote Albert Gradwohl hieß. »Pensioniert, einundsiebzig Jahre alt. Wohnt allein. Die Nachbarin hat den Schuss gehört und die Polizei verständigt.« Er wirkte kurz angebunden.
»Hat sie etwas gesehen?«, fragte Regina.
»Nein. Sie war in der Küche, behauptet sie.«
»Wie gelangte der Täter ins Haus?«
»Die Schiebetür zur Terrasse stand offen. Vermutlich kam er durch den Garten. Das FOR ist dort noch nicht fertig. Bald wissen wir mehr.«
Der Kleintransporter des Forensischen Instituts stand vor dem Haus. Ein Kriminaltechniker, den Regina nicht kannte, lud Kisten aus. Schaulustige hatten sich auf der Zufahrtsstraße versammelt. »Gibt es noch andere Zeugen?«
»Bis jetzt nicht. Ein Spazierweg führt unten am Haus vorbei, doch er ist nicht beleuchtet. Dahinter befinden sich nur Felder. Es ist einfach, unbemerkt in den Garten zu steigen, vor allem im Dunkeln. Der Weg ist weder durch eine Hecke noch durch einen Zaun abgetrennt.«
Regina betrachtete die Umgebung. Fünf Reihenhäuser säumten die Straße, Gradwohl bewohnte das Eckhaus. In einem Unterstand befand sich ein Chevrolet, der Briefkasten im Vorgarten war mit »U. S. Mail« beschriftet. In der Ferne war die Autobahn zu hören.
Thalmanns Telefon klingelte. Er schaute aufs Display und entschuldigte sich. Regina kehrte ins Haus zurück. Martin Angst und Sabine Hahn arbeiteten Seite an Seite, sie unterhielten sich über die Verteilung der Verbrennungspartikel auf der Haut des Toten.
»Wisst ihr schon, ob er stand oder saß, als er erschossen wurde?«, fragte Regina.
Angst zeigte auf die Oberschenkel des Opfers. »Siehst du diese feinen Blutspritzer? Ich denke, der Mann lag auf den Knien. Aber sicher wissen wir das erst, wenn wir den Tatablauf rekonstruiert haben.« Der 3-D-Laserscanner stand auf einem Stativ neben dem Sofa.
Regina runzelte die Stirn. »Das Ganze erinnert mich an eine Hinrichtung.«
Martin Angst und Sabine Hahn tauschten Blicke, dann nickte die Rechtsmedizinerin. »Der Gedanke ist mir auch gekommen.«
Angst stand auf und zog die Handschuhe aus. »Ich bin hier fertig, er gehört dir.«
Regina ging neben Sabine Hahn in die Hocke.
Die Rechtsmedizinerin entkleidete die Leiche und suchte nach weiteren Verletzungen. »Die Totenstarre hat noch nicht eingesetzt. Der Todeszeitpunkt liegt demnach nicht länger als drei Stunden zurück. Eher weniger, schätze ich.«
»Passt zum Notruf. Er ging um 21.56 Uhr ein.«
Sabine Hahn überprüfte die Muskelreize, anschließend untersuchte sie die Körperöffnungen. Als sie die Temperatur vom Thermometer ablas, nickte sie. »Zwei Stunden, das kommt hin.«
Regina schmunzelte. Rein äußerlich waren sich Sabine und ihr Vater vielleicht ähnlich, doch da hörten die Gemeinsamkeiten bereits auf. Uwe Hahn äußerte keine Vermutungen, und wenn er einen Befund erklärte, verstand Regina oft nur die Hälfte dessen, was er sagte.
Von draußen hörte sie aufgeregte Stimmen. Sie verließ das Wohnzimmer, um nachzusehen, was los war. Ein älteres Paar stand neben dem Briefkasten und redete auf einen uniformierten Polizisten ein, der ihnen den Weg versperrte.
»Ist Albert etwas zugestoßen?«, fragte die Frau. »Bitte, lassen Sie uns durch! Wir sind mit ihm befreundet!«
Regina stellte sich vor. »Wie gut kannten Sie Herrn Gradwohl?«
»Wir wohnen dort drüben.« Der Mann zeigte auf das zweitletzte Reihenhaus. »Wir sind zur gleichen Zeit wie Albert eingezogen, vor gut elf Jahren.«
»Was ist mit ihm?«, fragte die Frau erneut.
»Es tut mir leid«, sagte Regina. »Es wurde auf ihn geschossen.«
»Geschossen?«, stieß die Frau aus. »Auf Albert?«
»Ist er …?« Der Mann starrte sie mit aufgerissenen Augen an.
»Es tut mir leid«, wiederholte Regina.
Die Frau schlug sich die Hand vor den Mund.
»Die Polizei wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen einige Fragen über Herrn Gradwohl zu stellen«, sagte Regina.
»Natürlich, was immer Sie wollen!« Der Mann rieb sich das Gesicht. »Wissen Sie schon, wer es war?«
Regina lächelte vage und sah zu dem uniformierten Polizisten hinüber. »Würden Sie bitte die Personalien der beiden aufnehmen?«
Der Polizist holte ein iPad hervor. Im Kastenwagen des FOR brummte ein Föhn, mit dem ein Kriminaltechniker die mit Weinsäure getränkten Fließblätter trocknete. Nebenan ging die Tür auf, und Heinz Gurtner kam heraus. Regina seufzte leise. Von allen Sachbearbeitern beim Dienst Leib/Leben war Gurtner derjenige, mit dem sie sich am schlechtesten verstand. Sie fand seine Sprüche geschmacklos, seine Launen unberechenbar.
Er entdeckte Regina und kam auf sie zu. Mit seiner Körperfülle glich er einem Dampfschiff, das durchs Wasser pflügte.
»Weiß die Nachbarin etwas?«, fragte sie.
»Dienstags findet der Jass-Stammtisch statt. Oben im Dorf, im Bären. Der Mann der Nachbarin geht jede Woche hin, genau wie Gradwohl. Kurz nach halb zehn hat sich Gradwohl verabschiedet. Der Nachbar blieb noch auf ein Bier.« Gurtner befeuchtete den Daumen und blätterte seine Notizen durch. »Circa eine Stunde später hat die Frau einen Wagen gehört. Dachte, jemand habe ihren Mann nach Hause gefahren, manchmal trinkt er einen über den Durst. Sie ging zur Tür, sah, wie ein dunkler Wagen davonfuhr. Ein Japaner, vermutet sie. Mit Aargauer Kennzeichen. Die letzten Ziffern sind Zwei und Fünf.«
»Hat sie den Wagen schon vorher gehört, als er ankam?«
»Nein, sie hat sich einen Film angeschaut.«
»Der Täter könnte sich also während Gradwohls Abwesenheit unbemerkt ins Haus geschlichen haben.«
»Jawohl.« Gurtner fischte mit der Zunge etwas zwischen den Zähnen hervor.
»In welcher Stimmung war Gradwohl, als er das Restaurant verließ?«
»Wie immer, meinte der Mann. Gut gelaunt, riläxt.«
»Riläxt?«
»Unser Toter war ein USA-Fän.« Gurtner deutete auf den Briefkasten. »Flog fast jedes Jahr über den Teich. Die Nachbarin hat sich um seinen Garten gekümmert, wenn er weg war.«
»Vielleicht war er nicht ganz so relaxt, wie er sich gab«, sagte Regina. »Mir gefällt die Art und Weise, wie er erschossen wurde, überhaupt nicht.«
Gurtner schwieg. Noch immer schaute er zum Briefkasten. »Alles in Ordnung?«, fragte er schließlich.
Noch nie hatte sich Gurtner nach ihrem Befinden erkundigt.
»Ich meine, weil … die Stelle, du weißt schon.« Er sah sie immer noch nicht an.
»Welche Stelle?«
Plötzlich befand sich Regina im freien Fall. Deshalb war Hans-Peter Thalmann so barsch gewesen. Man hatte die Stelle des Dienstchefs beim Leib/Leben neu besetzt. Die Stelle, die ihr Lebenspartner Bruno Cavalli innehatte, bis er im Auftrag des Bundesamts für Polizei und des FBI in die USA gereist war, um im Reservat der Cherokee-Indianer einen Mörder aufzuspüren. Cavalli war in der Qualla Boundary aufgewachsen; er kannte sowohl die Kultur als auch die Sprache der Einheimischen. Da er seine Großmutter regelmäßig besuchte, weckte seine Anwesenheit keinen Verdacht.
Vor drei Monaten hätte er zurückkommen sollen. Obwohl das FBI versicherte, es werde alles getan, um ihn zu finden, fehlte immer noch jede Spur von ihm. Genauso von Emma Longhorn, einer jungen Krankenpflegerin, die mit ihm verschwunden war. Gerüchte kursierten, Cavalli habe sich über die Anweisungen des FBI hinweggesetzt und sei einer eigenen Spur nachgegangen. Regina traute es ihm zu, einfach unterzutauchen. Aber gewiss nicht, ohne ihr eine Nachricht zukommen zu lassen. Wochenlang hatte die Angst an ihr genagt, dann, vor gut zehn Tagen, hatte der Kurier eines asiatischen Take-aways bei ihr geklingelt und ihr eine Bestellung gebracht, die jemand im Namen ihrer dreijährigen Tochter aufgegeben hatte. Reis mit Erbsen. Lilys Lieblingsgericht.
Regina wusste, die Lieferung war eine Botschaft. Cavalli versuchte, ihr auf diese Weise mitzuteilen, dass er lebte. War er untergetaucht, weil er in Gefahr war? Oder hatte er sich mit Emma Longhorn davongemacht? Die Vorstellung war zu schmerzhaft, als dass Regina sie ernsthaft in Betracht ziehen wollte. Aber nicht undenkbar. Cavalli hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm seine Freiheit wichtig war. Vielleicht hatte er der Verlockung nicht widerstehen können und sich von allen Verpflichtungen losgerissen.
Nein, dachte Regina. Seine Tochter würde Cavalli nicht im Stich lassen. Er vergötterte Junebug, wie er Lily June liebevoll nannte.
»Wir haben die Hülse!«, rief Martin Angst von der Tür aus. »Das müsst ihr euch ansehen.«
Regina und Gurtner gingen ins Haus. Der Kriminaltechniker führte sie in ein Zimmer, das Albert Gradwohl offenbar als Büro gedient hatte. Ein Schreibtisch aus Massivholz stand an der Wand, darüber hing ein gerahmtes Foto. Es zeigte einen bärtigen Mann in grauer Uniform.
»Was hab ich gesagt.« Gurtner hakte die Daumen in den Hosenbund. »Ein USA-Fän.«
Regina konnte es sich nicht verkneifen, auf den Namen am unteren Rand des Fotos hinzuweisen. »Heinrich H. Wirz klingt nicht gerade englisch.«
Gurtner zeigte auf die Uniform. »Südstaatenarmee.«
So viel Wissen hatte Regina ihm nicht zugetraut.
»Es ist nicht das Bild, das ihr euch ansehen sollt«, sagte Angst. »Sondern das hier.« Er deutete auf den Schreibtisch. In der Mitte der Eichenplatte stand eine Hülse.
»Wie zum Geier ist die hierhergekommen?«, fragte Gurtner.
»Nicht von alleine, so viel ist klar.« Angst reichte ihm eine Pinzette. »Schau dir mal den Hülsenboden an. Du kannst sie umdrehen, wir haben bereits alles dokumentiert.«
Gurtner hob die Hülse auf. »Randfeuerung?«
»Ja. Kaliber .32.«
»Hab ich erst einmal gesehen.«
».32er Kaliber mit Randfeuerung sind Exoten«, sagte Angst zu Regina. »Sie wurden im neunzehnten Jahrhundert verwendet.«
Gurtner betrachtete das Bild. »Während der Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs.«
Angst nickte. »Gut möglich, dass die Tatwaffe aus dieser Zeit stammt. Das würde auch erklären, warum das Projektil im Schädel stecken blieb. Damals war eine .32er nicht stark genug, um das Schädeldach zwei Mal zu durchschlagen.«
»Die angesengten Augenbrauen«, sagte Gurtner langsam.
»Was ist damit?«, fragte Regina.
»Schwarzpulver«, antworteten Angst und Gurtner wie aus einem Munde. »Es verbrennt mit einer Stichflamme«, ergänzte Angst. »Bis jetzt haben wir im Haus zwar keine Relikte aus dem Bürgerkrieg gefunden, aber vielleicht hat Gradwohl seine Sammlung woanders gelagert.«
Gurtner machte sich Notizen. »Kläre ich ab. Wenn er historische Waffen besaß, wird sich das feststellen lassen. Ein Sammler versteckt seine Schätze in der Regel nicht.« Er stellte die Hülse wieder an ihren Platz zurück. »Handelt es sich um ein Original?«
»Sieht ganz danach aus. Es würde mich nicht erstaunen, wenn wir Spuren von Quecksilberfulminat fänden.«
»Knallquecksilber?«, fragte Gurtner.
Regina hörte nur mit einem halben Ohr zu. Sie trat einen Schritt zurück und betrachtete die Hülse nachdenklich. Warum stand sie genau an dieser Stelle? Wie eine Opfergabe vor einem Altar. Darüber Heinrich Wirz, kerzengerade, eine Hand auf der Brust. Ein buschiger Vollbart bedeckte seinen Mund, die Augen, hell wie Glas, waren auf einen Punkt in der Ferne gerichtet.
Trotz der Wärme fröstelte Regina.
3
North Carolina, 9. April
Cavalli hörte eine Stimme. Gedehnte Laute, die wie Honig von einem Löffel tropften. Es roch nach Kunstleder und Blut. Er versuchte, die Augen zu öffnen, doch es gelang ihm nicht. Als er die Beine anzog, spürte er einen stechenden Schmerz im Bauch.
»Bleib liegen!« Eine Frauenstimme.
Das Polster unter seinem Rücken vibrierte. Er lag in einem Fahrzeug.
»Bird? Kannst du mich hören? Halte durch! In wenigen Minuten sind wir bei der Notaufnahme.«
Bird. So wurde er nur im Reservat genannt. Bilder blitzten auf. Die Pistole im Licht des Schweinwerfers. Hände, die ihm auf die Füße halfen, ihn zum Wagen zerrten, auf den Rücksitz stießen. Emma.
»Halt an!«, schrie er. Zumindest glaubte er zu schreien. Der Ton, der seine Kehle verließ, klang eher wie ein Krächzen.
»Was?« Emma blickte kurz zurück.
»Halt … an!«
Kopfschüttelnd bog Emma in einen Waldweg ein. Sie löste die Sitzgurte und drehte sich um. »Du bist verletzt«, sagte sie. »Wir müssen so schnell wie – «
»Nein!« Cavalli versuchte aufzusitzen, doch Emma fasste ihn an der Schulter und drückte ihn zurück in den Sitz.
»Hör mir zu«, sagte er. »Bitte.«
Sie schwieg, ließ die Hand jedoch auf seiner Schulter liegen.
Cavalli versuchte, gleichmäßig zu atmen. »Im Krankenhaus sind wir nicht sicher.«
»Dann verständigen wir eben die Polizei!«
»Keine Polizei.« Schweiß rann ihm in den Nacken. »Das FBI … da war niemand. Im Granny Bee’s. Keine Agenten. Ein Maulwurf.«
Der Druck von Emmas Hand ließ nach.
»Ich hätte es gleich merken müssen«, fuhr Cavalli fort. »Ich wollte es nicht sehen.«
»Okay, ganz ruhig. Zuerst müssen wir uns um die Schussverletzung kümmern. Wir können auch zu einem Arzt fahren, wenn es dir lieber ist.«
»Du.«
»Ich soll dich verarzten?« Sie lachte ungläubig. »Ich bin Krankenpflegerin, nicht Chirurgin!«
»Ist es schlimm?«
»Bauchverletzungen sind immer heikel. Es könnten Organe oder Gefäße beschädigt sein.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn es dich am Darm erwischt hat, musst du sofort behandelt werden. Eine Peritonitis endet tödlich, falls sie – «
»Du hast doch im OP gearbeitet? Bevor …« Cavalli verstummte, eine Welle von Übelkeit hatte ihn erfasst.
»Du spinnst!«
»Tu es einfach!«
»Vergiss es, Bird. Damit will ich nichts zu tun haben. Du könntest sterben!«
Mit einer Hand tastete Cavalli nach der Verletzung. Unter dem Pullover trug er eine Bauchtasche, die aus mehreren Fächern bestand und Messer, Werkzeug und Notvorräte enthielt. Auf der rechten Seite, knapp über dem Hosenbund, spürte er ein Loch. Die Kugel hatte eine verpackte Isolierdecke sowie einen Müsliriegel durchschlagen. Er suchte eine Austrittswunde am Rücken. Da war nichts.
Die Autotür ging auf. Emmas Gesicht tauchte über ihm auf, Erinnerungen wurden wach. Vor Jahren hatte er einen Lungenschuss erlitten, damals war es Regina gewesen, die sich über ihn gebeugt hatte. Immer noch sah er die Angst in ihren Augen, aber auch eine tiefe Verbundenheit. In diesem Augenblick war ihm bewusst geworden, dass sie ihn immer noch liebte – trotz allem, was zwischen ihnen schiefgelaufen war. Die Schussverletzung war der Beginn von etwas Neuem gewesen. Nie hatte er sich aber träumen lassen, dass sie zusammen ein Kind haben würden.
Junebug!
Cavalli packte Emma. »Du musst es tun! Bitte, Emma! Ich weiß, wie sich eine lebensbedrohliche Schussverletzung anfühlt. Diese hier ist anders.« Er versuchte aufzusitzen.
»Nein!«
»Junebug ist erst drei. Sie braucht mich.« Er spürte, wie Emma zögerte. »Der Killer ist gut vernetzt, er würde uns im Krankenhaus aufspüren. Auch in einer Privatpraxis. Schau dir die Wunde wenigstens an, bevor du dich entscheidest.«
»Okay, okay! Ich schau sie mir an. Aber nur, wenn du meine Entscheidung akzeptierst.«
»Sicher.«
Sie schnaubte. »Leg dich hin.«
Er ließ sich langsam in den Sitz zurückfallen. Während Emma eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach holte, löste er die Klettverschlüsse der Tasche. Das Einschussloch war von einem schmalen, schwarzen Ring umgeben.
Emma tastete seinen Unterleib ab. »Wo ist der Schmerz am stärksten?«
»Rechts. An der Hüfte.«
Sie fuhr mit den Fingern über die Stelle. »Ich spüre eine Schwellung. Sieht aus, als steckte die Kugel im Beckenkamm. Weiteratmen.«
Er hatte nicht gemerkt, dass er die Luft angehalten hatte. »Gut. Die Kugel hat … Energie verloren. Durch die Tasche. Sonst hätte sie den Knochen durchschlagen.«
»Sie kann trotzdem großen Schaden angerichtet haben.«
»Ich stand schräg zum Schützen. Sie drang seitlich ein. Also sind keine Organe verletzt.« Er sah nach unten. Das Loch war oval und größer als das in der Tasche. Vermutlich hatte sich das Projektil gedreht. Sorgen machte ihm der unregelmäßige Wundrand. Fetzen von der Tasche waren in den Schusskanal geraten.
»Es ist nur ein Streifschuss«, sagte er.
Emma schüttelte den Kopf. »Du bist echt unmöglich. Langsam verstehe ich deine Mutter.«
Dass seine Mutter ins Reservat zurückgekehrt war, hatte Cavalli fast davon abgehalten, den Auftrag des FBI anzunehmen. Fünfunddreißig Jahre lang hatte Gail in Straßburg gelebt. Vor einem Jahr war sie an Brustkrebs erkrankt. Emma hatte ihre Pflege übernommen, damit Gail zu Hause bleiben konnte.
»Tust du es oder nicht?«, fragte er barsch.
»Mir fehlen die nötigen Instrumente.«
»Du hast bestimmt eine Notfallausrüstung im Wagen.«
»Aber keine chirurgischen Instrumente.«
»Messer und Pinzette reichen.«
»Ich brauche ein Anästhesiemittel.«
»Emma!«
Sie knüllte ihren Schal zusammen und reichte ihn Cavalli. »Drück ihn auf die Wunde. Und beweg dich nicht. Wir müssen an einen sicheren Ort fahren. Im Auto schnipsle ich nicht an dir herum. Ich brauche kochendes Wasser, um die Instrumente zu sterilisieren. Und bevor ich irgendetwas tue, will ich den Schussverlauf untersuchen. Wenn auch nur der geringste Verdacht besteht, dass die Kugel ein Organ gestreift hat, fahren wir in die Notaufnahme.«
»Einverstanden. Wir können aber nicht zurück nach Hause. Dort sucht uns der Killer als Erstes.«
»Ich habe einen Cousin drüben in Robbinsville, in der Snowbird community.«
»Ersten Grades?«
»Dritten Grades.«
»Besuchst du ihn häufig?«
»Nein, er war lange bei der Army. Wir haben uns aus den Augen verloren.«
Ein ehemaliger Soldat war Extremsituationen gewohnt.
»Fahr zu ihm. Und schalte vorher dein Telefon aus. Meins auch.«
Cavalli schloss die Augen. Wenn der Täter seinen Plan änderte? Cavallis Großmutter statt Emma als Ziel wählte? Er konnte sie nicht alle beschützen. Junebug. Regina. Seinen Sohn Chris. Seine Großmutter. Emma. Ja, sogar seine Mutter. Der Täter hatte ihn genau dort, wo er ihn haben wollte.
»Emma?«
»Du solltest nicht reden«, sagte sie. »Versuch, dich zu entspannen. Du wirst deine Energie noch brauchen.«
»Was ist geschehen? Auf dem Parkplatz.«
»Ich habe nur den Schuss gehört. Und dann bist du zusammengebrochen. Ich hab dich in den Wagen gezerrt und bin davongefahren.«
»Du bist ausgestiegen?«
»Hätte ich dich etwa zurücklassen sollen? Jetzt halt endlich die Klappe und konzentriere dich aufs Atmen. Langsam und regelmäßig.«
»Hast du ihn gesehen?«
Emma startete den Motor, und der Ford setzte sich in Bewegung. Cavalli presste den Schal auf die Wunde.
»Nein«, antwortete Emma. »Ich glaube, er ist abgehauen.«
Cavalli schlug die Augen auf, er hörte Stimmen. Kräftige Hände schoben sich unter seine Achseln, seine Füße berührten Kies. Emma erteilte Anweisungen, bald lag er auf einem Bett. Es roch nach abgestandenem Rauch, ungewaschenen Laken und Zedernholz. Das Gesicht, das sich über ihn beugte, sah er nur verschwommen. Cavalli erkannte dunkle Haut und eine Narbe, die vom Mundwinkel zum Ohr führte. Ein Fernseher lief im Hintergrund, eine Nachrichtensprecherin berichtete von einem Unwetter.
Emma zog ihm die Schuhe aus und machte sich an seiner Hose zu schaffen.
Cavalli lächelte schwach. »Dachte, du hättest die … Schnauze voll von Männern.«
»Hab ich auch«, gab Emma zurück. »Vor allem von dir.«
Ihr Cousin schnaubte. Cavalli drehte den Kopf und hob die Hand zur Begrüßung, was ihm sofort eine Schelte von Emma einbrachte.
»Du sollst dich nicht bewegen! Buzz, bring mir kochendes Wasser und saubere Tücher. Falls es hier so etwas gibt.«
Buzz verschwand aus Cavallis Blickfeld. Kurz darauf kehrte er mit einem Badetuch zurück, das Emma neben Cavalli auf dem Bett ausbreitete. Sie griff nach einer Plastiktüte und begann, Material auszupacken.
Buzz tauchte auf der anderen Seite des Bettes auf und hielt eine Flasche hoch. »Gin. Es ist nicht mehr viel drin, aber es reicht, um den schlimmsten Schmerz zu dämmen.«
Cavalli schüttelte den Kopf. Er hatte nie Alkohol getrunken und würde es auch jetzt nicht tun. Das Versprechen hatte ihm seine Großmutter als Kind abgerungen. Sie hatte sichergehen wollen, dass er nicht dem Alkoholismus verfiel, wie so viele seiner Verwandten. Buzz zuckte die Schultern und setzte die Flasche an.
»Lass das!«, sagte Emma. »Ich brauche deine Hilfe. Bird, du kannst es dir immer noch überlegen.«
»Leg los«, sagte Cavalli.
Buzz nahm noch einen Schluck Gin und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Emma erklärte ihm, was er zu tun hatte. Er griff nach einer schmutzigen Socke, die am Boden lag, rollte sie zusammen und hielt sie Cavalli vors Gesicht. »Mund auf.«
Fast hätte Cavalli gelacht.
»Es hilft«, sagte Buzz ungerührt. »Du wirst an nichts anderes denken als an dieses verdammte Stinkding. Ich weiß, wovon ich rede.« Er hob sein T-Shirt und zeigte auf eine alte Schussverletzung. »Afghanistan.«
»Der Gestank wird mich umbringen«, sagte Cavalli.
Buzz’ Mund verzog sich zu einer Grimasse. Es dauerte einen Moment, bis Cavalli begriff, dass er grinste. Wegen der Narbe sah es aus, als formten seine Lippen einen stummen Schrei. Schicksalsergeben öffnete Cavalli den Mund.
Als Emma den Verletzungsgang mit einer Sonde zu erkunden begann, war er froh um die Socke.
»Glück gehabt«, murmelte sie. »Der Gang verläuft innerhalb der Bauchwand. Ich sage es ungern, aber dein Sixpack hat dich vermutlich gerettet.« Sie zog die Sonde wieder zurück und griff zum Messer. »Ich hole die Kugel jetzt heraus. Sie steckt tatsächlich im Beckenkamm.«
Cavalli schloss die Augen und dachte an Schweißfüße. Endlich hielt Emma eine deformierte Kugel hoch.
»Na, was haben wir denn da«, sagte Buzz. »Hallo, mein Freund.«
»Schon einmal Bekanntschaft geschlossen?«, fragte Emma.
»Wenn ich schätzen müsste, würde ich auf eine .45 Auto tippen. War früher bei der Army Standardmunition. Wird aber auch von anderen Organisationen eingesetzt.«
»Vom FBI?«, wollte Emma wissen.
»Nein. Die sind zu 9 mm zurückgekehrt.« Buzz verstummte. »War der Schütze ein FBI-Mann?«, fragte er nach kurzem Nachdenken.
»Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das FBI den Killer hätte festnehmen sollen. Aber da war niemand.«
»Das gefällt mir nicht, Em. Lass dich da nicht mit reinziehen. Pack deine Sachen und hau ab.«
»Dafür ist es zu spät. Die Kugel da?« Emma schaute auf das Geschoss. »Die war für mich bestimmt, nicht für Bird.«
Buzz schüttelte den Kopf. »Ich kann dir helfen. Wenn du verschwinden musst.«
Emma zögerte. »Bird meint, der Killer wird nicht aufgeben. Ich habe keine Lust, mein Leben lang auf der Flucht zu sein.«
Cavalli versuchte, die Socke aus dem Mund zu stoßen, da begann Emma erneut, in der Wunde herumzustochern.
Buzz senkte die Stimme. »Ich glaub, es ist an der Zeit, dass du mir die ganze Geschichte erzählst.«
»Nicht jetzt.« Es blubberte, als Emma einen Gegenstand ins Wasser tauchte.
Vor Cavallis Augen tanzten schwarze Punkte. Als er wieder zu sich kam, hörte er Stimmengemurmel, doch er sah weder Emma noch Buzz. Auch die Socke war weg.
»Bird ist wegen des Indian-Killers zurückgekommen«, sagte Emma. »Nicht wegen seiner Mutter.«
Mehr brauchte sie offenbar nicht zu sagen. Der Indian-Killer, wie er im Reservat genannt wurde, war auch Buzz ein Begriff. Fünf Menschen hatte er mit dem Blasrohr getötet. Seit über einem Jahr jagte das FBI ihn, ohne Erfolg.
»Er ist ein Undercovercop?«
»Nur seine Familie weiß Bescheid, also behalt es gefälligst für dich.«
»Verdammt, Em, warum hat er dich in die Sache mit reingezogen?«
»Hat er nicht. Er versucht, mich zu beschützen. Aus irgendeinem Grund hat der Killer es auf mich abgesehen.«
»Scheiße. Und du weißt nicht, warum?«
»Nein.«
»Warum ermittelt Bird im Reservat? Wir sind uns doch einig, dass der Killer keiner von uns ist.« Eine Flasche wurde aufgeschraubt. »Die Einzigen, die wirklich mit einem Blasrohr umgehen können, sind der alte Owle und Frank Watty. Der alte Owle schafft es kaum, die Bierflasche bis an den Mund zu heben. Und Watty …« Frank Watty war Detective beim Cherokee Indian Police Department. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Watty ein Mörder ist?«
»Ich habe keine Ahnung, was ich glauben soll!«, zischte Emma. »Der Indian-Killer verwendet Pfeilgift.«
»Die Cherokee haben doch nie Pfeilgift verwendet.«
»Das ist mir klar. Bird auch. Er glaubt, der Killer versuche, eine falsche Fährte zu legen. Es so aussehen zu lassen, als stecke ein Cherokee dahinter. Im Restaurant wollte er mir etwas sagen, aber er kam nicht mehr dazu.«
»Was wirst du jetzt tun?«
»Bird gesund pflegen, nehme ich an. Und dann weiterschauen.«
»Du kannst dich hier verstecken, wenn du willst. Es ist nicht gerade das Ritz, aber ziemlich abgelegen.«
Es folgte ein langes Schweigen, schließlich sagte Emma: »Danke. Aber Buzz?«
»Mmh?«
»Es darf niemand erfahren, dass wir hier sind. Niemand, ist das klar?«
»Du hast doch selbst gesagt, dass der Killer keiner von uns ist.«
»Er hat überall Augen. Und so etwas«, sie zeigte auf Cavallis Bauch, »mache ich nie wieder.«
Buzz verließ das Zimmer.
»Wohin gehst du?«, rief Emma.
»Deinen Wagen verstecken.«
Emma setzte sich auf die Bettkante. Sie sah erschöpft aus. Zum ersten Mal fragte sich Cavalli, warum sie die Arbeit im Operationssaal aufgegeben hatte. Als private Pflegerin verdiente sie weniger, und besonders spannend war die Tätigkeit auch nicht.
»Wie geht es dir?«, fragte sie.
»Ich werde die Erinnerung an deine Hände auf meinem Körper immer mit dem Geruch von Schweißsocken verbinden.«
Sie verdrehte die Augen. »Wenn du wieder flirten kannst, geht es dir gut.«
Cavalli wurde ernst. »Danke, Emma.«
Sie nickte nur. Sie hatte ihren Blick auf das Bild einer Schlange geheftet, das über dem Bett angebracht war. »Im Restaurant wolltest du mir etwas über den Anakonda-Plan erzählen. Du hast gesagt, der Killer mache das Gleiche wie … wer hat den Plan ausgeheckt?«
»Winfield Scott.«
»Du hast auch gesagt, der Killer habe nichts gegen Indianer. Nur gegen einen. Und dass er einen weiten Kreis um sein Opfer ziehe. Was hast du damit gemeint? Wer ist sein Opfer?«
Cavalli sah sie an. »Ich.«
4
Rhodes Island, 6. Mai 1861
Feigling!«, rief Jeremiah Greene.
Benjamin Payne senkte den Blick und ließ den Spott des Freundes über sich ergehen.
»Meine Mutter ist auch verwitwet«, sagte Jeremiah. »Trotzdem steht sie hinter mir. Es ist unsere Pflicht, für die Union zu kämpfen! Alle müssen in dieser schwierigen Zeit Opfer bringen.«
Benjamin erwähnte nicht, dass bereits William, sein älterer Bruder, in den Krieg gezogen war. Seine Mutter brauchte ihn. Die beiden Schwestern auch. Jeremiah verzog das Gesicht und stapfte davon.
Lange blieb Benjamin stehen und lauschte der Brandung. Ein kühler Wind blies vom Atlantik her. Die Wellen trugen Schaumkronen an den Strand, wo sie wie Opfergaben liegen blieben. In diesen Gewässern war sein Vater gestorben. Er war Fischer gewesen, wie auch der Großvater und vor ihm der Urgroßvater. William hatte die Familientradition weitergeführt, doch Benjamin hatte sich nie wohlgefühlt auf dem Meer. Er brauchte sicheren Boden unter den Füßen. Als er den Beruf des Segelmachers erlernen durfte, war er überglücklich. Mit vierzehn hatte er sein Zimmer über der Werkstatt bezogen, heute, fünf Jahre später, arbeitete er an der Seite des Meisters. Zehn Dollar brachte er jede Woche nach Hause, Geld, das die Mutter dringend benötigte.
Feigling.
Die Zukunft sah düster aus. Der aufkommende Krieg beeinträchtigte den Handel; der alte Elisha prophezeite, dass viele Betriebe schließen würden. Präsident Abraham Lincoln behauptete zwar, der Krieg würde rasch ein Ende nehmen, doch der Segelmachermeister glaubte ihm nicht. Noch im April, als sich William einschrieb, suchte Lincoln Freiwillige für drei Monate. In seinem zweiten Aufruf war plötzlich von drei Jahren die Rede gewesen. Trotzdem strömten die Männer in die Rekrutierungsbüros.
Alle außer Benjamin.
Beim Abendessen konnte er der Mutter nicht in die Augen sehen. Lustlos schob er ein Stück Fisch auf dem Teller hin und her. Die kleinen Schwestern stritten sich über ein Bonbon, das ein Soldat ihnen geschenkt hatte. In diesem Moment empfand Benjamin nur Verachtung für sie. Die Demokratie, ja die Freiheit selbst stand auf dem Spiel, welche Bedeutung hatte da ein Bonbon? Er stand auf, entschuldigte sich bei seiner Mutter und verließ das Haus.
Elisha kam selbst zur Tür. Als Benjamin ihm mitteilte, er werde sich am nächsten Morgen im Rekrutierungsbüro melden, nickte der alte Mann bedächtig. Er bat Benjamin herein und verschwand in einem Zimmer. Kurz darauf kehrte er mit einem Bündel in der Hand zurück. Er legte es auf den Tisch und schlug den Stoff auf.
Der Revolver glänzte im flackernden Licht der Petrollampe. Der Rahmen war flach und kantig, so klein, dass er in den Hosenbund passte, aber stark genug, um einen Mann zu stoppen. Benjamin hatte von der neuen Waffe gehört. Der Smith & Wesson No. 2 war erst kürzlich auf den Markt gekommen, er verschoss echte Metallpatronen.
»Nimm ihn in die Hand«, sagte Elisha.
Ehrfürchtig griff Benjamin nach der Waffe. Sie fühlte sich erstaunlich leicht an.
»Jetzt klapp den vorderen Teil nach oben. Hier, mit dem Lauf.« Elisha zeigte auf die Stelle.
Benjamin zog die Trommel von der Trommelachse ab und starrte in die sechs Öffnungen.
»Hast du schon einmal mit Metallpatronen geschossen?«
»Nein.« Er hatte noch nie im Leben scharfe Munition gesehen.
Elisha öffnete eine Schachtel, reichte Benjamin sechs Patronen und erklärte ihm, wie er die Waffe laden musste. Benjamin setzte die Trommel wieder auf die Achse und klappte den Lauf zurück.
»Komm mit«, sagte Elisha.
Das Meer dämpfte den Knall der Schüsse. Die meisten verfehlten ihr Ziel, doch Elisha versicherte, Benjamin werde den Dreh bald heraushaben. Im Haus zeigte er ihm, wie er mit dem Stift am Lauf die Hülsen ausstoßen konnte. Dann reichte er ihm ein Holster.
»Ich darf den Revolver behalten?«
»Lehr die Rebels das Fürchten, Junge.«
Am folgenden Tag schrieb sich Benjamin beim 2. Freiwilligen-Regiment von Rhode Island ein. Seine Mutter weinte nicht. Sie hatte ihre Tränen schon für William vergossen.
Zusammen mit seinem Regiment bestieg Benjamin den Raddampfer »State of Maine«. Drei Tage später kam er in Washington, D. C. an, wo er im Lager der 1. Rhode-Island-Freiwilligen auf seinen Bruder traf. Einen Monat lang bestimmten Drillübungen seinen Tagesablauf. Benjamin lernte, mit einer Steinschlossflinte umzugehen, sie kam ihm schwer und altmodisch vor. Am 16. Juli war es dann endlich so weit. Das Regiment erhielt den Befehl, sich marschbereit zu halten. Zusammen mit den 2. New-Hampshire-Freiwilligen und der 71. New-York-Miliz bildeten sie eine Brigade unter dem Kommando von Oberst Ambrose E. Burnside.
Den ersten Schuss der Rebellen hörte Benjamin außerhalb von Centreville, im Bundesstaat Virginia. Noch ahnte er nicht, was ihn erwartete. Erst als er im Kugelhagel stand, begriff er, was Krieg bedeutete. Er suchte Schutz in einer Senke. Über ihm tauchten Rebellen auf und warfen Granaten herab. Benjamin floh mit eingezogenem Kopf, die Flinte fiel ihm aus der Hand. Benjamin war überrascht, er hatte ganz vergessen, dass er sie trug. Dann gaben seine Beine unter ihm nach. Er schleppte sich hinter einen Baumstamm, der auf dem Feld lag.
Als Jeremiah seinen Freund fand, hatte sich das 8. Georgia-Regiment bereits zurückgezogen. In der Hand hielt Benjamin ein Munitionskästchen, der Army No. 2 befand sich immer noch im Holster. Jeremiah fiel auf die Knie, rief Benjamins Namen, doch die Augen seines Freundes starrten ins Leere. Jeremiah spürte, wie sich seine Kehle zusammenschnürte. Sorgfältig löste er das Holster. Der Revolver war mindestens dreißig Dollar wert, er gehörte jetzt William. Jeremiah wischte sich mit dem Ärmel die Augen trocken, steckte die Waffe ein und kehrte zu seiner Kompanie zurück.
Neben Benjamin Payne starben weitere fünfundzwanzig Soldaten in der ersten Schlacht von Bull Run. Das Regiment wurde neu organisiert, William Paynes Dienstzeit lief ab, und er kehrte nach Rhode Island zurück. Jeremiah Greene hatte keine Gelegenheit, ihm den Revolver zu geben. Er schrieb einen Brief, faltete ihn zusammen, steckte ihn ins Holster und schnallte sich den Army No. 2 an.
5
Zürich, 27. Juli
Regina stand bereits vor dem Kripogebäude, als ihr einfiel, dass sie gar nicht wusste, wer der neue Dienstchef war. In der vergangenen Nacht hatte die Arbeit am Tatort ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert, und heute Morgen war sie vollauf damit beschäftigt gewesen, den Stoffadler zu suchen, der Lily vor Ungeheuern beschützte. Die Tagesmutter hatte das Stofftier schließlich im Wäschekorb gefunden. Regina fragte sich, wie sie ihren Alltag ohne Paz Rubin bewältigen würde. Während ihres Pikettdienstes wohnte die Paraguayerin sogar bei ihnen. Ihr frischgebackener Ehemann, Kriminalpolizist Tobias Fahrni, hatte halb im Spaß festgestellt, Paz verbringe mehr Zeit bei Regina in Gockhausen als bei ihm.
Wie immer nach einem Tötungsdelikt waren die ersten Tage hektisch. Nicht umsonst sprach man von der Chaosphase. Regina war erst um zwei Uhr in der Früh ins Bett gekommen, viele Kriminaltechniker hatten sogar durchgearbeitet.
Am Eingang zeigte sie ihren Ausweis. Der Pförtner griff zum Telefon und meldete sie an. Regina nahm den Aufzug in die fünfte Etage, wo sie einen Moment im Treppenhaus stehen blieb, um sich zu sammeln, bevor sie die Glastür aufstieß. Im Vorzimmer der Kripochefin summte eine Kaffeemaschine, von irgendwo hörte sie ein Lachen. Der Linoleumboden dämpfte ihre Schritte, sodass sie unbemerkt zu Cavallis ehemaligem Büro gehen konnte. Die Tür war nur angelehnt.
Regina klopfte.
»Ja?« Es war Juri Pileckis Stimme. Der Tscheche vertrat Cavalli seit fünf Monaten. Er hatte Interesse an der Stelle bekundet, war aber nicht in Betracht gekommen, weil seine Frau, eine ehemalige Cabaret-Tänzerin, im Rotlichtmilieu verkehrte. Regina vermutete, dass er insgeheim froh darüber war. Er war durch und durch Ermittler, Führungsaufgaben lagen ihm nicht. Dass ihn der Kommandant aber aufgefordert hatte, sich für eine Stelle außerhalb der Kriminalpolizei zu bewerben, hatte ihn schwer getroffen.
»Regina!« Pilecki klang unsicher. »Komm rein. Setz dich.«
»Wolltest du nicht wegfahren? Du hast doch Urlaub.« Sie sah sich um. Er hatte seine Sachen noch nicht weggeräumt.
»Wir haben unsere Pläne kurzfristig geändert. Irina ist allein mit Katja zu ihren Eltern gefahren.«
»Aber du hast dich auf ein paar ruhige Wochen in Kiew gefreut.«
Pilecki streckte die Hand nach einer Zigarettenpackung aus, die auf dem Schreibtisch lag, ließ sie dann wieder sinken. Erst jetzt bemerkte Regina, dass kein Rauch in der Luft lag. Obwohl das Rauchen im Gebäude untersagt war, hatte sich Pilecki nie an die Regel gehalten, was bei seinen Vorgesetzten gar nicht gut angekommen war.
Er stand auf und schloss die Tür. »In den letzten Wochen ist einiges geschehen.«
Regina sah auf die Uhr. »Die Sachbearbeiter-Konferenz beginnt gleich.«
Pilecki setzte sich. »Irina wird das Etoile nicht übernehmen.«
»Ich dachte, sie freue sich darauf, ihr eigenes Etablissement zu führen!«
Pilecki senkte den Blick. »Sie wusste nicht, dass es mich meine Stelle kosten würde. Sie ist ziemlich sauer.«
»Ihr habt es nicht miteinander besprochen?«, fragte Regina ungläubig.
Pilecki spielte mit der Zigarettenpackung. »Ich wollte ihr nicht im Weg stehen. Sie hat ein Recht darauf, ihre Träume zu verwirklichen. Bei der Bank gefällt es ihr nicht. Die Arbeit als Analystin macht ihr zwar Spaß, aber die Mitarbeiter … Sie war so begeistert, als sie erfuhr, dass das Etoile zum Verkauf stand.«
»Was wird sie jetzt tun?«
»Sich eine Auszeit nehmen, sagt sie. Weiterschauen.«
»Und du bleibst beim Leib/Leben?«
Er räusperte sich. »Ich habe gestern die Zusage bekommen.«
Endlich begriff sie. »Du bist neuer Dienstchef?«
»Ja.«
»Aber … ich dachte … du hast dich immer über den Papierkram beklagt.« Genau wie Cavalli wollte Pilecki Ermittlungen selber führen, nicht nur beaufsichtigen.
Er zuckte die Schultern. »Es hat auch Vorteile.«
Regina ahnte, was sich abgespielt hatte. Ihm zuliebe hatte Irina auf die Erfüllung ihres beruflichen Traums verzichtet. Nun fühlte er sich verpflichtet, die Beförderung anzunehmen. Er war in eine Falle getappt, genau wie Cavalli damals. Trotzdem freute sie sich. Aus menschlicher Sicht war Pilecki eine gute Wahl, auch wenn Regina sie nicht ganz nachvollziehen konnte. Dem ehemaligen Drogenfahnder fehlte es nicht nur an Führungsqualitäten, sondern auch an Durchsetzungsvermögen. Gut vernetzt war er auf Offiziersebene auch nicht. Weder Hans-Peter Thalmann, Chef der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität, noch der Kommandant hatten sich in der Vergangenheit für ihn ausgesprochen.
Sie reichte ihm die Hand. »Herzliche Gratulation. Es gibt niemanden, den ich lieber auf diesem Stuhl sähe.«
»Danke.« Er stand auf. »Dann lass uns loslegen.«
Die Kripoleitstelle war überfüllt, die Schiebetür zum angrenzenden Ermittlungsraum offen. Da es im Raum keine Fenster gab, staute sich bereits jetzt die Hitze. Thalmann bot Regina eine Tasse Kaffee an, doch sie schüttelte den Kopf. Es würde ein langer Tag werden, sie wollte sich die Koffeinschübe einteilen. Sie betrachtete die Anwesenden. Neben Sachbearbeitern des Leib/Lebens hatten sich Mitarbeiter des Forensischen Instituts, der Kriminalanalyse sowie der Medienstelle zur Besprechung eingefunden. Nur Sabine Hahn fehlte, vermutlich war sie direkt ins Institut für Rechtsmedizin gefahren, um die Obduktion vorzubereiten. Dafür war der Chef der Fahndungsabteilung da. Joe Walker lächelte, als er Regina sah. Sie nickte kurz und setzte sich möglichst weit weg von ihm. Sie wusste, der Offizier nahm nur deshalb an der Besprechung teil, weil sie hier war.
Pilecki eröffnete die Sitzung und übergab Gurtner das Wort, der berichtete, was in der Nacht geschehen war.
»Albert Gradwohl hat eine Schwester«, sagte er zum Schluss. »Verena. Sie lebt in Luzern. Die Kollegen dort haben bereits mit ihr gesprochen. Anscheinend gibt es in Gradwohls Leben eine neue Frau. Die Fahnder suchen nach ihr.«
Walker nickte, den Blick auf Regina gerichtet. Sie dachte an den Wagen, den die Nachbarin beobachtet hatte.
»Seltsam, dass die Nachbarn die neue Frau nicht erwähnt haben«, meinte Pilecki. »Seit wann kennen sie sich?«
Gurtner wusste es nicht. »Es wird eine Weile dauern, Gradwohls Kontakte durchzugehen. Es befinden sich viele Amerikaner darunter. Vielleicht kommt die Frau auch von drüben.«
Regina dachte an das Bild des Südstaatenoffiziers, das in Gradwohls Büro hing. »Stammt er aus den USA?«
»Nein, aus Luzern. Nach der Heirat 1976 zog er nach Zürich. Seine Frau starb vor neun Jahren. Keine Kinder.«
»Was hat er beruflich gemacht?«
»Er war Bauingenieur bei der Bahn. Seit vier Jahren ist er im Ruhestand.«
Ein Mitarbeiter der Bahn reist in der Regel nicht beruflich ins Ausland, überlegte Regina. Wo mochte Gradwohls Interesse an den USA herrühren?
Martin Angst öffnete eine Mappe. »Wir haben Fingerabdrücke gefunden, die nicht vom Opfer stammen. Überall im Haus. Leider sind sie nicht im System. Die vielversprechendste Spur ist im Moment die Hülse.«
»Das Geschoss steckt vermutlich im Schädel«, unterbrach Gurtner und tippte sich gegen den Kopf.
»Dank der Hülse wissen wir aber, dass es sich bei der Patrone um eine .32 Smith & Wesson Rimfire handelt«, sagte Angst. »Short. Ziemlich unüblich. Mit Schwarzpulver als Treibsatz.«
»Selbst hergestellt?«, fragte Pilecki. »Oder wieder geladen?«
»Eine Patrone mit Randfeuerzündung kann man nicht wieder laden. Der Hülsenboden wird bei der Schussabgabe zerstört. Die Patrone stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert.«
»Es gibt auch Patronen für Sammler, die neu hergestellt werden«, warf Pilecki ein.
»In unserem Fall war es ein Original«, wiederholte Angst.
»Wo zum Henker kriegt man Originalmunition aus dem neunzehnten Jahrhundert?«, wollte Gurtner wissen.
»Das ist gar nicht so schwierig. Es kommen immer wieder alte Waffen samt Munition auf den Markt. Sobald ich das Projektil sehe, kann ich mehr dazu sagen.«
»Funktioniert eine Patrone nach so langer Zeit überhaupt noch?«, fragte der Mediensprecher.
»Allerdings«, sagte Angst. »Ich erinnere mich an einen tragischen Fall: Zwei Kinder spielten mit einer alten Waffe, als sich ein Schuss löste – mit tödlichen Folgen. Die Patrone, die in der Revolvertrommel steckte, hatte der Urgroßvater siebzig Jahre zuvor geladen.«
»Da war doch auch dieser Tourist«, fügte Gurtner hinzu. »Mit der alten Vorderladerflinte. Es hieß, er habe sie irgendwo auf einem Markt in Afrika gekauft.« Er schaute in die Runde. »Zu Hause hat er damit angegeben. Wollte der Freundin zeigen, was für ein Prachtstück er ergattert hatte. Am Ende war die Frau tot.«
Angst nickte. »Sogar Waffen mit Steinschloss gehen gelegentlich los. Zünd- und Treibmittel sind stabile Verbindungen, besser gesagt, Stoffgemische.«
»Mich würde im Moment mehr interessieren, warum der Täter alte Munition verwendete«, sagte Regina. »Ein symbolischer Akt? Und warum stand die Hülse auf dem Tisch? Will er uns damit etwas sagen?«
Alle Köpfe drehten sich in ihre Richtung. Cavalli hätte den Gedanken sofort aufgegriffen, er dachte in ungewöhnlichen Bahnen, blickte über das Offensichtliche hinaus. Jetzt aber kam Regina sich vor, als habe sie vorgeschlagen, Tarot-Karten zu legen. Nur Tobias Fahrni drehte nachdenklich den neuen Ehering an seinem Finger.
»Meistens gibt es eine einfache Erklärung«, sagte Pilecki. »Vielleicht hatte der Täter zu Hause einen Vorrat an alter Munition.« Er wandte sich an Angst. »Lässt sich von der Hülse auf den Waffentyp schließen?«
»Wie gesagt, das Kaliber ist ungewöhnlich. Wir werden den Waffentyp sicher stark eingrenzen können. Wenn wir die Tatwaffe finden, können wir die Spuren am Projektil dem Lauf so zuordnen, dass sie als Beweismittel taugen. Ich fahre gleich noch in die Rechtsmedizin. Kommt jemand mit?«
Gurtner hob den Zeigefinger.
»Regina?«, fragte Angst.
»Ich habe leider keine Zeit.«
»Es sind alles Reihenhäuser«, sagte Fahrni plötzlich. »Und gestern war es heiß.«
»Nicht nur gestern«, murmelte Gurtner, der diese Nacht entweder nicht zu Hause gewesen war oder sein Hemd bereits durchgeschwitzt hatte.
»Hat keiner der Nachbarn am Abend den Garten gegossen?«, fragte Fahrni. »Bei dieser Hitze braucht meine Mutter dafür eine ganze Stunde. Und unser Garten ist klein. Warum hat niemand etwas gesehen?«
»Vielleicht, weil es sich um ein Eckhaus handelt?« Walker sah zu Gurtner. »Gibt es einen Seiteneingang? Kennen wir den Grundriss des Gebäudes?«
»Noch nicht«, sagte Gurtner.
»Warum nicht?«
Pilecki hob die Hand. »Eines nach dem anderen. Albert Gradwohl ist noch nicht mal kalt.«
»Wird er bei diesem Wetter auch nicht«, meinte Gurtner.
Thalmann blickte zu Pilecki. »Joe hat recht. Die ersten Stunden sind entscheidend, das solltest du wissen.«
Regina fragte sich, was Thalmann wirklich störte. Die Ermittlung war reibungslos angelaufen, alle arbeiteten auf Hochtouren. Pilecki hatte die richtigen Prioritäten gesetzt, die Aufgaben sinnvoll verteilt.
Sie stand auf. »Ich muss ins Büro. Wenn ihr etwas braucht, wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt. Bitte haltet mich auf dem Laufenden.«
Noch war die Luft frisch, der Boden feucht, wo die Straße soeben gereinigt worden war. Regina liebte Zürich im Sommer. Die Verbissenheit der Einwohner wich Lebensfreude, die Stadt pulsierte. Leider erhitzten sich auch die Gemüter. Im Gegensatz zu Gurtner, der während seines Pikettdienstes zwar ausrückte, die Fälle nachher aber auf die verschiedenen Sachbearbeiter verteilte, kümmerte sich Regina selbst um ihre Brandtour-Fälle. Wenn sie Pech hatte, deckte sie sich innerhalb weniger Tage mit Arbeit für ein ganzes Jahr ein.