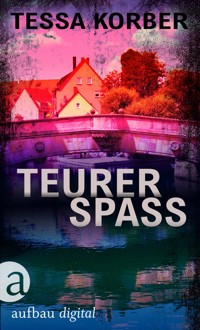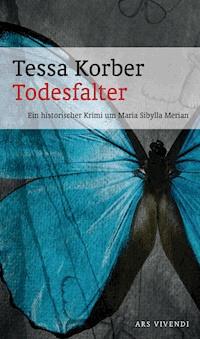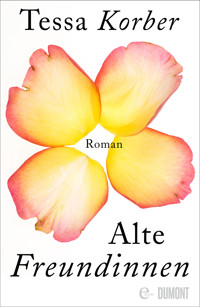
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Studentinnen hatten sie hauptsächlich von ländlicher Idylle und einer gemeinsamen Bibliothek geträumt, von Prosecco-Abenden und endlosen Gesprächen. Wie werden sie zurechtkommen mit dem Alter und seinen Begleiterscheinungen? Wie wird das Zusammenleben funktionieren, nachdem sie so unterschiedliche Leben geführt haben, mit und ohne Familie, mit mehr oder weniger geglückter Karriere? Wie wollen sie umgehen mit den großen Fragen des Lebens, mit später Liebe und frühem Tod? Wie mit alten Verwundungen und Eifersucht? Und auch die kleinen, für das Zusammenleben oftmals wichtigen Alltagsfragen sind nicht zu unterschätzen, etwa wie man den neugierigen Dorfnachbarn begegnet. Oder ob man sich eine Katze anschafft. Die vier gehen es mit Schwung und Zuneigung an, streiten und versöhnen sich, tragen ihre Verluste und gewinnen an Erkenntnis. Aber eines bleiben sie bis zum Ende: Freundinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für die vier Freundinnen Franziska, Annabel, Nora und Luise war das ein Traum, seit sie sich kennen. Jetzt, in ihren Sechzigern angelangt, scheint für alle die Zeit gekommen, in Franziskas Elternhaus auf dem Land ihre WG zu wagen. Doch hält ihre alte Freundschaft die neue Nähe aus? Gibt es genügend Platz für ihre gelebten Leben? Mit der Erfüllung ihres Jugendtraums beginnt für die vier Frauen etwas aufregend Neues.
Als Studentinnen hatten sie hauptsächlich von ländlicher Idylle und einer gemeinsamen Bibliothek geträumt, von Prosecco-Abenden und endlosen Gesprächen. Wie werden sie zurechtkommen mit dem Alter und seinen Begleiterscheinungen? Wie wird das Zusammenleben funktionieren, nachdem sie so unterschiedliche Leben geführt haben, mit und ohne Familie, mit mehr oder weniger geglückter Karriere? Wie wollen sie umgehen mit den großen Fragen des Lebens, mit später Liebe und frühem Tod? Wie mit alten Verwundungen und Eifersucht? Und auch die kleinen, für das Zusammenleben oftmals wichtigen Alltagsfragen sind nicht zu unterschätzen, etwa wie man mit den neugierigen Dorfnachbarn umgeht. Oder ob man sich eine Katze anschafft.
Die vier gehen es mit Schwung und Zuneigung an, streiten und versöhnen sich, tragen ihre Verluste und gewinnen an Erkenntnis. Aber eines bleiben sie bis zum Ende: Freundinnen.
© Cherima Nasa
Tessa Korber, 1966 geboren, hat u.a. Literaturwissenschaften studiert und in Verlagen und im Buchhandel gearbeitet. Seit ihrem Bestseller ›Die Karawanenkönigin‹ ist sie freie Schriftstellerin und als Autorin historischer Romane und Krimis bekannt. Sie lebt mit ihrem Mann in Nürnberg.
Tessa Korber
ALTE FREUNDINNEN
Roman
Originalausgabe eBook 2021 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten © 2021 DuMont Buchverlag, Köln Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © plainpicture/Frank Baquet Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-7097-4
www.dumont-buchverlag.de
Dieses Buch ist all den wunderbaren Frauen – und auch einigen Männern – gewidmet, die ich im Laufe meines Lebens meine Freundinnen oder Freunde nennen durfte.
Danke, ihr habt mich auf vielerlei Weise dazu inspiriert,
die vier Heldinnen zu erschaffen,
die in diesem Buch jetzt ihr ganz eigenes Leben führen.
Die vier sind keine von euch, sie sind ihr alle – und ohne euch wären sie nichts. So wie alles nichts wäre ohne euch.
DER SOMMER DES GROSSEN AUFBRUCHS
1 »Schwester, ich muss mal!«
»Herr Schürer, Sie wissen doch, dass ich keine Schwester bin.« Franziska ist eben erst in den Speiseraum des Altersheims gekommen. Hat ihren eisgrauen Zopf hochgesteckt, ist in die Schuhe mit den leisen Sohlen geschlüpft, hat sich vorgenommen, dass es heute keinen Ärger geben soll. Sie braucht den Job.
Herr Schürer rollt erwartungsvoll näher. Seine fleckigen, spinnendürren Hände drehen die Räder nur mit Mühe. Er ist eine empfindsame Seele, die abends vor dem Einschlafen für alle auf der Station betet. Als Soldat, sagt er, habe er Dinge gesehen, die niemand sehen sollte. Manchmal sieht er sie noch immer: einen Fluss und Menschen, die an seinem Ufer aufgereiht und dann hineingestoßen werden. Franziska weiß nicht, ob Herr Schürer unter denen war, die gestoßen wurden, oder unter denen, die stießen, vielleicht stoßen mussten. Herrn Schürers Akte ist leer, Besuch erhält er nie.
»Ach, Schwester«, wiederholt er noch einmal. »Es ist wirklich dringend.« Dabei schwimmen seine durchsichtig blauen Augen in Tränen. »Es darf doch nichts in die Hose gehen.«
»Natürlich, Herr Schürer. Aber ich hab es Ihnen ja erklärt: Ich darf das nicht.« Franziska ist Betreuungshelferin, ein neu geschaffener Beruf in der Altenpflege, ein Auffangbecken für Existenzen wie sie, deren Lebenslauf, wie ihre Freundin Nora es formuliert, einem Personalchef die Tränen in die Augen treiben würde. Wer sich als Schriftstellerin durchs Leben schlagen will, muss Kompromisse machen, vor allem, wenn sie die sechzig überschritten hat. Franziska hat schon viele berufliche Rollen gespielt und sich immer gesagt, dass es genau das im Grunde ist, ein Spiel, nicht mehr. Sie muss es allerdings nach den Regeln spielen.
Sie darf Gesangsrunden leiten, Sprichwörter-Raten veranstalten und die vielen Glastüren der Station mit Bastelarbeiten schmücken. »Pflegerische Handlungen vornehmen« darf sie nicht. Und Herrn Schürer die Urinflasche reichen, ist eine davon. Aber Herr Schürer muss auf die Toilette.
Franziska schaut sich um. Von den Pflegerinnen ist keine zu sehen. Alle sind unter Zeitdruck damit beschäftigt, die Bettlägerigen zu füttern. Das ist wie ein D-Zug, der durch die Station fährt. Gnade dem Ahnungslosen, der versucht, ihn anzuhalten.
Sie läuft zum Flur und reckt den Hals. Die Bahn scheint frei. Sie winkt Herrn Schürer, der neben sie rollt. »Wissen Sie was«, flüstert sie, »wir machen das jetzt einfach.« Entschlossen packt sie die Holme seines Rollstuhls. »Wir sind in geheimer Mission unterwegs.« Man muss die Abenteuer nehmen, wie sie kommen.
»Ach Gott, ach Gott, Schwester.«
Sie küsst ihn beschwichtigend auf seine Glatze mit den fünf Haaren. Er tut, als sei ihm so viel Überschwang lästig, wedelt mit der Hand und lächelt in sich hinein.
Beinahe wären Franziska und Herr Schürer den wachsamen Augen des Systems entkommen. Doch das Schicksal lässt Svetlana die Schreckliche aus Zimmer 302 treten, Gesundheitsschuhe an den Füßen, Bitterkeit in den Mundwinkeln, latexbehandschuhte Hände wie ein Serienmörder. »Was macht ihr da?«, verlangt sie zu wissen. Schwester Svetlana duzt jeden, Kollegen wie Bewohner. Dank ihr hat Franziska das »Sie« neu schätzen gelernt.
Betont würdevoll beginnt sie: »Herr Schürer benötigt Hilfe beim Wasserlassen …«
Svetlana lässt sie nicht ausreden. Sie greift nach dem Rollstuhl und schiebt ihn den ganzen Weg zurück in den Speisesaal, stellt ihn ruppig an den Tisch und arretiert die Bremsen. »Der pisst, wenn ich es sage.« Mit energischen Schritten ist sie schon wieder an der Tür, nimmt eine der Zeitschriften von der Ablage und wirft sie ihnen zu, dass sie vor dem Rentner auf den Tisch klatscht. »Da, lenk ihn damit ab.« Sie rauscht hinaus.
Franziska spürt die Röte in ihrem Gesicht pochen. »Kommen Sie!« Entschlossen schiebt sie den Rollstuhl ein zweites Mal über den Flur, sich nach rechts und links umschauend wie eine Verschwörerin.
»Aber dürfen wir das denn?«, fragt Herr Schürer besorgt, als sie sein Zimmer mit dem Bad erreichen. Franziska sucht und findet die Bettflasche, das seltsame Ding, aber sie darf jetzt nicht kneifen. »Nein, dürfen tun wir das nicht, Herr Schürer. Wir machen jetzt etwas komplett Illegales.« Sie lächelt ihn grimmig an.
Besorgt lächelt er zurück. »Und können Sie das auch?«
»Es ist nicht der Erste, den ich in Händen halte«, versucht sie sich und ihm Mut zu machen. In seine sonst wachsgelben Wangen schießt ein klein wenig Röte.
»Ach herrje.« Er jammert vor sich hin, halb verlegen und halb geschmeichelt von ihrer Zweideutigkeit, während Franziska sich bemüht, nicht zu schwitzen und ihre Entscheidung nicht zu bereuen. Es ist gar nicht so einfach, unter all den Stoffschichten das kleine Objekt zu finden und in Kontakt mit dem Flaschenhals zu bringen. Doch endlich ist es geschafft. Herr Schürer schließt die Augen und entspannt sich.
Nach der Aufregung will er sich hinlegen. Leise zieht sie die Zimmertür hinter sich zu. Sie steht einen Moment da. Jetzt wäre es Zeit, mit dem Rollwagen die Zimmer abzuklappern, Würfelspiele, Vorlesekapitel oder Duftölmassagen anzubieten, manchmal einfach nur ein Gespräch, bei dem sie den immer gleichen Erinnerungen lauscht. Aber Franziska, die auf der Suche nach der Kraft dafür all ihre Seelenschubladen durchstöbert, findet selbst im letzten Winkel nur ein widerspenstiges, entschiedenes »Nein«.
Im Flur ist niemand, der ihre Schritte auf dem Linoleum hören könnte, als sie Tasche und Jacke aus dem Aufenthaltsraum holt und zum Aufzug geht. Ungeduldig drückt sie auf den Aufzugknopf. Sie löst den Zopf und schüttelt ihr Haar aus, das wie ein schwerer Vorhang über ihren Rücken fällt, ihr Banner des Protests gegen die Welt. Sie hat sich getäuscht: Demütigung perlt nicht an der Haut der Rolle ab. Die Haut ist in ihrem Alter zu dünn dazu.
Gegenüber der Lifttür steht eine rote Plüschottomane. Sie hätte ein gemütliches Plätzchen für die Bewohner sein können, ist aber komplett belegt von Schaufensterpuppen in altmodischer Kleidung, die starr Seite an Seite sitzend an den Besuchern und aneinander vorbeiglotzen. Franziska hat schon immer gefunden, dass die Ungeschicklichkeit, mit der hier Leben simuliert wird, Bände spricht.
Heute spürt sie die toten Augen der Puppen kalt in ihrem Rücken: Alter, Verfall, Starrheit und Stumpfsinn sitzen da und warten auf sie. Der Aufzug kommt mit munterem Pling. Mit einer raschen Bewegung schubst Franziska die nächstgelegene Puppe an, dann tritt sie in den Lift und drückt auf »E«. Durch den sich schließenden Türspalt sieht sie die Puppen in Zeitlupe eine nach der anderen vom Sofa sinken. Für dieses Mal ist sie entkommen.
Eine Gedichtzeile schießt ihr durch den Kopf, warum gerade diese? »Ich hab mit dem Tod in der eigenen Brust den sterbenden Fechter gespielt.«
Franziska ist 64Jahre alt. Und sie fragt sich. Sie fragt sich so vieles.
2 Zurück zu Hause, vier Treppen hoch in einem Altbau ohne Lift, muss Franziska die Beantwortung ihrer Fragen erst einmal verschieben. Sie legt ein neues Brikett in den Ofen und stellt die Lüftungsschlitze weiter, damit es gut anbrennt. Mehr als lauwarm wird die Wohnung nie.
Sie lebt alleine. Nach ihrer Scheidung und nachdem ihr Sohn sich früh dafür entschieden hatte, beim Vater zu bleiben, hat sie nie wieder den Wunsch verspürt, sich auf das Abenteuer eines Zusammenlebens einzulassen. Sie hat ihre Bücher, Tausende, die alle Lücken füllen. Daneben, dazwischen: Muscheln, Steine, Poster, bunte Tücher, Ansichtskarten, alte Eintrittbillets – die Sedimente zahlreicher Erlebnisse. So viele Spuren von Leben in allen Zimmern. Aber alle Spuren stammen von Franziska selbst.
In der Küche wartet ein Stapel schmutzigen Geschirrs. Franziska stellt heißes Wasser an und wartet auf das Klacken, mit dem der alte Boiler im Bad anspringt. Sie schaut hinaus auf ihren von Tauben verschmutzten Balkon. Sonne und Regen haben alle Farbe aus den Windrädchen gezogen.
Wo ist die Hinterhofromantik geblieben? Wann war ihr die Lust ausgegangen, Pflanzen für die schmiedeeiserne Brüstung zu kaufen? Sie betrachtet die lachenden Gesichter auf den Sonne-Mond-und-Sterne-Laternen, mit denen sie ihre Schlafnische beleuchtet, und sieht nur den Staub. Ihre bunten Halsketten, als Wandschmuck an Haken über den Flur verteilt, sehen plötzlich billig aus. Nichts davon würde mit ihr in ein Pflegeheim umziehen, wenn es so weit wäre, da gibt es keinen Platz für Spielereien, nur für fünf Bücher, vier Fotos, drei Blumenvasen auf dem Fensterbrett. Mehr passt dort nicht in ein Leben. Und jemand anderes wird über ihr Ausscheidungsverhalten bestimmen. »Ich bin zu alt für das Boheme-Leben«, sagt sie zu sich selbst im Spiegel.
Sie ist fast eins achtzig groß, schlank bis zur Knochigkeit und hält sich sehr gerade für ihre 64Jahre. Man hat sie schon des Öfteren für eine gealterte Ballerina gehalten, obwohl sie mit den eher unspektakulären blaugrauen Augen und der zu großen Nase keine Schönheit ist. Die strenge Ausstrahlung wird durch ihre farbige Kleidung und ihre Neigung zu großen, archaisch wirkenden Schmuckstücken gemildert. Franziska kann wie eine Respektsperson aussehen. Doch das wollte sie nie. So wenig, wie sie je einen bürgerlichen Beruf angestrebt hat. Ein Fehler?
»Ich bin zu alt für das Boheme-Leben«, sagt sie eine halbe Stunde später am Telefon zu Annabel, einer ihrer besten Freundinnen. »Noch zwei, drei Jahre, und sie kassieren mich, wenn ich in meinen Flohmarktklamotten auf die Straße gehe, und stecken mich in eine Anstalt. Sein Alter zu ignorieren, ist auch ein Realitätsverlust.«
»Ich fand deine Kleidung immer schon ein wenig zu schrill«, sagt Annabel. »Vor meinen Klassen hätte ich das nie anziehen dürfen. Schon gar nicht als Blondine. Als Blondine bist du sofort das Sexualobjekt.«
Annabel ist pensionierte Lehrerin, und, ja, blond war sie einmal, ein Umstand, der trotz ihrer Befürchtungen nicht verhindert hat, dass sie es ohne Zwischenfälle zur Studiendirektorin brachte. Darüber hinaus war sie Zeit ihres Lebens Single und, soweit Franziska weiß, eher selten das Subjekt oder Objekt von Sex. Annabel schützt sich durch möglichst intellektuelle Brillen, einen – mittlerweile silbernen – Pagenkopf, der so exakt geschnitten ist, dass es fast wehtut, und eine dezidiert lehrerinnenhafte Kleidung, bestehend aus Bleistiftrock, Twinset und Pumps, die sie auch nach ihrer Pensionierung nicht abgelegt hat. Sie trägt die Schuhe selbst im Haus.
»Außerdem«, fügt Annabel der Ordnung halber hinzu, denn sie ist sehr ordentlich, »ist man noch kein Bohemien, nur weil man nicht Staub wischt.«
»Staub wischen? Bist du verrückt, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt.« Franziska lehnt sich in ihrem alten Sessel zurück. Sie streckt die langen Beine und lässt die Glöckchen an ihrer Fußkette klimpern. Langsam geht es ihr wieder besser. Sie weiß, dass Annabel es nicht böse meint. Als Studentin war sie lockerer. Wann hat das bei Annabel mit den Ängsten und den Verschwörungstheorien angefangen? War es im Referendariat? Franziska selbst hat sich dieser Veranstaltung des Bayerischen Bildungsministeriums zur Brechung von Seelen erfolgreich entzogen und nach dem Studium nie mehr eine Schule betreten. Lange Jahre hat sie sich zu dieser Entscheidung gratuliert, vor allem wenn sie Annabel betrachtet, die heute eine Stunde damit verbringen kann, vor dem Aufbruch zu einer Einkaufsfahrt sicherzustellen, dass ihr Herd aus ist.
Andererseits kann Annabel sich einen modernen Induktionsherd leisten, ein eigenes Auto, ein Appartement mit Garten und einen sündteuren Friseur. Franziska ihrerseits hat Post von ihrem Verleger erhalten, der ihr mitteilt, dass ihr Anteil am Verkauf ihres aktuellen Romans für das gesamte letzte Jahr 87Euro 93 beträgt. Auch das kann auf Dauer zu Zwangsvorstellungen führen.
»Sitzen bleiben, Marlon«, hört Franziska die Freundin sagen.
Sie fragt: »Hast du eine neue Katze?«
»Das ist ein Nachhilfeschüler«, erklärt Annabel. »Er brütet gerade über Nathan der Weise.«
»Mein Gott, ja, die Ringparabel.« Franziska lacht auf. »Weißt du noch, unser Theaterbesuch?«
»Wo sie den Kreuzritter nackt haben auftreten lassen?« Auch Annabel klingt jetzt heiterer. »Und dann wälzte er sich in all den Federn. Haben nur noch der Teer und der Ku-Klux-Klan gefehlt.«
»Oder eine Hüpfburg mit silbernen Bällen«, schlägt Franziska vor. »Ah, wir hätten Regietheater machen sollen.«
»Ach nee«, gibt Annabel zurück, »immer die langen schwarzen Ledermäntel und die Anspielungen auf das Dritte Reich. Meine These als Historikerin ist ja …«
»Du, was ich dir sagen wollte …«, unterbricht Franziska sie rasch, die Annabels historische Thesen fürchten gelernt hat. »Weil, ich hab nachgedacht …«
»Du weißt schon, dass der Satzbau ein Anglizismus und streng genommen grammatikalisch falsch ist«, gibt Annabel zu bedenken.
»Lass mich doch mal ausreden. Ich hab nachgedacht, weißt du noch, unser Projekt?«
Im Hörer ist es still. Liegt es an Franziskas Ton oder am Thema? An diesem Wort, »Projekt«, das gar nicht spezifiziert zu werden braucht? Es steht außer Frage, welches Projekt gemeint ist. Während ihrer langen Freundschaft gab es viele Ideen und Initiativen, aber nur ein »Projekt«.
Das »Projekt« ist etwas, das ihre Freundschaft seit den Anfängen begleitet. Eine gemeinsame Idee, zu der jede von ihnen etwas beigetragen hat, Annabel, Franziska, Nora und Luise. Schon an der Universität war es eines ihrer Lieblingsthemen gewesen, wenn sie abends, mit Rotwein aus dem Tetrapak, zu philosophischen Debatten und Liebeskummer beisammensaßen, vier Mädchen aus der Provinz, die Großes vorhatten.
Das Projekt war gewachsen und gewuchert, hatte über Jahre geruht, vornehmlich dann, wenn eine von ihnen mal wieder einen Mann ins Zentrum ihres Lebens gestellt hatte, und war so zuverlässig wieder aufgetaucht, wie die Männer verschwanden, nur, um mit noch mehr Hingabe weitergesponnen zu werden. All die Jahre war das Leben nie ganz über die Idee hinweggegangen.
Annabel nimmt, was Franziska nicht sehen kann, ihre Brille ab. Leise sagt sie: »Du meinst unsere Künstler-WG?«
»Ich meine unsere Alters-WG.« Franziska versucht, die Dinge beim Namen zu nennen. So war es auch immer geplant. Wenn sie alle alt wären, so hatten sie sich das ausgedacht als Studentinnen, die von der Zukunft keine Ahnung hatten und sich die irgendwie als ein Mehr vorstellten, ein Mehr von allem: den schönen Dingen, die zu erleben sie vorhatten, ein Mehr an Liebe, an Erfolg, an Bedeutung, an Selbstverwirklichung. Was gab es sonst im Leben?
Wenn sie alt wären und all das erreicht wäre, wollten sie zusammenziehen, um über das Erlebte zu plaudern und zu lachen. Um ein freies Leben zu führen voller Wein und Lektüre und Pläne und interessanter Freunde und Fremder, die zu Besuch kämen. Unsympathische Menschen wären gar nicht erst erlaubt, die ganze böse Welt bliebe draußen aus ihrem Märchenreich, in dem sie alleine herrschen würden, in Freundschaft und Harmonie. Bis dass der Tod sie schied. Was davor käme, das Altsein und Noch-älter-Werden, das hatten sie sich nicht weiter ausgemalt. Es war nur als ein weiteres begleitendes Mehr erschienen, ein Mehr an Jahren.
Oh, sie hatten sich durchaus auch Gedanken um praktische Fragen gemacht, etwa: War Gin in der Hausbar akzeptabel, oder kam nur Whiskey infrage? Durften Männer über Nacht bleiben? Vor allem aber: Wie sollten sie all ihre Bücher, deren Zahl in die Zehntausende ging, in einer gemeinsamen Bibliothek zusammenführen? War die alphabetische Ordnung nach Autorennamen die beste Lösung, oder sollten sie Themenabteilungen bilden? Nach Nationalsprachen trennen? Chronologisch vorgehen nach Geburtsjahr des Verfassers? Oder nach den Farben der Einbände, vorausgesetzt, dass das keine reine Barbarei darstellte, sondern eine ganzheitliche mnemotechnische Strategie? Ja, darüber redeten sie sich die Köpfe heiß. Nicht jedoch über Arthrose und Fersensporn, über Schwerhörigkeit, die einen freiwillig von Opernbesuchen Abstand nehmen ließ, über chronische Verstopfung und darüber, dass ihnen, wenn sie lachen mussten, die Unterhosen nass wurden.
All das weiß Franziska jetzt, die im Altersheim viel dazugelernt hat. Ihr ist mittlerweile klar, dass es auch um Treppenlifte gehen muss und darum, ob man noch alleine in die Dusche kommt. Um gute Beleuchtung, Telefone mit großen Tasten und Hausnotruf und um Platz für Rollatoren. Um all das, was in ihren Plänen bislang außen vor geblieben war. Sie fürchtet, dass Annabel sich an dasselbe erinnert wie sie, wenn sie an das Projekt denkt: an Mädchenträume mit wenig Substanz. Sie will die Freundin so gerne davon überzeugen, dass der alte Zauber mit neuem Pragmatismus unterfüttert werden kann. Gleichzeitig hofft sie, dass er hält, dieser Zauber. Denn sonst hat sie nichts anzubieten. Franziskas Stimme ist unwillkürlich höher geworden.
»Ich hab, wie du weißt, kein Kapital einzubringen. Aber da ist mein Elternhaus in Birkenbach. Seit fünf Jahren überlege ich, was ich mit der alten Wirtschaft anstellen soll. Kein Mensch wird sie mehr pachten. Sie ist praktisch nichts wert. Aber sie wäre ein solides Heim. Dreihundert Jahre alte Mauern eben. Es müsste umgebaut werden, aber es böte Platz für uns alle. Dazu die Scheunen, der Garten, nicht zu groß, aber man könnte mal raus.« Sie macht eine Pause. Annabel liebt diesen Garten, das weiß sie. »Die alte Gaststube könnte unser Wohnzimmer werden. Wir müssten die Theke gar nicht abbauen, das gäbe eine nette Hausbar für Nora.«
»Und die alte Jukebox«, fällt es Annabel ein. »Die mit den Schlagern aus den Fünfzigern.« Sie war ein- oder zweimal mit Franziska bei deren Eltern gewesen, in den Semesterferien. »Sommerfrische« genießen und der Freundin beistehen, damit sie im Laufe des langen Augusts vom Mief des zurückgelassenen Lebens nicht überwältigt würde und den Weg zurück an die Universität auch sicher wiederfände. Ein wenig hatten sie alle noch Angst in den ersten Jahren, ihre große Flucht aus dem Kleinbürgertum der Provinz könnte scheitern, schon allein, weil die Geisteswissenschaften eine so wackelige Rettungsleiter abgaben.
»Genau.« Franziska atmet auf. Das klingt besser, als sie erwartet hat. »Im ersten Stock gibt es fünf Zimmer, wenn man den Anbau dazunimmt. Der Aufgang ist bestimmt breit genug für einen Treppenlift. Und die Scheune ergäbe eine tolle Bibliothek mit behindertengerecht ebenerdigem Zugang.«
»Ach, weißt du, die Bibliothek …« Annabels Stimme verklingt. Ihr verschwommener Blick gleitet zu den Regalen, die sich als vage bunte Schatten abzeichnen. Seit sie keine Klassenlektüren mehr aussuchen muss, hat sie nicht mehr so oft darin gestöbert. Es strengt ihre Augen an, all die Wörter auf den Buchrücken zu entziffern. Die Zeiten änderten sich. Schwer zu sagen, wie. Nein, korrigiert sie sich, nur schwer, es auszusprechen. Unwillkürlich räuspert sie sich.
Franziska wartet darauf, dass etwas kommt. Als ihre Freundin schweigt, fährt sie fort, ihre Ideen auszumalen. Den Umbau, den Nora als Redakteurin eines TV-Magazins über Bauen, Wohnen und Lifestyle in die Hand nehmen könnte. »Ich habe die Immobilie, Nora das Know-how …«
»… und ich das Geld«, fällt Annabel ein.
»Na ja«, meint Franziska und hält den Atem an. Sie waren schnell beim Thema gelandet, dem kritischen Thema in ihrem Leben: den Finanzen. Franziska war die letzten vierzig Jahre nie über ein studentisches Verdienstlevel hinausgekommen. Die erste Pfändungsandrohung hatte sie noch in Panik versetzt; allmählich dann gewöhnte sie sich daran, dass ihr Konto ab Mitte des Monats überzogen war, obwohl sie nie woanders als bei Aldi oder Norma einkaufte. Kismet, sagte sie sich meist, ein kleiner Preis für ihre Freiheit. Aber auch der Grund, warum sie nie zu Klassentreffen ging.
Sie sagt: »Nora hat auch eine Menge gespart, falls sie nicht alles in Schuhen und Schals angelegt hat.«
»Und Luise?«, will Annabel wissen.
»Tja, Luise.« Sie schweigen beide. Luise ist die Einzige von ihnen, die geheiratet, ein Haus gebaut und dort Kinder großgezogen hat. Jahre waren vergangen, in denen sie am Telefon auf die Frage, wie es ihr gehe, stets antwortete: »Gut, du weißt ja.« Meist gab es nichts Neues. Nur die Fortschritte oder Rückschläge der Kinder in der Schule, dann an der Uni und schließlich im Beruf. Sie waren das Einzige, was sich in der Familie weiterzuentwickeln schien. Luises ruhiges Leben änderte sich wenig. Sie sah mit dreißig aus wie mit vierzig und mit vierzig ganz ähnlich wie mit fünfzig, ohne sich je daran zu stören und auch ohne sich in ihrem ruhigen, verträumten Wesenskern zu verändern. Sah man genau hin, dann hatte ihr rundes Apfelbäckchengesicht unter den mausgrauen Locken sogar die wenigsten Falten von allen.
Zu jedem Treffen der Freundinnen allerdings, zu jedem gemeinsamen Kurzurlaub erschien sie zuverlässig, eine gute Zuhörerin und ab dem dritten Glas unerwartet witzig und trocken in ihren Kommentaren. So war Luise eine der ihren geblieben. Sie hatten sich deshalb angewöhnt, über Luises so ganz anders geartetes Leben nicht groß nachzudenken; es spielte keine Rolle für sie. Bei der Planung einer Frauen-WG war ein Ehemann allerdings eine Größe, die nicht vernachlässigt werden konnte.
»Luise hat Wolfgang«, sagt Franziska schließlich. Auf Luise würden sie verzichten müssen.
Diese Erkenntnis wirkt ernüchternd auf sie. Mit einem Mal scheint ihr alles, was sie sich in den letzten Stunden überlegt hat und was ihr so real und vernünftig vorkam, nur doch wieder eine Neuauflage der alten Seifenblase zu sein. Es würde keine Alters-WG geben, natürlich nicht. Sie haben alle ihr Leben, das sie führen müssen. Es ist Unfug, zu glauben, die anderen würden das ihre auf den Kopf stellen, nur weil sie, Franziska, sich einsam fühlt und Trübsal bläst. Sie würde sich zusammenreißen, sich drei Tage krankschreiben lassen und dann in ihr Pflegeheim zurückkehren. Oder wieder als Verkäuferin in einer Beck-Filiale anfangen. Und eben von einer Brücke springen, ehe sie in die Fänge des Pflegesystems geriete. Um sich bis dahin besser zu fühlen, könnte sie ja einen weiteren Roman verfassen. Den keiner lesen würde. Wie gehabt.
»Weißt du«, hört sie Annabel sagen, »das ist gar keine dumme Idee. Ich könnte das Appartement verkaufen. Der Immobilienmarkt hier ist ja geradezu am Durchdrehen. Vermutlich bekäme ich nie mehr dafür als gerade jetzt. Es wäre der richtige Zeitpunkt.«
Franziska kann es kaum glauben. »Du würdest …?«
»Absolut«, sagt Annabel. »Ich meine, ich denke darüber nach. Aber ja, ich glaube, ja. Entschuldige, mein Schüler.« Es tutet aus dem Hörer.
Franziska legt ihrerseits auf. »Wahnsinn«, flüstert sie. Zum ersten Mal seit Langem fühlt es sich an, als hätte etwas Neues begonnen. Wirklich begonnen.
3 Auch Annabel sitzt einfach da.
»Hallo?«, meldet sich ihr Schüler irgendwann.
Sie wendet ihm das Gesicht zu, ohne die Brille wieder aufzusetzen. Ihre ungewöhnlich großen blauen Augen sind noch immer schön, das weiß sie. Aber die Welt, die sie damit betrachtet, ist unscharf geworden, an den Rändern verschwimmt sie in ein graustichiges Sepia, in dem die weiße Designereinrichtung, die Aquarelle und die Glastüren ihres geliebten Heimes einfach verschwinden. Diese Ränder wachsen langsam aufeinander zu. Sie setzt die Brille wieder auf. Das Unscharfe verschwindet nicht ganz. Eine neue Brille würde das beheben, aber nur kurz. Die Unschärfe wird zurückkehren, wird bleiben, sich verdichten wie Nebel, die Ränder werden weiterwachsen, auf einen engen Punkt zu, in dessen Mitte Annabel ihr eigenes, zu einem Schreien verzogenes Gesicht gespiegelt sieht. Irreversible Sehnervdegeneration. Sie weiß, was das heißt. Hase und Igel. Ein Rennen, das man sicher verliert. Schicksal, welch unterschätztes Wort heutzutage.
»Was ist?«, fragt sie ihren Schüler, dessen Gesicht sie nicht genau erkennen kann. Sieht es gelangweilt, verärgert, ängstlich aus?
»Ich versteh das alles nicht.« Marlons Stimme klingt anklagend und monoton. Alles, gar nichts, krass, geil – mehr kann er nicht zum Ausdruck bringen. Der Text, der Sinn des Textes, den er lesen soll, scheint für ihn genau wie seine eigenen Gefühle unter demselben schmutzigen Milchglas verborgen wie für Annabel die Welt des Sichtbaren. Daran würde ihr Unterricht ebenso wenig ändern wie eine Brille an ihrem Sehvermögen.
Den Nathan kann sie auswendig. Sie hat die Figur des alten Juden immer geliebt. Er hatte ihr die Hoffnung gegeben, dass das Leben im Grunde ganz einfach sein könnte. Weil es nur auf den einzelnen Menschen ankam und was er daraus machte.
»Was gibt es da nicht zu verstehen?« Sie schiebt die eine Seite ihres Haars hinter das Ohr zurück, von wo der Saum in einer scharfen Spitze nach vorne fällt. Unter ihren Schülern ein gefürchteter Anblick, der Moment der Attacke. »Es ist eine Parabel, ein Gleichnis. Über die Relativität von Wahrheit.«
»Gleichnis? Ja, aber wenn man jetzt gar nicht mehr erkennen kann, welcher Ring echt ist und welcher falsch, dann ist das doch scheiße.«
Annabel schließt die Augen. Sie wird blind sein. Wie ihr Vater. Doch der hatte zeit seines Lebens immerhin ihre Mutter gehabt, die ihn pflegte. Voll inniger Abneigung, aber umso zuverlässiger. Sie hat niemanden.
Was hat sie als junges Mädchen Angst davor gehabt, in einer Ehe zu enden wie die ihrer Eltern. Ein hassliebendes Ineinanderverstricktsein, eine Dauerfrustrationsmaschine; jeden Tag gab man einander eine sorgsam bemessene Dosis Gift ein. Nein, das hat sie nie gewollt. Sie hatte es deshalb als junges Mädchen locker angehen lassen, unverbindlich. Es hatte Partyflirts gegeben, auch mal eine Nacht. Aber nie hatte sie eine Begegnung sich weiterentwickeln lassen. Vielleicht war es ja Pech gewesen, vielleicht hatte einfach keine das Zeug dazu gehabt, der Anfang zu sein, dem ein Zauber innewohnt. Vielleicht lag es aber auch an ihr. An der zu schwer zu überwindenden Angst vor dem, womit sie aufgewachsen war: Zweisamkeit, eingelegt in Bitterkeit, die alles durchdrang wie Konservierungsflüssigkeit ein anatomisches Objekt. Sie hatte doch nur dem Unglück entgehen wollen. Ihm entflattern, wie Franziska ihm schon ihr Leben lang so erfolgreich davonflatterte. Nur, dass ihr das Zeug zum Schmetterling fehlte.
Deshalb war sie noch lang keine »Nutte« gewesen. Ulf hatte ihr das Wort trotzdem ins Ohr geflüstert vor über vierzig Jahren. Während er es ihr heimzahlte, wie er es nannte.
Annabel sitzt ganz reglos da. Es ist alles gut, der Herd ist aus, die Tür verschlossen. Offenbar hatte sie Ulf damals sehr verletzt, als sie ihn abservierte. Er hatte bei ihr geklingelt und sich auf ein letztes Bier eingeladen: »Das bist du mir zumindest schuldig.« Dann hatte er sie verletzt. Eine Vergewaltigung konnte man das nicht nennen, oder doch?
Sie war nicht zur Polizei gegangen, nicht einmal zum Arzt. Sie hatte die Wohnung ganz allein wieder in Ordnung gebracht und nie wieder Unordnung in ihr zugelassen. Und niemandem gegenüber je ein Wort darüber verloren. Hatte es unter Fehler verbucht. Ihr Fehler. Danach hatte sie sich gewissenhaft darum bemüht, keinen weiteren zu machen. Sich ganz auf das anstehende Referendariat konzentriert. Sie hatte ja ohnehin nie heiraten wollen.
Allerdings heißt das jetzt für sie, dass es auf ein Pflegeheim hinauslaufen könnte, vielleicht schon in ein paar Jahren. Ihr künftiges Leben würde dann zwar nicht in den Händen eines Mannes wie Ulf liegen, aber in den Händen von Menschen wie ihrem Schüler. Es wären Menschen um sie, die Annabel nicht mehr sehen würde und die im Gegenzug sie, Annabel, nicht kennen würden. Die nichts von dem wissen würden, was sie geprägt hat und ausmacht. Und die Lessings Ringparabel scheiße fanden.
Annabel steht auf, um in den Spiegel zu sehen. Ihre Absätze klacken auf dem polierten Steinboden, doch es liegt keine Energie darin. »Geh nach Hause, Marlon«, sagt sie müde, »und denk noch mal in Ruhe darüber nach. Wir machen Schluss für heute.«
Sie ignoriert sein Meckern und tritt an die Terrassentür, um ihren Garten zu betrachten, ein verschwommenes grünes Aquarell mit ein paar Strukturen. Bald wird sie ihn nicht mehr sehen können. Bald wird sie nicht mehr lesen können. Wird den Weg zum Supermarkt nicht mehr finden. Nicht mehr sicher wissen, ob der Herd wirklich aus ist. Sofort muss sie in die Küche, um es zu überprüfen. Schaltet den Herd an, um die Schalter umso energischer auf »Aus« zu stellen. An. Aus. An. Aus. Aus. Blind. Es wird nicht sofort geschehen, aber geschehen wird es. Sie muss es sich bewusst machen. Lieber würde sie es vergessen. Verdammt, manchmal wünschte sie wirklich, sie könnte heulen. Aber Menschen, die alleine leben, tun so etwas nicht. Es gibt ja niemanden, der es sehen und sie trösten kann. Du bist hart geworden, denkt Annabel sich. War das wirklich nötig? Und wird es weiter nötig sein müssen, bis zum Schluss? Mit trockenem, ausdruckslosem Gesicht geht sie zurück ins Wohnzimmer. Ja, sie wird ihre Wohnung zum Verkauf anbieten, wird die Aktiendepots auflösen. Sie will diese WG. Nein, sie braucht sie.
Die Ordner mit den Finanzunterlagen schon in der Hand, hält sie inne. Sie muss es den anderen sagen, das mit ihren Augen. Wenn es ernst wird, muss sie mit der Wahrheit herausrücken. Muss zugeben, dass sie bedürftig ist. Dass sie sehr schnell eine Last werden könnte. Das wäre wohl nur fair. Wie sie wohl darauf reagieren werden?
Ach, Franziska, die Probleme nie als unlösbar akzeptiert, bis sie schmerzhaft an ihnen scheitert und sich die Wunden leckt, ehe sie auf das nächste losstürmt. Franziska würde vermutlich rufen: »Spinnst du? Klar gehörst du zu uns. Ohne Augen, ohne Haare, ohne Beine. Hurra!« So ist Franziska, viel Enthusiasmus, wenig Urteilsvermögen. Wie fremd ihr das ist, und wie es sie anzieht.
Nora würde wohl eher etwas Trockenes hinzufügen, etwas Geschmackloses und leicht Verletzendes, so etwas wie: »Aber hoffentlich nicht ohne Schließmuskel.« Nora besitzt sehr viel Urteilsvermögen, aber wenig Herz. Aber wer ist sie, das jemandem vorzuwerfen? Fürs Herz ist Luisa zuständig. Immerhin ist sie die einzige Mutter in ihrem Kreis, jedenfalls die einzig erfolgreiche. Ein ewiges, beneidenswertes Rätsel.
Annabel muss lächeln: Franziska, Nora, Luise – doch, es gibt Menschen, die sie kennen, die mit ihr gelebt haben und wissen, wer sie ist. Sie mag ja ein vertrockneter, erblindender Single sein, aber die Gesichter ihrer Freundinnen sind etwas, das sie immer wird vor sich sehen können, egal, ob blind oder nicht.
4 »Schätzchen, mir brauchst du wahrhaftig nichts über behindertengerechtes Bauen zu erzählen.« Nora stößt den Rauch ihrer Zigarette durch die Nase aus, die klein ist, keck und spitz. So wie die ganze Person, die nur knapp eins fünfundsechzig misst, aber drahtig und auf dem Sprung wirkt, trotz ihres Alters. Vor allzu großer Herbheit schützen sie die unerwartet dunklen Schwarzkirschenaugen; Kinderaugen, könnte man meinen, wenn man nicht genau hinsieht.
Nora fährt sich mit der Hand durch die modische Kurzhaarfrisur und greift dann wieder nach ihrem Glas Whiskey Sour. Es ist das zweite an diesem Abend, und der ist ja noch jung. »Ich hab dazu mal einen Kongress in Düsseldorf besucht.« Ihre Stimme klingt, wie man es bei ihren Trinkgewohnheiten erwartet: rau und tief. »Hasi, ich weiß alles über extrabreite, nach außen zu öffnende Badezimmertüren, alles. Und auch, was es kostet, so eine Ruine wie deine an moderne Klimavorschriften anzupassen, hörst du?« Sie drückt den Stummel im Aschenbecher aus und angelt mit der freien Hand nach einer neuen Zigarettenschachtel.
»Nein, nein, jetzt hör du mal zu. Ich meine, wie denkst du dir das? Ich hab schließlich Gabriel.« Mit ihren lackierten Fingernägeln knipst sie an der Banderole herum. Es ist eine russische Marke, die sie auf einem weiteren Kongress, und zwar in der Ukraine, mitgenommen hat. Die Reisen waren das einzig Lustige an ihrem Beruf, der sie zeitlebens nur mit stupiden Geld- und Geschäftsleuten zusammengebracht hat. Banker, Manager, lauter Alpha-Äffchen ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit, es schüttelt sie, wenn sie daran denkt.
In der Ukraine waren noch ein paar russische Mafiosi dazugekommen, echte Verbrecher; in der Baubranche sind die nie weit. Andererseits, der Chef des Senders, für den ihre Sendung produziert wird, ist kürzlich auch angezeigt worden. Sein Name war auf einer dieser Steuer-CDs aufgetaucht. Früher oder später landen die Manager von der Titelseite der Business-Magazine alle im Knast.
Immerhin hat sie sich gut geschlagen all die Jahre in dieser Männerwelt. Sogar eine Auszeichnung hat sie bekommen für ihr Magazin über Bauen, Wohnen und Lifestyle, das über zwanzig Jahre in den Dritten lief und dann zu arte kam. Es war kein »Oscar«, nicht mal ein »Bambi«, aber immerhin. Wer hätte das gedacht im ersten Jahr, als die Redakteure im Senderbüro sich noch gegenseitig zumailten: »Heh, ich hab Blick auf die Titten der Praktikantin.« Als sie es mitbekam, heulte sie erst vor Wut, dann lag sie nächtelang wach, um sich Strategien zu überlegen, und schließlich handelte sie. Ihr Mundwerk ist bis heute gefürchtet.
»Was willst du damit sagen: Ich rede nie von Gabriel? Das muss doch nicht heißen, dass er mir nichts bedeutet. Wie? Martin? Ach Gott, das mit Martin ist doch schon ewig her, das war im letzten Jahrtausend, Herzchen.« Sie hält inne und überlegt. Ist das tatsächlich schon so lange her? Gabriel jedenfalls hat sie beim Geburtstag einer Freundin kennengelernt, mit der sie inzwischen nicht mehr befreundet ist. Und das, weiß sie, liegt jetzt vier Jahre zurück. Erst vier, Gott sei Dank. Wieso Gott sei Dank?, denkt sie. Gabriel fügt sich doch prima ein. Außerdem ist er jünger als sie, er ist noch nicht einmal Rentner, die meiste Zeit des Tages muss sie sich gar nicht mit ihm abgeben. Für nächstes Jahr plant er den stückweisen Ausstieg; dann wollen sie viel reisen, das ist ausgemacht. Ihn zieht es in die Berge, zu langen Bergtouren, zu denen es natürlich nicht kommen wird. Was sollte sie da, an einem Seil hängend? Nora will nach Kuba, die Prospekte liegen schon auf dem Beistelltischchen im Wohnzimmer.
»Klar helf ich dir, aber dass ich da einziehe, kannst du vergessen. Was soll auch eine Zicke wie ich auf dem Land, mit Stöckelschuhen und Gucci-Tasche, hm?« Nicht zu vergessen der Schal von Missoni, den sie sich gestern gekauft hat. Der ist klasse. Langersehnt. Runtergesetzt. So was findet man nicht auf dem Land. Vielleicht im Internet. Eine Frau, die wie sie so genau weiß, was sie will, findet dort eigentlich immer, was sie braucht. Wenn sie ehrlich ist, zieht sie das Stöbern im Netz inzwischen dem Herumirren in der Innenstadt vor. Klar sterben dadurch die Geschäfte, aber das wird sie allein eh nicht verhindern, denkt Nora, die nicht der kulturkritische Typ ist. Würden sie dort in den Boutiquen Whiskey ausschenken und einen hinterher nach Hause chauffieren, dann käme sie auch.
Nora beendet das Gespräch und macht für das Herumirren ihrer Gedanken den Whiskey verantwortlich. Es wird ohnehin Zeit für den dritten. Seit sie morgens nicht mehr in die Redaktion muss, kann sie sich das erlauben. Egal, wann sie aufsteht, sie wird das von Gabriel für sie zubereitete Frühstück auf dem Tisch vorfinden und den Vormittag in Ruhe genießen. Auch das ist ein Faktum, das gegen eine Wohngemeinschaft spricht. Da hätte sie zweifellos hin und wieder »Küchendienst« und bei den Mahlzeiten Gesellschaft, die sie aber doch nur am Abend erträgt. Wobei das Abendessen meist ausfällt. Jeder von ihnen beiden holt sich etwas aus der Küche, in ihrem Fall ist es oft nur etwas Alkoholisches – sie muss ja auf ihre Linie achten –, und nimmt damit im Wohnzimmer Platz, wo Gabriel ihnen als Ingenieur, der er ist, eine Art Privatkino eingerichtet hat, vor dem sie ihre parallel geführten Leben zu vereinigen pflegen, mit Beamer und Surround-Sound und so, die Details will sie gar nicht wissen.
Von Filmen hat Gabriel keine Ahnung. Eigentlich hat er von ziemlich viel keine Ahnung, was Nora betrifft und beschäftigt. Vermutlich weiß er nicht mal, dass sie nicht wirklich bernsteinblond ist.
Einmal hat sie sich Fritz Langs Stummfilmversion der Nibelungen ausgeliehen, ein großartiger Streifen, allein schon das Jugendstil-Design, das dem Zuschauer als archaisch verkauft wurde! Ach, und Kriemhilds Augenringe! Dazu das Gewusel der Hunnen, die als echte Untermenschen, wie man sich das vor Auschwitz noch in aller Unschuld vorstellte, halbnackt aus Erdlöchern krochen. Sie hatte sich mit Franziska darüber unterhalten, das weiß sie noch. Und Gabriel – oder war es doch Martin gewesen? – hatte sich eingemischt: »Attila, Attila – ist das nicht der, der mit den Elefanten über die Alpen kam?«
Das war peinlich gewesen, ohne Zweifel. Sie sagt sich immer wieder, dass sie dafür im Gegenzug keine Ahnung von Schrödingers Katze oder von Einstein hat. Die Katze war tot oder nicht, wo war das Problem? Und die Zeit ihrethalben gekrümmt. Leider interessiert sie das alles nicht im Geringsten.
Sie geht ins Wohnzimmer und kuschelt sich mit schlechtem Gewissen an ihren Freund, der sich gerade eine Natur-Doku reinzieht. Die Tierwelt ist groß. Und reizlos, denkt Nora, die für ein schlechtes Gewissen auf Dauer einfach nicht gemacht ist. Eine Viertelstunde später sehen sie Kinder des Olymp.
5 »Wie bitte? Ach nein, nein danke.« Oder hat sie das Falsche gesagt? Luise fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Sie will es auch gar nicht versuchen, denn dann müsste sie denken. Und wenn sie zu denken begänne, dann müsste sie an all die Dinge denken, die geschehen sind. Wie sie beim Essen saßen, Wolfgang und sie. Früher waren die Jungs dabei gewesen, ihre Plätze sind jetzt belegt von Wolfgangs Zeitschriften. Es gab kalt, wie abends immer, dazu einen Bordeaux aus ihrem Weinkeller, den sie sich vor Jahren schon geleistet haben: mit Lehmboden und gemauertem Rundgewölbe und einer konstanten Kerntemperatur, ein Traum für Wolfgang.
Es lief Jazz, abends lief immer Jazz, Klassik am Mittag. Sie hatten gemeinsam die Tagesschau gesehen, auch das ein Ritual, und gerade über die Verhandlungen zur Großen Koalition gesprochen und wie die Freien Wähler am Ort die Sache sahen, für die Wolfgang dieses Jahr kandidierte.
Da hielt Wolfgang auf einmal inne, seine Sprache wurde unverständlich. Dann kippte er langsam nach links weg. Ein Anblick, so unglaublich und surreal, von dem sie jedes Detail aufgenommen und doch nicht begriffen hatte. Sein Weinglas war umgefallen und der rote Bordeaux über die Tischdecke gelaufen, eine rote Ader, die bis zur Käseplatte reichte, ehe der Stoff sie aufsog. Luise erinnert sich, dass sie »Salz« dachte. Rotweinflecken gingen mit Salz heraus. Während ihr Mann auf dem Boden lag.
Sie hatte ihren Stuhl umgestoßen, als sie endlich in der Lage war, sich zu bewegen, aufzustehen und zu ihm zu stürzen. War sie wirklich gestürzt? Alles, was geschehen war, kam ihr später so langsam vor, jede Bewegung zähflüssig und alles Gesprochene nur schwer zu verstehen, wie unter Wasser formuliert und in trägen Blasen aufsteigend. Sie hatte den Notarzt gerufen, natürlich hatte sie das getan, das Telefon war gleich in der Küche. Einige Male war sie hin- und hergelaufen zwischen dem Körper da am Boden und dem Hörer, der altmodisch per Kabel mit dem Apparat verbunden war. Sie konnte nur das eine oder das andere tun: bei Wolfgang sein oder Hilfe für ihn herbeiholen. Es dauerte, bis sie sich zu entscheiden vermochte. Die Musik lief derweil weiter. Die Kerze brannte still. Sie lief telefonieren, rannte zurück und erschrak erneut über den Anblick ihres Mannes.
Luise schalt sich eine Idiotin und holte Kissen, eine Decke, strich seine Haare aus dem Gesicht, suchte nach dem Herzschlag, dem Puls, redete mit ihm, ohne Punkt und Komma redete sie. Korpulent, wie sie war, bereitete ihr das Knien Mühe. Sie hörte sich reden, stammeln, schwer atmen. Aber hörte er sie? Egal, sie redete und redete, solange sie sprach, musste doch jemand da sein, dem die Worte galten. Wer sprach, hatte einen Zuhörer. Das war Wolfgang, dessen Mund offen stand. Wer redete, musste außerdem nicht nachdenken über Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage, so weit waren sie noch lange nicht.
Die Haustür fiel ihr ein, die musste sie für die Rettungskräfte öffnen. Oder sollte sie das erst tun, wenn die Sanitäter läuteten? Nein, wenn sie offen stand, fanden sie das Haus schneller. Die Tür öffnen und alle Lichter einschalten wie zu einem Fest. Sich kurz schämen vor den Nachbarn wegen der Hausschuhe und der fleckigen Bluse. Dann schnell wieder hinein.
Vor der Tür zum Esszimmer hielt sie diesmal inne. Wenn er wieder am Tisch säße, sich nach ihr umdrehte und einen Lappen verlangte wegen des Weins, unwirsch, weil er so ungeschickt war. Und sie all die unnötige Aufregung verursacht hätte. Aber er lag noch da.
Luise war mitgefahren, jetzt wartet sie. Linoleumboden, Kaffeeautomaten, Plastiksitzschalen, die üblichen Requisiten des Wartens in Notaufnahmen. Sie würden operieren. Da war etwas mit einem Aneurysma, Luise möchte auch darüber nicht nachdenken. Sie kann nichts anderes fühlen, als dass eben noch alles so normal war, so ganz wie immer. Und dass sie absolut nicht will, dass sich daran etwas ändert. Natürlich ist ihr klar, dass genau das schon geschehen ist. Wolfgang hat einen Schlaganfall gehabt, dazu gibt es Komplikationen mit einer Hirnblutung, und Herzprobleme hat er ohnehin seit Jahren. Wenn er das überlebt … Luise schlägt sich die Hand auf den Mund, als hätte sie den Satz laut ausgesprochen und damit eine Realität heraufbeschworen, die sie durch Schweigen hätte verhindern können. Selbst wenn also, wird er schwer krank sein, ein Krüppel, denkt Luise und schämt sich. Ihr kultivierter Wolfgang, der Klavier spielt und mit der Francis-Bacon-Gesellschaft korrespondiert.
All das würde er nie wieder tun. Sagen die Ärzte. Nicht mit diesen Worten sagen sie es. Sie sprechen von Schädigungen des Gehirns, von irreparabel und gravierend. Von Pflegestufen. Luise denkt an die Kinder; sollte sie anrufen, wie viel Uhr ist es überhaupt jetzt, dort drüben in Kalifornien? Sie entscheidet sich dagegen, wozu die Kleinen aufregen. Es wäre außerdem noch ein Stück Wirklichkeit mehr, ein weiterer Stein, der Wolfgang in die Grube hinterhergeworfen würde. Sollte er die OP nicht überstehen, wieder so ein Satz, der nicht gedacht werden darf und doch wie von selbst sich bildet, dann kämen sie ohnehin zu spät. Wie ist das überhaupt mit der Zeitverschiebung, fragt Luise sich. Leben die Söhne in Kalifornien in der Vergangenheit, von ihr aus gesehen, oder in der Zukunft, eine Zukunft, in der ihr Vater vielleicht schon tot ist? Hat er es schon hinter sich?
Sie hat es vor sich, das weiß sie. Diese Nacht. Sie will nicht nach Hause. Kaffee will sie aber auch keinen. Nein danke. Sie hebt den Kopf und greift unwillkürlich nach ihrer Brille, um sie zu putzen. Alles wirkt so verschwommen. Aber die Brille ist nicht da; sie hat sie zu Hause vergessen. Wollte vielleicht gar nicht klar sehen. Mit einem Mal fehlt ihr das vertraute, abgeschabte, fettige alte Horngestell. Fehlt wie etwas Lebensnotwendiges. Wer redet da miteinander? Ist sie das?
Endlich begreift sie, was sie eben zu der Schwester gesagt hat, als Antwort auf deren Frage. Sie kann eine Liege bekommen, im Aufwachraum. Falls ihr Mann aufwacht, ist sie bei ihm. Falls nicht … Luise will nicht schlafen. Sie gehen immer spät zu Bett. Nach dem Essen, abends immer kalt, aber mit gutem Käse von dem Schäfer, der seinen Stand auf dem Wochenmarkt hat, und von dem italienischen Importeur. Und immer macht sie kleine Salate dazu oder eingelegtes Gemüse oder backt Blätterteiggebäck, salzig und gewürzt. Immer ist es ein kleines Fest. Wolfgang wird die Musik nicht mehr auswählen können. Er sucht doch immer die CD aus. Es ist seine Anlage, seine Musiksammlung. Er hat das Klavier angeschafft, das dann keines von den Kindern spielen wollte. Sie selbst kam nie über Pour Elise hinaus, sie hat auch keinen Ehrgeiz. Was sie hat und braucht, sind Wolfgang und ihr Heim.
»Frau Fürst?« Nein, das ist nicht sie. Sie sitzt nicht hier und wartet auf Nachrichten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schreckliche sind. Sie will nicht antworten, sie will verschmelzen mit dem Linoleum und den Sitzen, den billigen Drucken an den Wänden. Daheim hängt Horst Janssen, einer sogar ein Original. Nein, Luise will nicht. Sie wird nicht hören. Sie schließt die Augen. So sieht sie das Gesicht des Menschen nicht, der da mit ihr redet, während sie die Hülle ihres Handys umklammert hält, mit dem sie ihre Söhne nicht anrufen wird. Leidtun? Was redet der Mensch da, was sollte dem Sprecher leidtun? Er kennt Wolfgang doch gar nicht.
Sie kennt ihn gut, kennt ihn schon seit der Schule. Er war der hübscheste Junge in ihrer Klasse. Er hatte braune Locken und war gut in Sport wie in Musik. Er war viel lebhafter als sie, aber er hatte sie ausgesucht. Und dabei ist es geblieben. Luise hat es nie anders gewollt. Ihr Studium hat sie zu Ende gemacht, weil er darauf drängte; es wäre gut für sie. Aber die ehrenamtliche Arbeit in der Bibliothek war ihr dann viel lieber, halbtags, als die Kinder aus dem Haus waren. Als sie älter wurde, hat sie die Arbeit nicht vermisst. Ihren Wolfgang hingegen vermisst sie jetzt schon. Und sie weiß, es wird noch schlimmer werden, ein Schmerz, groß und tödlich, ein Loch im Gewebe und nirgends genug Stoff übrig, um es zu flicken. Wie sollte das gehen?
Nein, sie will keinen Kaffee, keine Liege und nicht schlafen, und schon gar nicht will sie zurück in das Haus, wo Wolfgang nicht sein wird. Wo nichts anderes auf sie wartet als die Erkenntnis, dass Wolfgang nicht da ist. Nie mehr sein wird. Nein, nein, nein. Luise bemerkt, dass sie zu schaukeln begonnen hat, und hört auf. Nein, sie will kein Beruhigungsmittel. Ob sie Auto fahren kann? Wo ist ihr Auto? Es steht doch zu Hause in der Garage, der alte Mercedes, ein Erbstück noch von ihren Eltern, immer gut gepflegt von Wolfgang, sein Auto, das nach seinen Zigarillos riecht. Das muss aufhören. Sie will das Auto nicht, sie will das Haus nicht, nicht das Leben, gar nichts von all dem, was man ihr hier anbieten könnte.
Ob sie ihn noch einmal sehen will?
Der Satz dringt zu ihr durch. Luise steht auf. Zu Wolfgang. Dann hält sie inne. Fühlt, dass ihr die Kraft fehlt für jeden weiteren Schritt. Allein wird sie das nicht schaffen, nicht einmal, wo doch Wolfgang auf sie wartet. Aber er wird unter einem weißen Tuch liegen, so kalt wie das Mobiliar ringsum. Luise wankt leicht. Sie spürt das Mobiltelefon in ihren Fingern. Wie von selber wählt sich die Nummer, die unter 1 eingespeichert ist, seit Wolfgang nicht mehr als Notar arbeitet.
»Ja?«, meldet Franziska sich. Sie hat Luise an der Nummer erkannt, wie immer. Sie stellt keine Fragen wegen der Uhrzeit. Wenn Luise um drei Uhr früh anruft, dann liegt etwas vor, bei dem es keine Zeit zu verlieren gibt. Luise weiß, dass Franziska das weiß. Sie muss nicht darüber nachdenken und ist sicher, dass ihre Freundin es auch nicht tut. Es ist nicht der erste Anruf dieser Art, den eine von ihnen von einer der anderen bekommt. Im Laufe der Jahre hatte jede ihre Krisen.
Ja, hat Franziska gesagt.
Luise bringt keinen Ton heraus.
»Soll ich kommen?«, fragt Franziska. »Wo bist du?«
Luise hört Geräusche, Stoffknistern, Schaben. Sie sieht das zerwühlte Bett der Freundin vor sich mit den kleinen Brokatkissen, den Papierlaternen und der Nachttischlampe aus Jugendstilglas, die sie jetzt vermutlich eingeschaltet hat. Das Bett ist hoch, selbst geschreinert, Wolfgang hatte es für die Freundin gebaut, Wolfgang, der alles kann, und Franziskas Beine baumeln, ehe sie den Boden findet. Der chinesische Seidenteppich ist ein Geschenk von Nora aus der Auflösung des Haushalts ihrer Eltern. Da fällt ihr ein: Wenn sie es nicht mehr schafft, ihr Haus zu betreten, wird auch ihr eigener Haushalt aufgelöst werden. Wie soll sie all das nur bewältigen? Luise schnappt nach Luft vor Schmerz. »Krankenhaus«, bringt sie heraus. »Maria am Hauch. Wolfgang.«
Mehr kann sie nicht sagen, mehr muss nicht sein. Es raschelt lauter im Hörer.
»Ich kann in drei Stunden da sein«, sagt Franziska. »Knapp eine, wenn Nora mir ihren Sportwagen leiht.«
»Ich bin hier«, sagt Luise und legt auf. Sie sinkt auf den Plastikstuhl. Sie hat nicht vor, irgendwo anders hinzugehen. Endlich kann sie den Kopf heben. Vor ihr steht ein müder Arzt. Vermutlich muss er oft Nachtschichten schieben, er sieht blass aus. »Ich besuche meinen Mann nachher, mit meiner Freundin zusammen«, sagt sie. Das ist ein Satz, wie sie ihn auch früher gesagt haben könnte. Er beinhaltet nichts Schmerzliches. Vorsichtig wie Trittsteine benutzt sie die Wörter; sie führen um die tiefen Stellen herum. »Danke«, fügt sie hinzu, als sie Widerspruch aufkommen spürt. »Vielen Dank. Und ja, jetzt hätte ich gerne einen Kaffee.« Luise beschäftigt sich so lange damit, ihr Mobiltelefon in ihrer Handtasche zu verstauen, bis der Arzt fort ist. Immer weiter wühlt sie in der Tasche, weiß nicht warum, ahnt nur, dass sie besser damit aufhören sollte, und lässt es nicht. Sie wühlt und wühlt und findet einen unbezahlten Strafzettel und einen Lippenstift, den sie schon Jahre nicht mehr benutzt hat, eher ein Fettstift mit ein wenig Rosé. Sie mag Schminke nicht, Wolfgang störte das nie. Störte – da ist sie wieder, die böse Vergangenheitsform. Sie schaut sich um und lässt den Lippenstift, der sie auf den herzlosen Gedankenpfad gebracht hat, ohne Gnade in einem Abfalleimer verschwinden. Eine Schwester kommt und stellt einen Porzellanbecher mit Kaffee neben sie. »Gebt mir Koffein und niemandem passiert was«, steht darauf.
»Aus dem Pflegepunkt«, sagt die Schwester. »Der Automat ist kaputt.«
Luise dankt auch ihr, danken ist eine gute Waffe. Auf dem Beistelltisch liegen alte Zeitschriften. Sie greift nach einem Das Goldene Blatt. Die automatische Tür öffnet sich für einen neuen Notfallpatienten, der an ihr vorbeigeführt wird. Ein Mann mit besorgter Miene lässt sich ihr gegenüber nieder. Luise schaut nicht auf, lässt die unschuldigen grauen Löckchen über die Augen fallen, zieht sich hinter den Schleier ihrer Sommersprossen zurück. Sie ist nicht ansprechbar. Sie wartet. Sonst wird sie nichts tun. Blättern, die Fotos anstarren, dasitzen, warten. Sie weiß, wie das geht. Sie hat schon einmal hier gesessen, am Anfang ihres Lebens. Wartend. Damals war es Tina. Luise verdrängt den Namen und jeden Gedanken an ihre Schwester umgehend. Sie blättert ihr Heft um, blättert und blättert, ihr Blick gleitet über die Seiten mit lächelnden Promis wie über eine schiefe Ebene, auf der sie unaufhaltsam abrutscht. Das schnelle Umblättern verlängert die Bahn, hält den Absturz auf. Mehr braucht sie nicht. Bis Franziska kommt, vielleicht mit Nora.
Die beiden würden wissen, wie das Leben weitergeht. Irgendwie.
6 Nora kümmert sich um den Papierkram. Sie kennt Wörter wie »Nachlassgericht« und »Personenstandsurkunden« und weiß, welche Nachweise die Versicherungen benötigen. Sie weiß auch, wann man die Geduld bewahren muss und bei wem sich die Drohung lohnt, dass man ihn »in Grund und Boden klage, mein Lieber«. Dazu trommelt sie mit ihren ultra-eleganten Fingernägeln auf die Tischplatte. Die Leute hören das durchs Telefon. Kein Zweifel, dass sie davon eine Gänsehaut bekommen.
Beinahe als der schwierigste Teil erweist es sich, der Telefongesellschaft klarzumachen, dass der Inhaber des Anschlusses verstorben ist. Der Fall müsste häufiger auftreten, sollte man meinen. Trotzdem scheint er in den vielen computergesteuerten Serviceschleifen nicht vorzukommen. Der Rest ist nicht kompliziert; Wolfgang hat Ordnung in seinen Unterlagen gehalten, und Luise erweist sich als das, was man »gut versorgt« nennt.
Annabel, Freundin der Disziplin und gegen Unordnung allergisch, macht in Luises Haus klar Schiff, das sicherste Mittel, das sie kennt, um böse Geister zu exorzieren. Gegen Trauer und Schmerz gibt es nichts Zuverlässigeres als Putzlappen, Seife und Essigessenz. Was ihr an Sicht fehlt, macht sie mit Entschlossenheit wett. Hygiene, sagt sie sich, geht schließlich in allen bürgerlichen Haushalten gleich. Sie räumt zuerst alles auf, was unbefugt herumliegt, sortiert Wäsche in die Maschine, Schuhe in den Flurschrank, und selbst Bücherstapel, auf denen der ehrenwerte Staub von Jahrzehnten liegt, werden zurück in die Regale gescheucht. Gebrauchtes Geschirr kommt in die Spülmaschine, frei laufende Lebensmittel werden in Tupperschüsseln interniert. Dann erfolgt die Grundreinigung. Schließlich werden ausgewählte Deko-Elemente mit finaler Sorgfalt arrangiert. Am Ende sieht alles fast so piekfein und spiegelnd aus wie in ihrem eigenen Zuhause. Nur den Rotweinfleck bekommt sie nicht aus der Tischdecke.
»Meine Güte«, sagt Franziska.
Nora zuckt mit den Achseln: »Unterschätze nie die Willenskraft der Zwangsgestörten.«
»Sei doch leiser.«
Aber Franziska muss sich keine Sorgen machen. Annabel steht schon mit Luise im Schlafzimmer vor dem großen Kleiderschrank mit Wolfgangs Sachen. »Bist du sicher?«, fragt sie.
Luise wirft nur einen kurzen Blick auf die Kleider und nickt dann. »Alles«, bringt sie heraus, dann läuft sie aus dem Zimmer. Annabel bleibt allein vor dem offenen Schrank zurück. Sie streicht mit der Hand über die Reihe der Jacketts und Hemden. Gute, gepflegte Stücke, kein Zweifel. Einen Moment zögert sie; es kommt ihr wie Verschwendung vor. Aber sie kennt niemanden … Annabel hakt vorsichtig einen Kleiderbügel aus und zieht ein Jackett heraus. Wie schwer Männerkleidung ist, wie massiv so ein Anzugstoff. Verstohlen hebt sie ihn ans Gesicht und riecht daran. Ein wenig Rauch, ein wenig Staub. Der Hauch eines Herrenduftes. Das bringt sie auf das Bad.
Langsam, fast andächtig drückt Annabel die Tür auf zum Allerheiligsten ehelicher Intimität. Da, das Rasierwasser in seiner faustgroßen, prächtig schwarzen Flasche steht neben Luises kleinem Goldflakon wie der Bräutigam auf einem Hochzeitsfoto. Ein altmodischer schwarzer Taschenkamm reitet auf der Haarbürste mit dem Schildpattrücken, ein schwarzer Kulturbeutel schmiegt sich an Luises geblümten. Auf dem Badewannenrand gebrauchte Socken und ein zerknüllter Waschlappen mit angetrockneten Seifenresten, der sich bedenklich glitschig anfühlt. Ein Jahresvorrat Hühneraugenpflaster, eine Hornhautraspel von der Größe eines Wagenhebers und ein paar braune Glasfläschchen mit Tinkturen; auf einem kann Annabel gerade noch aus nächster Nähe »Manneskraft« entziffern, ehe sie es rasch zurückstellt.
Luise hat recht, denkt Annabel, das Rote Kreuz ist die vernünftigste Lösung. Überhaupt ist es immer das Beste, man räumt auf. Schafft sich damit Frieden. Lässt los, was einem sonst das Herz bricht.
Annabel nimmt Objekt für Objekt mit der Vorsicht einer Schlangenbeschwörerin, hebt es hoch, wendet es noch einmal vor ihren Augen und legt es dann in eine Plastiktüte, rasch, ehe es zubeißen kann. Die Tüte kommt auf das verwaiste Bett. Dann holt sie Stück um Stück die Anzüge aus dem Schrank, die Hemden, die Pullover, Wolfgangs voluminöse Jeans. Zurück bleiben nur leise klirrende Kleiderbügel. Annabel faltet alles so gut sie kann und stapelt es neben der Tüte. Sie werden Umzugskartons brauchen. Die anderen würden wissen, wo welche sind.
»Sie hat was?«, ruft Franziska, als Annabel ihr in der Küche erklärt, was sie mit einem Stapel Umzugskartons will. »Alles weggeschmissen, auf einen Sitz, einfach so?«
»Hasi, das ist kein französischer Spielfilm«, gibt Nora zu bedenken. »Sie muss sich jetzt nicht betrinken, nächtelange Selbsterforschung betreiben oder sich flüchtigen Bekanntschaften für verzweifelte Schäferstündchen an den Hals werfen. Jeder trauert anders.«
»Aber …«
»Es steht nicht jeder so auf Dramatik wie du.«
»Alles wegschmeißen«, gibt Franziska zurück. »Wenn das mal kein dramatischer Akt ist.«
»Also ich finde das klug«, meint Annabel, die Selbstbeherrschte. »Sie zieht eben einen schnellen Schlussstrich vor.«
»Das klappt nie und nimmer«, erklärt Franziska. Sie hat für die Arbeit im Altersheim alles über Trauerprozesse gelesen. Es steht bei Kübler-Ross. »Trauer verläuft in fünf Stadien: Unglauben, Feilschen, Aufbegehren, Depression und schließlich Akzeptanz. Aber aus allen Phasen gibt es Rückfälle.«