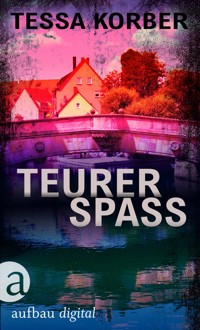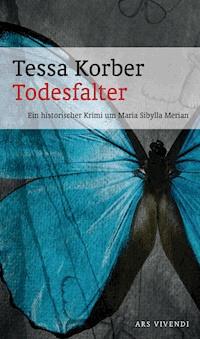Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Königin kämpft für ihr Volkes - bis zum Tod
Palmyra, 260 n. Chr.: Sie ist eine der größten Bedrohungen für das römische Reich: Julia Aurelia Zenobia. Die junge Herrscherin, bildschön und scharfsinnig, besteigt nach dem Tod ihres Ehemannes den Thron der Karawanenstadt Palmyra. Von Syrien aus führt sie ihr Volk zu unübertroffener Blüte und unterwirft schließlich sogar Ägypten. Doch ihre Macht und ihren Reichtum kann der römische Kaiser nicht dulden und so ruft er zum Krieg gegen die Karawanenkönigin ...
Die Lebensgeschichte einer überragenden Frau - neben Kleopatra die wohl bedeutendste der Antike -, die ihre Zeitgenossen durch ihre Schönheit und Klugheit gleichermaßen bezauberte. Ein farbenprächtiger historischer Roman voller Exotik und Erotik - jetzt als eBook lesen.
Weitere Romane von Tessa Korber bei beHEARTBEAT:
Die Magd und die Königin
Die Kaiserin
Der Medicus des Kaisers
Die Hüterin - Das verborgene Land
Die Hüterin - Das Erbe der Schlange
Berenike
Die Königin von Saba
Die Herrin der Gaukler
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
I. Die Stadt
Ein heimlicher Ausflug
Divide et impera
Träume
Balbus wird aktiv
Odus Stunde
Christen unter sich
Pläne für Zenobia
Balbus reitet
Die persische Mission
Neue Erfahrungen
Die Grabtürme
Was die Zukunft bringt
Das Fest der Götter und Pferde
Der goldene Prinz
II. Der Fürst
Strategie
»Evoe« dem Brautpaar
Eine Fürstin wird besichtigt
Clelia
Der Tod des Syndicus
Briefe
Lateinstunde
Der Anschlag
Verrat!
»Bath Zabbai«
III. Das Reich
Das Landgut
Regierungsgeschäfte
Es regnet in Rom
Ein Fest für Alexandria
Nomaden
Der Feldzug
Wo steckt bloß ...?
Hure Babylon
Heimkehr
IV. Die Liebe
Die Frau in der Sänfte
Der Krieg rückt näher
Belagert
Tragt mir was Hübsches vor
Gefangen
Livia
Der Triumphzug
Wie einst Kleopatra
Wenn die Schläfer erwachen
Das letzte Gefecht
Zukunft
Epilog
Über dieses Buch
Palmyra, 260 n. Chr.: Sie ist eine der größten Bedrohungen für das römische Reich: Julia Aurelia Zenobia. Die junge Herrscherin, bildschön und scharfsinnig, besteigt nach dem Tod ihres Ehemannes den Thron der Karawanenstadt Palmyra. Von Syrien aus führt sie ihr Volk zu unübertroffener Blüte und unterwirft schließlich sogar Ägypten. Doch ihre Macht und ihren Reichtum kann der römische Kaiser Aurelian nicht dulden und so ruft er zum Krieg gegen die Karawanenkönigin …
Die Lebensgeschichte einer überragenden Frau – neben Kleopatra die wohl bedeutendste der Antike –, die ihre Zeitgenossen durch ihre Schönheit und Klugheit gleichermaßen bezauberte. Ein farbenprächtiger historischer Roman voller Exotik und Erotik.
Über die Autorin
Tessa Korber, geb. 1966 in der Pfalz, ist promovierte Germanistin und Historikerin. Seit ihrem ersten Romanerfolg „Die Karawanenkönigin” hat sie über zwanzig Romane geschrieben, einige davon unter Pseudonym, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Sie lebt heute als freie Schriftstellerin in der Nähe von Erlangen.
Tessa Korber
Die Karawanenkönigin
Historischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Neuausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Der Roman erschien erstmals 1999 in der Pendo Verlag AG, Zürich.
Covergestaltung: © Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung folgender Bilder: thinkstock: cosmin4000; istockphoto: kshishtof
E-Book-Erstellung: Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3025-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Hier bist du also, mein Freund. Mein Mann wollte mir zunächst nicht sagen, wo ich dich finden kann. Er glaubt tatsächlich nur an die Schwäche der Frauen; er kennt mich nicht.
Aber es gefällt mir hier. Wie still es ist zwischen den Zypressen, ihre Nadeln dämpfen den Schritt, und das Sonnenlicht fällt warm über die Steine. Ich hab dir Rosmarin gepflückt, er duftet stark um diese Tageszeit. Doch nicht so betäubend wie früher in unserem geheimen Garten am Fluss ...
Es muss ein gutes Dutzend Jahre her sein, dass wir gemeinsam durch die Palmengärten schlichen zu unserem heimlichen Badeplatz. Denk dir: Ich kann immer noch nicht schwimmen. Bei meiner Flucht über den Euphrat wäre ich ertrunken, wenn mich nicht ein römischer Söldner an den Haaren herausgezogen hätte. Heute sieht es so aus, als ob ich ihm dafür dankbar sein müsste.
Wenn du mich sehen könntest, Freund. Eine richtige römische Matrone bin ich geworden, von meiner Frisur bis zu den goldbeschlagenen Sandalen. Als wir uns das erste Mal trafen, gingen wir beide barfuß, weißt du noch? O Allath, große Göttin, wie viel ist seither geschehen! Dabei kenne ich deinen Teil der Geschichte noch nicht einmal – und werde ihn vielleicht nie mehr erfahren.
Deine Tochter habe ich allerdings aufgespürt. Mach dir keine Sorgen um sie, es soll ihr gut gehen, du kannst dich auf mich verlassen, jetzt, wo ich dich wiedergefunden habe.
Mein kleiner Spielkamerad ist Vater, ich kann es kaum glauben. Du bist doch selbst immer nur ein Kind für mich gewesen. Und das schien dir nichts auszumachen. Erinnerst du dich, wie du mir immer nachgelaufen bist? Damals, als wir noch gemeinsam durch die Stadt streunten? Wie lange habe ich daran nicht mehr gedacht! Ach Odu, wie hätte ich wissen sollen, dass du einmal für mich sterben würdest. Es war doch alles nur ein Kinderspiel gewesen – bis zu jenem Pferdemarkt, damals, in Palmyra ...
I.Die Stadt
Ein heimlicher Ausflug
Der alte Mann hielt in seiner Erzählung inne, um sich der Aufmerksamkeit seiner Zuschauer zu vergewissern. Reglos saß er auf seiner Decke aus Ziegenhaar und wartete, bis die Stille rings auf dem Marktplatz von Palmyra so schwer wurde wie der Tropfen, der sich vom Rand des Bechers lösen will. Dann nahm er seinen trägen Singsang wieder auf.
»... und Sainab lag in den Armen ihres Geliebten. Sie schlug ihre schwarzen Augen zu ihm auf und flehte mit silberner Stimme: ›Lass uns fliehen, Liebster, lass uns fortreiten in die Wüste, wo der düstere König uns nicht findet ...‹«
Das Mädchen mit den buntgeflochtenen Zöpfen lauschte gebannt. Sainab war eindeutig ihre Lieblingsgeschichte. Doch plötzlich fand sie sich mitsamt der Kiste Pistazien, auf der sie sich niedergelassen hatte, unsanft beiseitegeschoben. Die eisernen Beinschienen eines römischen Zenturio pflanzten sich vor ihr auf und verstellten ihr den Blick.
»He, kannst du nicht Latein reden, Dattelfresser? Damit ein zivilisierter Mensch dich verstehen kann?«, höhnte er laut. In der Zuschauermenge wurde ein unzufriedenes Zischen hörbar, doch trat niemand den Soldaten entgegen. Der Kamerad des Zenturio lachte schallend.
»Hockt sich hier einfach in den Kamelmist, der überall rumliegt, dass man keinen Boden mehr sieht, römischen Boden, das vergessen die hier alle ja gerne ...« Nun feixten sie beide. Wütend rutschte Zenobia von ihrem Stammplatz. Sie war nicht die Einzige in Palmyra, die die zur Schau gestellte Überlegenheit der hier stationierten Legionäre gründlich satt hatte. Dattelfresser, pah. Sie spuckte ihm einen abgekauten Kern gegen die Waden und sah zu, dass sie in der Menge untertauchte, ehe er sich umdrehte. Aber wohin nun?
In dem Strom von Menschen, der sich zielstrebig durch die Straßen schob, schien sie die Einzige zu sein, die das nicht wusste. Zu den Ständen der Kaufleute und Färber vielleicht? Nein, da war heute nichts los. Und ein heimlicher Blick in das kühle Kontor von Clemens’ Seidenhandlung verriet ihr, dass auch ihr Freund Odu nicht da war. Zenobia musste ernsthaft befürchten, die Gefahr eines unerlaubten Ausflugs heute umsonst auf sich genommen zu haben.
Der Mittag war erreicht, und es wurde unerträglich heiß zwischen den riesigen Marmorkolonnaden. Die Konturen der bunten Steine begannen zu flimmern, und nichts dämpfte das metallene Blau des Himmels über der Wüste. Die Düfte des Marktes, Tierdung, Weihrauch, Schweiß, Früchte in Gärung, der süßliche Gestank der Schlachtereien und die herben Aromen der Kräuterstände, sie mischten sich zu jenem betäubenden Parfum, das gemeinsam mit der Hitze die Stadt während der nächsten Stunden in Schlaf versinken lassen würde. Doch noch hallte der Lärm der Marktgassen in Zenobias Ohren.
Plötzlich geriet die Menge in Bewegung. Schrille Warnrufe stiegen auf, eine Herde Ziegen floh in Panik so dicht an ihr vorbei, dass der scharfe Geruch sie einhüllte. Dann sah sie Reiter, die die Menschen in der engen Gasse vor sich her trieben. Der von den Hufen ihrer Pferde aufgewirbelte Staub flirrte in der Sonne. Kreischend rannte alles auseinander, während Zenobia sich zwischen den zurückdrängenden Leibern durchkämpfte und gerade noch einen Blick erhaschte auf breite Schultern und einen wehenden Leopardenfell-Umhang. Ein mächtiger Hengst warf Schaumflocken nach allen Seiten, ein goldener Helm funkelte vorbei, dann verhallte das Dröhnen der Hufe. Das war der Fürst gewesen, flüsterte man, der Fürst von Palmyra, der von der Front zurückkehrte, weil seine Frau in den Wehen lag. Vereinzelt stiegen Hochrufe auf. Zenobia stand eine Weile wie versunken.
Dann griff sie sich eine Handvoll Trauben aus einem vorbeipolternden Karren, schlug sie in ihr Schultertuch und flüchtete sich in den blauen Schatten einer Bildsäule, der einen Kreis aus Kühle und Ruhe in das Markttreiben schnitt. Sie lehnte sich zurück und blickte aus halbgeschlossenen Augen zurück auf den Zug von Händlern, Käufern, Dieben und Flaneuren, der vorüberquirlte, als wäre nichts geschehen.
Schließlich wandte sie sich ihrem Raub zu, den sie auf ihren untergeschlagenen Beinen ausbreitete und polierte, bis jede Beere gläsern schimmerte. Sie schob sich die erste zwischen ihre Schneidezähne, wo sie die Schale andächtig platzen ließ und erst kaute, als ihr der Saft süß in den Mund sickerte.
Der prächtige Reiter eben, er hatte sie an einen anderen erinnert, einen, den sie vor fast einem Jahr gesehen hatte, bei dem großen Markt, auf dem die Bergstämme ihre Pferde und Kamele hier den Karawanen-Kaufleuten anboten. Sie schnippte eine Traube über das Marmorpflaster, die kullernd aus ihrem Blickfeld hüpfte. Und in Gedanken begann sie, die Worte des Märchenerzählers zu wiederholen, während sie sich in die Geschichte der Prinzessin Sainab und ihres kühnen Prinzen gleiten ließ.
Vor ihren abwesenden Augen entstand dabei das Bild eines jungen, wilden Gesichtes. Oh, es war das Gesicht eines Königssohnes, dunkelgolden, mit einem heißen Mund und unbändigen Augen. Beim letzten Markt war er ihr begegnet, als die Herden in einem Wirbel von Staub und Lärm durch das Tor getrieben wurden. Er hatte gelacht und die Peitsche geschwungen, bald verdeckt, bald wieder sichtbar inmitten der stampfenden Pferdekörper. Sie war ihm hinterhergelaufen, am Rand der tobenden Herden, und hatte ihm nachgeschaut, solange sie konnte. Dann hatte die Stadt all dieses Leben aufgenommen und verschluckt.
Niemand konnte ihr eine Auskunft geben, kein Händler auf dem Markt kannte ihn. Er musste wohl zu den Bergstämmen gehören. Wer war er? Wie hieß er? Wenn sie sich nachts unruhig im Bett wälzte, träumte sie sich eine Antwort. Und von niemandem wurde seither der jährliche Pferdemarkt sehnsüchtiger erwartet als von Zenobia, Tochter des edlen Zenobios, des Kommandanten der Stadtgarde von Palmyra.
Sie kaute versonnen und schüttelte den noch kindlichen Medusenkopf, der stets von dem übrig blieb, was ihre Amme ihr jeden Morgen voll Trotz gegen die römisierten Sitten der Stadt als Frisur der unverheirateten Stammesfrauen flocht. Dennoch war sie in ihren Träumen eine Prinzessin, und ihren Beduinenprinzen kleidete sie ungeniert in Goldhelm und Leopardenfell, das Ornat eines Fürsten.
»›Lass uns fortreiten, Liebster‹«, rezitierte sie hingebungsvoll, und eine weitere Traube rollte zu den anderen. Zenobias Blick verfolgte sie über die Ritzen und Mulden des hellen Steins bis zu der Säule gegenüber, glitt an dieser hinauf ...
Da stand ihr Vater. Der Schreck riss sie ganz in die Gegenwart. Ihre Finger waren verklebt, ihre Tunika schmutzig; sie sollte nicht hier sein, und würde er ihre Gedanken kennen, er würde sie strafen. Zitternd zog sie die Beine an den Körper. Er hatte schon einmal von ihren Streunereien erfahren. Zenobia erinnerte sich nur zu gut der Art, in der er an ihr vorbeigesehen hatte, während er ihr ihre Sünden vorzählte und ihr Bruder ihr für jede davon zehn Schläge über den Rücken zog. Und sie hatte nie vergessen, wie gern er es getan hatte.
»Aber er weiß es ja nicht.« Mit aufsteigendem Trotz schaute Zenobia zu der Statue ihres Vaters auf, die streng und ungerührt an ihr vorbeisah, wie damals, als er sie züchtigen ließ, wie er stets seiner Autorität Geltung verschaffte.
»Und er sieht mich nicht«, setzte sie laut gegen ihr Unbehagen hinzu und warf mit Wucht eine neue Traube den anderen hinterher.
»Die Göttin grüßt dich, Zenobia. Warum machst du das?« Mit zurückhaltendem Bedauern sah Odu den Früchten nach.
Odu! Ach, das war gut. Erleichtert sprang sie auf.
Die beiden Kinder waren ein recht ungleiches Paar. Odu war ein Sklave, zwei Jahre jünger als sie und vor kurzem als Beute aus der Unterwerfung einiger Dutzend pannonischer Goten hierher verkauft worden. Abgemagert und erschöpft, hatte er damals auf dem Marktpodium des Sklavenhändlers gestanden, ein zerzauster kleiner Kerl, der dringend ein Bad gebraucht hätte und dessen Schulterblätter herausstanden wie die Springbeine eines Grashüpfers.
Doch über dem Brotfladen, den man ihm zum Kauen gegeben hatte, war in seinem Gesicht bereits wieder die Neugier für die fremdartige Umgebung erwacht. Und während aus der Menge für ihn geboten wurde, sah er mit aufgerissenen Augen seinem ersten Kamel hinterher. Es hatte den Göttern gefallen, ihm nichts von jener freundlichen und furchtlosen Art zu nehmen, mit der er auf alle Menschen und Dinge zuging. Und als er eines Tages Zenobia die Ladengassen der Goldschmiede entlangschlendern sah, die teure Tunika achtlos um die Hüften geschnürt, den schmalen Kopf mit der stolz gebogenen Nase hoch in die Luft gereckt, da war sie für ihn die Hasenkönigin selbst, die einsame Jägerin aus den Geschichten seiner Heimat, die sich nur selten dem Mutigen zeigte und manchmal den Todgeweihten. Er lief zu ihr und lachte sie aus seinen runden Augen an.
Ein solches Blau, wie es aus den Augen dieses kleinen Jungen strahlte, hatte Zenobia noch bei keinem Menschen gesehen. Sie waren blau wie der Mittagshimmel, wenn er sich in der Quelle Ephta spiegelte, und sie leuchteten in reiner, rückhaltloser Anbetung. Seitdem war Odu der treue Trabant all ihrer Ausflüge.
»Du, lass uns zum Tempel gehen.«
»Aber wieso ...?«
»Hier ist es langweilig. Oder weißt du etwas Besseres?« Damit drückte sie Odu den schon reichlich geplünderten Rest der Trauben in die Hand und lief los. Als sie auf gleicher Höhe waren, begannen sie mit dem »Fischspiel«, einer anspruchsvollen Übung, die verlangte, rhythmisch und möglichst ohne Stocken durch die Menge zu gleiten.
Auf diese Weise ließen sie das Tripylon linker Hand, nahmen den Weg an den römischen Kasernen und dem Stadtbad vorbei und durchquerten das Viertel der Färber, wo die zum Trocknen über der Straße aufgezogenen Seidenbahnen über ihren Köpfen im Wind hin und her schlugen. Zenobia verlangsamte das Tempo. Mit ganz in den Nacken gelegtem Kopf blickte sie nach oben auf den Stoff, der im Luftzug zu fließen schien. Indigo und Safran war heute in den Färbebecken gewesen. Sie drehte sich langsam um sich selbst, selbstvergessen, glücklich mit einem Mal.
»Odu, ach Odu, wie schön, sieh, wie schön. Ich will fliegen, ich will in der Luft schwimmen, ich möchte jeden Tag einen Regenbogen von Seide für mich haben.« Sie kreiselte weiter, ohne ihn anzusehen. Odu war anderer Meinung. Clemens, sein Herr, ließ ihn zu einer Hilfe für das Geschäft mit der Seide ausbilden, das auch den christlichen Kaufmann aus der italienischen Provinz in die Karawanenstadt verschlagen hatte, an das östliche Ende des Reiches, wo Syrer, Griechen, Juden, Araber und Perser friedlich ihre Waren tauschten. Daher fühlte er sich als Fachmann.
»Mein Herr Clemens hat bald keine Seide mehr. Die Perser lassen die Karawanen aus dem Osten nicht durch, das ist wegen dem Krieg mit den Römern. Kommt der Krieg hierher auch, Zenobia? Palmyra gehört doch zu Rom.«
»Kämpfen? Für die Römer?« Zenobia glaubte noch nie etwas Lächerlicheres gehört zu haben. Sie dachte an den Zenturio, der den Geschichtenerzähler beschimpft hatte. Für diesen Flegel sollten sie kämpfen? Da musste sie ja lachen.
»Ach was. Palmyra gehört niemandem! Es wird von Allath beschützt, der kriegerischen Göttin der Wüstenvölker. Sieh dir nur dieses Meer an.« Sie tanzte unter den blauen Flaggen über ihnen, die sich so klar von den staubigen Pastelltönen des Viertels abhoben.
»Palmyra ist die Schönste, die Königin der Karawanenstraßen. Und ich bin die Königin von Palmyra.«
Der größte ihrer Spielplätze, das Heiligtum des Bel, lag ganz im Südosten der Stadt. Hier wich der Lärm der Straßen bereits dem stetigen Rascheln der Dattelpalmen und dem feinen Rieseln des Sandes, der vom Wind gegen die geflochtenen Schilfzäune der Gärten getrieben wurde. Wie gewohnt, betraten sie über die Freitreppe der Propyläen das riesige, ummauerte Areal, das weiß vor ihnen in der Sonne gleißte.
In seiner Mitte erhob sich der Tempel, ein säulenumgebener Quader. Mit seinen üppig bemalten Blumenornamenten und bronzenen Akanthusblättern hatte er sie stets angezogen, so bunt wie er war, so labyrinthisch groß – und so verboten.
Die beiden hielten zügig auf den Eingang zu, als in der Ferne zwischen den Säulenreihen des Wandelgangs einige Mitglieder des Priesterkollegiums sichtbar wurden, die zwischen den Licht- und Schattenstreifen des Umbaus wandelten und in ein Gespräch vertieft schienen, von dem kein Laut zu den Kindern herüberdrang.
Zenobia winkte Odu, sich neben sie an den Rand des Opferaltars zu drücken, der ihnen auf halbem Weg im Hof etwas Schutz bot, und beobachtete die Gruppe über den Rand des Blocks. Nichts war zu hören als das Surren der buntschillernden Aasfliegen und das Knirschen des Sandes auf dem Marmor unter ihren vorsichtigen Bewegungen.
»Wenn sie um die Ecke sind, rennen wir rüber. Ich geb’ dir Zeichen.«
»Ist gut«, nickte Odu, der von Zenobias Spannung nicht so recht angesteckt wurde. »Schau, hier liegen Tesserae.« Damit hob er einige der Tonmünzen auf, die in der Stadt als Eintrittsmarken für die rituellen Opfermahle des Tempels dienten, und drehte sie zwischen den Fingern. »Es sind welche mit Gazellen, solche hab ich schon. Kannst du sie brauchen?«
»Lass sehen. Nein, die sind nicht schön. Warte doch bis zum Markt, da werden neue gemacht.«
Odu fiel etwas ein: »Stimmt das, du wirst dieses Jahr beim großen Gottesdienst an der Quelle dabeisein? Gleich beim Priester?« Zenobia zuckte nur die Schultern, das interessierte sie wenig.
»Sie sind weg. Achtung: jetzt!«
Beide rafften auf dieses Kommando hin ihre Tuniken und spurteten über den schattenlosen Platz, gerade auf den großen Eingang zu. Odus Finger lösten sich von einem sonnenbeschienenen Stück Stein des Portals, als sie ins dumpfe Halbdunkel des Tempelinneren traten, in dem ihr keuchendes Atmen das einzige Geräusch war. Nur wenig Licht fiel durch einige schmale Fenster hoch oben unter dem Dach. In den Lichtstreifen, die nirgendwo auftrafen, tanzte stumm der Staub. Die Luft schien so alt wie die Mauern selbst und bot keine Erfrischung.
Die Kinder wussten, wohin sie wollten. In der südlichen Cella verbarg ein steifer, alter Ledervorhang sehr wirkungsvoll eine Wendeltreppe, die in ihr eigentliches Lieblingsversteck führte, einen halbvergessenen Lagerraum im zweiten Stock, der wiederum einen Zugang zum Dach des Tempels besaß. Nachdem sie mit vereinten Kräften die harte Kamelhaut zur Seite gestemmt hatten, wobei sie den Statuen der Triadegötter in ihren Holzschreinen zur Sicherheit keinen Blick zuwarfen, stiegen sie zu ihrem Zimmer auf. Hier gab es zwischen alten Kisten, Teppichen, Lederkissen, Tonkrügen, Tragekörben und anderem Kram genug Material zum ungestörten Nestbau.
Aber heute waren hier ungewohnte Geräusche zu hören. Rascheln und Stöhnen drang aus dem Raum und ließ sie sich ängstlich hinter eine der herumstehenden Sänften ducken. Erst nach einer Weile spähte Zenobia durch deren verschlissene Vorhänge.
Auf einer verstaubten Liege in der Ecke links vom Fenster, das ein fast weißes Stück Himmel und die unendlich ferne Miniatur eines Palmenhaines in das Zimmer schnitt, lag ein Mann. Er war nackt und ganz glatt auf eine Art, die Zenobia gefiel und die sie gerne berührt hätte. Er bewegte sich, und etwas schien ihn abzuwerfen und doch nicht, etwas, das unter ihm lag. Sie konnte nicht recht erkennen, was es war, doch als ein schimmernd weißes Bein, das nicht seines war, vom Rand des Holzgestells herunterhing, da griff ein bodenloses Gefühl nach ihren Eingeweiden, und sie wusste nicht, warum. Es sah zauberhaft und grotesk zugleich aus, als das Bein sich hob und um des Mannes Rücken schlang wie von alleine. Die helle Haut seiner Achseln und Unterarme leuchtete verletzlich aus dem Dunkel der Ecke, während die Silhouette seines Gesäßes sich vor dem Fenster hob und senkte. Zenobia sah die starke Wölbung seines Hüftgelenks, wo seine Beine am Körper ansetzten. Man hätte die hohle Hand darüberlegen können. Die Luft im Raum war lau, mit einem scharfen Geruch. Und darin hing, als ob er dazugehörte, ein Laut wie das erstickte Wimmern eines Kindes, aber sie wusste, das war es nicht. Der Rhythmus aus Stöhnen und Bewegung hypnotisierte sie, als wäre es das pulsierende Atmen der Kammer selbst, das auch sie wiegte; nie hätte sie wegsehen können, obwohl der Tanz dort sicherlich nicht für sie war.
Nach einer Weile löste sich, was Zenobia im Schatten der Liege für die Fransen eines Überwurfs gehalten hatte, zu einer Fülle von Haar auf, aus dem eine Frau sich befreite. Der Mann setzte sich auf, zog ein Gewand über und war ein Priester, genauer gesagt, ihr Onkel Nesa, der eben wortlos der Frau einige Münzen in die Hand zählte. Aneinandergeschmiegt verließen sie den Raum. Zenobia duckte sich noch tiefer in den Schatten und hielt den Atem an, doch die Vorsicht war unnötig, die beiden bemerkten sie nicht.
Zenobia wurde es heiß. In ihren Schläfen klopfte die Schamröte, doch auch ihr Schoß pochte. Und niemandem hätte sie einzugestehen vermocht, dass sich dabei vor das Bild ihres Onkels unerklärlicherweise ein ganz anderes schob: das des jungen Mannes vom Pferdemarkt. Sie suchte den Bann abzuschütteln.
»Odu, ich glaube ...« Vor lauter Aufregung flüsterte sie noch immer. Doch ihr Gefährte hörte sie so oder so nicht. Er lag zusammengerollt neben ihr in einem Nest aus alten Decken und war über der unverständlichen Darbietung eingedöst.
Er verstand so verzweifelt wenig, dachte sie und blickte erbittert auf das schweißglänzende, blasse Kindergesicht neben sich, das sich im Schlaf sacht rötete.
Zenobia fand es unverzeihlich, dass er erst elf war. Sie sprang auf und lief zum Fenster. Froh, allein zu sein, doch zugleich umgetrieben von ihren Gedanken, fuhr sie über das glatte Mauerwerk, das ihren ungeduldigen Fingern keine Beschäftigung bot.
Die Aussicht war die öde ewig gleiche. Unter ihr in dem ersten Schatten, den der Tempel warf, standen ein paar Männer zusammen. Sie trugen die blauen Togen und die steifen, hohen, oben abgeflachten Kappen der Priester. Ob Nesa wieder unter ihnen war? Bei dem Gedanken, dass sie alle ihre Gewänder anhoben, um gegenseitig ihre Hintern zu begutachten, musste sie kichern. Sie tauchte ab, um sich ein paar von Odus Tesserae zu holen, und ließ den ersten auf die Gruppe fallen, ohne nachzudenken. Er zerschellte unbemerkt an der Tempelwand. Der zweite schlug in einer kleinen roten Staubwolke auf dem Boden auf. Zenobia bemerkte die erste Irritation unter sich; fast hysterisch vor Spannung gluckste sie und quietschte und warf Münze um Münze. Die letzte landete auf dem Filzrand einer Kappe.
Alles sah hinauf in einen wolkenlosen Himmel. Nicht einmal ein Vogel flog dort. Oben hockte Zenobia unter der Fensterbank, zu echter Angst ernüchtert, und sah in Odus schlaftrunkenes Gesicht. O ihr Götter, sie mussten nun wirklich nach Hause.
Divide et impera
Die Sonne ging schnell auf über Palmyra. Die Oasenstadt kannte kaum eine Dämmerung, und nur flüchtig spiegelte ihr Marmor ein fernes Violett wider, während das reife Gelb des Frühlichts zwischen ihren Säulen stand. Bald zerdampften die zarteren Töne des Morgens unter der Sonne, die den Himmel taghart brannte.
Einsam und prächtig lag es da zwischen seinen Gärten und den zusammengedrängten Lehmwaben der Bauernhütten, Klumpen erdfarbener Erhebungen, kaum sichtbar neben den pastellenen, bisweilen leuchtenden Farben Palmyras selbst, den alles dominierenden Kolonnaden, Tempeln und Prunkbauten, unter denen der neu angelegte Palast des Stadtherrn Odaenathos deutlich Kontur zu gewinnen begann, eine schneeweiße Baustelle aus griechischem Marmor, wie Brandung am Fuße des Stadtfelsens.
Ihre letzten Lehmtrabanten verloren sich in der Steppe, wohin die östliche Wüste die ersten Sanddünen vorschickte. Weit jenseits des Sandes lag das Euphrattal mit seinen uralten Metropolen, ebenso weit im Westen das Fruchtland der Mittelmeerküste. Dort gab es Kornfelder, Oliven und Weingärten. Aprikosenbaum-Pflanzungen wechselten sich ab mit Reihen um Reihen von Mandelbäumen. Doch all das verlor sich, ebenso wie die Zedernwälder, lange bevor die Hügelkette sichtbar wurde, die Palmyra im Nordwesten schützte. Sie gab ihr die zwei Quellen und die Lasttiere, die die Lebensgrundlage des Karawanenplatzes waren.
Die römische Oberschicht, die mit der Verwaltung der Provinz Syria befasst war, hatte darauf verzichtet, ihre Villen in diese Einöde zu setzen. Sie vertraute der unabhängigen Stadt ohnehin nur wenig, die seit Generationen in der Hand einheimischer Dynastien war und der römischen Verwaltungselite wenig mehr als eine Statistenrolle zuwies.
So waren Palmyras Nachbarn die Bergstämme und die schwarzen Haarzelte der Beduinen. Unter ihnen stand Palmyra, das alte Tadmor, wie eine der Blumen, die zuzeiten ein seltener Regenguss zu üppiger, doch tödlicher Blüte aus dem Wüstenboden lockt. Es verdankte seinen Reichtum jedoch nicht meteorologischen Launen, sondern der ungleich verlässlicheren Existenz eines dünnen Netzes von Straßen, auf denen Luxusgüter aus Nordasien, China, Indien und Arabien ans Mittelmeer gebracht wurden, den Marktplatz des römischen Imperiums. Einige dieser Handelswege fädelten sich durch die Oase Palmyra, unscheinbare Pisten, denen man nicht ansah, dass sie durch Länder führten, die noch kein Römer oder Araber je betreten hatte, selbst die berühmtesten der palmyrenischen Karawanenführer noch nicht und vielleicht nicht einmal der große Alexander. Fremde Menschen und Mythen brachen dort in der Ferne auf und versickerten in den Wüsten und Gebirgen auf ihrem Weg, während die Wunderwaren, die sie mit sich führten, von Hand zu Hand gingen. Seide, Gewürze und Trockenfrüchte, Edelsteine, Pelze, Silber, Korallen und Öle, auch Sklaven brachte ein stetig fließender Strom in die Stadt, die kaufte und verkaufte, besteuerte, verarbeitete und betrog und reich dabei wurde.
Sie bot ihr Wasser feil zu einem guten Preis, denn es war köstliches Wasser, und außerdem das letzte vor Damaskus, nicht wahr? Sie vermietete ihre Kamele und Führer sowie die Friedfertigkeit ihrer Beduinennachbarn, die leider, unzivilisierte Gesellen, die sie waren, oft gar kein Verständnis für die Belange des Handels zeigten. Und die wenigen römischen Grenztruppen, die sich hier notdürftig über den östlichen Limes verteilten, konnten schließlich nicht auf alles achten, gerade jetzt, wo die Perser in ihrem von den Göttern verfluchten Übermut alles in Unruhe versetzten. Ein Großreich, beim Bel, und dafür drohten sie die Handelsstraßen zu sperren und die heiligen Gesetze des Marktes zu verletzen! Wem sollte das nutzen? Palmyra gewiss nicht, dessen Lebensadern in dem andauernden Krieg zwischen Rom und Persien durchschnitten zu werden drohten.
»Dattelfresser, das sind sie, wo man hinsieht undurchsichtige Schacherer und Betrüger, Halsabschneider, stinkende Viehtreiber, selbst die Senatoren, die ganz besonders, alles Halunken. Denen möcht’ ich zeigen, was ein römischer Soldat unter Ehre versteht. Und Pflicht! Das hätten sie mal dringend nötig, diese Wegelagerer, lügen, wenn sie das Maul aufreißen, diese Ziegenficker.«
Decimus Pomponius Balbus hatte es offenbar wenig Erleichterung verschafft, dass er seinen Zorn diesen Morgen schon an dem Märchenerzähler auf der Agora ausgelassen hatte. Er fühlte sich in seiner Meinung eins mit jedem aufrechten Römer auf diesem letzten Vorposten römischer Zivilisation vor der Grenze, was er oft und gerne verkündete, so auch heute, während er in der eleganten Stadtvilla seines Vorgesetzten auf und ab marschierte. An den Sklaven, die sich rings umher an den Wänden des Tablinums bemühten, mit einigen großen Fächern für Erfrischung zu sorgen, ging der Tatendrang des Zenturio spurlos vorüber.
Sein Gastgeber betrachtete ihn schweigend. Als Syndicus Palmyras war Quintus Aelius Domitianus der ranghöchste Vertreter Roms in der Stadt und von dem herrischen Benehmen des Soldaten nicht begeistert. Er beobachtete, wie die tanzenden Nymphen seines Bodenmosaiks nacheinander den schweren Tritten des wandernden Offiziers erlagen, der dieses lautlose Massaker nicht zu bemerken schien. Jetzt bohrte sich ein Stiefel in den Nabel der ungerührt lächelnden Venus, was Domitians Nerven noch mehr strapazierte, als es sein ungehobelter Besuch ohnehin schon tat. Sein Blick wanderte zu der erfreulicheren Aussicht durch das Fenster auf den Innenhof. Weitere Sklaven waren dort damit beschäftigt, die Hibiskusbüsche zu schneiden.
»Es scheint mir, Balbus, etwas hat Euch verärgert.«
»Verärgert? Das kann man wohl sagen, Quintus Aelius Domitianus, und das ist noch weit untertrieben. Ich bin einfach stocksauer.«
Das Lächeln, mit dem der Syndicus antwortete, war säuerlich; er hatte das Gespür seines Gegenübers für Untertreibungen völlig richtig eingeschätzt. »Jedenfalls traktiert Ihr meine Venus strenger als selbst ihr betrogener Gatte, als er sie beim Ehebruch ertappte.«
»Wie, äh, ja, allerdings.« Balbus zeigte sich nur kurz irritiert. »Betrogen ist schon richtig. Und in mir wurde Rom betrogen, das könnt Ihr glauben.«
Domitian lehnte sich ob der Zumutung, dass er in diesem Emporkömmling Rom erblicken sollte, in seinem Sessel zurück. »Wollt Ihr mir nicht endlich Meldung machen, wo Ihr so lange gewesen seid?«, fragte er schließlich leicht gereizt. »Immerhin seid Ihr mein einziger Verbindungsmann zur palmyrenischen Armee.«
»Ich war unterwegs, diesen Arabern auf die Finger schauen, dem Pack.«
»Araberpack?« Domitian zog die Augenbrauen hoch. »Einige von ihnen hat man immerhin schon zu römischen Kaisern erhoben. Denkt nur an Heliogabal.« Die sanfte Ironie dieser Worte entging Balbus vollkommen.
»Diese dekadente Phase ist zum Glück vorbei«, entgegnete er knapp.
»Gewiss. Etwas Wein?« Gewiss, dachte Domitian, dafür hatte man seither als Imperatoren irgendwelche größenwahnsinnigen Söldner zu ertragen. Kaum von ihren Soldaten auf die Schilde gehoben, waren sie schon auf dem Weg nach Rom, wo sie meist nicht lange überlebten. Der jetzige, Valerian, war in Raetien von den Truppen akklamiert worden, wo immer das liegen mochte, und hatte in der Hauptstadt nicht mehr als einige Monate verbracht. Immerhin war er kein Germane, wenn böse Zungen das auch behaupten mochten. Aber dich, mein Freund, hat sicher keine Römerin geboren.
Domitian schaute versonnen auf die gedrungene Figur und das rotverbrannte Gesicht vor ihm, das düster über den Rand seiner Weinschale blickte. Balbus’ Gedanken waren nicht freundlicher als seine Miene. Domitians Verhalten ärgerte ihn. Dieser Lackaffe, dachte er, bildet sich offenbar wer weiß was auf seinen Adel ein.
»Ich war bei den Grenztruppen am Limes wegen einer Warnung von Eurem Freund Odaenathos, Stadtfürst nennt er sich nun ja wohl. Deswegen bleibt er doch nur ein arabischer Emporkömmling, nichts Besseres als ein Beduine.«
Domitian runzelte die Stirn. »Dieser Beduine organisiert und führt immerhin den derzeit schlagkräftigsten Teil der römischen Hilfstruppen: seine Reiterei. Wenn ich richtig informiert bin, trug schon sein Großvater den Titel eines römischen Senators. Und ich glaube, der gute Odaenathos hat schon lange kein Zelt mehr von innen gesehen.«
Balbus war sich da nicht so sicher. Und wenn, dann umso schlimmer. Er wusste aus Erfahrung, wo es hinführte, wenn diese Eingeborenen arrogant wurden.
»Na, wie auch immer, der Kerl hat mich hingeschickt, und natürlich nix: keine persische Invasion, keine Truppenbewegungen, gar nichts. Nur ein Haufen verlauster Legionäre, die ihre Ausrüstung wohl schon ’ne ganze Weile gegen ein paar dürre Milchziegen eingetauscht hatten und ihre Muttersprache nur noch zum Würfeln miteinander benutzten. Die hausen da in Lehmhütten neben ihren Kastellen, und kein Schwein kann sagen, was mehr stinkt, sie, ihre Ziegen oder ihre Weiber.« Balbus nahm einen tiefen Schluck. »Ihre Brut schreit, dass es ’ne persische Armee in die Flucht schlagen könnte. Das ist die Verteidigung unserer Ostgrenzen. Und ich hock’ hier mit nichts als ein paar Bogenschützen und diesem Odaenathos vor der Nase, der angeblich so siegreich gegen die Perser zieht. Wer’s glaubt. Der hat Truppen, die hab ich noch nicht mal zu Gesicht gekriegt. Keiner weiß doch, was der treibt, Domitian, Palmyra braucht eine Besatzungsarmee.«
Es war dem Syndicus nicht anzusehen, wie er zu dieser Bemerkung stand.
»Mein lieber Freund«, begann er schließlich langsam, »der hygienische und moralische Zustand der Grenztruppen mag sicherlich bedauerlich sein, so wie Ihr ihn schildert. Auch mir scheint, sie sind nicht in der Lage, den Limes zu schützen. Doch sollen sie das überhaupt? Die Zeiten sind vorbei, in denen Rom sich noch mit Mauern und einer Postenkette gegen seine Feinde schützen konnte, dazu sind seine Grenzen zu lang, dazu ist Rom zu groß geworden, schon seit langem. Palmyra hat eine ausgezeichnete Reiterei, auch wenn sie ohne Eure Hilfe ausgehoben wird, vielleicht die einzige, die dem Perserkönig Schapur zu widerstehen vermag, es zahlt seine Steuern und ist bereit, Valerian formell als Imperator anzuerkennen. Mehr sollten wir momentan nicht von ihm fordern, denn mehr können wir nicht von ihm erzwingen.«
»Pah, unsere Lage war lange nicht so gut. Der Kaisersohn verteidigt die Grenzen im Westen und Norden gegen die Barbarenvölker ...«
»... und ist dabei mehr als beschäftigt. Wir haben Gallien verloren. Allein das macht ihm genug zu schaffen, und die Goten drängen über die Donau.«
»Valerian hat Antiochia befreit«, hielt Balbus dagegen.
»O ja, nun schon zum zweiten Mal.«
»Und er steht jetzt vor Karrhai.«
Nun, dachte Domitian, die Goten fluteten ihrerseits über den Tauros, Schapur war über den Euphrat gegangen, wo das bisher uneinnehmbare Dura Europos vor wenigen Monaten in Strömen von Blut versunken war. Die Welt, wie er sie kannte, ging unter, und sie saßen hier in der Wüste und mussten zusehen. Vorläufig.
»Noch etwas Wein, Zenturio?«
»Palmyra ist ein wichtiger Vorposten«, setzte Balbus erneut an, »deshalb ...«
»... deshalb sollten wir nichts unternehmen, was es zu der Ansicht bringen könnte, Roms Interessen seien nicht die seinen.«
»Und wenn es dieser Ansicht nun schon wäre, hä? Habt Ihr daran schon mal gedacht Syndicus? Was glaubt Ihr wohl, wieso der Kerl mich in die Wüste geschickt hat. Also ich hab mich das gefragt, wie ich da so rumstand. Und da hab ich mich umgesehen.«
Domitian fuhr die Linien einer attischen Plastik nach, die er in die Hände genommen hatte, um sein steigendes Interesse zu verbergen. Nun stellte er sie auf den Tisch zurück.
»Und was habt Ihr gesehen, Zenturio?«
»Den Sohn vom Stadtkommandanten Zenobios, wie er, einfach so, nach Osten in die Wüste reitet, zum Euphrat.«
»Habt Ihr ihn sicher erkannt?«
»Ich kenne sein Pferd.«
»Ihr saht also ein Euch bekanntes Pferd in die Wüste traben; ich kann verstehen, dass Euch das erregt.«
»Ich bin ihm nachgeritten, zum Hades auch, ich hab gesehen, wo er hin ist, mittenrein in einen Haufen Perser. Die haben ihm nichts getan. Eure sauberen Araber haben uns an Schapur verkauft«, trumpfte Balbus auf.
Ja, vermutlich, dachte Domitian. Wie interessant.
Er war eher erleichtert als erschüttert und begann, nun seinerseits auf und ab zu gehen; sein Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Wie lange mochte der Kontakt bestehen? Die Palmyrener wollten für ihren Handel einen schnellen Frieden mit Persien, das war klar. Und was wäre logischer, als Zenobios’ Sohn Gash als Mittelsmann zu wählen? Dass er darauf nicht früher gekommen war! Zenobios war verschwägert mit den Bene Mattabol, dem einflussreichsten Stamm der Umgegend. Die meisten Rekruten der palmyrenischen Armee waren Bene Mattabol – und die meisten Karawanenführer auch. Ohne ihre Zustimmung konnte Odaenathos einen solchen Frontenwechsel gar nicht vornehmen ...
Seine Überlegungen wurden abrupt von einem aufgebrachten Schnauben seines Gastes unterbrochen, der noch immer in triumphierender Haltung vor Domitians nun leerem Sessel aufgerichtet stand und sich um die wohlverdiente Wirkung seiner Worte gebracht fühlte.
»Mein verehrter Balbus, Ihr habt völlig recht. Aber Ihr steht schon wieder auf dem Bauch der Venus.« Domitian legte dem Zenturio den Arm um die Schultern. »Wisst Ihr, ich denke, wir sollten diesem Gash bei seinem nächsten Ausflug auflauern und ihn, nun äh, umbringen, am besten mit einem persischen Speer. Noch ein wenig von dem Wein?«
Balbus setzte sich. Sein Mund stand vor Überraschung weit offen. Doch er hörte zu. Und eine halbe Stunde und einige Becher später war er überzeugt.
»Ganz richtig, der Verrat muss verhindert werden. Es gibt dafür keinen Zuverlässigeren als mich, ganz klar. Ich zeig’ es dem arabischen Hundesohn.«
»Aber arbeitet allein und arbeitet diskret. Sobald Ihr wisst, wann er das nächste Mal zu Schapur reiten soll, baut Ihr Euren Hinterhalt jenseits des Limes. Und vergesst die Lanze nicht.«
»Ich werd’ sie ihm reinrammen.«
»Hauptsache, die Verhandlungen werden erst mal unterbunden. Für das Weitere sorge ich dann.« Seine erste Tat würde zweifellos sein, sich diesen kompromittierenden Attentäter vom Hals zu schaffen. Er trank zuviel und redete zuviel. Versonnen sah er in das weingerötete Gesicht des Zenturio, ehe er nachschenkte. »Ich verdanke Euch viel, Zenturio.«
Balbus grinste. Endlich hatte der Kerl das gefressen. »Diesem Odaenathos hab ich nie getraut, hat zuviel Ehrgeiz, der Mann. Habt Ihr seinen neuen Bau gesehen? Ein Palast wird das. Hab ihm nie geglaubt.«
»O ja, er scheint ehrgeizige Pläne zu haben, unser Freund. Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie mächtig Palmyra werden könnte, wenn es sich enger mit den Wüstenstämmen verbündete?«
»Hä? Sind doch alle nur Pack, dreckige Ziegenficker.«
Domitian wiegte den Kopf, er war nicht überzeugt.
»Ich habe darüber nachgedacht, seit Ihr Zenobios erwähntet. Er ist das Verbindungsglied zu den Stämmen. Hat der Mann nicht auch eine Tochter? Zenobia, wenn ich nicht irre. Seht Ihr, Balbus, eine Verbindung mit diesem Mädchen zum Beispiel würde Odaenathos zum Herrn einer großen Zahl Beduinenkrieger machen. Was für Möglichkeiten für einen ehrgeizigen Feldherrn! Aus Palmyra könnte mehr werden als nur ein reicher Handelsplatz, viel mehr, es könnte eine eigenständige Macht im Osten werden.«
»Diese Eingeborenen taugen alle nicht fürs Kriegshandwerk«, schnaubte der Zenturio.
»Nun, es ist ja auch nur ein Gedankenspiel, bisher. Aber ein beunruhigendes. Je länger ich es mir überlege, Odaenathos ist nicht dumm ... Wenn es soweit kommt, wäre es gut, wir hätten etwas in Händen, was diese Liaison etwas behindern könnte. Divide et impera, mein Bester.«
»Äh ...«
»Was ich meine, Zenturio, ist: Kennt Ihr jemanden, der ein paar Erkundigungen über die Familie einziehen könnte? Nur damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Vielleicht findet sich dabei ja ein triftiger Grund gegen eine Hochzeit.«
»Ach, Ihr meint ..., ehä, hähä, ich wüsste wohl schon einen.«
»Hättet Ihr etwas dagegen, mich zu ihm zu begleiten?«
Der Abend kam ebenso schnell wie der Tag. Der Himmel hatte sich zu dem durchsichtigen Blau ägyptischen Glases verdunkelt. Selbst die weißen Kuben der Häuser, fensterlose Flächen nach außen hin, schimmerten bläulich in der Dämmerung. Die nachlassende Hitze wirkte nun fast angenehm. Während Domitian sich an der Seite seines Begleiters der sanften Abendluft überließ, wurde die Stadt um sie herum zum zweiten Male lebendig.
Rechts von ihnen wurde durch die Säulen der Kolonnade die Baustelle zu Odaenathos’ neuer Behausung sichtbar. Einige Arbeiter waren gerade dabei, den Porticus zu errichten. Balbus hatte recht gehabt, es würde ein Palast werden, und Domitian fragte sich, was er Rom kosten würde.
»Wär’ ein guter Platz für ein Garnisonslager«, meinte Balbus, mit dem Kinn nach der halbfertigen Anlage weisend, »beherrscht die Gegend.« Der Syndicus widersprach nicht.
Fliegende Verkäufer waren wieder unterwegs, um Getränke aus Zitrusfrüchten oder vergorener Ziegenmilch anzubieten. Ganz verkrümmt gingen sie unter dem Gewicht der umgeschnallten Metallbehälter, aus denen sie ihre Erfrischungen in Becher zapften. Domitian winkte einen heran. Sie tranken im Stehen, neben einigen eleganten Syrerinnen, die durch die Körper ihrer Leibsklaven vom Strom der abendlichen Flaneure abgeschirmt wurden und eine goldklirrende, leise lachende Gruppe inmitten des Getriebes bildeten.
Nahe vorbei drängte sich eine ganz andere Gesellschaft: Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Sie kamen jetzt fast täglich, zu Fuß oder mit Eselskarren, verstaubte kleine Gruppen, die persönliche Habe als schnell zusammengeraffte Haufen auf den Wagen der Neugier preisgegeben. Manche trugen nur mehr ihre Kinder oder Eltern auf dem Rücken. Die Gesichter der Umstehenden waren nicht freundlich, zu deutlich machte ihnen dieser Treck, wie nahe ihre eigene Stadt dem Kampfgebiet und den feindlichen Heeren stand. Früher hatten palmyrenische Truppen das westliche Euphratufer gehalten, doch diese Stellungen waren längst verloren. Nur noch die östliche Sandwüste trennte den Frieden Palmyras von den Persern.
Die letzten Ankömmlinge heute aber waren Heimkehrer, erkennbar an ihren langen, an den Knöcheln gebauschten Hosen, die vorne über die Länge des Beines Borten mit Blumenmustern schmückten. Die Obergewänder reichten, wie es für Reiter günstig war, nur bis zu den Knien, waren seitlich geschlitzt und am runden Halsausschnitt wie an den übrigen Säumen ebenfalls mit Rankenornamenten verziert. Alles bestand aus lockerem, feingewebtem Baumwollzeug, das der Abendwind sacht blähte, als sie, vom Wiegegang ihrer Dromedare geschaukelt, durch die Menge getragen wurden. Den Fuß gegen den Halsansatz ihrer Tiere gestemmt, trieben sie sie mit energischem »hathathat« auf den Eingang der Karawanserei zu, verfolgt vom schrillen Willkommensgeschrei einer Horde Kinder.
In dem bärtigen Karawanenführer, der nun abstieg, erkannten die beiden Römer Nesa. Nesa war Mitglied des Senats und, da er zu den reichsten Männern Palmyras zählte, auch einer der zehn Dekaproten, jener Bürger, die mit ihrem Vermögen für Defizite bei den Steuereinnahmen einstanden, ein Fall, der bislang allerdings noch nie eingetreten war. Das persische Embargo mochte das bald ändern. Er begrüßte beide förmlich und wechselte einige Worte mit Domitian. Sein Reittier ließ den Kopf mit den großen, langbewimperten Augen über ihnen hin- und herpendeln. Es schnob und versuchte, an den roten Seidentroddeln zu kauen, die sein Zaumzeug schmückten.
»Nesa ist übrigens der Onkel unseres Schurken Gash und seiner Schwester Zenobia«, wandte Domitian sich etwas später wieder an Balbus. »Ich habe die Gelegenheit genutzt, ihm zur Verlobung seiner Nichte mit dem Stadtfürsten zu gratulieren. Denkt Euch: Er war gar nicht überrascht.«
Balbus pfiff anerkennend.
»Verdammt guten Riecher habt Ihr, Syndicus. Na, dann will ich Euch mal meinen Kumpel vorstellen. Er hockt meistens in der Taverne da drüben. Der ist richtig, sag’ ich Euch.«
»Macht Ihr das lieber, bester Freund. Hier, bezahlt ihn aus diesem Beutel und erklärt ihm das Nötige. Er soll die Kleine unauffällig beobachten und Euch täglich berichten. Ihr informiert dann mich.«
»Prompt und zuverlässig, werdet schon sehen.«
»Ich hoffe es. Ich meinerseits werde wohl meine Frau bitten, Zenobios’ Gattin einmal einzuladen. Vielleicht lässt sich so auch etwas erfahren.« Domitian rieb am Saum seiner Toga. »Dieses Vieh vorhin hat mich doch tatsächlich angespuckt.« Balbus zuckte die Achseln, ihn wunderte das nicht.
Da Balbus nun fürs Erste beschäftigt war, entschied sich Domitian, die Pflicht für heute Pflicht sein zu lassen. Er machte sich auf den Weg zum Stadtrand. Dort hielt er sich schon seit Monaten eine arabische Hetäre, deren raffinierte Künste er als eines der so unerwartet wenigen Privilegien seines Orientaufenthaltes betrachtete. Ihre Fügsamkeit war ihm nach den Tagesgeschäften mit diesem so schwierigen Volk eine besondere Genugtuung. Er nannte sie seine bronzene Hindin und hatte ihr eine römische Landvilla mit Garten vor der Stadt gekauft, an deren Tor er jetzt stand.
Voll befriedigter Rührung betrachtete Domitian das typisch römische »Cave Canem«-Mosaik an der Pforte, das seine Geliebte dort hatte anbringen lassen – sein Herrschaftssiegel. Er atmete die blütensatte Luft des Gartens ein, die über die Mauer zu ihm herüberwehte. Was für ein Tag! Doch er hatte ihn gemeistert. Voller Vorfreude trat er ein.
Träume
Sorglos döste auf ihrer Widderliege Julia Aurelia Zenobia, Tochter des Julius Aurelianus Zenobios, Kommandant der Stadtpolizei, Schwester des ehrenwerten Claudius Aurelianus Septimius Gash und des siegreichen Gaius Aurelianus Septimius Maliku, Tochter der Sime von den Bene Mattabol. Dass ihre Familie eine der einflussreichsten in Palmyra war, war für sie selbstverständlich und außerdem unwichtig. Falls ihr Vater ehrgeizige Pläne hatte, übertrafen die ihren sie jedenfalls bei weitem. Wie gerne wäre sie Kleopatra gewesen, die große Königin, die Liebende, deren Männer allesamt aus unerfüllter Liebe zu ihr starben. Die Beherrscherin des Orients räkelte sich auf ihrem schmalen Kinderbett, das ihr schon bald zu kurz sein würde: Die ausgestreckten Zehen ans Fußende gepresst, berührte ihr Scheitel schon beinahe die geschnitzten Tierköpfe der Pfosten. Bereits heute freute sie sich auf den Tag, an dem sie ihrer Mutter verkünden konnte, dass nun dringend ein Erwachsenenbett hermusste, ein breites, und zwar auf der Stelle. Im Moment war Sime allerdings nicht da, alle waren sie ausgegangen, zu Besuch bei einer römischen Dame, während sie hier herumlag und sich langweilte. Odu würde sie erst in einer Stunde treffen können. Zur Ablenkung hatte sie sich den Schmuckkasten ihrer Mutter geholt. Jedes Stück darin hatte seine eigene Geschichte. Sie betrachtete ein Collier aus Ktesiphon, wie es jetzt so Mode war. Der sagenhafte Schmuck, der in Antiochia und Alexandria auf der gepuderten Haut so mancher syrischen oder römischen Edeldame bestaunt werden konnte, stammte – glaubwürdigen Gerüchten zufolge – aus den Königsgräbern von Adiabene, die vor knapp dreißig Jahren von den Söldnern des geisteskranken Caracalla aufgebrochen und geplündert worden waren. Vielleicht war dies auch der Grund, warum die Kostbarkeiten fast immer in Form von Kopien getragen wurden, die Unheil bringende Macht von Totenschmuck war schließlich allgemein bekannt.
Hier ein Armreif, den die Mutter bei ihrer Hochzeit aus der Wüste mit in ihr neues Heim gebracht hatte, begleitet von zwei Dienerinnen und drei schweren Kamelladungen, der Mitgift einer Tochter der Bene Mattabol. Simes Urgroßmutter hätte zu diesem Anlass noch zwei Decken mitgebracht, fünf Krüge, einen Sattel, Zaumzeug, zwei Kamelkälber, einige Ziegen und vielleicht auch noch ein Zelt.
Zenobia drehte sacht ihr erhobenes Handgelenk; der Armreif schimmerte schwach im trüben Licht des Zimmers. Kleine Figürchen umtanzten Hand in Hand ihren Arm. Archaisch und plump sahen sie aus, von ungeschickten Händen in einer lange entschwundenen Zeit in das matte Silber getrieben; die Sprüche, die dabei gemurmelt worden waren, sind verloren gegangen.
»Attay?«
Zusammengesunken zu einem dunklen Haufen Stoff, hob die alte Kinderfrau in einer Ecke unwillig den Kopf. Der helle Ton der Kinderstimme klang fordernd.
»Attay, erzähl mir die Geschichte der Männer.«
»Männer?« Die Amme war eben im Begriff gewesen, sich für die Mühsal des Kinderhütens mit einem Nickerchen zu belohnen. Noch halb benommen beging sie den schweren Fehler, mit einer Frage zu reagieren.
»Was denn für Männer?«, wiederholte sie verwirrt.
Statt einer Antwort hob Zenobia ihr Handgelenk und ließ den Schmuck klimpern.
»Das sind keine Männer. Die Männlein da sind uralt, sie haben noch gar kein Geschlecht. Es sind die Menschen, bevor man sie in zwei Hälften geschnitten hat. Deswegen halten sie sich ja auch alle an den Händen: Keiner will sich vom anderen unterscheiden und von ihm getrennt sein.«
Aber Zenobia ging es nicht um mythologischen Tiefsinn. Sie liebte diesen Armreif, weil er schon ihrer Großmutter und Urgroßmutter gehört hatte. Seine Geschichte war die ihre – und die wollte Zenobia jetzt hören. Es war ein altes Spiel zwischen Attay und ihr, aus dem sie fast immer als Siegerin hervorging, so auch heute. Attay war jetzt unwiderruflich wach, unwillig zwar, aber bereit, ihnen beiden die Zeit mit der alten, ewig gleichen Erzählung vom Brautschatz der Sime zu vertreiben.
»In jenen Tagen, als das Gesetz der Stämme noch nicht geschrieben war und unser Boden noch frei von fremden Eroberern, da wanderte Ambákra einsam durch die Wüste. An einer Quelle entdeckte er ein seltsames Tier: Seine Füße waren wie Teller aus Leder. Es hatte eine lange, kürbisförmige Nase, aus der es immerfort schnaubte, und einen gewaltigen Buckel auf dem Rücken. Er fing es, zähmte es und ritt auf ihm weite Strecken ohne Wasser, aber das bair, wie er es nannte, wurde niemals müde. In der Stadt verkaufte er es als Lasttier an einen reichen Händler für einen kostbaren Armreif aus Silber, denn Silber war in jener Zeit das edelste Metall, das die Menschen kannten.«
»Aber das bair hatte seinen Herrn lieb gewonnen.«
»So war es. Es zerriss seine Fesseln und suchte seinen wahren Herrn, bis es ihn gefunden hatte. Von da an blieben sie für immer zusammen bis in den Tod. Und so ist es Brauch geblieben unter den Stämmen bis auf den heutigen Tag.«
»Und Ambákra wurde der Stammvater der Bene Mattabol«, ergänzte Zenobia zufrieden.
Jene sagenhafte Liebe des ersten zahmen bair zu seinem Herrn schien sich seinen Nachkommen auf wunderbare Weise vererbt zu haben. Diese edlen Tiere entfliehen nämlich nach dem Verkauf oft bei erster Gelegenheit den neuen Besitzern, um sich von neuem dem vertrauten Clan anzuschließen. Die erbosten Käufer beschimpfen dann die Beduinen als Betrüger und bezichtigen sie einer raffinierten Dressur. Aber was wussten diese Städter schon von wahrer Treue?
»Und bald war aus den Bene Mattabol ein mächtiger Stamm geworden.« Attay nickte.
»Prächtig waren ihre Herden, scharf ihre Dolche und geschickt ihre Viehdiebe. Niemals unterlagen sie dem Drängen der eifersüchtigen Bene Taymay, den Listen der tückischen Bene Hasash, den Anstürmen der wilden Bene Anubat. Sie waren unbesiegbar. Bis ...«
»Bis zu der Nacht, als der Mond so hell auf die Erde schien, dass alle Dünen leuchteten wie Silber.« Attay hatte die Augen geschlossen, und ihr Körper wiegte sich über ihren überkreuzten Beinen hin und her, hin und her.
»Die Wüste war weiß und der Himmel kohlschwarz. Wie jede Nacht führten Zebida und sein Bruder Zabdas ihre Familien nach dem Abendstern, der ihnen den rechten Weg wies. Da standen plötzlich vor ihnen zwei herrlich schöne Jünglinge auf weißen Kamelen, die leuchteten wie Perlen. Zebida forderte die Tiere als Wegzoll, wie es Brauch war. Da lachten die Jünglinge fröhlich und sagten ...«
»... wenn ihr von uns einen Zoll haben wollt, dann müsst ihr ihn auch eintreiben. Wir wollen so lange mit dir und deinem Bruder kämpfen, bis wir wissen, wer von uns dem anderen tributpflichtig sein soll.« Zenobias Gesicht glühte vor kriegerischem Feuer.
»So kämpften sie wohl zehn Stunden miteinander, doch den lächelnden Jünglingen ritzten sie nicht eine Falte ihres Gewandes. Da warfen sich Zebida und Zabdas vor ihnen auf die Erde und erflehten Gnade: Wer ihr auch sein mögt, o mächtige Herren, die Bene Mattabol legen ihr Schicksal auf immer in eure Hände, denn wer von euch beschützt würde, hätte nichts mehr zu fürchten. Und als sie sich erhoben, da lag nur noch ein silberner Stirnreif mit einem Stern in der Mitte vor ihnen. Da erkannten sie, dass sie mit dem Abendstern gerungen hatten, der als ein Bruderpaar am Rande der Dämmerung stand, einmal zum Morgen hin und einmal zur Nacht. Seitdem beschützen Arzu und Azizu all unsere Karawanen, ihr Gad, ihre Kraft, ist mit uns.«
Die tausendfältige Kraft der Karawanengötter hatte den Bene Mattabol in der Tat gut getan und ihnen einen beachtlichen Wohlstand eingebracht. Mochte es an jenen Schutzgeistern liegen oder daran, dass sie die Kunst der Wegelagerei am besten beherrschten. Der Verkauf des eingebrachten »Wegzolls« auf den Märkten am Rande der syrischen Wüste brachte genügend Kapital ein, um bald selbst eine Karawane auszurüsten.
Und die Reichtümer, die auf diese Weise erworben wurden, ließen sich noch schneller vermehren, wenn sie eigene feste Umschlagplätze einrichteten. Für die jüngeren Söhne, denen diese Aufgabe meist zugewiesen wurde, war die ungewohnte neue Sesshaftigkeit ein guter Tausch, denn viele der stillen Oasen wuchsen im Laufe der Zeit zu bedeutenden Handelsplätzen heran; mit den Jahrhunderten wurden Städte daraus und aus den geschmähten Nichtkriegern angesehene, reiche Patriarchen. Natürlich wohnten die meisten Stammesmitglieder lange Zeit noch nicht in den steinernen Käfigen, wie es die Städter taten, sondern blieben innerhalb der Stadtmauern in ihren traditionellen Haarzelten. Doch die Besitztümer, die sich darin anhäuften, passten nicht mehr auf die übliche Zahl Kamele und hatten ein Wandern schon lange unmöglich gemacht.
Auch Palmyra bildete darin keine Ausnahme. Und in einem besonders glücklichen Jahr ergab es sich, dass der junge Taimoamad von den Bene Mattabol, trotz seines lahmen Kamels, zu einem eigenen Stadthaus kam.
Attay war inzwischen durch den sanften Rhythmus ihrer Erzählung beinahe wieder eingeschlafen. Zenobia verhinderte das, indem sie der Amme ihren Einsatz gab.
»Taimoamad war ein flinker und starker Sohn Olays, dessen Vater Kohaylon seinerzeit den sagenhaften Raub der dreißig Kamele vollbracht hatte.« Und wie es die Spielregeln verlangten, führte Attay das Kind weiter in die große Geschichte der Bene Mattabol.
»Mit den Kindern und Kindeskindern von den Kamelen seines Großvaters Kohaylon zog Taimoamad eines Sommers hinab in die Stadt, um sie für seine Familie zu verkaufen. Wie gewöhnlich trieb er seine Herde auf den Marktplatz und bot sie dort feil. Zum Abend hatte er sie alle verkauft, bis auf das letzte, das hatte sich auf dem Weg einen Dorn eingetreten. Eben wollte er damit in die Karawanserei zurückkehren, als ihm mit großer Hast ein Mädchen in den Weg trat und sprach: ›Ich will dein Kamel kaufen, wenn es nur schnell genug läuft.‹ Aber Taimoamad antwortete: ›Du hast Glück, denn ich bin kein Betrüger und werde dir helfen. Wo ist dein Vater?‹ Das Mädchen begann zu weinen. Unter Schluchzen erzählte sie, dass ihr Vater sie sicher schon suchen ließe, da er sie morgen mit einem reichen und mächtigen Kaufmann aus der Stadt vermählen wolle. Doch der sei so alt und dick, dass sie lieber in die Wüste fliehen wolle, als ihn zum Manne zu nehmen. Da betrachtete sie Taimoamad, und sie gefiel ihm wohl, also sprach er: ›Eine Bitte um Hilfe wird dir von mir nicht verwehrt werden. Du sollst nämlich wissen: Ich bin ein Sohn der Bene Mattabol und will dich von deinem Vater befreien, wenn du dies wünschst.‹ Da lächelte sie unter Tränen, und noch zur nämlichen Stunde wurden sie insgeheim getraut. Der Vater war drei Tage lang so im Zorn, dass er Taimoamad gewiss den Kopf und andere wichtige Teile abgeschlagen hätte, wären sie nicht in die Wüste geflohen. Aber da er sein Kind über alles liebte und sah, wie herzlich sich die beiden zugetan waren, schenkte er schließlich seiner Tochter einen geflochtenen Goldring als Brautgeschenk und als Dreingabe ein kleines Stadthaus.«
Den viel zu großen, aus dicken Goldfäden gedrehten Ring auf den Daumen gesteckt, hatte sich Zenobia bildersatt auf ihr Lager zurücksinken lassen. Die Geschichte von Taimoamad war so bedeutsam, weil das kleine Stadthaus, ein handfester Beweis für ihre Echtheit, heute noch stand. Es war ein altmodischer, eingeschossiger Würfelbau von blassrosa Farbe, den ihre Familie vermietete. In ihm hatten damals die beiden Liebenden Platz gefunden, nachdem der junge Beduine die reiche Kaufmannstochter am Abend des Markttages erst gegen alle guten Sitten belästigt und hinterher in einem stillen Winkel des nahe liegenden Tempelbezirks verführt und geschwängert hatte – so verbreitete es wenigstens der erbitterte Vater, den nur die Einsicht in das Unvermeidliche und die Aussicht auf bevorzugte Handelsbeziehungen mit dem mächtigen Wüstenstamm davon abhielten, den Namen seiner Tochter ein für allemal aus dem Gedächtnis seiner Familie zu streichen.
Seitdem kam es immer wieder zu Verbindungen zwischen den Stämmen und der Stadt. Als Zenobios, der Stadtkommandant von Palmyra, bei einem der Pferdemärkte das Beduinenmädchen Sime zum ersten Mal gesehen hatte, war es nicht nur ihr frisches Gesicht zwischen den rauen Gestalten ihrer Brüder gewesen, das ihn anzog, sondern auch die Tatsache, dass sie mehr Silberschmuck am Leibe trug, als er je auf einmal gesehen oder bei einer so zierlichen Person für möglich gehalten hätte.
Attays regelmäßiger Atem klang zu Zenobia herüber. Die Alte war eingeschlafen. Nun, das schadete nichts, die Zeit ihrer Verabredung mit Odu war da; die Sonnenstrahlen fielen schon schräg durch das Fenster herein. Alles war still im Haus. Zenobia rutschte vorsichtig von ihrer Liege und schlich sich zur Tür.
Sie ging leise durch die kühlen, halbdunklen Flure und überquerte den Innenhof, über dem einige buntgestreifte Sonnensegel vergeblich die Hitze zu mildern suchten. In ihrem lauen Schatten plätscherte lustlos der Springbrunnen. Schließlich erreichte sie die Küchengebäude. Sie schmiegten sich neben einem kleinen Garten, in dem die Kräuter in der Sonne welkten, an die lange Außenmauer, die das Gebäude von einer schmalen Nebenstraße trennte. Dort war auch eine Tür, die die Dienerschaft benutzte, um das Anwesen zu Einkäufen und dergleichen zu verlassen. Es wäre zu unpraktisch gewesen, sie verschlossen zu halten, da sie oft benutzt wurde, auch war meist jemand in Küche und Garten, der sie im Auge behalten konnte. Nur nicht mittags, wenn alle schliefen, auch der Sklave, der eingerollt unter seinem Burnus im Verschlag hinter der Zitronenmelisse döste. Zenobia hörte ihn schnarchen.
Was sie nicht hörte, das waren die Schritte hinter ihr auf dem staubigen Boden. Und so erschrak sie fürchterlich, als sich eine Hand auf ihre Schulter legte.
»Was machst du da?«
»Gash!« Unsicher schaute sie ihren Bruder an.
»Wolltest du schon wieder verschwinden, hm. Dir haben die Prügel damals wohl nicht gereicht?« Er packte sie fest an beiden Armen. Zenobia biss sich auf die Lippen; sie erinnerte sich im Gegenteil nur zu gut daran, wie Gash auf sie einschlug, während ihr Vater danebenstand und kalt aufzählte, wie ein junges Mädchen sich zu verhalten habe. Und die Erinnerung machte sie wütend.
»Wenn du Vater sagst, dass ich weg war, dann sage ich ihm, dass du dir Wäsche aus Yasemins Zimmer stiehlst, um dir damit ...« Weiter kam sie nicht, denn eine heftige Ohrfeige riss ihren Kopf zur Seite.
»Tust du doch!«, keuchte sie und starrte ihren Bruder mit aufrichtigem Hass an. Gash holte noch einmal aus, ließ den Arm aber wieder sinken.
»Du kleines Stück Dreck.« Und er stapfte durch die Kräuter davon. Zenobia atmete tief durch und sah sich in dem kleinen Garten um. Der Sklave schlief noch immer, die Sonne schien heiß und still auf sie beide. Sieg, sie hatte einen Sieg errungen. Noch zitternd von der aufregenden Begegnung, aber hochgestimmt, schob sie den Riegel zurück und schlüpfte auf die Straße.
Balbus wird aktiv
Balbus schob sich gereizt durch den Trubel der Innenstadt und kaufte den Proviant fr seine bevorstehende Mission zusammen. Ausgerechnet heute musste Palmyra mit den Vorbereitungen fr den Pferdemarkt beginnen. Ein allgemeiner Sturm auf die Tesserae hatte begonnen, die tnernen Eintrittsmarken zu den groen Tempelgelagen, bei denen keine Familie, die auf sich hielt, fehlen durfte. An allen Ecken zogen fliegende Verkufer die Menschentrauben an. Und wehe dem Haushaltsvorstand, der in diesem Wettstreit versagte! Die Stnde fr Lebensmittel waren ebenfalls belagert, da viele Familien ber die Feiertage Besuch von Verwandten aus den Stmmen erwarteten und dafr Vorrte anlegten, als stnde eine Hungersnot bevor. Balbus hatte Mhe, ein wenig Brot, Datteln und Trockenfleisch zu einem vernnftigen Preis zu erstehen. Er konnte sich nicht lange aufs Feilschen einlassen, da sein Spitzel ihn am Nachmittag erwartete, angeblich mit guten Neuigkeiten. Offenbar hatte er etwas gefunden, was man dieser Zenobia ans Bein binden konnte. Also keilte er sich einen Weg durch die aufgeregte Menge.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!