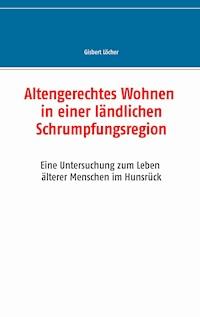
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der demografische Wandel führt zu einem bundesweit wachsenden Bevölkerungsanteil an älteren Menschen und stellt insbesondere in ländlichen Schrumpfungsregionen diese Altersgruppe vor Herausforderungen. Diese sind zweifach geprägt: Zum einen verschlechtern sich Infrastruktur und Nahversorgung. Die Veränderungen führen zum anderen dazu, dass ein Teil der Jüngeren die Arbeitsplätze nicht mehr ausreichend in der näheren Umgebung findet. Das Leben auf dem Lande wandelt sich, besonders für die Älteren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Theoretische Aufarbeitung des Problemfeldes
2.1 Individuum und Umfeld
2.2 Leben im ländlichen Raum
2.3 Altengerechtes Wohnen
2.4 Altern im ländlichen Raum
2.5 Ländliche Schrumpfungsregionen
Darstellung der empirischen Untersuchung
3.1 Forschungsfragen
3.1.1. Forschungsfragen für die Befragung der Senioren
3.1.2. Forschungsfragen für die Befragung der Experten
3.2 Untersuchungsmethodik
3.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials
3.2.2 Ablaufmodell der Analyse
3.3 Statistische Prozeduren und Rechenprogramme
3.3.1 Praktische Erfahrungen mit QCAmap
Ergebnisse
4.1 Senioreninterviews
4.1.1 Teilnahme an den Senioreninterviews
4.1.2 Zentrale Kategorien der Deutung
4.1.3 Forschungsfrage: Welche persönlichen Basisdaten der Befragten wurden ermittelt?
4.1.4 Forschungsfrage: Welche Schul- und Berufsausbildung haben die Befragten durchlaufen?
4.1.5 Forschungsfrage: Was hat sich in den vergangenen Jahren in den Familien der Befragten verändert?
4.1.6 Forschungsfrage: Wie hat sich in den vergangenen Jahren das Wohnen zu Hause für die Befragten verändert?
4.1.7 Forschungsfrage: Wie hat sich in den vergangenen Jahren die Gesundheit der Befragten verändert?
4.1.8 Forschungsfrage: Was hat sich in den vergangenen Jahren in der Freizeit der Befragten und ihrem Leben in der Dorfgemeinschaft verändert?
4.1.9 Forschungsfrage: Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert, wenn die Befragten von A nach B wollen?
4.1.10 Forschungsfrage: Wie haben die Befragten die von ihnen beschriebenen Veränderungen empfunden?
4.1.11 Forschungsfrage: Was wünschen die Befragten sich für die Zukunft?
4.2 Experteninterviews
4.2.1 Teilnahme an den Experteninterviews
4.2.2 Zentrale Kategorien der Deutung
4.2.3 Forschungsfrage: Wie beurteilen die Experten die Folgen des demografischen Wandels auf das Leben der Senioren in Bundenbach?
4.2.4 Forschungsfrage: Wie beurteilen die Experten den Einfluss des modernen Lebens auf das Leben der Senioren in Bundenbach?
4.2.5 Forschungsfrage: Wie beurteilen die Experten die Chancen und Risiken der Personengruppe in Bundenbach, die in der Regel kein Auto fährt und oft auf die Hilfe von Nachbarn angewiesen ist?
4.2.6 Forschungsfrage: Inwiefern sind die Lebensbedingungen der Senioren in Bundenbach nach Meinung der Experten typisch für ländliche Schrumpfungsregionen?
Diskussion
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Wichtigkeit von Infrastruktureinricht ungen
Tabelle 2: Einrichtungen in Gehreichweite
Tabelle 3: Elemente qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring
Tabelle 4: Regelmäßig von den befragten Bewohnern genutzte Verkehrsmittel
1. Einleitung
Der demografische Wandel führt zu einem bundesweit wachsenden Bevölkerungsanteil an älteren Menschen und stellt insbesondere in ländlichen Schrumpfungsregionen diese Altersgruppe vor Herausforderungen. Diese sind zweifach geprägt:
Zum einen verschlechtern sich Infrastruktur und Nahversorgung. Diese Entwicklung veranlasst Unternehmer wie z.B. Ladenbesitzer und Ärzte, ihre berufliche Existenz in den Dörfern aufzugeben und sich in die Städte und Kleinstädte zurückzuziehen. Dort finden sie mehr Kundschaft.
Die Veränderungen führen zum anderen dazu, dass die ein Teil der Jüngeren die Arbeitsplätze nicht mehr ausreichend in der näheren Umgebung findet. Viele Berufstätige pendeln weit, um zu ihrer Arbeit zu gelangen oder ziehen gleich den weiter entfernten Arbeitsplätzen nach. Das Problem verschärft sich ohnehin dadurch, dass seit Jahrzehnten immer weniger Kinder geboren werden. In der Folge verändern sich bisherige familiäre Strukturen. All dies führt dazu, dass die Jungen nicht mehr in dem Maße wie früher im Dorf anwesend sind, um die Älteren zu unterstützen. Das Leben auf dem Lande wandelt sich.
Welche Bedeutung misst die Wissenschaft der Erforschung dieser Phänomene bei? Einen Hinweis gibt die Einschätzung Wahls, dass die Folgen des demografischen Wandels auf dem Lande in der gerontologischen Transformationsforschung als auch in der sozialen Gerontologie insgesamt keine wesentliche Rolle gespielt haben. Das Interesse am Altern beschränkte sich auch nach der Wende hauptsächlich auf urbane Gebiete. Das Altern im ländlichen Raum scheint sich allgemein konstant auf einem eher niedrigen Niveau zu halten (Wahl, 2015. S. 17).
Wie gehen nun die Älteren in ihrem Alltag mit den Herausforderungen des demografischen Wandels in einer Schrumpfungsregion um? Ist erfolgreiches Altern und altengerechtes Wohnen bei den räumlichen und sozialen Gegebenheiten ihres Zuhauses und Wohnumfeldes möglich? Welche Hindernisse stehen im Weg, aber auch welche Möglichkeiten bieten sich den Älteren, um dort altengerecht zu leben und am sozialen Leben teilzuhaben?
Der Autor suchte nach Antworten auf diese Fragen bei betroffenen älteren Bürgern einer Gemeinde im Hunsrück. Das Interesse galt den Einwohnern des Dorfes Bundenbach. Die Gemeinde liegt mit ihren 899 Einwohnern im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz und gehört der Verbandsgemeinde Rhaunen an ((rlp-Direkt). Damit befindet sich die Gemeinde in der Mitte des Hunsrücks. In Bundenbach sind 22,8% aller Einwohner 65+ (Altenquotient 38,2). In der Verbandsgemeinde Rhaunen liegt der Anteil nahezu gleich bei 22,7%, allerdings mit höherem Altenquotienten (38,6). In ganz Rheinland-Pfalz liegt der Anteil der Einwohner 65+ „nur“ bei 20,9% (34,3).
Die Forschungsfragen und Interviewleitfäden orientierten sich an dem Ansatz der narrativen Gerontologie und wurden so konzipiert, dass sie nicht zu schnellen Ja- oder Nein-Antworten einluden. Vielmehr öffneten Wie-Fragen den Befragten den Raum, aus ihrem Leben zu erzählen und sich dabei auf die gestellte Frage zu beziehen.
Die Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung stellt sich so dar:
zu Beginn wird der aktuelle Stand der Wissenschaft zum altengerechten Wohnen in ländlichen Räumen analysiert. Im Hauptteil steht sodann die empirische Untersuchung anhand von Interviews mit Bewohner 70+ und Experten im Brennpunkt. Die Senioren wurden zu den räumlichen und sozialen Gegebenheiten ihres Zuhauses und Wohnumfeldes befragt. Die Befragungen der Bewohner sollten Erkenntnisse liefern über die Herausforderungen altengerechten Wohnens in Bundenbach aus der Sicht der Befragten. Zu den Ergebnissen wurden anschließend die Experten befragt.
Nach der Darstellung der empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert.
Die Untersuchung schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab.
2. Theoretische Aufarbeitung des Problemfeldes
2.1 Individuum und Umfeld
Die vorliegende Untersuchung untersucht, inwiefern altengerechtes Wohnen in einer Gemeinde einer ländlichen Schrumpfungsregion für die Älteren eine Herausforderung darstellt und wie sie versuchen, diese zu meistern. Der theoretische Teil der Untersuchung beginnt mit der Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Thema Individuum und Umfeld. Im Anschluss wird der Blick zunehmend auf die allgemeinen Lebensbedingungen im ländlichen Raum eingegrenzt, sodann auf altengerechtes Wohnen und das Altern im ländlichen Raum. Zum Abschluss der theoretischen Aufarbeitung des Problemfeldes folgt eine Analyse der strukturellen Bedingungen ländlicher Schrumpfungsregionen.
In der Forschung gewann die Frage an Bedeutung, ob räumliche Strukturen Auswirkungen auf die Lebensqualität der älteren Bewohner haben könnten. So äußert sich Wahl (Wahl, 11.06.2005/) zu dem Thema: „ … it would appear that simple urban-rural contrasts relating to older people no longer provide convincing answers to the challenges in the field of gerontology. Instead, a more differentiated approach is demanded which focuses on specific urban or rural areas.” Wahl führt weiter aus, dass “the urban-rural divide may be perceived as being too broad an umbrella for investigating concrete empirical research questions.”
Wahl zitiert an dieser Stelle Golant (2004), der als zentrale Herausforderung des „urban-rural divide“ die Frage ansah: „Does the place one grows old in matter and does it matter more for some groups of older people than for others?”.
In demselben Aufsatz verbindet Wahl Golants Frage mit Erkenntnissen der angewandten Gerontologie oder auch der „environmental gerontology“. Diese erforscht die Interaktionen eines Individuums innerhalb eines Kontextes und zwischen Individuum und Umwelt, um Alternsprozesse und Auswirkungen zu verstehen: „ … it is assumed that competencies and needs of ageing individuals are supported by or can be threatened by existing person-environment constellations (Carp 1987). This view is also driven by the assumption of environmental gerontology that vulnerability to environmental characteristics represents a fundamental feature of the ageing process and, because of this, the consideration of the environment is crucial for any research approach to ageing.”
Nach Golant und Wahl sollte also das jeweilige Umfeld (environment) eines Individuums bei Forschungen zum Alternsprozess berücksichtigt werden. Die vorliegende Untersuchung greift diesen Ansatz auf. Sie geht von der Richtigkeit der These aus, dass „the place one grows old in matters“.
In die gleiche Kerbe schlagen Beetz et al. Ihrer Ansicht nach kommt dem Umweltaspekt in der Alternsforschung eine zentrale Rolle zu: ganz allgemein ist er neben den individuellen Faktoren maßgeblich für die räumlichen, sozialen und institutionellen Bedingungen des Alterns verantwortlich. Dabei geht die ökologische Alternsforschung von einem Passungsverhältnis zwischen Individuum und Umwelt aus. Es gibt nicht die alternsgerechte Umwelt, sondern je nach individueller Lage und Situation können Umwelten förderlich oder blockierend wirken (Beetz, Müller, Beckmann & Hüttl, 2009), S. 18).
Die Autoren heben die geografische Lage als Erklärung für viele Unterschiede räumlicher Muster hervor. Regionen mit ungünstiger Erreichbarkeit weisen häufig erschwerte Lebensbedingungen für ältere Menschen auf. Darüber hinaus wird ein ökonomischer und sozialer Strukturumbruch in stark landwirtschaftlich geprägten Regionen von abnehmenden Bevölkerungszahlen sowie einem sehr hohen Anteil alter Menschen begleitet (Beetz et al., 2009), S.82). Weiter heißt es: „Eine wichtige Dynamik in der Verschärfung räumlicher Ungleichheiten bilden Wanderungsbewegungen, die ausgesprochen selektiv verlaufen, weil die weniger Mobilen, die Armen, die Älteren, die Unqualifizierten in den Abwanderungsgebieten zurückbleiben.“ (Beetz et al., 2009), S.83).
Schließlich verweisen die Wissenschaftler im Zusammenhang mit der vergleichsweise geringen Wohnsitzmobilität Älterer auf den Begriff des Aging in Place. Er „wird vor allem in kritischer Wertung benutzt, um aufzuzeigen, dass insbesondere ältere Menschen über viele Jahre an eine Wohnung oder einen Wohnort bzw. an eine nicht-gesundheitsförderliche Umwelt gebunden sind. Sie sind auf Güter, Dienstleistungen und conveniences angewiesen, die ihnen nicht gestatten, ihre Lebensumstände zu verändern bzw. sie zu verlassen.“
Der Ansatz von Beetz et al., dass je nach individueller Lage und Situation Umwelten förderlich oder blockierend wirken können, stellt in der vorliegenden Untersuchung ein wichtiges Motiv dar, den Blick auf eine Region, genauer eine ländliche Region einzugrenzen. Im nächsten Kapitel werden die allgemeinen Lebensbedingungen des ländlichen Raums skizziert.
2.2 Leben im ländlichen Raum
Wie sind die strukturellen Bedingungen des ländlichen Raumes? Das Statistische Bundesamt weist in seinem Jahrbuch 2015 (Statistisches Bundesamt, 2015), S.29) zum Grad der Verstädterung aus: 35.4% der Bevölkerung Deutschlands lebten im Jahre 2013 in dichtbesiedelten Gebieten (Städte oder Großstadtgebiete). 41,5% der Bevölkerung lebten in Gebieten mittlerer Besiedlungsdichte (Städte und Vororte oder Kleinstadtgebiete). Schließlich wurden 23,1% der Bevölkerung in gering besiedelten Gebieten (ländliche Gebiete) gezählt. Knapp zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands leben demnach in nicht dichtbesiedelten Räumen.
Nach Maretzke (Maretzke 2013, zitiert in Rupprecht, Dummert, Meixner & Lang, 2014, S.12) sind ländliche Räume im Vergleich zu (groß-) städtischen Ballungsräumen vor allem durch folgende strukturelle Bedingungen gekennzeichnet:
Geringere Einwohnerdichte
Schlechtere Erreichbarkeit von Mittelzentren
Höheres Durchschnittsalter der Bevölkerung (bzw. höherer Anteil älterer Bewohner)
Angleichung der ursprünglich höheren Geburtenrate in ländlichen Regionen an die niedrigen Raten in den städtischen Ballungsräumen (Ridderbusch, 2008)
Negative Bevölkerungsentwicklung (ca. 3% Abnahme in den letzten 10 Jahren)
Negatives Binnenwanderungssaldo (d.h. Wegzug von vor allem jüngeren Bewohnern, der durch Zuzug nicht ausgeglichen wird)
Geringere Bruttowertschöpfung und geringere Kaufkraft der Bevölkerung
Im Bericht „Landleben – Landlust“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Sturm & Walther, 2010, S.1-14) stehen die Aussagen von Bewohnern von Kleinstädten und Landgemeinden im Zentrum. Die Veröffentlichung beruht auf Daten der jährlichen Bevölkerungsumfrage des BBSR. Die Bewohner zeigten sich in ihrer Heimatregion stark verwurzelt. 31% mochten dort nicht fortziehen. Zum Bleiben veranlassten sie vor allem stärkere Bindungen an Verwandte - die in der Nähe wohnten -, an das eigene Haus und an die Landschaft. Die Bindung an das eigene Haus gründet vor allem auf der hohen Eigentumsquote. Das eigene Haus wurde geschätzt und diente wie eh und je als Nest der Familie und als Alterssicherung. Auch traditionellere Lebensstile und regionale Identitäten wurden als ausschlaggebend für die Ortsgebundenheit genannt. Insgesamt scheint die Mehrheit derer, die in eher ländlich geprägten Gebieten Deutschlands wohnen, genau dort leben zu wollen. Die Ortsbindung ist höher als in Städten und die Lebensstile sind traditioneller.
In Kleinstädten und Landgemeinden außerhalb der Stadtregionen spielt Nachbarschaftshilfe immer noch eine bedeutende Rolle, auch wenn ihre Bedeutung schrumpfen mag. So berichtete die Mehrheit der Befragten des BBSR-Berichts, dass man „sich gelegentlich aushilft“ bzw. dass man „sich öfter besucht“. In Landgemeinden können als Nachbarn auch Menschen zählen, die im Umkreis bis zu einem Kilometer leben.
In Bezug auf den motorisierten Individualverkehr hebt der BBSR-Bericht hervor, dass Menschen, die auf dem Land lebten, stärker auf das Auto angewiesen waren als Großstadtbewohner. Trotz weiterer Wege in ländlichen Regionen waren durch den Gebrauch privater Fahrzeuge die Wegezeiten nicht länger als in der Stadt.
Über die Jahre hinweg waren die Bewohner von Kleinstädten und Landgemeinden mit ihrem Wohnort immer etwas zufriedener gewesen als die Bewohner größerer Städte. Dabei blickten die Befragten nicht nur auf bauliche Gegebenheiten und die Infrastrukturausstattung ihres Wohnorts, sondern auch auf die angebotenen Gelegenheiten zur Verwirklichung der eigenen Lebensplanung. Insofern beeinflussten die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten oder das generelle Raum- und Landschaftsbild das Urteil der Befragten. Auch ihre allgemeine Lebenszufriedenheit lag etwas höher als bei Bewohnern größerer Städte. Vergleicht man ost- und westdeutsche Gemeinden, so zeigt sich: Gemeinden in Ostdeutschland konnten und können ihren Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor nur selten gleichgute Lebenschancen bieten wie viele (süd-)westdeutsche Gemeinden.
Landleben findet heute häufiger in den Stadtregionen, also in Großstadtnähe, und seltener außerhalb derselben statt. Dabei äußerten sich die Befragten außerhalb der Stadtregionen tendenziell mit diversen Lebensbereichen zufriedener als die Befragten im suburbanen Umfeld der Großstädte. Landleben – so der BBSR-Bericht - heißt dabei vergleichsweise häufiger Familienleben, es findet eher im eigenen Haus statt.
Nach der Skizzierung der allgemeinen Lebensbedingungen im ländlichen Raum wird nun im Folgenden der Blick auf das Altern im ländlichen Raum eingegrenzt.
2.3 Altengerechtes Wohnen
Nach Scherzer bezieht sich altengerechtes Wohnen nicht nur auf die Wohnung (Stichwort: Bar





























