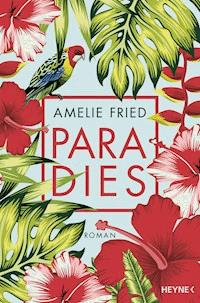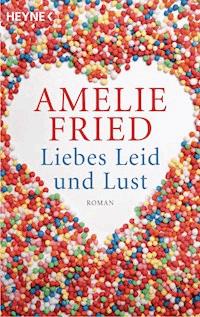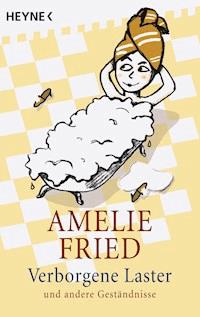4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau will mehr vom Leben! Annabelle hat einen netten Mann, zwei Kinder, ein Reihenhaus und einen Halbtagsjob. Doch von einem Tag auf den anderen bricht ihre heile Welt zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
Annabelle ist vom Familienleben genervt. Am meisten stört sie ihre gesundheitsbewusste, kettenrauchende, besserwisserische Mutter, die regelmäßig zu Besuch kommt. Als sich Mutter für drei Monate bei Annabelle und ihrer Familie einnistet, weil ihr Haus renoviert wird, ergreift Anna begeistert die Chance, auf ein »Entspannungswochenende« zu fahren. Freundin Doro, die eigentlich auf die Kinder aufpassen sollte, beginnt bei dieser Gelegenheit eine Affäre mit Annabelles Ehemann Friedrich. Als Anna zurückkehrt, ist sie entsetzt. Sie packt ihre Sachen und verlässt Friedrich und die Familie. Prompt lernt sie auf einer Party einen jungen Studenten kennen, der die Leidenschaft in ihr weckt …
»Ein Buch, das seine Geschichte mit viel Augenzwinkern und liebenswerter Ironie erzählt.« Die Welt
DIE AUTORIN
Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zuletzt erschien bei Heyne der Bestseller Traumfrau mit Lackschäden. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von München.
AMELIE FRIED
AM ANFANG
WARDER
SEITENSPRUNG
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Vollständige Ausgabe 06/2014
Copyright © 1998 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
Copyright © 2006 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik∙Design, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-14576-7V002
Für meine Tochter
EINS
Das Verhängnis näherte sich unaufhaltsam. Es würde über mich hereinbrechen wie jedes Jahr, und ich würde es nicht aufhalten können. Oder doch? Ich nahm einen Schluck Kaffee, schmierte mir noch ein Brötchen und warf einen Blick auf die Zeitung, hinter der sich Friedrich, mein Mann, verschanzt hatte. Draußen war alles grau in grau. Ein typisch deutscher Winter.
In einer Woche war Weihnachten.
»Was machen wir diesmal?«, fragte ich die Zeitung.
»Was meinst du?«, vernahm ich Friedrichs Stimme hinter der Wand aus Papier.
»Du weißt genau, was ich meine.«
»Ach so, das. Keine Ahnung.«
»Wie wär’s mit Karibik?«, schlug ich vor. »Zu teuer. Außerdem …«
»… die Kinder wollen einen Weihnachtsbaum und Geschenke und Schnee und nicht im Sonnenschein unter einer Palme sitzen, ich weiß«, beendete ich seinen Satz. Ich kannte diese Unterhaltung. Wir führten sie jedes Jahr.
»Ich könnte Lamm kochen«, fuhr ich fort. »Sie erträgt den Geruch nicht.«
»Ich auch nicht.«
»Einer von uns könnte eine infektiöse Lungenentzündung bekommen!«
»Lungenentzündung ist nicht ansteckend. Wenn du nicht willst, dass sie kommt, dann sag es ihr.«
»Ich traue mich nicht«, jammerte ich. »Sie ist meine Mutter.«
Endlich ließ Friedrich die Zeitung sinken.
»Mein Gott, Anna, jedes Jahr das gleiche Theater! Es wird schon nicht so schlimm werden. Bisher hast du jedes Weihnachtsfest überstanden.«
Klar, mit einer Nervenkrise. Friedrich fand es gar nicht so übel, wenn Queen Mum zu Besuch kam. Das hing vermutlich damit zusammen, dass wir dann immer besonders leidenschaftlichen Sex hatten. Es machte mir Spaß, meine Mutter in Verlegenheit zu bringen, indem ich besonders laut stöhnte und schrie, sodass sie es im Zimmer gegenüber hören musste.
Friedrich hielt mir die Seite mit Immobilienanzeigen unter die Nase. »Wir sollten endlich aufs Land ziehen.«
Wir wohnten in einer Vorort-Reihenhaussiedlung, die die Nachteile des Stadtlebens mit den Nachteilen des Landlebens verband, ohne einen einzigen ihrer Vorteile aufzuweisen. Es gab eine Menge Autolärm und Abgase, weil jede Familie glaubte, mindestens zwei Autos besitzen zu müssen, und gleichzeitig gab es weit und breit keine anständige Kneipe, kein Kino und außer einem Supermarkt keinen einzigen Laden. Zugegeben, wir hatten, wovon viele Leute träumen: einen Garten. Nur hatte ich leider nicht den geringsten Sinn für Gartenpflege, und so wucherten ein paar Stauden und Büsche, die noch von unseren Vormietern stammten, ungehindert vor sich hin. Hie und da wurde der Rasen gemäht, und im Sommer stellte ich ein paar Töpfe mit Rosen und Begonien auf die Terrasse. Ich hätte am liebsten mitten in der Stadt gewohnt, aber Friedrich hatte sich bisher all meinen Überredungsversuchen standhaft widersetzt.
»Denk an die Kinder!«, ermahnte er mich jetzt wieder.
»Die Kinder?« Ich lachte auf. »Glaubst du, Lucy will mit Bauernjungs in der Dorfdisco knutschen?«
»Knutschen?« Mein Mann sah mich entgeistert an. »Lucy ist fünfzehn!«
»Wann hattest du deinen ersten Zungenkuss?«
»Mit elf.«
»Na bitte. Und Jonas hat mir gestern mitgeteilt, dass er beabsichtigt, demnächst einen Computerkurs zu machen. Das könnte er auf dem Land bestimmt auch nicht.«
»Computerkurs? Der kann doch noch nicht mal lesen.«
»Erstens kann er es fast schon, und zweitens bedient er deinen PC wie ein Alter. Kürzlich hat er einen ganzen Nachmittag lang Tetris gespielt.«
»Ich konnte mit fünf übrigens auch schon lesen, das hat er von mir«, sagte Friedrich stolz.
Ich stand auf, um neue Butter zu holen. Im Vorbeigehen küsste ich ihn auf seinen schütter werdenden Haarschopf.
»Du warst ja sowieso ein Wunderkind!«
Unser Sohn war zum Glück einigermaßen normal. Vorausgesetzt, es ist normal, dass ein Fünfjähriger mit einem Vogelbestimmungsbuch und dem Fernglas durch den Garten rennt.
Lucy jedenfalls war die normalste Fünfzehnjährige, die man sich vorstellen kann. Aufsässig, frech und miserabel in der Schule. Ich fragte mich, ob ich in diesem Alter auch so unausstehlich gewesen war. In ein paar Tagen würde ich Gelegenheit haben, mich bei meiner Mutter danach zu erkundigen.
»Wo sind sie überhaupt?« Friedrich sah sich erstaunt um, als hätte er jetzt erst bemerkt, welch himmlische Ruhe diesen Sonntagmorgen auszeichnete.
Lucy hatte bei ihrer Freundin übernachtet, und Jonas war schon seit acht bei Goofy, seinem Freund aus der Nachbarschaft.
»Sturmfreie Bude?« Friedrichs Augen begannen zu glänzen.
Ich betrachtete Friedrichs Hände, die noch immer leicht gebräunt waren, obwohl der Sommer schon eine Ewigkeit vorbei war. Er fuhr sich durch sein vom Schlafen verstrubbeltes Haar, das reichlich graue Einsprengsel hatte. Es stand ihm gut, fand ich. Mit vierzig musste man nicht mehr aussehen wie ein Junge. Ich dachte an seinen Körper, der kräftig und wohlproportioniert war. Ich hatte ihn immer als sehr anziehend empfunden, vielleicht waren wir deshalb noch verheiratet.
Jetzt beugte ich mich runter, schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn aufs Ohrläppchen. Mit einer schnellen Bewegung setzte ich mich rittlings auf ihn. Mein Bademantel öffnete sich. Die Zeitung segelte in mehreren Einzelteilen zu Boden und kam raschelnd auf. Ich nahm Friedrichs Gesicht in beide Hände und drückte meinen Mund auf seine Lippen. Mit einem wohligen Seufzer zog er mich an sich. Wenige Augenblicke später taten wir, was wir seit dem Tag unserer ersten Begegnung am liebsten taten und was schon damals für Ärger gesorgt hatte.
»Wer ist der Kerl?« Mein Vater funkelt meine Mutter wütend an, als wäre sie schuld daran, dass seine Tochter mit einundzwanzig schwanger geworden ist.
»Er studiert Biochemie«, sage ich.
»Seit wann kennst du ihn?«
»Sechs Wochen.«
Meine Mutter stöhnt auf.
»Was machen die Eltern?«
»Weiß nicht. Interessiert mich auch nicht.« Trotzig schiebe ich die Unterlippe vor.
»Aber mich!«
Mein Vater lässt seine flache Hand krachend auf den Tisch fallen und zuckt heftig mit den Augenlidern, was ein Zeichen dafür ist, dass er sehr wütend ist.
»Wie stellt ihr euch das vor? Wer soll euch finanzieren?«
»Vielleicht kann ich nach der Geburt die Banklehre zu Ende machen«, schlage ich schüchtern vor.
Ich denke natürlich keine Sekunde daran, die Lehre zu beenden. Dass ein Baby mich davor bewahren würde, zwischen Bilanzen und Kreditanträgen zu verschimmeln, war schon Grund genug, es zu bekommen.
»Und wovon wollt ihr bis dahin leben? Das dauert doch noch Jahre, bis der Junge was verdient!«
»Bis dahin müsst ihr mich eben unterstützen.«
Hab dich bloß nicht so, denke ich wütend. Schließlich bist du ein erfolgreicher Architekt, verdienst eine Menge Geld, und ich bin deine einzige Tochter.
»Wie konnte das bloß passieren?«, fragt meine Mutter mit ersterbender Stimme.
»Mein Gott, Mummy, wie so was halt passiert! Wir haben zusammen geschlafen und nicht verhütet.«
Sie macht eine abwehrende Handbewegung. »Hör auf! Keine Einzelheiten, bitte! Schlimm genug, dass heute jeder mit dem Erstbesten ins Bett springt!«
»Friedrich war nicht der Erstbeste!«, lächle ich.
»Ich will gar nicht wissen, wie viele Männer es in deinem Leben schon gegeben hat!«, kreischt meine Mutter.
Gespräche über Sex sind ihr zuwider. Vermutlich ist ihr Sex zuwider.
»Musst du das Kind denn kriegen?«, fährt sie, etwas ruhiger, fort.
»Ich liebe Friedrich, wir werden heiraten, und alles ist in Ordnung. Ihr solltet euch freuen!«
»Und deine Karriere?«
»Welche Karriere?«
»Ja, glaubst du denn, wir haben umsonst die ganze Schulzeit mit dir durchlitten und jahrelang den teuren Nachhilfeunterricht bezahlt?«
Ihr Blick ist ein einziger Vorwurf. Das ist also das Problem. So viel haben sie investiert, und jetzt bringt das undankbare Balg keinen Ertrag. Kein Studium, mit dem man vor Bekannten protzen kann, keine Urkunde zum Übers-Bett-Hängen, kein Doktortitel zum Angeben.
»Ich kann ja später noch studieren«, sage ich erschöpft und hoffe, dass sie endlich Ruhe gibt. Aber sie jammert weiter.
»Alles hätte dir offengestanden, die Universität, eine Karriere in der Wirtschaft, Erfolg und Anerkennung …«
»… alles, was dir versagt geblieben ist! Ich weiß, dass du mir deine Karriere geopfert hast, du hast es mir oft genug vorgehalten.«
»Und – du – bist – im – Begriff – den – gleichen – Fehler – zu – machen«, deklamiert Mummy mit theatralischem Vibrato in der Stimme. »Sag – später – nicht – ich – hätte – dich – nicht – gewarnt!«
»Keine Sorge.«
Ich wünsche mir inständig, dass sie endlich aufhören, mich zu bearbeiten. Aber jetzt fängt mein Vater wieder an.
»Du musst den Kerl doch nicht gleich heiraten, nur weil du schwanger bist. Heutzutage ist man da nicht mehr so.«
»Ich will ihn aber heiraten!«, rufe ich jetzt und balle entschlossen die Fäuste.
Ermattet sank mein Kopf auf Friedrichs Schulter.
»Nicht schlecht, so ein Morgenquickie!«, seufzte ich.
Friedrich kraulte mir den Rücken. »Jetzt schlafe ich schon seit sechzehn Jahren mit derselben Frau und finde sie immer noch scharf. Ist das normal?«
Ich kicherte geschmeichelt. »Wahrscheinlich nicht.«
Ob Friedrich mich wirklich noch nie betrogen hatte? Ich wollte es gar nicht so genau wissen. Ich lebte sehr gut mit der Illusion. Sehr viel mehr als guter Sex verband uns eigentlich nicht. Wir lebten nebeneinander her, ohne uns gegenseitig zu stören. Jeder war an den anderen gewöhnt wie an einen liebgewordenen Gegenstand, dessen Existenz man nicht mehr ständig wahrnahm, dessen plötzliches Fehlen einem aber schmerzhaft bewusst werden würde.
Friedrich war stellvertretender Leiter eines kleinen wissenschaftlichen Instituts und ging völlig in seinem Beruf auf. Er war ohne jeden Ehrgeiz, und so lebten wir seit Jahren vom selben mittelmäßigen Gehalt, ohne Aussicht auf großartige Verbesserungen. Er hatte es klaglos hingenommen, dass eines Tages ein aufstrebender junger Biochemiker zum Institutsleiter ernannt worden war, obwohl dieser Posten eindeutig ihm zugestanden hätte. In Wahrheit war er sogar ganz froh darüber gewesen, weil er sich auf diese Weise weiter seinen Forschungen widmen konnte und keine Zeit durch Repräsentation, Vorträge und Reisen verlor.
Wir waren seit sechzehn Jahren verheiratet, und vermutlich bedeutete die Tatsache, dass wir uns so gut wie nie stritten, dass wir eine gute Ehe führten. Wahrscheinlich eine bessere als viele andere Paare, denn wir hatten, wie gesagt, wenigstens noch Sex.
»Weißt du, woran ich gerade denken muss?«
Fragend sah ich Friedrich an. Ich saß noch immer auf seinen Knien, und er hatte die Arme um meine Taille geschlungen.
»An unsere Hochzeitsnacht. Da haben wir’s auch im Sitzen gemacht, weil meine Kommilitonen unser Bett mitgenommen hatten.«
»Und die Schlafzimmertür haben sie ausgehängt und überall gefüllte Wassereimer aufgestellt!«, erinnerte ich mich an die üblen Scherze seiner Studienfreunde.
Unsere Hochzeit! Ich wurde immer noch wütend, wenn ich daran zurückdachte. Nachdem meine Eltern eingesehen hatten, dass jeder Widerstand zwecklos war, hatte Mummy sich umgehend daran gemacht, die geplante Hochzeit in ihrem Sinne zu gestalten. Flugs wurden allerhand Verwandte eingeladen, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte.
»Das ist deine Familie!«, entschied Mummy. »Und die kommt zu deiner Hochzeit. Das gehört sich so!«
Froh darüber, dass es keinen größeren Eklat gegeben hatte, fügte ich mich in alles. Sogar das Restaurant für die Feier suchte meine Mutter ohne mich aus.
Die Trauung selbst war eine schrecklich steife, peinliche Zeremonie gewesen. Der Standesbeamte rasselte seinen Text herunter wie ein Notar, der einen Grundstückskaufvertrag vorlas, seine Assistentin gähnte ungeniert, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Ich saß neben dem Bräutigam und kämpfte gegen meine Schwangerschaftsübelkeit. Wir hatten nur noch einen Termin morgens um neun bekommen, und um diese Zeit saß ich normalerweise zu Hause vor der Kloschüssel und kotzte.
Den Leuten, die meine Familie darstellten, merkte man deutlich an, was sie von unserer Verbindung hielten. Ich sah in verspannte Gesichter und auf nervös verschränkte Hände. Meine Großmutter, die damals noch lebte, schüttelte immer nur ihren Kopf mit dem riesigen Hut und stieß bei jeder Drehung gegen das linke Ohr meines Vaters, der neben ihr saß und gedankenverloren nach der Hutkrempe schlug, als wäre sie eine lästige Fliege.
Nur Friedrichs Eltern waren bester Stimmung. Ihr Lachen war echt, und sie waren die Einzigen, die bei dem Satz »Undnunsindsiemannundfrauherzlichenglückwunsch!« applaudierten. Ihr Klatschen versickerte im Schweigen der anderen Anwesenden, die befremdet den Kopf drehten. Leider lebten meine Schwiegereltern, die ich an diesem Tag endgültig ins Herz geschlossen hatte, in Kanada, und wir sahen uns fast nie. Nur an Weihnachten kamen sie manchmal zu Besuch, aber für dieses Jahr hatten sie abgesagt.
»Denkst du, du hältst die paar Tage mit Queen Mum aus, oder sollen wir noch schnell die Flucht organisieren?«, wollte Friedrich wissen.
»Dann ist sie bloß monatelang sauer. Ich glaube, da müssen wir durch.«
Friedrich nickte ergeben. »Wie jedes Jahr.«
Die Tür flog auf, und Lucy erschien auf der Bildfläche. Sie trug eine viel zu lange, viel zu weite Jeans, deren halb aufgetrennte Hosenbeine um ihre Schnürstiefel schlackerten, einen riesenhaften Pullover und eine umgedrehte Baseballkappe. Die Augen hatte sie dunkel geschminkt, die Lippen leuchteten in einem aufreizenden Brombeerton. Lucy war doch so hübsch, warum entstellte sie sich derartig?
»Na, ihr Turteltäubchen, habt ihr ’ne kleine Morgennummer geschoben?«
Ich errötete, stand auf und zog schnell meinen Morgenmantel über der Brust zusammen. Lucy stürmte zum Kühlschrank, riss die Milchflasche heraus und setzte sie an den Mund.
»Moment mal, junge Dame, so geht das aber nicht!« Friedrich bemühte sich um einen autoritären Tonfall.
»Hallo, Papa, nett, dich mal wieder zu sehen!«
Sie knallte die Flasche auf den Tisch, wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab und entzog sich geschmeidig seinem Zugriff. Im nächsten Moment war sie aus der Küche.
»Es hat keinen Sinn«, murmelte ich. »Erziehung ist zwecklos.«
»Stimmt, Mami!«, ertönte jetzt Jonas’ Stimme. Er umrundete mich auf dem Skateboard. »Kinder wissen selbst am besten, was gut für sie ist. Man muss sie ihre Erfahrungen machen lassen.«
Wo hatte er das bloß wieder aufgeschnappt? Ich fuhr ihm mit der Hand durch die Haare, als er kurz in meine Nähe kam, und verzichtete darauf, eine Debatte über den Sinn und Zweck von Erziehung zu beginnen. Stattdessen widmete ich mich meinen hausfraulichen Pflichten.
Mit Gummihandschuhen an den Händen und gerümpfter Nase nahm ich ein Hähnchen aus, wusch es, tupfte es vorschriftsmäßig mit Küchenkrepp ab und füllte es mit einer Mischung aus Zwiebeln und Äpfeln. Ich liebte Hähnchen, wenn es braun und knusprig auf meinem Teller lag, aber ich ekelte mich vor dem blassen, toten Tier, dessen weiche Haut sich widerstandslos hin und her schieben ließ, während ich es mit Pfeffer, Salz und Paprika einrieb. Erleichtert schob ich den Bräter mit dem präparierten Vogel in den Backofen.
Schnuppernd kam Jonas wenig später zurück in die Küche.
»Schon wieder Hähnchen?«, fragte er, und ich nickte. Wütend stampfte er auf. »Du weißt doch, dass ich keine Vögel esse! Vögel sind meine Lieblingstiere, und du bist brutal und gemein!«
Er lief aus der Küche. Aufseufzend zuckte ich die Schultern. Das Thema war ein Dauerbrenner, aber ich hatte beschlossen, mich nicht kleinkriegen zu lassen. Ich zwang ihn ja nicht, Hähnchen zu essen. Aber ich sah auch nicht ein, warum ich mich seiner Kleine-Jungen-Marotte unterwerfen sollte.
Solange der Braten schmorte, widmete ich mich dem Auf- und Abhängen meiner Wäsche. Ich hatte keinen direkten Widerwillen gegen Hausarbeit, aber gelegentlich fragte ich mich doch, ob diese öden, immer wiederkehrenden Tätigkeiten wirklich der Sinn meines Lebens sein könnten.
Ich liebte meinen Mann und meine Kinder, ich fühlte mich (trotz des Traumes von der Großstadt) im Grunde wohl in unserem Häuschen, ich war glücklich in unserer gemütlichen, kleinen Spießeridylle, in der alles berechenbar und ungefährlich war. Das entsprach meinem Naturell. Ich fand, es kam darauf an, mit welchem Bewusstsein man spießig war. Der Besitz eines Gartengrills änderte nichts daran, dass ich in meiner Seele eine Rockerin war. Aber ich musste auch nicht alle meine Träume ausleben. Ich war in Wahrheit nicht besonders abenteuerlustig, sondern schätzte die Beständigkeit. Nur in seltenen Momenten, meistens nachts, wenn eines der Kinder mich geweckt hatte und ich nicht wieder einschlafen konnte, beschlich mich ein komisches Gefühl. Vielleicht gäbe es, ganz nahe bei meinem, ein ganz anderes Leben? Vielleicht würde ein bisschen Mut oder Übermut ausreichen, und mein Leben wäre mit einem Schlag unberechenbar und gefährlich? Noch während ich das dachte, bekam ich jedes Mal Angst. Ich war nicht mutig und schon gar nicht übermütig. Ich war eine ganz normale Frau mit einem ganz normalen Leben. Ich wollte kein anderes. Alles war gut, wie es war.
ZWEI
Großkampftag im Supermarkt. Alle Vorort-Muttis waren unterwegs, um sich für Weihnachten einzudecken. Ich holte tief Luft und startete.
Nudeln, Knäckebrot, Cornflakes, Knödel halb und halb, Rotkraut– das lief ja wie geschmiert. Verdammt, keine konservierten Esskastanien mehr für die Gänsebratenfüllung! Ich war zu spät dran, wie jedes Jahr. Beim Schälen der frischen Kastanien würde ich mir wieder die Fingernägel ruinieren.
Kaffee, Honig, Marmelade, Erdnussbutter. Lange frühstücken war das Schönste an Feiertagen.
Den ersten Stau gab es bei den Milchprodukten; die Frischmilch war ausgegangen und aufgebrachte Kundinnen standen herum und warteten auf Nachschub. Dann eben H-Milch, war mir egal. Joghurt, Sahne, Schokopudding, Butter.
Bei Wurst und Käse die Mega-Schlange. Ich versuchte, das Ende zu finden.
»Stellen Sie sich gefälligst hinten an!«, keifte eine Kundin und presste hektisch ihren Einkaufswagen in die kleine Lücke vor mir. Ich schluckte. Sie hatte sich eindeutig vorgedrängt, aber ich scheute Auseinandersetzungen vor Publikum.
Vor mir entdeckte ich ein paar bekannte Gesichter und grüßte mit einem Lächeln oder ein paar freundlichen Worten. Man kannte sich, schließlich lief man sich mindestens einmal pro Woche über den Weg.
Als mein Wagen vollgepackt war, steuerte ich die Kasse an. Das durfte doch wohl nicht wahr sein! Von den fünf Kassen waren nur drei besetzt, die Schlangen reichten durch den halben Laden.
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging nach vorn.
»Könnten Sie bitte eine zusätzliche Kasse öffnen?«, bat ich eine der Kassiererinnen.
Sie warf mir einen genervten Blick zu und sprach in ein Mikrofon, das vor ihr installiert war. »Bitte Kasse vier besetzen, Kasse vier, bitte!«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!