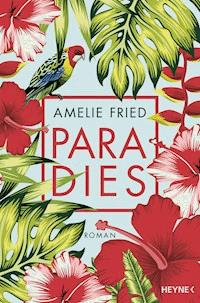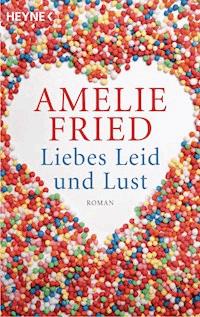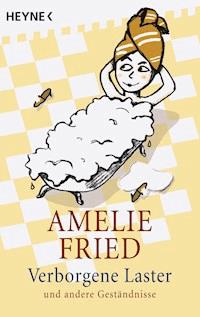3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
India lebt mit ihren Hippie-Eltern und ihrem Bruder Che in der bürgerlichen Umgebung einer süddeutschen Kleinstadt. Intelligent und mit spöttischem Scharfblick betrachtet sie die Welt der Erwachsenen und durchschaut deren Lebenslügen. Ihr Nachbar, ein Musiklehrer, überredet sie zu Klavierstunden und entdeckt ihre große musikalische Begabung. Während ihre Eltern mit einer Ehekrise beschäftigt sind und Che in die Kriminalität abzudriften droht, entsteht zwischen India und ihrem Lehrer eine einzigartige Verbindung, getragen von der Liebe zur Musik. Doch in einem einzigen Moment zerstört er ihr Vertrauen, und India steht vor einer furchtbaren Entscheidung: Ihr Geheimnis öffentlich zu machen – oder für immer zu schweigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Die 13-jährige India lebt mit ihren Hippie-Eltern und ihrem Bruder Che in der bürgerlichen Umgebung einer süddeutschen Kleinstadt. Intelligent und mit spöttischem Scharfblick betrachtet sie die Welt der Erwachsenen und durchschaut deren Lebenslügen. Ihr Nachbar, ein Musiklehrer, überredet sie zu Klavierstunden und entdeckt ihre große musikalische Begabung. Während ihre Eltern mit einer Ehekrise beschäftigt sind und Che in die Kriminalität abzudriften droht, entsteht zwischen India und ihrem Lehrer eine einzigartige Verbindung, getragen von der Liebe zur Musik. Doch in einem einzigen Moment zerstört er ihr Vertrauen, und India steht vor einer furchtbaren Entscheidung: Ihr Geheimnis öffentlich zu machen – oder für immer zu schweigen.
Die Autorin
Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zusammen mit ihrem Mann Peter Probst schrieb sie den Sachbuch-Bestseller Verliebt, verlobt – verrückt?. Bei Heyne erschien zuletzt der Roman Traumfrau mit Lackschäden. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in München.
AMELIE FRIED
ICH FÜHLE WAS,
WAS DU NICHT FÜHLST
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Der Abdruck des Gedichts »An mein Kind« erfolgt mit freundlicher Genehmigung. Aus: Mascha Kaléko, Die paar leuchtenden Jahre.
© 2003 dtv Verlagsgesellschaft, München.
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik · Design, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
eISBN 978-3-641-18934-1V001
www.heyne.de
»Die Wirklichkeit eines anderen Menschen liegt nicht in dem, was er dir offenbart, sondern in dem, was er dir nicht offenbaren kann. Wenn du ihn daher verstehen willst, höre nicht auf das, was er dir sagt, sondern vielmehr auf das, was er dir verschweigt.«
KHALIL GIBRAN
1
1975
Dass mit meiner Familie etwas nicht stimmte, hatte ich schon länger vermutet. Spätestens, als mein Bruder religiös wurde, mein Vater uns ein schreckliches Geheimnis verriet und meine Mutter schließlich verschwand, wurde es zur Gewissheit. Aber bis dahin würden noch vierhundertneunzehn Tage vergehen, von dem Tag an gerechnet, an dem die Geschichte begann.
An diesem Tag war ich zur Frau geworden, jedenfalls hatte meine Mutter es so genannt, mich begeistert geküsst und mir eine rote Rose aus Seidenpapier und einen knallroten Lippenstift aus ihrer Sammlung geschenkt.
Für mich war es der Tag, an dem ich nach der Englischstunde aufgestanden war und hinter mir die hämische Stimme einer Mitschülerin gehört hatte.
»Da schau, die Verrückte hat in die Hose gemacht!«
Ich fuhr herum, zwei grinsende Teenager glotzten mir auf den Hintern. Ich sah an mir hinunter, bemerkte zwischen den Beinen dunkle Flecken auf dem blauen Stoff, tastete entsetzt mit den Fingern danach, fühlte etwas Feuchtes.
Ich wusste natürlich, was passiert war, meine Eltern hatten mich aufgeklärt. Und zwar so früh und umfassend, dass ich im Alter von vier Jahren meiner Kindergärtnerin erklärt hatte, die beiden Hunde im Hof würden nicht raufen, sondern rammeln. »Und dann kriegen sie viele kleine Hundekinder«, hatte ich zufrieden festgestellt. Meine Mutter war daraufhin zur Leiterin einbestellt worden.
Mir war also klar, dass ich meine Periode bekommen hatte. Und mir war auch klar, dass dieser Umstand auf Wochen hinaus Anlass zu Spott und Gemeinheiten seitens meiner Mitschülerinnen sein würde. Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen, und senkte den Kopf.
Du heulst nicht!, befahl ich mir selbst. Wer Schwäche zeigt, fordert den Jagdinstinkt seiner Verfolger heraus. Ich blähte die Nüstern, richtete mich auf und nahm Anlauf, um mich auf eine meiner Peinigerinnen zu stürzen.
Da spürte ich, wie mir jemand eine Strickjacke um die Hüften schlang, und sah überrascht zu, wie die Ärmel über meinem Bauch verknotet wurden.
»So wird’s gehen«, sagte Bettina, packte mich resolut am Arm und zog mich aus dem Klassenzimmer. Widerstandslos ließ ich es geschehen.
Ich rechnete. Ich war genau dreizehn Jahre, vier Monate, vier Tage und elf Stunden alt. Wenn ich davon ausging, dass ich, bis ich fünfzig wäre, jeden Monat meine Periode bekommen würde, davon zweimal neun Monate abzog, falls ich Kinder bekommen würde, und wenn die Blutung im Schnitt fünf Tage dauerte, würde ich in den nächsten siebenunddreißig Jahren an zweitausendeinhundertzwanzig Tagen bluten. Fast sechs Jahre lang.
»Ich will keine Frau sein«, stöhnte ich.
»Red keinen Quatsch«, sagte Bettina.
Zu Hause versorgte mich meine Mutter mit Binden, öffnete eine Flasche Sekt und reichte mir ein halb gefülltes Glas.
»Ich bin so stolz auf dich!«, sagte sie.
Ich begriff nicht, warum sie mich feierte, als hätte ich eine besondere Leistung vollbracht. Meine guten Schulnoten riefen längst nicht so viel Begeisterung hervor, und an denen hatte ich deutlich mehr Anteil als an der blöden Blutung. Wie so oft kam mir die Reaktion meiner Mutter übertrieben vor, irgendwie gekünstelt.
Als mein Vater kam, verkündete sie ihm die Neuigkeit mit einer Begeisterung, als hätte ich mindestens die Bundesjugendspiele gewonnen (was unwahrscheinlich war, weil ich grundsätzlich keinen Sport trieb).
Es war mir furchtbar peinlich, dass sie meinen Vater in diese Frauengeschichten einweihte, und ich spürte, dass es ihm ebenfalls unangenehm war.
»Du weißt ja, dass du ab jetzt aufpassen musst«, warf er mir hin. Und damit war das Thema für ihn offenbar erledigt.
Ich fragte mich, wie er auf die Idee kommen könnte, ich würde mit dreizehn bereits Sex haben. Seine Gedankenlosigkeit machte mich wütend.
»Wann hattest du denn zum ersten Mal Sex?«, fragte ich herausfordernd.
Er tat so, als müsste er überlegen. Ein unsicheres Auflachen. »Keine Ahnung, ist schon so lange her.«
Ich wusste, dass er log. Entweder es war ihm peinlich, dass er bei seiner Entjungferung schon ziemlich alt gewesen war, oder aber er fand es unangemessen, mit seiner dreizehnjährigen Tochter über Sex zu reden. Mir zu sagen, dass ich ab jetzt gefälligst vorsichtig sein solle, das war für ihn okay. Aber zu erfahren, wann er zum ersten Mal Sex hatte – das stand mir offenbar nicht zu.
»Ich sage es dir«, sagte ich. »Du warst neunzehn, und du bist nach dreißig Sekunden gekommen.«
Meine Mutter gab ein hysterisches kleines Lachen von sich.
Mein Vater warf ihr einen finsteren Blick zu. »Ich hab zu tun«, murmelte er und verschwand.
Spöttisch blickte ich ihm nach. Es war so einfach, die Erwachsenen aus dem Konzept zu bringen.
Meine Eltern behaupteten, ich sei seltsam. Anders als andere Mädchen meines Alters. Anders, als sie in meinem Alter gewesen seien. Anders als alle anderen. Manchmal waren sie besorgt und sprachen davon, einen Therapeuten für mich zu suchen, dann verhielt ich mich eine Weile betont unauffällig, und sie vergaßen es wieder. Sie waren so sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, dass ich den Eindruck hatte, sie vergaßen zwischendurch völlig, dass ich überhaupt existierte. Besonders meine Mutter blickte manchmal so überrascht, wenn sie mich bemerkte, als hätte sie mich noch nie gesehen.
Mein Vater schien im Umgang mit mir immer irgendeine Rolle zu spielen. Er gab, je nach Situation, den besorgten/wohlmeinenden/interessierten/strengen/liebevollen Vater und verhielt sich genau so, wie er glaubte, dass es gerade erwartet würde. Er war recht gut als Vaterdarsteller, und andere ließen sich von ihm täuschen. Aber mir konnte er nichts vormachen, ich spürte sein inneres Unbeteiligtsein, die Unsicherheit, das fehlende Interesse. Ich glaube, er konnte mit Kindern generell nicht viel anfangen. Vielleicht hatte er gar keine gewollt. Vielleicht waren wir nur aus Versehen entstanden. Immerhin gab er sich Mühe.
Meine Eltern hielten mich also für seltsam und merkten nicht, dass sie selbst höchst seltsam waren. Allein die Sache mit unseren Vornamen. War es etwa normal, seine Kinder India und Che zu nennen statt Sabine und Thomas? Ich fragte mich, wie sie es geschafft hatten, den Standesbeamten dazu zu bewegen, diese ausgefallenen Namen zu akzeptieren. Vermutlich hatten sie ihn bis zur Besinnungslosigkeit mit Marihuanadämpfen eingenebelt oder ihm ewige Erlösung im Nirwana versprochen. Vielleicht hatten sie ihn auch einfach nur bestochen.
Jedenfalls würde ich dem Kerl gern mal die Meinung sagen und ihm erzählen, wie man sich fühlt, wenn einen schon der Vorname zum Außenseiter macht.
Wie demütigend die Blicke und das Getuschel der Mitschüler sind, wenn man seinen Namen nennen musste. Dass ein Name ein Fluch sein kann, von wegen Schall und Rauch. Ich hätte alles dafür gegeben, Sabine, Susanne oder Claudia zu heißen wie die Mädchen in meiner Klasse.
Zu meinem letzten Geburtstag hatte ich mir eine Namensänderung gewünscht, aber meine Eltern hatten mir stattdessen einen Gutschein für Reitunterricht geschenkt, obwohl sie wussten, dass ich mich vor Pferden fürchtete. Oder sagen wir, sie hätten es wissen können, wenn es sie interessiert hätte. Aber wie so oft hatten sie sich an dem orientiert, was sie für die Wirklichkeit hielten. Und dreizehnjährige Mädchen lieben doch Pferde, oder nicht?
Den Gutschein hatte ich Bettina weitergeschenkt, im Tausch für ihren Radiorekorder. Bettina wohnte im Haus nebenan und hörte ständig Musik, weil ihr Vater Klavierlehrer und Chorleiter war. Es war allerdings nicht die Art von Musik, die sie gern mochte. Beatles und Tom Jones, Rolling Stones und so was, was ihr richtig gefiel, durfte sie aber nicht hören. Das hatte ihre Mutter verboten. Also brauchte sie auch keinen Radiorekorder.
Meine Eltern hätten mir jede Art von Musik erlaubt, egal wie wild oder verrückt sie war. Sie hatten selbst Platten von den Stones, Led Zeppelin und anderen Rockbands. Aber ich mochte Musik nicht besonders. Seit ich größer war, wusste ich auch, woran es lag. Musik konnte Gefühle in mir auslösen, Wahrnehmungen in und an meinem Körper, die seltsam und beinahe ein wenig unheimlich waren. Deshalb vermied ich es, Musik zu hören. Vermutlich war ich der einzige Teenager der westlichen Hemisphäre, der nicht den größten Teil seines Taschengelds für Schallplatten ausgab. Dafür liebte ich Hörspiele und Wissenssendungen im Radio, und mit Bettinas Radiorekorder konnte ich die endlich allein in meinem Zimmer hören.
Mein eigentliches Element aber waren Zahlen, sie gaben mir Sicherheit. Ich konnte in kürzester Zeit Aufgaben lösen, für die andere viel Zeit oder einen dieser Taschenrechner brauchten, die es neuerdings gab, die aber in der Schule verboten waren. Wenn ich mich schlecht fühlte, brachte ich Ordnung ins Chaos, indem ich versuchte, Muster zu erkennen, Zuordnungen vorzunehmen, Berechnungen anzustellen, die mir den Überblick zurückgaben. Eigentlich bildeten sich die Muster von selbst, als folgte alles einer geheimen Gesetzmäßigkeit, und ich müsste nur das Kommando geben, damit die Dinge sich an den richtigen Platz begäben.
Nur mit Menschen funktionierte es nicht so gut. Ich konnte sie zählen, zuordnen und Muster erkennen, aber sie waren unberechenbar und verhielten sich nicht so, wie ich es voraussah oder mir wünschte. Manchmal zog ich deshalb den Umgang mit Zahlen dem Umgang mit Menschen vor. Das war weniger anstrengend. Außerdem fand ich Zahlen schön. Sie waren bunt und bildeten, wenn ich rechnete, ganze Farbsymphonien.
Erst in der Schule hatte ich begriffen, dass nur ich die Zahlen so sehen konnte. Eines Tages schrieb unser Lehrer Zahlen mit farbiger Kreide auf die Tafel und wollte wissen, was an der Rechnung falsch sei. Ich antwortete: »Die Sieben ist nicht rot. Sie ist blau. Und die Vier ist grün. Die Farben sind falsch.« Er sah mich entgeistert an, die anderen Schülerinnen kicherten.
Er forderte mich auf, an die Tafel zu kommen, und schob mir den Kasten mit den farbigen Kreidestücken zu. Dann bat er mich, die Zahlen in den richtigen Farben zu schreiben. Er sah mir nachdenklich zu und sagte nichts. Aber seither strich er mir keinen Fehler mehr an, wenn ich auch in meinem Heft die Zahlen bunt schrieb.
Ich wünschte mir nicht nur einen normalen Namen, ich wünschte mir vor allem normale Eltern. Einen Vater, der morgens zur Arbeit ging, eine Mutter, die mittags für uns kochte und mich zum Geburtstag mit einem Kuchen überraschte. Wie Frau Berthold, Bettinas Mutter, die ich in Gedanken Margot nannte, weil meine Eltern die Bertholds duzten. Die machte jeden Morgen Frühstück für ihre Töchter, mangelte tagsüber Wäsche für andere Leute und besserte Kleidung aus. Daneben kochte und buk sie ständig. Kartoffelsuppe mit Würstchen, Pudding, kleine Napfkuchen. Das war wohl ihre Art, Zuneigung auszudrücken. Sonst konnte sie es nicht besonders gut, meist war sie ein wenig ruppig und mürrisch. Meine Mutter sagte, sie sei frustriert. Mir gegenüber war sie aber immer sehr freundlich und behandelte mich so nachsichtig, als hätte sie Mitleid mit mir. Manchmal hockte ich mich zu ihr und sah ihr bei der Hausarbeit zu. Dann konnte es passieren, dass sie mir einen Blick zuwarf und mit einem Seufzen sagte: »Wie siehst du nur wieder aus.«
Tatsächlich führte die Gleichgültigkeit meiner Eltern dazu, dass mein Kleidungsstil für ein Mädchen meines Alters ziemlich ungewöhnlich war. Ich trug viel zu große Männerhemden, bunte Schals und T-Shirts, die ich selbst gebatikt hatte, dazu unförmige Pullis, die zuvor meinem Bruder oder meinem Vater gehört hatten. Ich konnte mich nicht erinnern, dass meine Mutter mit mir jemals zum Kleiderkaufen gegangen wäre. Als ich klein war, trug ich die Kleidung irgendwelcher Kinder aus dem Bekanntenkreis meiner Eltern auf, als ich größer wurde, kaufte meine Mutter hin und wieder etwas für mich ein, und seit ich elf war, bekam ich in unregelmäßigen Abständen etwas Geld für Kleidung zugesteckt, das ich aber meist für andere Sachen ausgab. Meinen Eltern war es völlig egal, wie ich herumlief. Hauptsache, es war nicht »spießig«. Das galt in unserer Familie als die schlimmste Sünde überhaupt.
Margot hielt mich für ein emotional vernachlässigtes Kind und meine Mutter für eine »egozentrische Person«. Das hatte ich einmal zufällig bei einem Gespräch zwischen Margot und ihrem Mann aufgeschnappt. Christian hatte meine Mutter verteidigt. Sie tue bestimmt, was sie könne, aber sie sei eben eine Träumerin. Es hatte mich überrascht, dass er meine Mutter in Schutz nahm.
Margot konnte zum Arbeiten nicht aus dem Haus gehen, weil sie ihren Bruder betreuen musste. Der war geistig behindert und wurde von allen nur »der Onkel« genannt, als hätte er keinen Namen. Der Onkel hatte komische, schräg stehende Augen, wulstige Lippen und patschige Hände, mit denen er nach mir zu greifen versuchte, wenn ich bei Bettina war. Er war mir ein wenig unheimlich, und ich ekelte mich auch ein bisschen vor ihm, denn er sabberte und hatte immer nasse Lippen. Fragte man ihn nach seinem Namen, antwortete er stotternd: »B-b-bin der Onkel. B-b-bin mongo.« Wenn er mich sah, grinste er und sagte: »Ficki-ficki!«
Dann flüchtete ich mich in Bettinas Zimmer und bestand darauf abzuschließen, was regelmäßig zu Ärger mit ihrer Mutter führte.
»In diesem Haus gibt es keine verschlossenen Türen«, sagte sie streng.
Meine Eltern schliefen noch, wenn mein Bruder und ich uns morgens selbst das Frühstück machten. Wenn wir aus der Schule nach Hause kamen, war unsere Mutter oft noch im Pyjama und trank gerade ihre erste Tasse Tee, bevor sie ihre Yogaübungen machte. Unser Vater lief mit wirrem Haar und abwesendem Gesichtsausdruck durchs Haus, eine Zigarette im Mundwinkel. Man sprach ihn lieber nicht an, denn auch wenn es nicht so aussah, arbeitete er. Ein Künstler arbeitet gewissermaßen immer, deshalb wusste ich nie genau, wann ich ihn ansprechen konnte. Manchmal vergaß er, dass er gerade arbeitete, beugte sich zu mir herab und küsste mich auf die Stirn. Er schnupperte an meinem Haar und murmelte etwas, das wie »Sonne« oder »Sommer« klang. Diese seltenen Momente passte ich ab, um ihn Sachen zu fragen wie: »Du-Papa-kann-ich-mein-Taschengeld-haben?« oder: »Du-Papa-mein-Fahrrad-hat-einen-Platten-könntest-du …« Ich sprach ganz schnell, um seine kurze Aufmerksamkeitsspanne zu nutzen.
Bettina musste nicht nach ihrem Taschengeld fragen, sie bekam es jeden Sonntag nach der Kirche von ihrer Mutter ausgehändigt. Dafür musste sie sich allerdings jedes Mal den Spruch anhören: »Ich weiß nicht, ob du es verdient hast. Geh sparsam damit um.«
Aber das hätte ich hingenommen, genauso wie die sonntäglichen Gottesdienstbesuche, das gemeinsame Beten vor jeder Mahlzeit, die Diskussionen um Musik, Rocklänge, Make-up und Ausgehen, die Bettinas ältere Schwester Petra ständig mit ihren Eltern führte, wenn ich dafür in der angenehm spießigen Normalität der Familie Berthold hätte aufwachsen dürfen.
Ich hasste es, wenn jemand mich fragte, was mein Vater denn so mache. Wie gern hätte ich gesagt: »Er arbeitet als Ingenieur« oder: »Er ist Lehrer.« Oder wenigstens »kaufmännischer Angestellter«. Mein Vater hieß zwar Kaufmann, war aber keiner. Er war »Aktionskünstler«. Meist kam die verwirrte Nachfrage: »Und was macht er beruflich?« Wenn die Sprache auf meine Mutter kam, sagte ich: »Sie gibt Kurse in Transzendentaler Meditation.«
Genauso gut hätte ich sagen können, meine Mutter bewohne ein hübsch möbliertes Zimmer in der geschlossenen Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses und mein Vater könne über Wasser wandeln. Wenn ich bis dahin in einer Gruppe noch nicht die Außenseiterin gewesen war, so war ich es spätestens nach dieser Auskunft. Deshalb behauptete ich manchmal auch einfach, mein Vater sei Unternehmer und meine Mutter seine Sekretärin. Das klang normal und war noch nicht mal wirklich gelogen. Mein Vater war ja eine Art Einmannunternehmen, er war Firmenchef, Verkaufsdirektor und Produkt in einem. Und meine Mutter nahm ihm alles ab, was ihn in seiner Kreativität hemmen könnte. Den Schriftverkehr mit Behörden, das Schreiben und Bezahlen von Rechnungen, die Kontaktpflege mit Veranstaltern und Galeristen. Sie führte den Haushalt … Na ja, eigentlich führte sie ihn nicht, deshalb war es immer unordentlich bei uns, und zu essen gab es meist nur, was mein Bruder oder ich kochten. Wenn man das, was wir veranstalteten, als Kochen bezeichnen konnte. Das Zusammenschütten verschiedener Zutaten hatte eher Ähnlichkeit mit dem, was andere Kinder mit ihrem Chemiebaukasten anstellten.
Manchmal allerdings bekam unser Vater einen Schub, dann zelebrierte er mit großem Tamtam die Herstellung einer Mahlzeit, verwüstete dabei die Küche und ließ sich von uns als Kochgenie feiern. Da er immer viel zu viel kochte, mussten wir tagelang seine zweifelhaften Kreationen essen, bis mein Bruder irgendwann die Reste ins Klo kippte. Daraufhin hielt mein Vater uns flammende Vorträge über darbende Künstler, die es sich nicht leisten könnten, Essen wegzuwerfen, weil die Gesellschaft ihnen die notwendige Anerkennung verweigere und leider auch jede Form der Alimentierung, dabei seien Kunst und Kultur die wichtigsten Grundlagen eines Gemeinwesens, aber in unserer oberflächlichen Welt hätten sie einen viel zu geringen Stellenwert, jeder Schlagersänger verdiene ein Vielfaches von dem, was er bekomme, dabei sei der Schlager eine Kulturschande … und so fort.
Mein Bruder machte sich während dieses Sermons jedes Mal unauffällig davon, während ich irgendetwas ausrechnete. Wie oft in den letzten fünfundsiebzig Jahren der zwölfte Mai auf einen Sonntag gefallen war, zum Beispiel. Das war genau zwölf Mal der Fall.
Die wenigsten Leute machten sich die Mühe nachzufragen, worin denn die Tätigkeit eines Aktionskünstler bestehe, und ehrlich gesagt hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, es zu erklären. Wie sollte man jemandem klarmachen, dass es Kunst war, wenn mein Vater sich in unserem Garten nackt an einen Marterpfahl binden ließ, den ganzen Körper bunt bemalt, und die Zuschauer ihn mit Staubwedeln und Wischmopps traktierten und dabei brüllend um den Pfahl herumliefen?
Mein Vater hätte dazu eine klug klingende Erklärung abgeben können, wie zum Beispiel, dass er mit dieser Performance für die Rechte der Indianer kämpfe, indem er sich mit ihnen identifiziere und solidarisiere, dass die Indianer stellvertretend für alle Unterdrückten stünden und die Staubwedel und Wischmopps die Waffen symbolisierten, mit denen die Weißen die Eingeborenen überall auf der Welt vertrieben und getötet hätten, und dass – indem er das Publikum an der Performance beteilige – deutlich werde, dass wir alle uns schuldig gemacht hätten und immer weiter schuldig machten an all diesem Unrecht, und … und … und …
Mit solchen Aktionen konnte er viele Erwachsene schwer beeindrucken, die standen dann stundenlang mit Weingläsern in der Hand bei uns herum und diskutierten, und meistens wurde am Ende gestritten, weil verschiedene Kunstauffassungen aufeinanderprallten oder ein Kunstkritiker dem anderen die Frau ausgespannt hatte, was unter dem Einfluss von Alkohol plötzlich ans Licht kam. Ich war empört darüber, wie viel Erwachsene logen und betrogen. Ich fand, sie müssten Vorbilder für uns Kinder sein, aber das waren die wenigsten.
Schwierig war es auch, wenn jemand mich zu Hause besuchte. Nicht dass es in letzter Zeit häufig vorgekommen wäre, aber als ich noch etwas jünger war und mir nicht vorstellen konnte, welch verheerenden Eindruck der Anblick meines Elternhauses und seiner Bewohner auf Kinder aus normalen Familien machen musste, hatte ich ab und an eine meiner Mitschülerinnen eingeladen. Während der Grundschule ging es noch einigermaßen. Die Kinder waren zwar anfangs etwas befremdet, aber irgendwann gefiel es ihnen, dass bei uns völlige Freiheit herrschte und kein Erwachsener sich darum scherte, was wir trieben. Wir machten alles, was in anderen Familien verboten war, schnitten unseren Puppen die Haare, räumten die Möbel in meinem Zimmer um, entzündeten Feuer im Garten und versuchten, den Nachbarhund zu dressieren, der allerdings keinerlei Interesse daran zeigte, durch meinen Hula-Hopp-Reifen zu springen, und knurrend die Zähne fletschte. Es war ein Wunder, dass nie etwas Schlimmes passierte.
Nur einmal, als ich eine Mitschülerin eingeladen hatte und wir nicht nur unseren Puppen, sondern auch uns gegenseitig die Haare geschnitten hatten, stand abends die erboste Mutter mit meiner Komplizin an der Hand vor unserer Haustür und stellte meine Mutter zur Rede. Die sah aus, als wäre sie gerade von sehr weit her zurückgekommen. Ihre Pupillen waren unnatürlich groß, und auf ihrem Gesicht lag ein seliger Ausdruck. Sie lächelte die wütende Frau freundlich an und sagte mit leicht schleppender Stimme: »Es ist doch wunderbar, wenn Kinder ihre Kreativität ausleben!«
Die Frau schnappte nach Luft, dann fiel ihr Blick auf mich. Ich sah noch viel schlimmer aus als ihre Tochter, die mich verheult und böse anstarrte. Bestimmt hatte sie ein gewaltiges Donnerwetter über sich ergehen lassen müssen und gab mir die Schuld daran. Und tatsächlich war es auch meine Idee gewesen.
Mutter und Tochter warfen uns einen letzten, vernichtenden Blick zu und machten auf dem Absatz kehrt. Meine Mutter strich zärtlich mit der Hand über die stoppeligen Reste meiner Haarpracht und sagte: »Sind doch nur Haare. Die wachsen nach.« In diesem Moment liebte ich sie von ganzem Herzen und war ausnahmsweise einmal froh, dass sie nicht normal war.
Unsere neuen Frisuren sorgten natürlich auch in der Schule für Aufsehen, und wir mussten eine Menge Spott von unseren Mitschülern aushalten. Kein Wunder, dass sich danach die Zahl meiner Freundinnen gegen null bewegte. Ich hatte jetzt den Ruf eines bösen Mädchens, und keine meiner Klassenkameradinnen wollte von mir in etwas hineingezogen werden, womit sie sich Ärger einhandeln könnte. Aus der anfänglich vorhandenen Faszination für mein unkonventionelles Elternhaus entwickelte sich eine Ablehnung, die sich schließlich gegen mich richtete und alles einschloss, was mit mir zu tun hatte.
Im Gymnasium wurde es noch schlimmer. Dort war ich von Anfang an als Außenseiterin abgestempelt, und die anderen Mädchen gingen mir aus dem Weg.
Ich sehnte mich ganz furchtbar danach, dazuzugehören und Freundinnen zu haben. Zwar hatte ich Bettina, mit der ich gewissermaßen mein ganzes Leben verbracht hatte, aber sie war mehr wie eine Schwester für mich. Ich hatte sie mir nicht ausgesucht. Da wir zufällig nebeneinander wohnten, hatten unsere Eltern uns irgendwann gemeinsam in einen Laufstall gesperrt, und seither waren wir fast immer zusammen gewesen.
Aber da gab es auch noch Yvonne. Sie war das schönste Mädchen der siebten Klasse, hatte langes, welliges Haar, ein perfekt proportioniertes Gesicht mit großen Augen und geschwungenen Lippen, die sie manchmal zu einer niedlichen Schnute verzog. Sie war bei allen beliebt, sogar bei den Lehrern, und zu allem Überfluss war sie auch noch eine Sportskanone. Kurz, sie war das genaue Gegenteil von mir. Ich verzehrte mich danach, wie Yvonne zu sein. Weil das nicht ging, wollte ich ihr wenigstens nahe sein.
Ich stahl meinen Eltern Geld und kaufte Süßigkeiten, um sie Yvonne zu schenken. Die vertrug, wie ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, keinen Zucker und durfte deshalb nichts Süßes essen. Da ich Brausestangen und Gelee-Himbeeren nicht mochte, versteckte ich sie unter meinem Bett. Eines Tages waren sie verschwunden. Vielleicht hatte mein Bruder das Diebesgut an sich gebracht, vielleicht hatte aber auch meine Mutter die Süßigkeiten gefunden und während einer ihrer Heißhungerattacken, die sie nach dem Haschischrauchen regelmäßig überfielen, aufgegessen.
Weil mein Versuch mit den Süßigkeiten fehlgeschlagen war, riss ich mir einige meiner Lieblingsbücher aus dem Herzen, darunter Narziss und Goldmund und Die Falschmünzer, und schenkte sie Yvonne, die mir herablassend erklärte, sie lese lieber Pferdebücher.
Ich lud sie zu meiner Geburtstagsparty ein, aber sie kam nicht. Es kamen sowieso nur drei von den acht Mädchen, die ich eingeladen hatte, und das waren die, die noch unbeliebter waren als ich. Die anderen hatten alle eine sehr einleuchtende Erklärung, warum sie nicht kommen konnten. Klavierstunde, eine sterbende Oma, den Hochzeitstag der Eltern, ein Magen-Darm-Virus. Yvonne hatte nicht mal eine Ausrede. Sie kam einfach nicht.
Als ich am nächsten Tag den Mut aufbrachte, sie zu fragen, wo sie denn gewesen sei, sagte sie: »Ich hatte einen Fototermin.«
Tatsächlich waren in der nächsten Ausgabe des Versandhauskatalogs, aus dem die Familien unseres Städtchens ihre Kleidung bestellten, Bilder von ihr. Yvonne in einem pinkfarbenen Jeansanzug, Yvonne in einem Sommerkleid mit gesmoktem Oberteil, in einer duftigen, bunten Bluse, in Hotpants mit Korksandalen und einem gestreiften Oberteil, das im Nacken gebunden wurde. Ihr Blick schien dem Betrachter etwas Großartiges zu versprechen: TRAG DIESEN PINKFARBENEN JEANSANZUG, UND DU WIRST GLÜCKLICH!
Wenig später trugen sämtliche Mädchen in unserer Schule den Anzug, das Sommerkleid, die Bluse und die Hotpants. Auch ich flehte meine Mutter an, mir wenigstens eines der Teile zu bestellen, aber sie weigerte sich.
»Katalogware kommt mir nicht ins Haus«, erklärte sie mit seltener Entschiedenheit. »Die ist spießig und gefährdet den örtlichen Einzelhandel.«
Nichts hätte mir gleichgültiger sein können als der örtliche Einzelhandel. Ich wollte ein Mal, nur ein einziges Mal aussehen wie alle anderen. Aber meine Mutter war unerbittlich.
Yvonne war nun endgültig der Star der Schule, und ich begrub meine Freundinnenträume.
Dann kam mir das Schicksal in Gestalt der Heimatkundelehrerin zu Hilfe. Die hatte sich mit alternativen Lehrmethoden von Maria Montessori bis Rudolf Steiner befasst, stieß damit an unserer Schule aber auf wenig Resonanz. Dennoch hatte sie Stuhlkreise und gelegentliche Gruppenarbeit durchgesetzt. Und so fand ich mich plötzlich in einer Hausaufgabengruppe mit Yvonne wieder. Unser drittes Gruppenmitglied war wegen einer Mittelohrentzündung abwesend.
Yvonne hatte die Situation offenbar blitzschnell analysiert und war zu dem Schluss gekommen, dass es schlimmer wäre, mich ihren Eltern präsentieren zu müssen, als mich zu Hause zu besuchen. Nur so konnte ich mir erklären, dass sie nach der Stunde sagte: »Ich komm zu dir. Wann hast du Zeit?«
Ich schlug ihr den Nachmittag vor. Als ich nach Hause kam, stellte ich zu meiner Erleichterung fest, dass meine Eltern nicht da waren. Pfeifend räumte ich mein Zimmer auf und beseitigte in der Küche die größte Unordnung. Dann pflückte ich einen Strauß Gänseblümchen und stellte sie in eine Tasse. Blumen empfand ich als Inbegriff bürgerlicher Wohnkultur, aber meine Mutter weigerte sich, Schnittblumen zu kaufen. Die seien tot, und sie wolle nicht für den Mord an Pflanzen verantwortlich sein.
»Dann solltest du aufhören, Gras zu rauchen«, hatte mein Bruder ihr geraten, was sie geflissentlich überhörte.
Ich kochte chinesischen Tee, in dem kleine Blüten schwammen, was ich immer sehr hübsch gefunden hatte (den trank meine Mutter übrigens auch, ohne sich um die ermordeten Blümchen zu scheren), und stellte die Kanne auf das Stövchen.
Als es klingelte, stürmte ich zur Haustür und ließ Yvonne herein. Misstrauisch blickte sie sich um und folgte mir zögernd in die Küche, wobei sie im Flur herumliegende Schuhe, Gartengeräte und anderes Zeug elegant umkurvte.
»Macht bei euch niemand sauber?«, fragte sie und wischte mit ihrem Blusenärmel Staub von der Sitzfläche eines Holzstuhls, bevor sie sich darauf niederließ.
»Nein«, sagte ich. »Meine Mutter ist berufstätig.«
Als ich mich mit den Augen einer Fremden in meiner gewohnten Umgebung umsah, registrierte ich beschämt, wie ungepflegt alles wirkte. Ich fand unsere Küche gemütlich, aber auf einen Außenstehenden konnte das Durcheinander aus Geschirr, Gewürzdosen, Obst- und Gemüsekörben, Kräutertöpfchen, Einmachgläsern, Kochbüchern auf schiefen Regalbrettern, bunten Küchenhandtüchern und fettigen Kupferpfannen, die neben Postern von Musikern und Entwürfen meines Vaters zur Dekoration an der Wand hingen, chaotisch und ziemlich schäbig wirken.
»Meine Mutter hat gerade wenig Zeit«, sagte ich entschuldigend. »Sie muss einen Workshop vorbereiten.« Ich merkte, dass diese Erklärung die Sache nicht besser machte. Wie Yvonne einmal bei einer Diskussion in der Schule erklärt hatte, war es die Bestimmung von Frauen, für ein gepflegtes Heim und das Wohlergehen von Mann und Kindern zu sorgen. Sie durften vielleicht zusätzlich einige Stunden am Tag in einem Büro arbeiten, aber die Organisation von Meditationsworkshops für durchgeknallte Sinnsucher fiel definitiv nicht in ihren Aufgabenbereich.
Ich schenkte meinem Gast Tee ein und achtete darauf, dass drei besonders hübsche Blüten auf der Oberfläche schwammen. Mit angewidertem Blick fischte Yvonne sie raus. Schlapp und leblos hingen sie in ihren Fingern.
»Wo kann ich die hintun?« Sie hielt die Hand Hilfe suchend in die Luft, dabei tropfte Tee auf den Tisch. Ich deutete auf den Eimer mit den organischen Abfällen, die später auf dem Kompost landen würden.
Yvonne wischte die Hand an ihrer Jeans ab und holte die Schulsachen aus der Tasche, die wir für die Gruppenhausaufgabe benötigen würden. Ich hätte mich gern noch eine Weile unterhalten, aber sie schien entschlossen, sich keinen Moment länger als nötig bei mir aufzuhalten und die uns gestellte Aufgabe deshalb so schnell wie möglich zu lösen.
Das Thema lautete: »Beschreibe den Ort, in dem du lebst. Warum ist er Heimat für dich?« Darunter hatte unsere Lehrerin geschrieben: »Sammelt gemeinsam Material, und tauscht euch über euren Wohnort aus. Dann schreibt jede ihren Text. Hinterher bitte vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.«
Yvonne verdrehte die Augen und begann zu schreiben. Die gemeinsame Materialsammlung übersprang sie einfach.
Ich kaute auf meinem Stift herum und überlegte. Wenn ich ehrlich wäre, müsste ich schreiben: »Der Ort, in dem ich lebe, ist ein stinklangweiliges Kaff mit lauter spießigen Leuten. Es gibt in unserem Viertel fast nur Reihenhäuser, deren Mauern mit komischen grauen Platten bedeckt sind. Mein Vater sagt, die sind nicht nur hässlich, sondern auch giftig, deshalb darf man sie auf keinen Fall abnehmen. Verstehe ich nicht, gerade wenn sie giftig sind, sollte man sie doch abnehmen. Das einzig Schöne an unserer Ortschaft ist der Marktplatz, da gibt es rundherum einige hübsche, alte Häuser und in der Mitte einen Brunnen. Manche Leute sind ziemlich unfreundlich und abweisend zu mir, ich glaube, weil sie meinen Vater nicht mögen. Auch die meisten meiner Mitschülerinnen sind nicht besonders nett. Freunde habe ich eigentlich keine, und meine Eltern sind leider verrückt, weshalb ich so schnell wie möglich von ihnen wegwill. Dass unser Ort Heimat für mich wäre, kann ich nicht sagen. Ich fühle mich hier nicht zu Hause, weiß aber auch nicht, wo ich mich sonst zu Hause fühlen könnte. Ich glaube, ich kenne den Ort noch gar nicht, der eine Heimat für mich sein könnte.«
Aber wenn ich das schriebe, gäbe es eine Riesendiskussion mit der Lehrerin. Womöglich würde sie meinen Aufsatz der Klasse vorlesen und alle auffordern mitzudiskutieren. Darauf konnte ich gut verzichten, deshalb schrieb ich: »Ich wohne in einer hübschen, mittelgroßen Stadt, die alles hat, was man braucht. Ein Rathaus, ein Schwimmbad, eine Eisdiele und eine Bibliothek. Das Leben hier ist angenehm und ruhig, die Leute sind freundlich, und ich fühle mich sicher und geborgen. Heimat ist da, wo Menschen sind, die man gernhat. So wie ich meine Eltern und meine Freunde gernhabe. Wo sie sind, fühle ich mich zu Hause …«
Ich war in die Schöpfung meiner kleinen heilen Welt so vertieft, dass ich gar nicht bemerkte, was sich währenddessen in unserem Garten abspielte. Erst als Yvonne ein erschrecktes Quieken von sich gab, hob ich den Kopf und blickte hinaus. Eine merkwürdige Prozession näherte sich dem Haus. Leute in bunten, weiten Gewändern, Schals und Bänder um den Kopf geschlungen, manche mit auffälligen Ketten um den Hals, die meisten von ihnen barfuß. Vorneweg ging meine Mutter, die Hände in der indischen Gebetshaltung vor der Brust, mit gesenktem Blick vor sich hin murmelnd.
Verdammt. Ich hatte ganz vergessen, dass heute Mittwoch war. Mittwoch war Gruppentag. Die Teilnehmer kehrten von ihrer Naturmeditation zurück, bei der sie die Wälder der Umgebung heimsuchten und ahnungslose Spaziergänger schockten. Wer würde nicht erschrecken, wenn er sich auf einer Lichtung plötzlich einer Horde seltsam gewandeter Menschen gegenübersah, von denen sich einige ekstatischen Tänzen hingaben und andere am Boden liegend laut vor sich hin summten.
Yvonne starrte durchs Fenster. »Was ist das denn?«
»Das ist nur die Meditationsgruppe«, sagte ich leichthin. »Du weißt ja, dass meine Mutter solche Seminare gibt.«
»Was für Seminare genau?«, fragte Yvonne.
Ich überlegte, wie ich ihr erklären könnte, was meine Mutter machte. Von Yoga hatte Yvonne vielleicht schon gehört, aber worin eine Transzendentale Meditation bestand, das wusste ich selbst nicht so genau.
»Es ist … so was wie ein geistiger Gymnastikkurs. Die Teilnehmer sitzen ganz still und entspannen sich, manchmal tanzen sie auch, und wenn’s gut läuft, kommen sie in so einen … Glückszustand und sind eins mit sich und der Welt.«
Ich fand, das war eine ziemlich gute Erklärung, und sah Yvonne erwartungsvoll an.
»Du meinst, die nehmen alle Drogen«, erwiderte sie nüchtern.
»Neiiin«, sagte ich energisch. »Das hat mit Drogen nichts zu tun.«
Yvonne blickte zweifelnd. Die Gruppe hatte sich im Kreis auf den Rasen gesetzt, der dringend mal wieder gemäht werden müsste. Mein Vater hatte dazu keine Lust, mein Bruder verkündete jedes Mal, wenn die Sprache darauf kam, er wolle mit keiner Sorte Gras irgendetwas zu tun haben, ich war noch nicht kräftig genug, den schweren Rasenmäher zu schieben, und meine Mutter bemerkte nicht mal, wie hoch die Halme standen. Also wucherten sie ungehindert weiter, bis die nächste Gruppe eine kreisförmige, platt gesessene Fläche hinterließ.
Die Teilnehmer hatten sich die Daumen in die Ohren gesteckt und die Finger neben dem Kopf gespreizt, was ihnen das Aussehen von Kindern verlieh, die »Elefant« spielten. Sie hatten die Augen geschlossen und summten in unterschiedlichen Lautstärken.
»Was machen sie denn jetzt?«, fragte Yvonne entgeistert.
»Hummelbrummen«, sagte ich. »Das übertönt die eigenen Gedanken und versetzt den Kopf in Vibration, es wirkt klärend und beruhigend.«
Yvonne hingegen wirkte erschüttert. »Es gibt wirklich komische Leute«, sagte sie schließlich und verdrehte die Augen.
Ich hoffte inständig, dass es bei der Gruppensitzung nicht zu irgendwelchen Ausbrüchen kam, und tatsächlich blieb diesmal alles ruhig.
Wir arbeiteten schweigend weiter.
Ungefähr zwanzig Minuten später legte Yvonne ihren Stift ab. »Wie weit bist du?«
»Fast fertig«, sagte ich und schrieb den Satz zu Ende. Es war völlig egal, an welcher Stelle meine Lügengeschichte aufhörte.
»Lies vor«, befahl Yvonne.
Ich las meinen Text vor und war fast selbst gerührt, so idyllisch und liebenswert hatte ich unseren Heimatort und seine Bewohner dargestellt.
Yvonnes Miene war undurchdringlich. »Aha«, sagte sie. »Deine Freunde hast du also gern. Wen denn zum Beispiel?«
»Dich!«, brach es aus mir heraus. »Dich hab ich gern! Wir sind doch Freundinnen, oder?«
Sie zuckte leicht zusammen und wandte ganz offensichtlich peinlich berührt den Blick ab. Ich hätte mir auf die Zunge beißen können, aber es war zu spät.
Statt einer Antwort gab sie ein Räuspern von sich und las ihren Text vor, der, wie nicht anders zu erwarten, perfekt war. Sie begann mit einem kurzen Ausflug in die Geschichte unserer Stadt, gab die Fläche an, nannte die Einwohnerzahl, beschrieb die wirtschaftliche und die politische Situation, vergaß nicht, ein paar folkloristische Besonderheiten wie das Flussfest und die traditionelle Verleihung des Bürgerordens zu erwähnen, zählte alle Einrichtungen auf, die fürs Gemeindeleben wichtig waren, darunter die Musikschule, die Sporthalle und das Theater. Sie beschrieb den liebenswerten Charakter der Einwohnerschaft und schloss mit einer Anekdote, in der ihre Verbundenheit mit ihrem Heimatort deutlich wurde. Als sie fertig war, blickte sie auf. »Na, was sagst du?«
»Toll«, sagte ich bewundernd. »Du kannst wirklich gut schreiben.«
Yvonne griff nach dem Aufgabenblatt. »Hinterher bitte vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen«, las sie. »Ich glaube, das können wir uns schenken. Die Unterschiede liegen ja auf der Hand.«
»Aber …«, protestierte ich. Darin bestand ja der eigentliche Sinn der Gruppenarbeit, dass man sich austauschte. Aber Yvonne war schon aufgestanden und packte ihre Sachen ein. Die Erleichterung über das Ende ihres Besuchs stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Also, dann bis morgen«, sagte sie. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Danke für den Tee.«
Am nächsten Tag in der Pause stand sie mit ihren Freundinnen zusammen. Sie tuschelten und kicherten, hie und da traf mich ein vielsagender Blick. Mit erhobenem Kopf ging ich an ihnen vorbei.
»Kann ich auch mal bei so ’nem Buddha-Seminar mitmachen?«, rief mir ein Mädchen hinterher, das sich gern wichtigmachte.
Ich blieb stehen, drehte mich zu ihr um und blickte sie spöttisch an. »Du? Ich dachte, du bist schon erleuchtet.«
Sie wurde rot, die anderen kicherten.
Schnell wandte ich mich ab, damit sie meine aufsteigenden Tränen nicht sehen konnten.
Mein Leben in der alles andere als normalen Familie Kaufmann wäre sicher noch schwieriger gewesen, wenn ich nicht einen Bruder gehabt hätte, der nicht minder seltsam war, nur auf andere Art. Che war drei Jahre älter als ich, und wenn ich meinen Eltern gegenüber so etwas wie Peinlichkeit und leichte Verachtung fühlte, so empfand mein Bruder puren Hass für sie. Er verabscheute, was sie taten und sagten, was sie dachten und wie sie aussahen. Er verabscheute ihre Berufe und ihre Freunde, und er zählte die Tage, bis er endlich volljährig sein würde. Zu seiner großen Erleichterung war das Volljährigkeitsalter gerade von einundzwanzig auf achtzehn herabgesetzt worden. In seinem Zimmer machte er mit Kuli Striche an die Wand, wie ein Gefangener. Manchmal fragte er mich, wie viele Tage es noch seien. An dem Tag, an dem ich meine erste Periode bekam, waren es noch sechshundertvierundzwanzig Tage.
Che bemühte sich, in allem anders zu sein als unsere Eltern. Obwohl alle Jugendlichen die Haare lang trugen, bestand er darauf, sein Haar kurz zu schneiden. Nicht weil er nicht aussehen wollte wie seine Freunde, sondern weil er nicht aussehen wollte wie unser Vater, der seine schulterlangen Haare meist im Nacken zu einem Zopf zusammenband. Dazu trug er flatternde Hemden und bunte Leinenhosen, im Winter Pullover mit Mustern aus Norwegen oder Peru und darüber bestickte Fellmäntel, die nach Schafscheiße rochen.
Che dagegen trug nur Schwarz. Schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, schwarze Rollkragenpullis. Dazu Turnschuhe, die er sich selbst schwarz färbte, oder schwarze Stiefel. Er hörte nie Rock oder Pop, sondern Musik von Liedermachern und Folksängern wie Peter, Paul and Mary und Woody Guthrie, außerdem schwärmte er für die melancholischen Songs von Leonard Cohen, die er auf der Gitarre nachzuspielen versuchte.
ENDE DER LESEPROBE