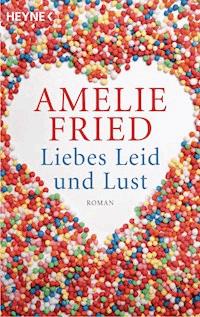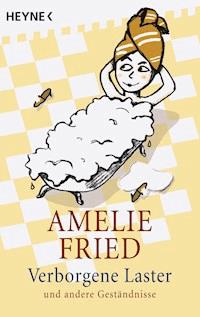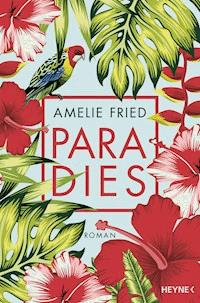
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Woche im Paradies: Hier zählen nur Sie – und am Ende werden Sie nicht mehr der gleiche Mensch sein!
Petra freut sich auf eine Auszeit ganz für sich, ohne Haushalt, Kinder, Mann und Job. Ihren Sehnsuchtsort findet sie auf einer spanischen Insel, bei einer Seminarwoche im herrlich gelegenen Hotel Paraíso mit Selbsterfahrung, Körperarbeit, Meditation und Yoga. Dort trifft sie auf die anderen Teilnehmer der Gruppenreise, darunter Anka, Suse und Jenny, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und Geheimnisse haben, die nicht nur Petras Leben aus den Fugen heben. Als auch noch ein Sturm die Hotelgäste einschließt und ein Entkommen von der Insel unmöglich macht, kochen die Emotionen innerhalb der Gruppe lebensgefährlich hoch. Am Ende wird aus dem Meer eine Frauenleiche geborgen. Aus der paradiesischen Wellnesswoche ist ein Albtraum geworden, und keiner der Teilnehmer ist mehr der Mensch, als der er gekommen ist – wie im Prospekt versprochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Petra freut sich auf eine Auszeit ganz für sich, ohne Haushalt, Kinder, Mann und Job. Ihren Sehnsuchtsort findet sie auf einer spanischen Insel, bei einer Seminarwoche im herrlich gelegenen Hotel Paraíso mit Selbsterfahrung, Körperarbeit, Meditation und Yoga. Dort trifft sie auf die anderen Teilnehmer der Gruppenreise, darunter Anka, Suse und Jenny, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und Geheimnisse haben, die nicht nur Petras Leben aus den Fugen heben. Als auch noch ein Sturm die Hotelgäste einschließt und ein Entkommen von der Insel unmöglich macht, kochen die Emotionen innerhalb der Gruppe lebensgefährlich hoch.
Die Autorin
Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Bei Heyne erschien zuletzt der Bestsellerroman Ich fühle was, was du nicht fühlst. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in München.
AMELIE FRIED
PARADIES
ROMAN
Für Peter Probst, in Liebe und Dankbarkeit
Er war nicht nur leichtsinnig genug, mich zu heiraten, und nachsichtig genug, es bis heute mit mir auszuhalten. Er hat mich ermutigt, mit dem Schreiben zu beginnen, und er ist an meiner Seite, wenn ich ihn brauche. Dieses Buch würde es ohne ihn nicht geben.
Die frühe Morgensonne lässt das Meer glitzern. Das Motorboot fährt ein Stück an der Küste entlang, wendet und fährt wieder zurück. Mehrmals wiederholt es das Manöver, schließlich stoppt es. Nun schaukelt es vor der Insel auf den Wellen und gerät dabei immer wieder gefährlich nahe an ein Felsmassiv, das sich hoch über dem Ufer auftürmt. Die dreiköpfige Besatzung hat sichtlich zu kämpfen, das Boot in Position zu halten. Schließlich gibt einer der Männer ein Zeichen, gleich darauf rast der Anker in die Tiefe. Einen Moment verharren alle, dann hebt der Bootsführer den Daumen.
Am nahe gelegenen Strand hockt eine Gruppe Männer und Frauen zusammen und beobachtet mit einem Fernglas, das vom einen zum anderen gereicht wird, jede Bewegung des Bootes. Ihre Gesichter wirken übernächtigt, die Mienen angespannt. Hie und da geht jemand nervös ein paar Schritte den Strand entlang, vorbei an den beiden Polizisten, die an ihrem Auto lehnen, vorbei an einem wartenden Krankenwagen, um sich kurz darauf wieder zu den anderen zu gesellen. Hände greifen nach Händen, Arme legen sich tröstend um Schultern. Manche blinzeln verstört in die immer kräftiger werdende Sonne oder wischen sich verstohlen die Augen.
Ein Mann auf dem Boot trägt einen Taucheranzug. Er schlüpft in seine Flossen und setzt sich eine Maske auf die Stirn. Er kontrolliert die Pressluftflasche, schwingt sie sich auf den Rücken und schnallt sie fest. Prüfend blickt er in das dunkle Wasser. »Profundidad?«, fragt er. »Tiefe?«
Der Bootsführer wirft einen Blick auf sein Display und bewegt den Daumen auf und ab.
»Zwölf bis fünfzehn Meter.«
Der Taucher hakt ein langes Seil, das zu einer Acht aufgerollt auf dem Boden liegt, an seinem Anzug fest. Der dritte Mann überprüft die Halterung des Seils am Boot, dann streift er ein Paar kräftige Handschuhe über, nimmt das Seil in die rechte Hand und wickelt es sich um den Unterarm. Der Taucher vergewissert sich mit einem Blick zu ihm und dem Bootsführer. »Listo?«
Zweifaches Nicken.
Der Taucher schiebt die Maske über die Augen und nimmt das Mundstück zwischen die Zähne. Dann hockt er sich auf den Rand des Bootes und lässt sich rückwärts ins Wasser fallen.
Petra
Ihr Kopf tauchte ins kühle Wasser, die Stimmen um sie herum wurden leiser, ihre Arme und Beine bewegten sich rhythmisch, trugen sie durch die leichte Brandung. Sie spürte die Sonne auf dem Gesicht, schmeckte das Salz, fühlte ihren Körper und das Meer. Langsam ließ sie den Kopf tiefer unter Wasser sinken, bis sie ein dumpfes Pulsieren vernahm, von dem sie sich vorstellte, es sei der Herzschlag der Erde.
Kurze Zeit später lag sie im warmen Sand und spürte eine Hand auf ihrer Haut, ein zärtliches, planvolles Kreisen mit den Fingern, das ihre Neugier weckte. Wem gehörte die Hand, wohin würde sie wandern? Ein zartes Prickeln durchfuhr sie, und sie hielt die Lider geschlossen, weil sie den Moment so lange wie möglich festhalten wollte.
»Meine Damen und Herren, wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht, bitte bleiben Sie während des gesamten Fluges angeschnallt, da es jederzeit unerwartet zu Turbulenzen kommen kann.«
Ernüchtert schlug Petra die Augen auf und seufzte. Sie griff in ihre Handtasche, die sie zwischen den Füßen abgestellt hatte, und holte einen Prospekt heraus. Zum hundertsten Mal studierte sie den Text und die Bilder, die eine heftige Sehnsucht in ihr hervorriefen.
Eine Woche im Paradies lautete die Überschrift, und darunter stand:
Hier zählen nur Sie! Wählen Sie aus unserem Wohlfühlangebot: Selbsterfahrung, Körperarbeit, Entspannung, Erholung. Sie wohnen im sympathischen, familiären Hotel Paraíso direkt am Meer, das alle Annehmlichkeiten (Pool, Wellnessbereich, Wassersport) bietet. Jeden Morgen erwartet Sie ein sensationelles Frühstücksbüfett, abends werden Sie mit köstlichen pescetarischen und vegetarischen (auf Wunsch auch veganen) Gerichten verwöhnt.
Unsere Kursleiter betreuen Sie professionell und individuell. Ob Yoga, Meditation, Achtsamkeitstraining, Körpererfahrungen oder ein psychologisch unterstützendes Gespräch – Sie entscheiden, was Ihnen guttut. Und was immer Sie in dieser Woche finden – sich selbst oder andere, geistige Anregung, körperliche Entspannung, seelische Ruhe oder von allem etwas –, Sie werden am Ende nicht mehr der Mensch sein, als der Sie angekommen sind.
Jedes Mal wenn sie den letzten Satz las, erschauerte sie ein wenig. Er klang vielversprechend und bedrohlich zugleich. Wollte sie denn eine andere werden? Oder wollte sie wieder die werden, die sie mal gewesen war? Ging das überhaupt, zu einer früheren Version seiner selbst zurückzukehren? Oder konnte man nur die derzeitige Version optimieren?
Die Stewardess mit dem Getränkewagen hatte ihre Reihe erreicht.
»Was möchten Sie trinken?«
Das ältere Ehepaar neben ihr klappte geschäftig die Tische herunter. Petra wettete mit sich selbst, dass sie Tomatensaft bestellen würden. Bingo! Aus den Augenwinkeln beobachtete sie, wie der Mann die kleine Plastiktüte aufriss, die mit dem Tomatensaft gereicht wurde. Er nahm die Papierserviette heraus und legte sie zur Seite, öffnete nacheinander die Tütchen mit Salz und Pfeffer, streute sie über seinen Saft und den seiner Frau und rührte sorgfältig um. Die zweite Tüte steckte er ein. Genauso machte er es mit dem Knabberzeug. Er zählte die Cracker ab, legte die Portion für seine Frau auf die Papierserviette und verstaute die zweite Tüte in seinem Rucksack. All das geschah, ohne dass er und seine Frau ein Wort miteinander gewechselt hätten, wie ein lange eingeübtes Ritual. Petra unterdrückte den Drang zu lachen. Oder zu weinen. Sie wusste es nicht so genau.
Wurden alle Ehen irgendwann so … lächerlich? Die Ehepartner so berechenbar? Kannte man sich irgendwann so gut, dass Kommunikation überflüssig wurde, weil man sowieso wusste, was der andere sagen würde, wenn er etwas sagen würde? Vielleicht erklärte das, warum so viele alte Paare kaum mehr miteinander sprachen. Vielleicht gab es irgendwann tatsächlich nichts mehr zu sagen.
Sie fragte sich, wie Matthias und sie auf einen Beobachter wirkten. Ob sie auch so seltsame Gewohnheiten entwickelt hatten?
Die Akribie, mit der ihr Mann beispielsweise einen Fisch zerlegte, die Zunge in den Mundwinkel geklemmt, mit einer Entschlossenheit, als gälte es, seinen schlimmsten Feind zu besiegen, fand sie schon erheiternd. Am Schluss reihte er die Gräten der Größe nach am Tellerrand auf, blickte triumphierend hoch und sagte: »Den Kerl hätten wir erledigt.« Jedes Mal sagte er diesen Satz, und als Petra ihn einmal vorweggenommen hatte, war er eingeschnappt gewesen. »Du findest mich also langweilig«, hatte er schmollend gesagt, und nur mit Mühe war es ihr gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass es nicht so war.
Wenigstens sprachen sie noch miteinander, wenn auch weniger als früher. Wie hatten sie sich immer über Paare mokiert, die im Restaurant saßen und sich nichts zu sagen hatten! Die eine ganze Mahlzeit hindurch schwiegen, sich manchmal nicht einmal ansahen. Niemals würde ihnen das passieren, hatten sie einander versichert. Und nun passierte es doch manchmal.
Es war kein feindseliges Schweigen, eher ein einvernehmliches: weil so vieles schon gesagt war, weil sie sich auch ohne Worte verstanden, weil nicht ständig etwas Neues passierte, worüber sie sich austauschen könnten. Nein, dachte Petra, ihr Schweigen war kein Zeichen von Entfremdung, es zeigte vielmehr, wie nahe sie sich waren. Ihr schien es eher ein Zeichen von Liebe zu sein, wenn man den anderen nach so langer Zeit immer noch gerne um sich hatte, mit all seinen Spleens und Eigenheiten.
Sie blickte auf die Fotos in dem Prospekt vor ihr und träumte sich wieder weg ins Paradies. Eine Woche ganz für sich – ohne Haushalt, Kinder, Mann und Job –, das hatte es noch nie gegeben. Allein die Vorstellung, nicht einkaufen und kochen zu müssen, erfüllte sie mit Euphorie, ganz zu schweigen von den unzähligen anderen Pflichten ihres Alltags, denen sie für sieben wunderbare Tage entrinnen würde. Sieben Tage! So lange, wie Gott gebraucht hatte, die Welt zu erschaffen.
Für einen Augenblick hatte sie die erschreckende Fantasie, dass im Hotel Paraíso alle nackt herumlaufen würden, wie es sich fürs Paradies gehörte. Aber dann beruhigte sie sich damit, dass in der Broschüre nirgendwo etwas von FKK zu lesen war.
Sie hatte noch nie verstanden, warum manche Leute so scharf darauf waren, sich vor anderen auszuziehen. Außer Matthias und ihrem Gynäkologen hatte noch kein Mann sie nackt gesehen. Mit sechzehn hatte sie Matthias kennengelernt, mit zweiundzwanzig wurde sie schwanger, und sie hatten geheiratet. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, das Kind nicht zu bekommen. Auch Matthias hatte keine Sekunde gezögert. Er fand es super, Vater zu werden, wobei seine Begeisterung für diese Rolle, wie sich bald herausstellte, eher theoretischer Natur war. Praktisch hatte er sich all die Jahre wenig an der Erziehungsarbeit beteiligt. »Frag lieber Mama« war seine Standardantwort, wenn eines seiner Kinder mit einem Anliegen zu ihm kam, das mit Mühe verbunden war. Zwischendurch überkamen ihn spontane Anfälle von Vaterliebe. Dann balgte er sich mit den Kindern, lud sie zu Pizzagelagen ein oder las ihnen stundenlang vor.
Als Eva zur Welt kam, war Petra dreiundzwanzig und mitten im Studium. Drei Jahre später hatten sie Marie bekommen, sechs Jahre später Simon. Ein Nachzügler. Ungeplant. Und zu einem Zeitpunkt, der ungünstiger nicht hätte sein können.
Damals war gerade ein Seitensprung von Matthias aufgeflogen, und Petra hatte beschlossen, ihn zu verlassen. Bevor sie ihre Entscheidung in die Tat umsetzen konnte, stellte sich heraus, dass sie ein Kind erwartete. Sie blieb.
Nun war Simon dreizehn und legte es darauf an, alle Rekorde im Pubertieren zu schlagen. Mal kam er mit einem Vollrausch nach Hause, mal durften sie ihn wegen des Besitzes von Marihuana bei der Polizei abholen. Einmal hatten sie ihn in den Armen eines deutlich älteren Mädchens erwischt, das ihm Sachen beibringen wollte, die er mit dreizehn noch nicht kennen sollte. Er war launisch und faul, unzuverlässig und unverschämt. Kurzum, er setzte alles daran, ihnen das Leben schwer zu machen, wie um ihnen zu sagen: Ihr wolltet mich nicht? Das sollt ihr büßen.
Kinder waren schlimmer als die CIA, sie wussten alles. Nie hatten Matthias und sie damals vor den Mädchen über Trennung oder Scheidung gesprochen, und dennoch hatte Eva, die Achtjährige, sie zielsicher mit unangenehmen Fragen gelöchert:
Lasst ihr euch scheiden?
Müsst ihr dann Lose ziehen, wer mich und wer Marie kriegt?
Darf ich Papa besuchen, wenn er woanders wohnt?
Wenn er eine neue Frau hat, muss ich dann Mami zu ihr sagen?
Kriegt Papa dann auch neue Kinder?
Marie, damals fünf, hatte eine Strichmännchenfamilie gemalt. Links Matthias, groß, mit braunem Haarschopf und Brille. Daneben sie, Petra, nur ungefähr halb so groß, an der Hand Eva. Und am äußersten Bildrand ein kleines, gekrümmtes Wesen, halb Kind, halb Gnom, dem große Tränen aus den Augen rannen. Es hatte Petra das Herz zerrissen.
Als die Krise überwunden und Simon ein Jahr alt gewesen war, hatte Petra Marie das Bild gegeben und sie gefragt, ob sie ihren kleinen Bruder mit draufmalen wolle. Marie hatte singend ein Baby auf einer bunten Decke gezeichnet, das wie ein Schutzengel über der Familie zu schweben schien. Petra hatte das Bild rahmen lassen und im Eingangsbereich des Hauses aufgehängt.
Sie richtete den Blick aus dem Fenster und betrachtete die wattige Wolkenlandschaft, durch die sie gerade flogen. Es war unglaublich, wie kompakt die Wolken wirkten. Als könnte man sich in sie hineinfallen lassen wie in ein Daunenbett. Dabei war da nichts, nur Luft.
Genau wie damals, als Matthias’ Betrug aufgeflogen und alles, worauf sie vertraut hatte, nur eine Täuschung gewesen war. Seine Liebe, seine Loyalität, seine Verlässlichkeit. Sie hatte sich fallen lassen in das Daunenbett ihrer Beziehung und war ins Bodenlose gestürzt.
Petra lehnte den Kopf zurück und schloss wieder die Augen, aber sie konnte sich nicht mehr entspannen. Dann fing der Mann neben ihr zu schnarchen an. Sie öffnete die Augen und bedachte ihn mit einem strafenden Blick, aber er schlief tief und fest, den Kopf nach hinten gelehnt, den Mund geöffnet. Seine Frau knuffte ihn zwischendurch unauffällig in die Seite, dann war er kurz ruhig, bevor er von neuem zu sägen begann.
Petra stellte sich vor, wie die Nächte dieses Paares verliefen. Er schnarchte, sie warf sich schlaflos herum. Jedes Mal wenn sie gerade am Einnicken war, fing er wieder an. Irgendwann würde sie ihn fragen, ob er sich vorstellen könne, im Gästezimmer zu schlafen, und er wäre empört.
Du liebst mich also nicht mehr!
Aber ich kann neben dir nicht schlafen!
Andere Frauen halten das auch aus, du bist einfach zu empfindlich.
Viele Frauen leiden darunter, dass ihre Männer schnarchen.
Eine Ehe ohne gemeinsames Schlafzimmer ist keine Ehe.
Kein Wunder, dass Frauen schneller altern als Männer, dachte Petra. Erst können sie nicht schlafen, weil sie sich um ihre Neugeborenen kümmern müssen. Dann können sie nicht schlafen, weil sie sich Sorgen um ihre Pubertierenden machen, die nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause kommen. Und schließlich können sie nicht schlafen, weil ihre Männer – die in all den Jahren über sämtliche Störungen selig hinweggeschlafen haben – zu schnarchen beginnen.
Es hatte ihr große Bauchschmerzen bereitet, Matthias um getrennte Schlafzimmer zu bitten. Schließlich wollte sie ihn nicht verletzen. Alle ihre Freundinnen mit schnarchenden Männern (also alle mit Männern) hatten sie vorgewarnt. Zu ihrer Überraschung hatte Matthias sofort eingewilligt und war widerspruchslos in Evas Zimmer gezogen, die gerade ihr Studium in einer anderen Stadt begonnen hatte. Damit war er der einzige Mann in ihrem Freundeskreis, der aus dem Thema Ehebett keine Grundsatzfrage gemacht hatte. Zuerst war sie erleichtert gewesen, aber inzwischen fragte sie sich, ob das wirklich ein gutes Zeichen war.
Mit seinem Auszug aus dem ehelichen Schlafzimmer war ihre Sexualfrequenz drastisch gesunken. Fast so, als hätten sie zuvor nur miteinander geschlafen, weil es so einfach gewesen war. Weil es genügt hatte, die Hand auf die andere Bettseite zu schieben, um Bereitschaft zu signalisieren. Nun schien es, dass der Gang von einem Zimmer ins andere ein fast unzumutbarer Aufwand war.
Nicht dass es Petra viel ausgemacht hätte. Sie hatte schon seit Jahren nicht mehr sonderlich viel Lust auf Sex. Meistens war sie einfach zu müde nach diesen übervollen Tagen, die morgens um halb sieben begannen und abends um elf endeten. Tagen, an denen sie kaum eine Minute Zeit für sich fand zwischen Unterricht, Lehrerkonferenzen, Heftkorrekturen, Einkaufen, Kochen, Hausaufgabenbetreuung, Aufräumen, Waschen und Putzen.
Aber das abendliche Kuscheln, die körperliche Nähe, der Kuss vor dem Einschlafen – das alles fehlte ihr. Und sie war gekränkt über die Leichtigkeit, mit der Matthias auf dieses langjährige Ritual verzichtete. Er hatte sich in sein eigenes Reich zurückgezogen, als hätte er nur auf die Gelegenheit gewartet.
Matthias ging morgens aus dem Haus und kam abends spät wieder, wenn er nicht ohnehin auf Geschäftsreise war. Was in der Zwischenzeit zu Hause los war, interessierte ihn nicht besonders. Aufgabenteilung nannte er das.
Wenn sie darüber diskutieren wollte, breitete er die Arme aus und sagte gönnerhaft: »Wir können gern tauschen. Ich reduziere auf halbtags und übernehme den Haushalt, und du arbeitest Vollzeit.« Damit war das Thema durch. Ihr Gehalt als Lehrerin betrug nur einen Bruchteil von seinem, sie würden kaum davon leben können.
Wenn sie die Weiterbildung machen könnte, die ihr angeboten worden war, sähe die Sache allerdings bald anders aus. Dann würde sie in zwei, drei Jahren Schulleiterin sein und deutlich mehr verdienen als heute. Aber das hieße, dass Matthias für diese Zeit im Job zurückstecken müsste. Deshalb: keine Weiterbildung, kein Schulleiterposten.
Beim Gedanken daran stieg eine Hitzewelle in ihr hoch und breitete sich in ihrem Körper aus. Sie riss sich die Strickjacke herunter und fächelte sich Luft zu. Das kam in letzter Zeit häufiger vor, offenbar bahnte sich bei ihr der Wechsel an. Sie war sechsundvierzig. Doppelt so alt wie ihre ältere Tochter, die ihr die T-Shirts aus dem Schrank klaute, gemeinsam mit ihr zu Popkonzerten ging und ihr damit die Illusion verschaffte, selbst noch jung zu sein.
Die Vorstellung, nicht mehr fruchtbar zu sein, machte ihr nichts aus. Aber als Frau nicht mehr wahrgenommen zu werden, das tat weh. Die Männer begannen durch sie hindurchzusehen, als wäre sie nicht vorhanden, vor allem wenn sie mit ihren Töchtern unterwegs war. Gerade neulich hatte sie es erlebt: Sie war mit Eva in einem Café verabredet und wie immer als Erste da gewesen. Zehn Minuten lang hatte sie versucht, den Kellner auf sich aufmerksam zu machen – keine Chance. In der Sekunde, in der Eva sich neben sie gesetzt hatte, stand der Kerl am Tisch, saugte sich mit seinem Blick an ihrer Tochter fest und fragte mit umwerfendem Lächeln: »Was kann ich für euch tun?«
Fast hätte sie ihm gesagt, er könne sich zum Teufel scheren. Aber dann hatte sie einen Cappuccino und ein Tiramisu bestellt und sich mit dem Gedanken getröstet, dass sie – wenn Männer sie sowieso nicht mehr sahen – ab jetzt wenigstens essen würde, worauf sie Lust hatte. Es war dann allerdings Eva gewesen, die sich den größten Teil einverleibt hatte. Eva konnte essen, was und so viel sie wollte, während Petra ein Tiramisu nicht mal ansehen konnte, ohne zuzunehmen. Es war einfach ungerecht.
»Wir haben unsere Reiseflughöhe verlassen und befinden uns im Landeanflug. Bitte kehren Sie zu Ihren Sitzen zurück, klappen Sie die Tische hoch und bringen Sie Ihre Lehne in eine aufrechte Position.«
Petra schrak auf, sie musste eingenickt sein. Kurz fragte sie sich, warum sie in einem Flugzeug saß und wohin sie unterwegs war, dann fiel es ihr wieder ein. Sie war auf dem Weg ins Paradies.
Matthias hatte sie mit der Reise überrascht, und sie war glücklich gewesen. Das erste Mal seit Jahren würden sie wieder zu zweit wegfahren! Aber eines Abends war er nach Hause gekommen und hatte ihr mitgeteilt, dass er nicht mitkommen könne, in seiner Firma gehe es drunter und drüber. In letzter Zeit schien er viel beruflichen Stress zu haben, war oft angespannt und nervös. Also versuchte sie, so rücksichtsvoll wie möglich zu sein.
Matthias hatte nach dem Studium eine Beratungsfirma gegründet. Er und seine Mitarbeiter erklärten den Managern großer Firmen, wie sie noch mehr Leistung aus ihren Mitarbeitern rausholen konnten oder wie man ihnen am besten schlechte Nachrichten beibrachte: dass die Firma ans andere Ende der Stadt umziehen und der Weg zur Arbeit für die meisten deutlich länger werden würde; dass es Umstrukturierungen geben würde – eine freundliche Umschreibung dafür, dass am Ende die meisten Mitarbeiter etwas machen müssten, wozu sie keine Lust hatten; oder dass sie leider gefeuert würden. Ach, nein: freigestellt.
Ausgerechnet Matthias, der bei Streit verstummte oder das Weite suchte, der kaum über seine Gefühle sprechen konnte und das, was ihn beschäftigte, mit sich selbst ausmachte – ausgerechnet dieser Mann brachte anderen bei, besser zu kommunizieren. Und offenbar machte er es gut, denn seine Firma war erfolgreich. Es war zum Lachen.
Petra hatte ihr Studium, Deutsch und Sozialkunde für Lehramt, trotz der Kinder zu Ende gebracht. Nach einer längeren Pause arbeitete sie seit einigen Jahren wieder, wenn auch nicht Vollzeit. Oft wurde sie als Schwangerschaftsvertretung eingesetzt, zusätzlich gab sie Deutschunterricht in einer Übergangsklasse für junge Migranten. Sie liebte ihren Beruf, aber im Moment konnte sie Erholung wirklich gut gebrauchen.
Das Flugzeug befand sich im Sinkflug, nur noch wenige Minuten bis zur Landung. Plötzlich wurde sie ganz aufgeregt. Wie würden die anderen Teilnehmer sein? Die Gruppen seien nicht größer als zwanzig Personen, hatte der Veranstalter versprochen. Petra fand das ganz schön viel, immerhin die Größe einer Schulklasse.
Hoffentlich hatte sie eine nette Zimmergenossin. Man konnte zwischen Einzel- und Doppelzimmer wählen, und als klar war, dass sie allein reisen würde, hatte sie sich für ein Doppelzimmer entschieden. Sie war noch nie allein verreist und fürchtete, keinen Anschluss zu finden. Außerdem war die Reise schon teuer genug.
Die Rollbahn kam in Sicht, und die ersten Palmen tauchten in der Ferne auf. Ihr Herz machte einen glücklichen Hüpfer. Palmen! Sonne! Meer!
Das übliche Gedränge begann. Alle versuchten, sich auf den Gang zu schieben, obwohl die Türen noch gar nicht geöffnet waren. Petra blieb sitzen, sie hatte keine Eile. Sobald sie ihren Koffer hätte, würde sie sich nach dem Bus zum Hafen erkundigen. Hoffentlich würde ihr jemand Auskunft geben können, obwohl sie kein Spanisch konnte. Das Paradies befand sich auf einer nahe gelegenen Insel, daher stand ihr noch eine einstündige Überfahrt mit dem Schiff bevor, auf die sie sich schon freute.
In die Gruppe am Strand kommt Bewegung. Diejenigen, die am Boden hocken, springen erwartungsvoll auf, das Fernglas wird nach oben gerissen, Arme deuten in Richtung Boot, wo sich das Seil unaufhaltsam aus seiner ordentlichen Achterform löst, durch die Hände des Seilführers rast und in der Tiefe verschwindet, bis es zum Stillstand gekommen ist.
Die Polizisten werden unruhig, das Schnarren ihrer Funkgeräte ist das einzige Geräusch, das die Stille durchschneidet.
Der Seilführer und der Mann am Steuer blicken konzentriert auf die Stelle, an der das Seil die Wasseroberfläche durchschneidet und man ihm noch einige Meter mit dem Blick folgen kann. Ein Daumen zeigt in die Höhe.
»Er ist unten.«
Nach einer Weile wandert das Seil ein Stück vom Boot weg, kommt näher und entfernt sich wieder, eine kontinuierliche Zickzackbewegung, mit der die Suche am Meeresboden vonstattengeht.
Die Gruppe am Strand wirkt inzwischen wie erlahmt. Fast bewegungslos kauern die Leute am Boden, starren aufs Wasser. Die Sonne steigt höher, es wird immer heißer. Schweißperlen auf Stirnen und Oberlippen, vergebliches Umherblicken auf der Suche nach Schatten. Eine halb volle Plastikflasche mit Wasser macht die Runde. Eine Frau lässt sich in den Sand fallen, verbirgt das Gesicht in den Händen, weint. Ein Sanitäter kommt aus Richtung des Krankenwagens, spricht mit der Frau, deutet auf den Krankenwagen.
Nach einigen Minuten ein kräftiges Rucken am Seil, der Taucher kommt an die Oberfläche. Er nimmt das Mundstück heraus, schiebt die Maske hoch, schüttelt den Kopf.
Er klettert an Bord, nimmt die Flasche ab.
Die Männer beraten. Schließlich werden Seil und Anker eingeholt. Der Bootsführer startet den Motor und bringt das Boot vorsichtig mehr nach rechts und noch näher ans Ufer, so nah an das Felsmassiv wie nur möglich. Er ankert erneut, wirft einen Blick aufs Display.
»Immer noch zehn Meter.«
Der Taucher macht sich wieder bereit, gleich darauf verschwindet er erneut in der Tiefe.
Die Atmosphäre am Ufer ist zum Zerreißen gespannt. Die Frauen sitzen zusammen, trösten sich gegenseitig. Die Männer stehen einzeln herum, scharren mit den Zehen im Sand oder ziehen abwesend an ihren Zigaretten. Keiner blickt den anderen an, als könnte jeder Blick etwas verraten, was besser ungesagt bliebe.
Auf dem Boot wischen sich die Männer den Schweiß von der Stirn. Der Seilführer zieht einmal kurz am Seil, ein kurzes, zweimaliges Rucken ist die Antwort. Wieder vergehen einige Minuten.
Plötzlich scheint das Seil lebendig zu werden, es tanzt hin und her, zweimal, dreimal. Die Männer halten die Luft an und blicken ins Wasser. Luftblasen steigen auf, unter der Wasseroberfläche wird etwas sichtbar, etwas Dunkles und etwas Helles, das zusammenzugehören scheint. Als es höher steigt, zeichnet sich ein Körper ab, um den weißer Stoff wabert. Ein zauberhaftes, unbekanntes Meerestier.
In die Gruppe kommt Bewegung, alle springen auf, recken den Kopf, versuchen, etwas zu erkennen. Die Polizisten verlassen ihren Wagen und nähern sich dem Ufer, die Sanitäter folgen ihnen. Alle starren über das glitzernde Wasser, hinüber zu dem dümpelnden Boot.
Der Taucher hebt den Körper scheinbar mühelos aus dem Wasser, die Männer auf dem Boot packen ihn und ziehen ihn hinein. Der weiße Stoff fällt in sich zusammen und schmiegt sich um den Körper der toten Frau.
Anka
Je weiter sich das Schiff vom Festland entfernte, desto besser fühlte sie sich. Nur weg, hatte es während der letzten Wochen in ihr getönt, und endlich war sie unterwegs, mehr auf der Flucht als im Urlaub. Sie stellte sich an die Reling und starrte in den schaumigen Streifen, den das Schiff hinter sich zurückließ. Die Häuser an der Küste wurden kleiner, bald war nur noch eine verschwommene Linie im Dunst zu erkennen. Sonst nur Wasser, wohin sie blickte.
Wie war es ihr bloß gelungen, ihr Leben derartig in die Scheiße zu fahren?
Sie war sechsunddreißig und hatte nichts von dem erreicht, was sie sich vorgenommen hatte. Beruflich war sie in einer Sackgasse gelandet. Aus den angeblich tollen Aufstiegschancen in der Firma für Biokosmetik, in der sie sich seit Jahren abrackerte, war nichts geworden. Immer noch stand auf ihrer Visitenkarte Regionalleiterin/Direktvertrieb, was im Klartext hieß, dass sie als Vertreterin durch die Gegend reiste, um ihren Kunden Produkte zu verkaufen, die sie ebenso gut im Internet bestellen konnten. Das war auch der Grund, warum es der Firma schlecht ging. Die Eigentümer, zwei Brüder namens Hartmann, hatten die Entwicklungen des E-Commerce nicht verschlafen, sondern bewusst ignoriert. Der persönliche Kontakt zum Kunden ist durch nichts zu ersetzen, so der gebetsmühlenartig wiederholte Glaubenssatz der Hartmänner. Blöd nur, dass die Kunden das anders sahen.
Ihre Mutter war begeistert gewesen, als sie den Job bekommen hatte. Immer wieder hatte sie von der Avon-Beraterin erzählt, die früher zu ihnen nach Hause gekommen war und ihnen all die wundervollen Cremes und Lotionen präsentiert hatte. Anka betonte gern, dass sie nicht für einen großen Konzern tätig sei, sondern Produkte vertreibe, für deren Herstellung keine Tiere gequält würden und deren Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau stammten. Sie selbst verwendete die Produkte allerdings nicht. Sie glaubte an die Wirkung von Chemie, nicht an die der Natur. Aber bio lag im Trend. Hatte sie wenigstens gedacht. Nun zeigte sich, dass sie besser bei einem Großkonzern angeheuert hätte als bei dem kleinen, feinen Unternehmen, das vor lauter Idealismus kurz vor der Pleite stand. Sie hoffte, die Eigentümer würden das Steuer noch herumreißen können.
Die Frage war, wie weit sie als Einzelhandelskauffrau überhaupt kommen konnte. Wieso hatte sie nicht wenigstens studiert? Immerhin hatte sie das Fachabitur. Aber ihr war es wichtiger gewesen, möglichst schnell Geld zu verdienen, damals, als sie jung war und gedacht hatte, das Wichtigste seien tolle Klamotten, schicke Autos und wilde Nächte in exklusiven Clubs.
Der Bekanntenkreis, den sie sich in jener Zeit aufgebaut hatte, war längst in alle Winde verstreut. Die Frauen waren verheiratet und interessierten sich nur noch für ihren Nachwuchs, die Männer waren mit ihren Karrieren beschäftigt. Durch Ankas ständige Reiserei fiel es ihr schwer, Freundschaften zu pflegen, und so saß sie an ihren freien Abenden und Wochenenden meist allein zu Hause. Auch aus ihrem Traum von einer Familie war nichts geworden. Mit untrüglichem Instinkt suchte sie sich unter allen Männern, die frei herumliefen, immer die Nieten aus.
Mit Anfang zwanzig hatte sie sich in Harry verliebt, der sie mit Geschenken überschüttet und wie eine wertvolle Trophäe in seinem Sportcabrio herumgefahren hatte. Als er eines Tages plötzlich pleite gewesen war, hatte sie herausgefunden, dass er an Spielsucht litt.
Dann war Anton gekommen, ein Unternehmersohn, der sie angebetet und auf Händen getragen hatte. Leider besaß er eine Neigung zur Zwanghaftigkeit und faltete vor dem Zubettgehen nicht nur seine Hose auf Bügelkante, sondern saugte mit dem Handstaubsauger das Laken ab. Ein Leben mit ihm konnte sie sich, trotz aller materiellen Vorzüge, nicht vorstellen.
Auf Anton folgte Mike. Bei ihm hatte einfach alles gestimmt. Er war erfolgreicher Manager in einem Elektronikkonzern und auf dem Weg in den Unternehmensvorstand. Völlig überraschend hatte ihn seine langjährige Freundin verlassen, und wie die meisten Männer ertrug er es nur schwer, allein zu sein, weshalb er alles daransetzte, diesen Zustand schnellstmöglich zu beenden. Dass eine so attraktive Frau wie Anka auf sein Werben einging, war Balsam für seine gekränkte Seele. Es dauerte nicht lange, bis er ihr einen Heiratsantrag machte. Er wünschte sich eine Familie und war zu Ankas Entzücken der Meinung, eine Mutter müsse nicht sofort in den Beruf zurückkehren, sondern solle sich erst einmal um die Kinder kümmern. Später sei, wenn überhaupt, immer noch Zeit für eine Karriere.
Als Hochzeitsreise hatte sie sich eine Kreuzfahrt und eine Woche in einem Fünfsterneresort auf den Malediven gewünscht – schließlich heiratet man nur ein Mal im Leben! Sie hatte den Luxus in vollen Zügen genossen und gespürt, dass sie endlich den richtigen Mann gefunden hatte. Einen, der sie wirklich liebte, der sie zu schätzen wusste und glücklich machen wollte. Nichts schien ihm zu teuer zu sein, und wann immer sie einen Wunsch äußerte, erfüllte er ihn ihr.
Sie wollte so schnell wie möglich schwanger werden, aber schon während der Flitterwochen zeigte Mike immer weniger Interesse an Sex. Sie tat alles, um ihm zu gefallen und ihn anzutörnen, aber er zog sich immer mehr in sich selbst zurück. Sie hatte die schlimmsten Vermutungen – dass er krank sein könnte, dass seine Exfreundin sich wieder gemeldet hatte, dass es Probleme in der Firma gab –, aber er weihte sie nicht in die Gründe für sein Verhalten ein.
Wenige Monate nach der Hochzeitsreise eröffnete er ihr, dass er sie verlassen würde. Ihre Fixierung auf Luxus sei krankhaft, ihre materiellen Erwartungen seien so groß, dass er Angst habe, sie auf Dauer nicht erfüllen zu können. Er wolle nicht enden wie Ankas Vater, der sich nicht nur für die Hochzeit finanziell auf unverantwortliche Weise übernommen habe, um den Ansprüchen seiner Tochter zu genügen.
Sie war erschüttert gewesen. So schlecht dachte Mike über sie, nur weil sie Freude an schönen Dingen hatte? Wofür verdiente man denn Geld, wenn nicht dafür, sich das Leben angenehm zu gestalten? Ihre Fähigkeit, genießen zu können, hatte sie immer als positive Eigenschaft gesehen, und nun wurde sie ihr so negativ ausgelegt! Dass Mike ihren Vater als Kronzeugen für ihre angebliche Verschwendungssucht benannte, fand sie unerhört. Ihr Vater hatte schon immer alles getan, um sie glücklich zu machen. Aber war das nicht normal, wenn man seine Tochter liebte?
All ihre Versuche, Mike umzustimmen, waren gescheitert. Mit zwei Koffern hatte sie die tolle, teure Wohnung verlassen, die sie gemeinsam eingerichtet hatten, war in ein Zweizimmerapartment gezogen und hatte das Nötigste bei Ikea gekauft.
Dann war sie krank geworden. Nesselfieber. Gastritis. Unerklärliche Kopfschmerzen. Ihrer Verwandtschaft und ihren Kollegen hatte sie erklärt, Mike habe sich auf der Hochzeitsreise als bisexuell geoutet und ihr angekündigt, neben der Ehe sexuelle Beziehungen mit Männern führen zu wollen. Das sei eine unerträgliche Vorstellung für sie gewesen. Alle waren voller Mitgefühl und höchst empört über Mike. Ein Heiratsschwindler sei er, ein gewissenloser Betrüger, der Ankas Leben zerstört habe. Das Mitleid und die Anteilnahme ihrer Mitmenschen waren wie ein warmes Bad, das ihren Schmerz ein wenig gelindert hatte.
Die Hochzeit hatte tatsächlich ein Vermögen gekostet. Ankas Vater hatte extra einen Kredit dafür aufgenommen, damit er seiner einzigen Tochter ein Fest ausrichten konnte, das sich ungefähr so prächtig ausnahm wie eine Hochzeit im englischen Königshaus. Weiß eingedeckte Tische mit Rosenschmuck im teuersten Hotel der Stadt, Fünf-Gänge-Menü, Champagner bis zum Abwinken, eine Liveband, ein Zauberer. Natürlich hatte ihr das gefallen.
Allein ihr Kleid hatte zweieinhalbtausend Euro gekostet. Glücklicherweise hatte sie es bei E-Bay für tausend Euro losbekommen, die sie ihrem Vater zurückgegeben hatte. Trotzdem würde er nun mit seinem geringen Handwerkergehalt jahrelang Schulden abbezahlen und bei jeder Abbuchung daran erinnert werden, welche Enttäuschung sein Kind ihm zugefügt hatte. »Das weiß man doch, ob einer schwul ist!«, hatte er immer wieder verzweifelt ausgerufen. »Das hättest du doch merken müssen!«
Ihr Versuch, der Scheidung zuvorzukommen und die Ehe wegen des Verschweigens bisexueller Neigungen seitens des Ehemannes annullieren zu lassen, war gescheitert. Es hatte keine Beweise und keine Zeugen für ihre Behauptung gegeben, und so war nach Ablauf des Trennungsjahres die Scheidung vollzogen worden. Aufgrund der kurzen Ehedauer hatte der Familienrichter keinen Anspruch auf Unterhalt anerkannt.
Nach dem Termin waren Mike und sie aus dem Gerichtsgebäude gegangen, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Am Fuß der breiten Treppe hatte die Exfreundin von Mike gewartet. »Du Dreckstück«, hatte sie Anka angezischt und vor ihr ausgespuckt.
»Soll ich Anzeige erstatten?«, hatte ihr Anwalt interessiert gefragt, aber Anka hatte nur geschluckt und den Kopf geschüttelt.
Sie wusste, wie mies es war, Mike diese Geschichte anzudichten, aber andererseits, was hätte sie ihrer Familie sagen sollen? Dass er sie für eine verwöhnte Prinzessin hielt, die den Hals nicht vollkriegen konnte? Immer noch, fast zwei Jahre nach dem Scheidungstermin, kränkte es sie zutiefst, dass er zu dieser Einschätzung gekommen war.
Nach all dem Mist, den sie seither mit Männern erlebt hatte (die frustrierenden One-Night-Stands und Affären gar nicht mitgerechnet), und in einem Alter, in dem ihre biologische Uhr nicht tickte, sondern ohrenbetäubende Gongschläge von sich gab, hatte sie es tatsächlich geschafft, erneut danebenzugreifen: Sie hatte sich in einen verheirateten Mann verliebt.
Und so saß sie an ihren freien Abenden und Wochenenden allein zu Hause und wartete. Dass er eine Nachricht schicken würde. Vielleicht sogar anrief. Oder, wie durch ein Wunder, plötzlich vor der Tür stand (was noch nie passiert war). Die Warterei war demütigend, zerrte an ihren Nerven und ließ sie zu einer Person werden, die sie nicht sein wollte: abhängig, schwach, bedürftig. Und das machte sie wütend. Während er zu Hause bei seiner Familie saß, sich von seiner Frau bekochen und von seinen Kindern anhimmeln ließ (zumindest stellte sie sich das so vor), hockte sie herum, außerstande, an etwas anderes als an ihn zu denken, unfähig, etwas mit sich und ihrer Zeit anzufangen.
Am meisten graute ihr vor Feiertagen und Ferien. Dann stürzte sie sich in verzweifelte Aktivitäten, die sie sich eigentlich nicht leisten konnte. Skifahren, Drachenfliegen, Kitesurfen – Hauptsache, sie war abgelenkt. Einmal hatte sie sich beim Snowboarden den rechten Arm gebrochen und sich danach wochenlang gequält, weil sie nicht schlafen konnte und alles so anstrengend und kompliziert war. Heulend saß sie auf dem Klo, weil sie es kaum schaffte, sich den Hintern abzuwischen (man ahnt ja nicht, wie ungeschickt Rechtshänder mit der linken Hand sind).
In dieser Zeit hatte ihr Freund komischerweise kaum Zeit für sie gehabt. Einmal nur hatten sie sich getroffen und waren zum Essen gegangen. Aber als ihm klar geworden war, dass sie keine Lust auf Sex hatte, war er sauer abgefahren und hatte sich zwei Wochen nicht mehr gemeldet.
Anka wusste, dass ihr die Zeit davonlief. Sie wollte ein Kind. Nein, das stimmte nicht. Sie wollte einen Mann und ein Kind. Mit Entsetzen beobachtete sie die alleinerziehenden Mütter in ihrer Umgebung, die ständig angestrengt und gehetzt wirkten, die mit hohen, gepressten Stimmen sagten: »So, Mäuschen, und nun komm bitte zu Mama, wir müssen noch …«, und das Kind ungeduldig von seinem Spiel wegrissen, weil niemand da war, der es betreuen könnte, während sie verzweifelt versuchten, ihr Leben im Griff zu behalten.
Nein, eine solche Mutter wollte Anka nicht sein, das wollte sie ihrem Kind nicht antun. Außerdem ahnte sie, dass ihr Vater ihr den ersten, missglückten Eheversuch nur verzeihen würde, wenn sie es doch noch fertigbrachte, einen Mann zu finden und Kinder zu bekommen, »wie jede normale Frau«.
Am Anfang ihrer Affäre mit Jo war sie noch zuversichtlich gewesen, dass alles gut ausginge und es nur eine Frage der Zeit wäre, bis er sich für sie entscheiden würde. Deshalb hatte sie nur gehört, was sie hören wollte, und seinen Versprechungen bereitwillig geglaubt.
Unsere Ehe ist eigentlich am Ende, aber ich muss Rücksicht auf die Kinder nehmen …
Im Moment geht es meiner Frau nicht gut, ich muss warten, bis sie es verkraften kann …
Ich habe gerade Probleme im Job, da habe ich einfach die Nerven nicht. Gib mir ein bisschen Zeit …
Irgendwann wurde ihr klar, dass sie sich trennen müsste, wenn sie nicht jede Selbstachtung verlieren wollte. Massenhaft E-Mails hatte sie geschrieben, in denen sie mit ihm Schluss machte, keine davon hatte sie abgeschickt. Vor jedem Treffen nahm sie sich vor, ihm die Pistole auf die Brust zu setzen: deine Frau oder ich.
Aber dann wollte sie die kostbare gemeinsame Zeit mit ihm nicht verderben. Und irgendwo in ihr schlummerte die Überzeugung, dass sie am Ende bekommen würde, was sie wollte. Schließlich war unübersehbar, wie verrückt er nach ihr war. Er machte ihr Geschenke, lud sie in exquisite Restaurants und Hotels ein und zeigte ihr so immer wieder, wie viel sie ihm bedeutete.
Wenn sie miteinander schliefen, waren sowieso alle Zweifel vergessen. Mit wilder Leidenschaft stürzte er sich auf sie, nahm Besitz von ihrem Körper, flüsterte ihr heiser ins Ohr, wie schön sie sei, wie erotisch, wie unwiderstehlich. Es schien, als wäre die elende Warterei nur ein wiederkehrender böser Traum, aus dem sie erst erwachte, wenn er das nächste Mal vor der Tür stand. Dann war sie lebendig, fühlte sich bewundert und begehrt. Diese Stunden entschädigten sie für alles, und es kam ihr so vor, als wäre der Preis dafür nicht zu hoch.
Kaum war er weg, kam die Wut zurück. Auf ihn, weil er sie hinhielt, und auf sich, weil sie immer wieder schwach wurde. Nur eine einzige Freundin hatte sie in ihr Liebesschlamassel eingeweiht (sehr viel mehr Freundinnen hatte sie ja auch nicht), und die riet ihr, sich sofort zu trennen. Erst dann würde ihrem Liebhaber klar werden, was er an ihr hätte. Und wenn nicht, sollte sie den Qualen ein Ende machen und sich nicht weiter vertrösten lassen.
»Für Männer ist das eine bequeme Angelegenheit«, sagte die Freundin. »Im Alltag die Ehefrau, zum Vögeln die Geliebte. Und immer eine gute Ausrede, wenn sie keine Lust mehr haben und sich abseilen wollen.«
»Bei ihm ist es anders«, verteidigte Anka ihren Freund. »Er will sich ja trennen. Aber die Kinder sind noch zu klein, und seiner Frau geht’s nicht gut. Außerdem hat er gerade solchen Stress in der Arbeit. Ich bin sicher, es ist nur eine Frage der Zeit …«
»Träum weiter«, sagte ihre Freundin.
Und das tat sie.
Seit fast einem Jahr ging das so, und wenn sie ehrlich zu sich war, musste sie sich eingestehen, dass sie ihrem Ziel keinen Millimeter näher gekommen war. Es lief so, wie es von Anfang an zwischen ihnen gelaufen war. Er bestimmte, wann und wo sie sich trafen, seine Versprechungen und Erklärungen waren immer die gleichen, und manchmal beschlich sie der Verdacht, dass sie doch nur eines dieser bescheuerten Weiber war, die sich von einem Typen ewig einwickeln ließen und entsorgt wurden, wenn sie zu viel Theater machten.
Was für eine Genugtuung es gewesen war, als sie ihm erzählt hatte, dass sie für eine Woche wegfahren würde! Immer wieder hatte sie ihn angefleht, mal mit ihr zu verreisen, wenigstens für ein paar Tage. Nie hatte er es möglich gemacht.
»Aber genau in der Woche wollte ich mir Zeit für uns nehmen«, hatte er behauptet. Einen winzigen Augenblick lang war sie versucht gewesen, ihren Urlaub zu stornieren. Doch dann hatte sie es tatsächlich geschafft zu sagen: »Tja, das ist wirklich schade.« Und nach einem Atemzug hatte sie noch einen draufgesetzt und behauptet, sie sei von einem alten Freund in dessen Ferienhaus nach Spanien eingeladen, zusammen mit einer Gruppe netter Leute. Das klang interessanter als Wellnessurlaub allein. Sollte er sich ruhig fragen, wer dieser alte Freund war.
Ein Tuten ertönte, die Insel kam in Sicht. Anka ging auf die andere Seite des Decks, um besser sehen zu können. Sie seufzte. Eine Woche Ruhe, ein bisschen inneren Frieden finden. Gönn dir was, wenn es sonst schon keiner tut, sagte sie sich. Sie hatte Schulden gemacht, um sich den Urlaub leisten zu können.
Ihr war ein bisschen flau im Magen. Hoffentlich wurde sie nicht seekrank. Tief atmete sie die frische Meeresbrise ein.
Mit einem Mal bemerkte sie die junge Frau, die neben ihr stand. Blondes Strubbelhaar, wache blaue Augen in einem hübschen Gesicht, ein bisschen blass vielleicht.
Suse
»Gehörst du auch zur Gruppe?«, fragte Suse die Frau, die so melancholisch ins Meer starrte. Die musste ja voll den Blues haben. Hoffentlich waren die nicht alle so drauf.
Die Frau blickte verwirrt. »Welche Gruppe?«
»Na, die Burn-out-Muttis auf dem Weg zu sich selbst«, sagte Suse grinsend und streckte die Hand aus. »Suse.«
»Anka«, sagte die Frau, nahm ihre Hand und stellte klar: »Nee, dazu gehöre ich nicht.«
»Bist du nicht im Hotel Paraíso?«
»Doch, schon.«
»Na bitte. Wer bucht denn sonst einen Wellnessurlaub?«
Die Frau guckte entsetzt. »Sehe ich aus wie eine … wie hast du das genannt … Burn-out-Mutti?«
»Nein, keine Sorge.« Suse lächelte beruhigend. »Du siehst super aus!«
Die Frau sah wirklich verdammt gut aus. Sie selbst dagegen zurzeit echt beschissen. Zu blass, zu mager, Ringe unter den Augen. Ein echtes Wrack.
Anka schien Komplimente gewohnt zu sein. »Danke«, sagte sie so beiläufig, als würde sie so etwas jeden Tag hören. »Bist du denn eine von denen?«
»Burn-out ja, Mutti nein«, fasste Suse ihren Zustand zusammen. Wobei, Burn-out fand sie schon ganz schön übertrieben. Sie hatte gelacht, als der Arzt den Begriff verwendet hatte. So was kriegten doch nur Manager oder Politiker. Nicht Leute wie sie, die einfach ihre Arbeit machten.
Klar, sie wuppte ihren Job in der Unterkunft mit großem Einsatz, leistete Überstunden, die sie nie bezahlt bekam, und fragte nicht lange, wenn Not am Mann war, sondern packte einfach an. Als sie neulich umgekippt war, hatten sich alle ganz schön erschrocken. Sie selbst auch. Das kannte sie nicht von sich, dass sie schlappmachte, sie war doch kein Weichei. Noch nie hatte sie sich krankschreiben lassen. Und jetzt hieß es: erholen. Dafür sorgen, dass sie wieder auf die Beine kam. Sie wurde schließlich gebraucht.
Ihre Oma hatte ihr die Reise geschenkt. Suse war entsetzt gewesen, als sie gesehen hatte, was die Woche kostete. »Du sollst doch nicht so viel Geld für mich ausgeben«, hatte sie protestiert.
»Nichts da, du brauchst das jetzt«, hatte ihre Oma energisch erklärt. »Außerdem sterbe ich bald, dann erbst du das Geld sowieso.«
»Quatsch, Oma, du und sterben!«, hatte Suse widersprochen. »Du wirst mindestens hundert.« Ihre Oma war wie sie. Nicht totzukriegen.
Aber eine kleine Pause war wohl wirklich nicht schlecht. Bisschen Sonne tanken vor dem Winter, noch mal ins Meer springen, lecker essen und auf der Yogamatte rumliegen und sich wichtig fühlen. Was stand in dem Prospekt? Hier zählen nur Sie!
Das hatte es in ihrem Leben bisher selten gegeben, dass nur sie zählte. Meistens zählten die anderen, und zwar auf sie. Dass sie da war, dass sie stark war. Suse, der Kumpel, die Unverwüstliche, auf die man sich verlassen konnte.
War ja auch kein Wunder, wenn man als Älteste in einer Familie mit drei kleineren Geschwistern aufgewachsen ist und die Mutter stirbt, kaum dass man sechzehn ist. Wenn der Vater seinen Kummer im Alkohol ersäuft und die Oma der einzig zurechnungsfähige Mensch in der näheren Umgebung ist. Da kann es schon mal vorkommen, dass man selbst nicht so viel zählt, sondern mehr so das große Ganze.
Aber sie hatte es geschafft. Ihr Vater wurde in einem Heim versorgt, seit er sich den letzten Rest Verstand aus dem Hirn gesoffen hatte. Ihre Geschwister waren erwachsen und machten alle was Vernünftiges. Keiner von ihnen hatte angefangen zu trinken. Und sie hatte Abi gemacht und studiert.
Seit drei Jahren arbeitete sie als Sozialarbeiterin in einer großen Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand, wo sie für die Neuankömmlinge zuständig war. Für Männer, die alles verloren hatten außer ihrem Leben. Für Frauen, die durch die Schrecken der Flucht verstummt waren. Für Kinder, die mit offenen, entzündeten Füßen ankamen und nicht wussten, was sie mit dem Spielzeug anfangen sollten, das ihnen jemand in die Hand drückte.
Längst hatte Suse aufgehört mitzuleiden, sonst hätte sie den Job nicht machen können. Sie hatte sich darauf verlegt zu funktionieren. Bis zum Umfallen.
Ihre Oma hatte gesagt, es sei sehr aufschlussreich, dass Benni sie gerade jetzt verlassen habe. Und dass man einen Menschen erst richtig kennenlernt, wenn es mal nicht so gut läuft. Dass die meisten Männer nicht gut mit Krisen umgehen könnten. Suses Vater sei das beste Beispiel dafür. Sie solle Benni um Gottes willen vergessen und sich jemanden suchen, der zu ihr hielt, wenn es drauf ankam.
Benni hatte es nicht mal hingekriegt, sie anzurufen, um mit ihr Schluss zu machen. Es war ja auch viel leichter, eine Whatsapp zu schicken.
Bin eine Weile weg, gehe auf Tour mit der Band. Hoffe, bei dir ist bald alles wieder cool. So long, Benni
Hatte ganz schön reingehauen, so abserviert zu werden. Immerhin waren sie ein Dreivierteljahr zusammen gewesen. Benni war eigentlich ein guter Typ, krass kreativ und voller verrückter Ideen, außerdem echt schön mit seinen grünen Augen und dem dunklen Bart. Er hatte was Geheimnisvolles an sich, das sie faszinierte, aber so richtig nahe war sie ihm nie gekommen. Außer beim Sex vielleicht. Da war die Distanz, die sie sonst gespürt hatte, plötzlich weg gewesen. Aber womöglich hatte sie sich das auch nur eingebildet.
Sie hatte ja sowieso keine Lust, sich schon zu binden. Sie war noch jung, erst achtundzwanzig. Na ja, so jung war das vielleicht gar nicht mehr. Die ersten Paare aus ihrem Bekanntenkreis kriegten jetzt Kinder und benahmen sich, als stünden sie unter Drogen. Völlig balla in der Birne. Wahrscheinlich waren es die Hormone. Oder der Schlafentzug. Jedenfalls konnte man mit keinem mehr vernünftig reden. Es war, als hätten sie sich in ein Paralleluniversum verabschiedet, aus dem sie erst mit Volljährigkeit der Kinder wieder zurückkehren würden. Ein Universum, das aus Stilleinlagen, Schnullern, Babyrasseln, Anti-Bläh-Tropfen und zusammenklappbaren Kinderwagen bestand. Und aus dem unaufhörlichen Reden über Babys, deren Persönlichkeit ihre Körpergröße weit zu überragen schien. Sie hießen der Finn und die Sophie oder der Leon und die Noa, und sie hatten unglaublich viele Eigenschaften und Besonderheiten und Bedürfnisse. Der Raum, den sie im Leben ihrer Eltern einnahmen, war jedenfalls bedeutend größer als der Raum, den Suse irgendeinem Wesen in ihrem Leben einzuräumen bereit war. Nein, das alles war nichts für sie. Sie wollte schnell wieder fit werden und weiterarbeiten.
Hoffentlich gab es in diesem Paraíso auch ein paar Leute in ihrem Alter. Eine ganze Woche nur mit Burn-out-Muttis abzuhängen wäre ganz schön uncool. Andererseits, wie sagte ihre Oma immer? Nichts ist erholsamer als Langeweile.
Sie hatte ihre Entdeckungsreise auf Deck fortgesetzt, aber bevor sie alle drei Stockwerke inspiziert hatte, tutete es wieder. Das Schiff verlangsamte seine Fahrt und steuerte den Hafen an. Ein paar Jachten schaukelten auf dem Wasser, mehrere kleine Boote waren an der Hafenmauer vertäut, und in den Cafés saßen nur wenige Leute. Das weiße Gebäude der Marina hob sich strahlend vom blauen Himmel ab, daneben wiegte sich eine Palme sanft im Wind. Der Anblick war so idyllisch, dass es fast wehtat.
Wie konnte es nur sein, dass manche Orte auf der Welt so schön waren und andere so grauenvoll? Und dass es reiner Zufall war, wo einen das Schicksal fallen ließ: auf einer Karibikinsel, in Syrien, in Duisburg oder New York? Natürlich konnten Menschen an vielen Orten glücklich sein, und Palmen brauchten sie dafür auch nicht unbedingt. Aber manche hatten schon verdammt viel Glück und andere verdammt viel Pech. Und keiner konnte was dafür.
Auf der Treppe, die nach unten zum Ausgang führte, traf sie Anka wieder.
»Wollen wir zusammen ein Taxi nehmen?«, fragte die.
Suse zögerte. »Ich hab nicht so viel Kohle. Gibt’s denn keinen Bus?«
»Weiß nicht«, sagte Anka, die offenbar müde war und keine Lust hatte, nach einem Bus zu suchen. »Komm mit, ich lade dich ein.«
Sie wuchteten ihr Gepäck auf die Gangway und schoben es vom Schiff hinunter. Unten warteten Reiseleiter mit Schildern auf Touristen, Einheimische empfingen Freunde oder Verwandte. Menschen umarmten und küssten sich, klopften sich gegenseitig auf die Schulter und kniffen Kindern liebevoll in die Wangen.
Anka seufzte wehmütig. »Wie in meinem Lieblingsfilm Tatsächlich Liebe. Kennst du den?«
Suse schüttelte den Kopf. Das letzte Mal, als sie im Kino gewesen war, hatte sie eine Doku über einen afghanischen Jungen gesehen, der es im Radkasten eines Lkws bis nach Deutschland geschafft hatte. Nie im Leben würde sie sich eine dieser Hollywood-Schmonzetten reinziehen.
»Mindestens sieben Mal habe ich den schon gesehen, und jedes Mal muss ich wieder heulen«, erzählte Anka schwärmerisch.
»Du scheinst ja gerne zu heulen«, sagte Suse.
Anka lächelte. »Ja, komisch, im Kino schon.«
Dabei gibt es im Leben viel mehr Grund zum Heulen, dachte Suse. Aber das gibt keiner gerne zu. Vielleicht heulen die Leute deshalb im Kino. Um ihre ganzen ungeheulten Tränen loszuwerden.
Am Taxistand stießen sie fast mit einer Frau zusammen, die in denselben Wagen steigen wollte wie sie. Bestimmt über fünfzig, schulterlanges, braun gefärbtes Haar, enges Kleid mit Raubtiermuster und großzügigem Dekolleté. Dazu hochhackige Sandalen und reichlich Make-up auf der sonnengegerbten Haut. Sie sah, trotz des ätzenden Outfits, nicht übel aus. Sicher war sie als junge Frau ziemlich hübsch gewesen.
Sie strahlte. »Hallo, Mädels, ihr wollt bestimmt auch ins Paradies?«
Suse und Anka nickten stumm.
»Na dann, rein mit euch zwei Hübschen!«
Jenny
Mit Mühe quetschten sie das Gepäck in den Kofferraum des Taxis, wobei Jennys Koffer mit Abstand der größte war. Sie hatte sogar Übergepäck bezahlt, damit sie alle ihre Lieblingsklamotten mitnehmen konnte. Man wusste schließlich nie, wie das Wetter sein würde, in welcher Stimmung man wäre und auf welches Teil man Lust haben würde. Das Einfachste war, für jede Gelegenheit etwas mitzunehmen.
»Wie lange bleibst ’n du hier?«, fragte die blonde junge Frau mit Blick auf den Koffer erstaunt.
»Eine Woche, wieso?«
»Also, mit so viel Gepäck könnte ich ein Jahr überleben.«
»Komm du mal in mein Alter«, sagte Jenny mit nachsichtigem Lächeln.
Sie stiegen ein, Jenny setzte sich auf den Beifahrersitz. Dann drehte sie sich um und streckte den beiden Frauen die Hand hin.
»Ich bin übrigens die Jenny aus Köln. Mein Motto ist: Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst ja doch nicht lebend raus! Und wer seid ihr?«
Die beiden Frauen musterten sie befremdet, aber das kannte Jenny schon. Eigentlich ging es ihr fast immer so, wenn sie jemanden kennenlernte. Sie bekam irgendwie nie den richtigen Tonfall hin. Entweder war sie zu ruppig oder zu herzlich, jedenfalls blickten die meisten Leute sie erst einmal an wie zu grell gemusterte Vorhänge.
Schließlich stellte die Jüngere sich als Suse vor, die Ältere als Anka. Obwohl Jenny es für höchst unwahrscheinlich hielt, fragte sie: »Seid ihr Schwestern?«
Die beiden erklärten, dass sie sich gerade auf der Fähre kennengelernt hätten.
»Wobei kennengelernt ein bisschen übertrieben ist«, bemerkte die Jüngere. »Wir haben nicht mehr als ein paar Worte gewechselt.«
»Na, das wird sich im Laufe der Woche ja wohl ändern«, sagte Jenny aufgekratzt. »Schließlich ist das hier eine Gruppenreise!«
»Gruppenreise?« Anka blickte entsetzt. »So habe ich das aber nicht verstanden. Ich dachte, ich buche einen Urlaub, und dann entscheide ich mich, welche Angebote ich nutzen möchte. Ich will doch nicht ständig mit einer Gruppe zusammen sein!«
»Mach dir keine Sorgen, Schätzchen. Das hältst du einfach so, wie du willst. Keiner zwingt dich zu irgendwas.«
Anka sah Jenny pikiert an.
Der Fahrer, der geduldig gewartet hatte, ließ jetzt den Wagen an und fragte, wohin es gehen solle.
Jenny lachte und sagte: »Vamos al Hotel Paraíso, por favor.«
»Du sprichst spanisch?«, fragte Suse bewundernd.
»Nur für den Hausgebrauch. Hab mir vor dem Urlaub so ’ne App runtergeladen und ein bisschen geübt. Bin schon auf Level vier.«
»Wow«, sagte Suse, und Jenny konnte nicht einschätzen, ob es freundlich oder spöttisch gemeint war.
»Ich hatte mal einen italienischen Lover, einen Conte«, sagte Anka träumerisch. »Für den hätte ich sogar Italienisch gelernt. Hat aber nicht lange genug gehalten.«
Jenny seufzte unhörbar und warf einen wehmütigen Blick in den Schminkspiegel. Klar, so wie du aussiehst, hattest du jede Menge Lover, dachte sie. Die braunen Rehaugen, die langen Haare, die tolle Haut. Ankas makellose Figur war ihr als Erstes aufgefallen, als sie zusammen vor dem Taxi gestanden hatten. Schon blöd, dass ausgerechnet so eine Klassefrau in der Gruppe war. Ihre Anwesenheit reduzierte Jennys Chancen, jemanden kennenzulernen, glatt um hundert Prozent.
Interessiert fixierte sie Anka im Spiegel. »Bist du verheiratet?«
»Ich?«, sagte Anka überrascht. »Wieso interessiert dich das?«
»Nur so. Bin manchmal ’n bisschen neugierig.«
Sie blickte noch einmal in den Rückspiegel und wusste es plötzlich. Nein, Anka war nicht verheiratet. Manchen Frauen war das Verheiratetsein ins Gesicht graviert, anderen die Einsamkeit. Anka war trotz ihrer Schönheit allein, das konnte sie sehen.
»Nein«, kam es von hinten. »Nicht verheiratet. Und du?«
»Auch nicht. Wär ich aber gern.«
»Warum sind die meisten Frauen bloß so versessen aufs Heiraten?«, fragte Suse. »Schließlich wird fast die Hälfte aller Ehen wieder geschieden.«
»Weil alle glauben, sie gehören zur anderen Hälfte«, sagte Jenny.
»Und? Glaubst du das auch?«
Jenny lachte kurz auf. »Ach, weißt du, Schätzchen, allmählich ist es ein bisschen spät für mich. Männer in meinem Alter interessieren sich ja eher für Küken wie dich.«
»Ja, nee«, sagte Suse angewidert. »Ich würde doch nicht mit so ’nem alten Sack zusammen sein wollen!«
»Danke«, sagte Jenny trocken.
»Oh, entschuldige, so hab ich das nicht gemeint!«
»Schon gut«, gab sie gelassen zurück. »Du hast ja recht.«
Jenny hatte sich lange gegen das Alter gewehrt, es vor sich selbst und anderen verleugnet, bis sie gespürt hatte, dass sie allmählich zur lächerlichen Figur wurde. Immer noch kleidete sie sich unkonventionell und etwas zu jugendlich, aber das war mehr so eine Trotzhaltung. Sie bildete sich nicht ein, dadurch jünger zu wirken. Das Älterwerden war nicht nur ein optisches Problem, es brachte auch allerhand zeitraubende Begleiterscheinungen mit sich. Haare wuchsen an Stellen, wo sie nicht hingehörten, und mussten entfernt werden, Nägel wurden rissig und verlangten nach aufwendiger Pflege, Muskeln wurden steif und wollten gedehnt werden, Fett bildete sich und musste durch gesunde Ernährung im Rahmen gehalten werden. Die Wartung eines alternden Körpers erforderte ständige Aufmerksamkeit und permanenten Einsatz. In dieser Woche wollte sie sich mal so richtig verwöhnen lassen.
»Hast du’s mal mit Tinder probiert?«, fragte Suse.
»Klar«, gab Jenny zurück. »Aber bei Tinder geht’s doch nur ums Poppen. Außerdem ist das Durchschnittsalter ungefähr fünfundzwanzig. Da macht man sich in meinem Alter fast schon verdächtig. Wusstet ihr, dass die meisten, die tindern, in festen Beziehungen sind? Ich glaube, fast die Hälfte.«
Suse wirkte überrascht. »Du kennst dich ja aus.«
Jenny lächelte. »Man tut, was man kann.«
Sie hätte Suse eine Menge zu dem Thema erzählen können. Von dem Typen, der sie nach ein bisschen Tinder-Talk in seine Hotelsuite eingeladen, mit Champagner und Langusten bewirtet, endlos vollgelabert und schließlich brutal von hinten genommen hatte. Bevor sie ging, hatte er ihr zweihundert Euro hingeworfen. »Das war es doch, was du wolltest, oder?«
Sie hatte die beiden Geldscheine vor seinen Augen zerrissen und auf den Boden geworfen, dann war sie gegangen.
Selbst schuld, selbst schuld, hatte sie sich endlos vorgesagt, aber das machte die Demütigung nicht kleiner und auch nicht das bohrende Gefühl von Scham.
Wie oft schon wollte sie mit Tindern aufhören, aber dann konnte sie doch nicht auf den süchtig machenden Moment verzichten, in dem die stilisierte Flamme aufleuchtete, die anzeigte, dass man ein Match hatte. Wuuusch!!! Eine Welle von Adrenalin schoss dabei jedes Mal in ihr hoch. Ein Mann fand sie anziehend!
Sie hatte ein besonders vorteilhaftes Bild von sich gepostet, auf dem sie ein Stück jünger war als in Wirklichkeit. Man soll seine Chancen ja nicht von vornherein reduzieren. Es war immer mal wieder zu unschönen Szenen gekommen, wenn sie die Männer dann getroffen hatte. »Wieso postest du ein Bild von deiner Tochter?«, hatte einer gesagt. Und ein anderer: »Ich bin doch nicht nekrophil.«