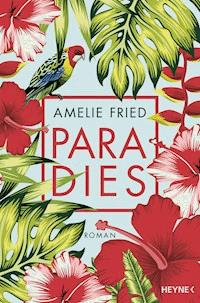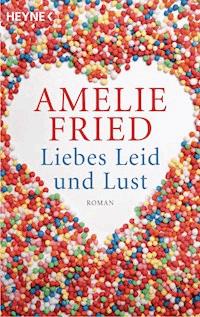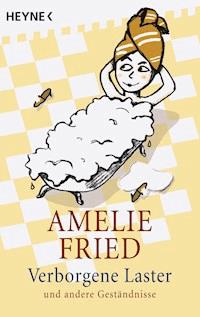5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine raffiniert erzählte Geschichte über falsche Hoffnungen und zerstörte Träume, über die Tücken der Liebe und den Wert von Freundschaft
Die Schwestern Kim und Mona wollen alles – Liebe, Geld, Sex – aber leider wollen sie es vom selben Mann. So lassen sie sich beide in Gregors Plan einspannen: Mit einer fingierten Entführung will er seine wohlhabende Frau erpressen, um endlich das Leben führen zu können, das er sich erträumt. Als die drei sich ihrem Ziel ganz nahe glauben, ist plötzlich alles anders: Die brave Mona entpuppt sich als gerissene Betrügerin, der unsteten Kim begegnet unerwartet die große Liebe, und Gregor zahlt die Rechnung für das missglückte Gaunerstück. Am Ende müssen alle erkennen, dass sich wahres Glück nicht erzwingen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Die Schwestern Kim und Mona wollen alles – Liebe, Geld, Sex – aber leider wollen sie es vom selben Mann. So lassen sie sich beide in Gregors Plan einspannen: Mit einer fingierten Entführung will er seine wohlhabende Frau erpressen, um endlich das Leben führen zu können, das er sich erträumt. Als die drei sich ihrem Ziel ganz nahe glauben, ist plötzlich alles anders: Die brave Mona entpuppt sich als gerissene Betrügerin, der unsteten Kim begegnet unerwartet die große Liebe, und Gregor zahlt die Rechnung für das missglückte Gaunerstück. Am Ende müssen alle erkennen, dass sich wahres Glück nicht erzwingen lässt.
Glücksspieler ist eine Geschichte, die große Gefühle ernst nimmt und die alte Frage neu stellt, warum das Glück immer woanders ist.
Die Autorin
Amelie Fried, geboren 1958, ist eine bekannte TV-Moderatorin. Für ihre Fernseharbeit erhielt sie den Grimme-Preis, den Bambi und den Telestar-Förderpreis. Auch als Autorin kann sie auf große Erfolge verweisen. Ihr erstes Kinderbuch Hat Opa einen Anzug an? wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Ihre Romane Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung und Der Mann von nebenan wurden zu Bestsellern und erfolgreich verfilmt. Zuletzt erschienen ihre Erzählbände Geheime Leidenschaften und Verborgene Laster.
Amelie Fried lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem Dorf bei München.
Inhaltsverzeichnis
Für Peter, ohne den es dieses Buch nicht gäbe
Obwohl er tot war, schaffte es Monas Vater immer noch, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen.
Das lag vielleicht daran, dass Mona eigentlich immer ein schlechtes Gewissen hatte. Oder daran, dass der Blumenschmuck, den sie für die Beisetzung bestellt hatte, so spärlich ausgefallen war. Vielleicht war der Grund dafür aber auch, dass sie in ihrem Inneren vergeblich nach einem Gefühl von Trauer suchte. Da war keine Trauer. Kein Schmerz. Nur ein Gefühl von Erleichterung, gepaart mit einer leichten Ratlosigkeit.
Der Sarg stand wenige Meter vor ihr in der Apsis der Friedhofskapelle, und für einen Moment hatte sie das Gefühl, ihr Vater blicke von irgendwoher missbilligend auf die eintreffenden Trauergäste. Niemand schien von seinem Weggang erschüttert zu sein. Einige weitläufige Verwandte hatten sich eingefunden, ein paar frühere Patienten, Vertreter ärztlicher Standesorganisationen, seine langjährigen Praxishelferinnen. Freunde hatte er wohl nicht gehabt, wie Mona ohne großes Erstaunen konstatierte. Da drüben entdeckte sie Willi, seinen alten Studienkollegen. Er würde die Trauerrede halten.
Wo Kim nur wieder blieb? Beunruhigt ließ Mona ihre Blicke über die halb gefüllten Stuhlreihen Richtung Eingang wandern. Sie sah ihre Schwester durch den Mittelgang eilen, die Jacke offen, die lockige Mähne unfrisiert, in Minirock und Stiefeln. Sie schob sich auf den freien Platz neben ihr. Mona bedachte sie mit einem strafenden Blick.
»Mach mich bloß nicht an!«, sagte Kim aggressiv.
»Ich hab keinen Ton gesagt«, gab Mona zurück. »Ich dachte nur, wenigstens zur Beerdigung deines Vaters könntest du mal pünktlich sein.«
»Davon hat er auch nichts mehr.«
Die Orgel setzte ein, die Trauergäste räusperten sich und setzten sich zurecht. Eine Sopranistin der städtischen Oper, die Mona für ein exorbitantes Honorar engagiert hatte, sang das Ave Maria. Die anschließende Predigt rauschte an Mona vorbei. Erst als Willi ans Rednerpult trat, kehrte ihre Aufmerksamkeit zurück.
Er hielt eine dieser grauenvoll verlogenen Reden, bei der jeder, der ihren Vater näher gekannt hatte, sich vor Peinlichkeit winden musste. Er rühmte die Verdienste des Verstorbenen als Arzt und Vater, sprach von seiner großen Menschlichkeit, seiner Fähigkeit, Freundschaften zu schließen und zu pflegen. »Mein Freund Herbert war einer der Besten«, schloss Willi mit brechender Stimme, »und die Besten gehen immer zu früh.«
Die Wahrheit war, dass die beiden als junge Ärzte einen katastrophalen Kunstfehler begangen und gemeinsam vertuscht hatten. Bei einer Leistenbruchoperation war der diabeteskranke Patient wegen eines Narkosefehlers ins Koma gefallen und später gestorben.
Ein letztes Mal erhob sich die Stimme der Sopranistin und füllte den hohen Raum. Gegen eine flüchtige Rührung kämpfte Mona an, indem sie den Minutenpreis der Künstlerin ausrechnete. Kim starrte unbeteiligt in die Luft.
Wieder meldete sich Monas schlechtes Gewissen. War es möglich, dass sie beide so wenig für ihren Vater empfanden? Als Kinder hatten sie um ihn gebuhlt, um seine Liebe rivalisiert. Kim, die acht Jahre Jüngere, mit dem unschuldigen Charme des Kleinkinds, Mona mit den Waffen der Heranwachsenden. Viel später, als sie erkannt hatten, dass keine von ihnen diesen Wettstreit würde gewinnen können, hatten sie sich von ihm abgewandt. In den letzten Jahren hatte Mona noch mal versucht, ihm näher zu kommen. Aber mit dem Alter war ihr Vater noch egozentrischer, unbelehrbarer und starrsinniger geworden. So war ihr Versuch nicht viel mehr gewesen als das verzweifelte Aufbäumen eines abgewiesenen Kindes; für Mona nur die letzte in einer langen Reihe von Demütigungen.
Die Trauergäste erhoben sich jetzt und folgten dem Sarg zur Grabstelle. Vor diesem Moment hatte Mona sich gefürchtet. Nicht nur, dass sie die Schaufel nehmen und Erde auf den Sarg werfen musste, eine Geste, die ihr schon im Kino immer die Tränen in die Augen trieb; nein, sie und Kim würden am Rande des Grabes stehen bleiben und die Kondolenzbezeugungen entgegennehmen müssen.
Sie setzte die Sonnenbrille auf, obwohl der Himmel bedeckt war. Ihre Hand zitterte leicht, als sie die Schaufel aus der Hand des Pfarrers entgegennahm. Entschlossen nahm sie etwas krümelige Erde und ließ sie auf den Sargdeckel fallen. Ein mitgereister Regenwurm wand sich aus dem Erdreich und suchte das Weite. Sie reichte die Schaufel weiter. Achtlos schippte Kim ein paar Kiesel mit, die polternd auf dem Sarg aufschlugen.
»Fahr zur Hölle«, murmelte sie, und Mona sah sie erschrocken an.
Kim gab die Schaufel dem nächsten Trauergast und wandte sich zum Gehen. Mona erwischte sie gerade noch am Jackenärmel.
»Du bleibst hier!«, befahl sie. »Wenn ich mich schon sonst um alles allein kümmern musste.«
Kim blieb widerstrebend stehen, um all die Hände zu schütteln und die gemurmelten Tut-mir-so-Leids und Mein-herzliches-Beileids über sich ergehen zu lassen. Endlich waren die letzten Trauergäste gegangen. Aufatmend zog Kim ein Päckchen Zigaretten aus der Jackentasche und steckte sich eine an. Mona nahm die Sonnenbrille ab und rieb sich die Augen.
»Und jetzt?«, fragte sie erschöpft.
»Keine Ahnung.« Kim scharrte mit der Stiefelspitze im Kies.
»Eine Cola und eine Pizza mit allem«, bestellte Kim, als sie sich gesetzt hatten. Der Kellner nickte eilfertig und notierte die Bestellung, als handele es sich um ein sechsgängiges Menü.
»Für mich nur ein Wasser«, bat Mona und lächelte entschuldigend.
Die Tristesse des Lokals mit seinen Kunststoffmöbeln, den Strohblumensträußen und kitschigen Capri-Ansichten war nicht geeignet, die Stimmung zu heben. Mona fragte sich, was einen Italiener dazu hatte bewegen können, sein schönes, sonniges Land zu verlassen, um am Rande eines deutschen Großstadtfriedhofs eine Pizzeria zu eröffnen.
»Also, sag schon«, begann Kim und steckte sich die nächste Zigarette an, »springt was für mich raus?«
»Was meinst du?«
»Paps’ Testament natürlich. Er wird doch was hinterlassen haben?«
Mona holte tief Luft. »Sag mal, schämst du dich gar nicht? Dein Vater ist noch keine halbe Stunde unter der Erde, und du redest schon wieder vom Geld?«
»Warum sagst du immer ›dein Vater‹«, äffte Kim gereizt ihre Schwester nach, »erstens war er auch dein Vater, und zweitens kann ich mir Sentimentalitäten bei meiner Finanzlage nicht leisten.«
»Lass uns nicht streiten«, bat Mona und legte ihr die Hand auf den Arm. »Erzähl mir doch erst mal, wie’s dir geht.«
»Wie soll’s mir schon gehen, wie immer eben.«
»Neuer Job? Neuer Freund?«
»Ach, hör doch auf, das interessiert dich doch gar nicht.«
»Natürlich interessiert es mich!«, sagte Mona gekränkt.
Kim ließ sich nicht vom Thema abbringen. »Komm schon, was ist mit Kohle? Ich sehe vor lauter Schulden kein Land mehr!«
Mona zuckte die Schultern. »Tut mir Leid, Kimmie, ich muss dich enttäuschen. Paps konnte, wie du weißt, mit Geld überhaupt nicht umgehen, und die letzten Jahre im Augustenstift haben alles aufgefressen. Am Schluss musste ich noch Geld zuschießen.«
Kim schlug mit der Faust auf den Tisch. »Verdammt!«, fluchte sie. »Das hat er mit Absicht getan, alles rauszuhauen, damit wir bloß nichts mehr kriegen!«
»Quatsch«, wehrte Mona ab, »darüber hat er gar nicht nachgedacht.«
Kim starrte finster vor sich hin. »Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen?«, fragte sie schließlich.
»Vorige Woche. Er hat mich kaum noch wahrgenommen. Sie hatten ihn mit Schmerzmitteln voll gepumpt und er hing am Tropf. Er sah ganz klein aus. Wenn ich daran denke, wie viel Angst wir früher vor ihm hatten.«
»Weißt du«, sagte Kim nach einer Pause nachdenklich, »seit ich den Sarg gesehen habe, denke ich, es war vielleicht doch ein Fehler, dass ich ihn nicht mehr besucht habe. Ich erinnere mich an ihn als gesunden Mann, und ich kann ihm einfach nicht verzeihen.«
Mona nickte. »Wenn du ihn zuletzt gesehen hättest, wär’s vielleicht anders.«
»Kann sein. Hast du ihm verziehen?«
Mona folgte dem Rauch von Kims Zigarette mit den Augen.
»Ich weiß nicht. Wenn du so oft zurückgestoßen wirst, gibst du’s irgendwann auf. Und wenn du jemanden nicht mehr liebst, ist es auch nicht mehr so wichtig.«
Kim schwieg einen Moment. Dann sagte sie: »Nachdem Mama weg war, warst du alles für ihn.«
»Du spinnst, Kim. Ich war ihm gleichgültig. Alle Menschen waren ihm gleichgültig. Die Einzige, die an ihn rankam, warst du. Du warst aufsässig, du hast ihn zum Wahnsinn getrieben, aber du hast wenigstens Gefühle bei ihm ausgelöst.«
Kim erhob mit einer heftigen Bewegung ihr Glas, als wolle sie die Erinnerung wegwischen.
»Auf dich, Paps!«, sagte sie mit aufgesetzter Fröhlichkeit. »Vielleicht bist du da drüben glücklicher, als du’s hier warst.«
Sie stürzte sich auf die Pizza, die der Kellner in diesem Moment servierte, und aß gierig. Mona betrachtete sie aufmerksam.
»Soll ich Manfred fragen, ob er in der Firma was für dich tun kann?«, bot sie an.
Kim sah von ihrem Teller auf.
»Pah, damit ich den Flanellärschen Kaffee koche und mir den Hintern betatschen lasse?«
Einen Moment herrschte Schweigen, nur unterbrochen vom Klappern des Bestecks. Aufseufzend schob Kim den Teller von sich und griff nach den Zigaretten.
»Wie’s mir geht, willst du wohl nicht wissen«, fragte Mona.
Kim nahm den ersten Zug und blies den Rauch in die Luft.
»Ehrlich gesagt, nein. Ich hab genug eigene Probleme.«
Sie stand auf, nahm ihre Zigaretten und die Jacke. »Ich muss los. Danke für die Einladung.«
Drei Minuten vor zwei schlüpfte Kim in ihre Schürze und befestigte das Kellnerinnen-Häubchen in ihrer Lockenmähne. Wie sie dieses Häubchen hasste! Es diskriminierte sie, stempelte sie ab, unterstrich unübersehbar die Kluft zwischen ihr und den Gästen des Flughafencafés vor Gate 21. Dabei hätte sie alles dafür gegeben, auf der anderen Seite des Tresens zu stehen, einen letzten Espresso zu schlürfen, um dann zu einem geschäftlichen Termin nach Hamburg, London oder Madrid zu fliegen. Der Neid fraß an ihr, wenn sie diese teuer gekleideten Tussis mit ihren Prada-Täschchen sah, die irgendeine glamouröse Tätigkeit wie Marketing, Public Relation oder Lifestyle-Beratung ausübten.
Kim war ein halbes Jahr vor dem Abitur von der Schule geflogen. Statt, wie ihr Vater es gewünscht hatte, ins Ausland zu gehen und Sprachen zu lernen, hatte sie eine Frisörlehre angefangen; später hatte sie Maskenbildnerin beim Film oder beim Fernsehen werden wollen. Mit einundzwanzig war sie schwanger geworden und hatte die Lehre abbrechen müssen. Und dann hatte sie nicht ein Kind gekriegt, sondern gleich zwei auf einmal.
Mona hatte es cleverer angestellt; sie hatte gerade so lange vorgegeben, Medizin zu studieren, bis Manfred aufgetaucht war, ein gut aussehender, ehrgeiziger BWL-Student, der gleich nach der Hochzeit eine Stelle in einem großen Medienkonzern erhalten hatte und seither die Karriereleiter unablässig nach oben kletterte. Das hatte Mona die Strapazen des Arztberufes erspart und ihr dennoch einen ständig steigenden Lebensstandard ermöglicht. Sie hatte nur ein Kind, und seit Tommy in England im Internat war, konnte Mona ungehemmt ihrer Lieblingstätigkeit nachgehen: dem Geldausgeben. Kim stellte sich immer wieder vor, wie angenehm es sein müsste, keine Geldsorgen zu haben; nur das Problem, welchen Wunsch man sich als Nächstes erfüllen soll. Sie hasste Mona für ihr sorgloses Leben.
Sie machte einen Scheißjob, um ihren zwei Mädchen einen anständigen Kindergarten, Schuhe mit Fußbett und später mal Geigenunterricht bezahlen zu können, sofern sie sich Geigenunterricht wünschen sollten, was Gott verhüten mochte. Dafür mussten ihre Kleinen mit Klamotten von H&M, Nudeln von Aldi und einer chronisch übermüdeten Mutter vorlieb nehmen.
Seufzend warf Kim einen Blick in den Spiegel überm Waschbecken und verließ die Personaltoilette. Normalerweise hatte sie die längere Morgenschicht von sechs bis zwölf; heute hatte sie wegen der Beisetzung mit ihrer Kollegin Jasmin getauscht. Das würde sie zwei Stundenlöhne kosten.
Franco, ihr cholerischer Chef, begann bei ihrem Anblick sofort zu brüllen.
»Kannse du nich komme pünktlich?«
»War bei ’ner Beerdigung«, antwortete sie Mitleid heischend, was seine Wirkung auf Franco völlig verfehlte.
»Solange nich deine eigene Beerdigung, is mir total egal!«
»Fick dich ins Knie«, murmelte Kim unhörbar und nahm ihren Platz hinter dem Tresen ein.
Zwei Männer nahmen auf den Barhockern vor ihr Platz. Sie unterbrachen ihr Gespräch nur, um die Bestellung aufzugeben; keiner von beiden schien Kim auch nur wahrzunehmen. Wütend knallte sie Bier und Kaffee auf den Tresen. Sie, Kim Morath, übersah man nicht! Sie wollte wahrgenommen werden, verdammt noch mal! Erstaunt sahen die zwei Typen hoch. Kim setzte ihr strahlendstes Lächeln auf.
»Einmal Bier, einmal Kaffee, bitteschön.«
Verwirrt bedankten sich die Kerle, vermutlich Vertreter, wie Kim mit geschultem Blick feststellte. Sie konnte anhand des Anzuges mit ziemlicher Sicherheit sagen, in welcher Branche jemand arbeitete, manchmal sogar, auf welcher Stufe der Karriereleiter. Sie konnte einen Armani-Anzug auf zehn Meter von einem Boss-Anzug unterscheiden, und die braunen oder auberginefarbenen C&A-Sakkos von Werkzeugmaschinenvertretern identifizierte sie durch die gesamte Abflughalle. Bei den Jungs hier lohnte keine weitere Mühe, so viel war klar.
Sie wandte sich der Espressomaschine zu. Kaffeebohnen mussten nachgefüllt werden, die Milchdüse war verklebt. Gut, dass Franco es noch nicht bemerkt hatte, sonst wäre der nächste Anfall fällig. Ihr Chef, obwohl Italiener, verfügte leider nicht im Geringsten über südländischen Charme. Er war pingelig und geizig, ständig schlecht gelaunt, und behandelte seine Angestellten wie Leibeigene. Kim hatte er besonders auf dem Kieker; vermutlich weil sie ihn mehrfach hatte abblitzen lassen. Seither beobachtete er mit Argusaugen jede längere Unterhaltung, die sie mit einem Gast führte.
Im Moment war nicht viel los; die Frankfurt-Maschine würde gleich landen, Berlin und Wien wurden gerade abgefertigt. Kim richtete ihre Konzentration auf die Milchdüse, ließ heißes Wasser über die Tülle laufen und polierte die Zuleitung aus Edelstahl. Sie war so vertieft, dass sie zusammenzuckte, als plötzlich eine Männerstimme vor ihr sagte: »Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben?«
Sie sah auf und erstarrte. Ein Blick aus grünen, bernsteinfarben gesprenkelten Augen. Ein schön geschwungener Mund, der dem Gesicht einen empfindsamen Ausdruck gab. Dunkles Haar, nicht zu kurz. Ein Anzug der oberen Preisklasse, über dem Arm ein leichter Überzieher. Kein Laptop. Leute mit Laptop mussten noch selbst arbeiten. Leute ohne Laptop hatten es bereits geschafft, dass andere für sie arbeiteten.
Kim verwandelte sich kurzzeitig in die Heldin ihrer Lieblingsfernsehserie »Ally McBeal«; die Farbe fiel ihr aus dem Gesicht und ihre Zunge schnellte einen halben Meter vor, um den Hals dieses männlichen Prachtexemplars zu umschlingen.
»Ein Glas Mineralwasser, bitte«, wiederholte die Stimme, und Kim verwandelte sich wieder zurück.
»Ja, natürlich, entschuldigen Sie«, krächzte sie.
Sie schenkte ein großes Glas Mineralwasser ein und inspizierte unauffällig seine Schuhe. Schuhe waren das absolut Verräterischste an einem Menschen. Selbst, wenn jemand sich geschickt mit einem teuren Anzug tarnte, an den Schuhen erkannte man, wer er war. Am schlimmsten waren Slipper mit Troddeln. Das waren die Zuhälter. Slipper ohne Troddeln kamen am häufigsten vor, das waren die mittleren Angestellten und die Vertreter. Schwarze Schnürschuhe verrieten den Juristen oder Wirtschaftsmann, Turnschuhe und Stiefeletten den Werbefuzzi. Braune Schuhe konnte man vergessen, das waren die Rentner.
Der Mann am Tresen trug absolut perfekte Schuhe. Modisch, aber nicht geckenhaft, solide, aber nicht spießig. Kim hätte ihm allein auf Grund der Schuhe ein polizeiliches Führungszeugnis ausgestellt.
Er drückte drei Aspirin aus einer Packung und trank mit schnellen Schlucken das Wasser nach. Mit einem gequälten Gesichtsausdruck rieb er sich die Augen; offenbar hatte er Kopfschmerzen.
Kim musste sich eingestehen, dass sie ihn anziehend fand. So sehr, dass ihr gewohntes Verhaltensrepertoire sie im Stich ließ. Normalerweise sendete ihr Körper wie von alleine die Signale aus, die einem Mann zeigten, dass er ihr gefiel. Jetzt wusste sie plötzlich nicht mehr wohin mit den Händen, den Armen, dem Blick.
Dass sie Männer dazu kriegen konnte, sie zu begehren, war die Grundlage ihres Selbstbewusstseins. Sie wusste, dass sie gut im Bett war. Sex machte ihr Spaß, weil er ihr das Gefühl gab, jemand zu sein. Jemand, der wahrgenommen wurde.
Der Mann bedankte sich und legte einen Zehnmarkschein auf den Tisch, was immerhin vier Mark Trinkgeld für Kim bedeutete. Als er sich schon zum Gehen wandte, fiel sein Blick auf ihr Namensschild.
»Sie sind Kim?«, fragte er und sah sie mit plötzlichem Interesse an.
Kim nickte verdattert. »Sie kennen mich?«
Er lächelte. »Sagen wir so, ich hab von Ihnen gehört.« Er zog ein Kärtchen aus der Innentasche seines Sakkos. »Vielleicht haben Sie Lust, mich anzurufen?«
Er schickte ihr einen viel sagenden Blick aus grün gesprenkelten Augen und ging. Kim sah ihm nach. Dann sah sie auf das Kärtchen: eine Handy-Nummer, kein Name.
Er hatte also von ihr gehört. Irgendeiner ihrer Stammkunden hatte sie weiterempfohlen. Geh doch in München mal zu Gate 21, hatte er gesagt, da bedient so ’ne geile Kleine, die besorgt’s dir, wenn du ihr ein paar Scheine hinlegst.
Kim zog die Nase hoch. Dann ließ sie das Kärtchen in ihrer Schürzentasche verschwinden.
Die Trauer kam völlig unvermittelt. Mona hatte ihr Haus betreten, gedankenverloren die Einkaufstüten abgestellt, ihren Jil-Sander-Mantel an die Garderobe gehängt und Teewasser aufgestellt. Kein Schwarztee nach sechzehn Uhr, rief sie sich ins Gedächtnis, sonst schläfst du noch schlechter als sonst. Zitronengras-Ingwertee. Gut für Nerven und Verdauung.
Sie kontrollierte schnell, ob ihr Sohn eine E-Mail geschickt hatte. Das war die einzige Art, wie er kommunizierte. Einen normalen Brief würde er nie schreiben, und Telefonieren war aus dem Internat schwierig. Also hatten sie einen Computer aus Manfreds Firma im Haus aufgestellt und einen Internet-Anschluss eingerichtet.
Nein, keine neue Post. Zum Trost las sie seine letzte Nachricht vom Morgen noch mal.
hallo monamami, sei nicht traurig. wäre bei der beerdigung gerne dabei um dich zu trösten, aber du weisst ja, es geht nicht. loveyou tommy :-)
Mit der Tasse in der Hand wanderte sie ins Wohnzimmer, ließ den Blick über die indonesische Rattansitzgarnitur schweifen, über den niedrigen Couchtisch, den Teakholzschrank, die Palmen, die sie so liebte, und die sie an ihren Lebenstraum erinnerten: Besitzerin eines kleines Hotel zu sein, irgendwo im Süden.
Kurz nach dem Abi war sie einmal auf einer winzigen Mittelmeerinsel gelandet, auf der es nichts gab außer ein paar bambusgedeckten Strandbars und kleinen Pensionen. Die Leute lebten vom Fischfang, von ein bisschen Landwirtschaft und den paar Touristen, hauptsächlich Hippies, die nächtliche Gitarrensessions am Strand veranstalteten. Diese Insel war in Monas Erinnerung das Paradies; wann immer sie sich aus ihrem Leben wegträumte, war es dieser Ort, nach dem sie sich sehnte. Irgendwann würde sie vielleicht dorthin zurückkehren.
Ihr Blick blieb an dem hübschen Servierwagen im Kolonialstil hängen, den sie erst kürzlich bei einem ihrer Shopping-Streifzüge entdeckt hatte. Sie hatte Fotos darauf drapiert. Fotos von Manfred und Tommy, von ihr und Kim als Kinder, von ihr im Studium, von Lilli und Lola. Und Fotos von ihrem Vater. Als er sie jetzt ansah, mal spöttisch lächelnd, mal mit seinem typisch skeptischen Ausdruck, brach sie in Tränen aus. Das war’s dann also. Sie hatte niemanden mehr. Keine Großeltern, keine Mutter, keinen Vater. Sie war völlig allein. Bei diesem Gedanken schluchzte sie auf.
Sofort rief sie sich zur Vernunft. Allein? Lächerlich. Sie hatte einen Mann, einen Sohn, eine Schwester. Oh Gott, ja, und was für eine!
Sie schnaubte sich die Nase und kuschelte sich auf dem Rattansofa zusammen. Der süß-scharfe Geschmack des Ingwertees wirkte beruhigend.
Was für einen Auftritt Kim heute wieder hingelegt hatte. Mona verabscheute ihre Schnoddrigkeit, ihr scheinbar unerschütterliches Selbstbewusstsein, ihre Lecktmich-doch-alle-mal-Attitüde. Und sie würde was darum geben, wenn sie nur einen Bruchteil davon hätte. Noch mehr würde sie darum geben, wenn sie ein Sexleben hätte, wie Kim es zu haben vorgab.
Mona seufzte. Sie und Manfred führten eine gute Ehe, daran hatte sie keinen Zweifel. Aber es war das geschehen, was in Millionen anderer Ehen auch geschieht: Die Leidenschaft war verloren gegangen.
Sie waren ein perfektes Team für die Organisation des Alltags, für den gesellschaftlichen Auftritt. Sie strahlten nach außen den Nimbus des erfolgreichen Paares aus. Aber kaum waren sie alleine, breitete sich eine merkwürdige Lähmung zwischen ihnen aus, als wäre die Quelle versiegt, aus der sie gemeinsam Energie geschöpft hatten. Sie sprachen wenig, berührten sich selten, lebten jeder für sich wie in einer Luftblase. Sie stritten fast nie, führten keine Auseinandersetzungen oder Diskussionen, weder über das Fernsehprogramm noch über den Zustand ihrer Ehe. Sie waren einander abhanden gekommen.
Mona dachte an heute Morgen. Beim Frühstück, das sie üblicherweise schweigend einnahmen, hatte Manfred kurz die Zeitung sinken lassen. Ach übrigens, Darling, ich kann leider nicht mit zur Beisetzung kommen, es macht dir doch nichts aus? Nein, Darling, natürlich nicht. Kurzes Tätscheln der Hand. Ende.
Mona fragte sich, wann sie angefangen hatten, sich gegenseitig »Darling« zu nennen. Und, warum sie nicht irgendwann damit aufgehört hatten. War dieser Kosename nur noch eines jener Rituale, die in Ehen eingezogen werden wie Stahlträger, damit das morsche Gebäude nicht zusammenkracht?
Sie überlegte angestrengt, wann sie das letzte Mal zusammen geschlafen hatten. Es musste Wochen her sein. Sie fragte sich zum tausendsten Mal, wie etwas, das am Anfang ihrer Ehe so selbstverständlich gewesen war, plötzlich zum Problem hatte werden können. Bestimmt lag es an ihr. Männer hatten doch immer Lust. Und wenn sie mal keine hatten, genügten ein paar eindeutige Signale.
Früher hatte sie Spaß am Sex gehabt. Sie war leicht erregbar gewesen, keine von den Frauen, die ein stundenlanges Vorspiel brauchten. Manfred mochte das; oft hatten sie es zwischendurch schnell getrieben, in seiner Mittagspause, oder kurz bevor Gäste kamen, einmal sogar in der Toilette eines Sterne-Restaurants, zwischen Vorspeise und Hauptgang.
Mit dem Kind war alles anders geworden. In der Schwangerschaft hatte ihr der schiere Gedanke an eine intime Berührung Übelkeit verursacht. Als Tommy dann da war, gab es nur noch das Baby. Sie stillte über ein Jahr; in dieser Zeit zog Manfred sich fast völlig von ihr zurück. Die milchtropfende Brust war ihm unheimlich, der kleine Rivale schüchterte ihn ein. Er beklagte sich nicht, wurde nicht wütend, stellte keine Forderungen. Schweigend drehte er sich abends im Bett von ihr weg, murmelte einen Gutenachtgruß und schlief ein. Sie hätte sich zurückgesetzt fühlen können, aber in Wahrheit war sie froh. Nichts sollte die Intimität zwischen ihr und dem Kind stören.
Manfreds Beziehung zu seinem Sohn wurde in all den Jahren nie so intensiv wie die zwischen ihr und Tommy. Als Manfred so vehement dafür plädiert hatte, den Jungen nach England ins Internat zu schicken, konnte Mona sich des Verdachts nicht erwehren, dies sei die späte Rache dafür, dass Tommy ihm Mona entfremdet hatte.
Irgendwann jedenfalls stand Manfreds sexueller Frust wie ein Betonblock im Schlafzimmer; Mona konnte nicht mehr so tun, als nähme sie ihn nicht war.
Sie kaufte teure Seidenunterwäsche, las erotische Romane und versuchte, ihre verschüttete Leidenschaft wieder zu wecken. Sie ging sogar so weit, sich gemeinsam mit Manfred Sexvideos anzusehen, was ihr immer schon zuwider gewesen war.
Sie bat Manfred, gemeinsam mit ihr einen Sexualtherapeuten aufzusuchen.
Er brauste auf, wurde zum ersten Mal richtig wütend. Er wisse nicht, was er bei einem Seelenklempner zu suchen hätte, bei ihm sei schließlich alles in Ordnung. Wenn sie ein Problem habe, könne sie gern eine Therapie machen, er bezahle auch dafür.
Für eine Weile suchte sie tatsächlich eine Therapeutin auf. Sie erzählte viel aus ihrer Kindheit, von ihrem Vater, ihrer Schwester, und davon, dass ihre Mutter die Familie verlassen hatte, als sie dreizehn gewesen war. Auf ihr Problem mit dem Sex hatte das keine Auswirkungen. Als die Therapeutin darauf bestand, Manfred müsse mitkommen, brach sie die Sitzungen ab.
Seit das Problem gewissermaßen offiziell war, fiel es ihr zunehmend leichter, nicht mehr daran zu denken. Alle paar Wochen – vermutlich rund um den Eisprung – gelang es ihr, gerade genügend Lust aufzubringen, dass es zum Vollzug kam. Sie hoffte, Manfred würde sich damit zufrieden geben. Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass es nicht so wäre.
»Mit wem sprichst du, Darling?«, erklang Manfreds Stimme aus dem Hausflur. Mona schrak hoch. Sie hatte sich angewöhnt, vor sich hin zu murmeln, wenn sie alleine im Haus war. Manchmal sprach sie auch mit ihren Pflanzen; angeblich förderte das ihr Wachstum.
»Mit niemandem«, gab sie zurück.
Die Tür ging auf, Manfred betrat das Zimmer. Er küsste Mona im Vorbeigehen flüchtig auf die Wange und steuerte zur Hausbar. Unmerklich hatte sich ein weiteres Ritual in ihren Alltag eingeschlichen: das gemeinsame Trinken. Nach dem Büroalltag entspannte Manfred sich bei einem Whiskey, Mona trank meistens Wodka-Lemon. Zum Essen tranken sie Wein, später, vor dem Fernseher, nippten beide noch an einem Grappa oder einem Marc de Champagne.
Häufig waren sie auch eingeladen, besuchten Filmpremieren, Vernissagen oder andere gesellschaftliche Ereignisse, bei denen sie ebenfalls tranken wie alle anderen.
Der Alkohol entspannte Mona, legte einen angenehmen Schleier zwischen sie und die Welt. Auch Sex fiel ihr leichter, wenn sie getrunken hatte.
»Mixt du mir einen Drink?«, bat sie, »einen doppelten, bitte.«
Er kam mit zwei Gläsern und setzte sich neben sie auf die Couch. Er hatte die Krawatte abgelegt und den obersten Hemdknopf geöffnet. Obwohl er letztes Jahr vierzig geworden war, hatte er noch immer diese jungenhafte Ausstrahlung, die sie so an ihm mochte. Beim Sprechen bewegte sich sein Adamsapfel aufgeregt hoch und runter, seine Bewegungen waren schlaksig.
»Cheers«, sagte er und erhob sein Glas. »Wie war die Beerdigung?«
»Oh, ganz in Ordnung. Sie haben nicht genügend Blumen geliefert, aber die Kirche war immerhin halb voll, und Willis Rede war sehr ergreifend, wirklich.«
»Schön«, sagte er unbeteiligt.
»Kim hat sich wieder unmöglich benommen«, fuhr Mona schnell fort.
Sie hoffte, die Unterhaltung ginge ein bisschen weiter, nur ein paar Sätze lang, so dass sie das Gefühl haben könnte, er interessiere sich für das, was sie sagte.
»Kim? Ich wünschte, wir könnten ihr helfen.«
Mona runzelte die Stirn. »Sie will sich nicht helfen lassen. Hofft auf einen Prinzen, der in den Flughafen geritten kommt und sie befreit.«
»Na ja, hübsch genug ist sie ja.« Manfreds Blick wurde abwesend.
Wahrscheinlich stellt er sich vor, wie es wäre, mit Kim zu schlafen, dachte Mona. Sie legte ihm die Hand auf den Oberschenkel und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Er nahm ihre Hand herunter und stand auf.
»Entschuldige mich, bitte. Ich muss noch mal kurz telefonieren.«
Kims Wohnung war im dritten Stock eines unauffälligen, älteren Mietshauses, dessen unschätzbarer Vorteil seine zentrale Lage war. In der Nähe waren zahlreiche Geschäfte, vom türkischen Gemüseladen bis zum Antiquitätenshop, vom asiatischen Imbiss bis zur Edelboutique.
Kim stemmte, die Hände voller Einkaufstüten, mit der Schulter die Haustür auf. Eine Glühbirne im Treppenhaus verbreitete funzeliges Licht, aus den Wohnungen kamen gedämpfte Geräusche und Gerüche. Im ersten Stock hielt Kim an und läutete an einer Tür.
Von drinnen erklangen schlurfende Schritte, die Tür wurde einen Spalt geöffnet.
»Ich bin’s, Frau Gerlach«, sagte Kim und wartete geduldig, bis die alte Dame die Sicherheitskette gelöst hatte und sie eintreten ließ. Langsam folgte sie der zierlichen, gebückt gehenden Frau in die Küche.
»Na, was haben’S mir Schönes gebracht heute?«, fragte Anna Gerlach mit ihrem altmodischen Münchner Akzent. »An Sellerie? Mei, wen soll ich denn damit beglücken in meinem Alter?« Sie lachte, ihre Augen blitzten. Sie war über achtzig.
Kim verstaute die Einkäufe. Ihr Blick ruhte für einen Moment auf dem verblichenen Foto eines jungen Mannes, das in einem Silberrahmen auf dem Küchenbüfett stand. Er hatte ein schmales Gesicht, sanfte dunkle Augen, einen ernsten Ausdruck.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!